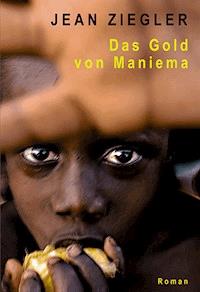8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jean Ziegler ist ein Mensch, der sich nicht mit den Dingen abfinden will, die er für falsch erachtet. Ein Unbequemer, der in seinem leidenschaftlichem Engagement für die gerechte Sache nicht davor zurückschreckt, sich einflußreiche Feinde zu machen.
Hier schreibt Jean Ziegler über Jean Ziegler: aus dem Leben eines Aufsässigen, der das gute Leben liebt, die Frauen und nicht zuletzt natürlich seine Heimat, die Schweiz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
JEAN ZIEGLER lehrte Soziologie in Genf und an der Sorbonne, war bis 1999 Abgeordneter im Eidgenössischen Parlament und von 2000 bis 2008 UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Heute ist er Vizepräsident im Beratenden Ausschuss des UN-Menschenrechtsrats. Zieglers Bücher wie Die Schweiz wäscht weißer haben erbitterte Kontroversen ausgelöst.Zuletzt erschienen die Bestseller Ändere die Welt! (2015) und Der schmale Grat der Hoffnung (2017).
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.deund Facebook.
Jean Ziegler
Wie herrlich, Schweizer zu sein
Erfahrungen mit einem schwierigen Land
Aus dem Französischenvon Thorsten Schmidt
Die Originalausgabe ist 1993 unter dem Titel »Le bonheur d’être suisse« bei Le Seuil-Fayard, Paris, erschienen.Die deutsche Ausgabe erschien erstmals 1993 im Piper Verlag, München. Die vorliegende Ausgabe entspricht in ihrem Textstand der aktualisierten Taschenbuch-Fassung von 1999, erschienen im Goldmann Verlag, München.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichenvon Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.Copyright © dieser Ausgabe 2017 by Jean Ziegler Umschlag: Cornelia Niere, München Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-21847-8V002www.penguin-verlag.de
Dieses Buch ist ihrem Andenken gewidmet:Padre Italo Coelhovon der Pfarrgemeinde Santa Cruz de Copacabana,Rio de JaneiroLuiz Carlos Perreira,meinem Patensohn, der im Alter von 21 Jahrenin Moro Santa Teresa in Rio de Janeiroermordet wurde,meiner Mutter,meinem Vater.
Inhalt
Vorrede
Erster Teil: Thun, Kanton Bern
Zweiter Teil: Paris
Dritter Teil: Das Chaos im Kongo
Vierter Teil: Brasilien, meine Mutter
Fünfter Teil: Die Schweiz
Epilog
Anmerkungen
Vorrede
Fürchtet doch nicht so den TodUnd mehr das unzulängliche Leben!
BERTOLT BRECHT, Die Mutter1
Ein Sommertag 1992 im Verhandlungssaal der Strafkammer des Cour de Justice im zweiten Stock des Genfer Justizpalasts: Durch die hohen Fenster der Westfassade ergießt sich ein milchiges Licht auf den Fußboden.
Es ist heiß an diesem Nachmittag. Windstill. Der Saal ist klein und schmucklos. Die Seitenwände sind mit hellem Eichenholz getäfelt. Die calvinistische Republik verabscheut Ornamente. Einzige Ausnahme: Ein aus dunklem Holz geschnitztes Genfer Wappen prangt über dem kahlen Haupt des Vorsitzenden. Das Wappen besteht aus einem gespaltenen Schild: links, auf rotem Grund, ein halber schwarzer Adler, Symbol des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation; rechts, auf goldenem Grund, der Schlüssel Petri, Emblem episkopaler Gewalt. Und über dem Schild, in schwarzen Buchstaben, das Motto der calvinistischen Revolution: Post Tenebras Lux.
Man beschuldigt mich, einen der angesehensten Bürger der Republik – einen internationalen Finanzier –, der Geschäftsbeziehungen zum zaïrischen Diktator Mobutu unterhält, verleumdet und beleidigt zu haben. Er verlangt meine strafrechtliche Verurteilung und Schadensersatz von mehr als 500000 FF.
Links auf dem Podium, hinter einer schmiedeeisernen Schranke, die ihn von den Anwälten, Zeugen, Journalisten und dem Publikum trennt, erhebt sich Staatsanwalt Laurent Kasper-Ansermet, ein eleganter, gewiefter Herr in den besten Jahren. Mit klangvoll-feierlicher Stimme prangert er meine unheilvolle Rolle in der Schweiz und in Europa an, geißelt den ungeheuren Schaden, den ich, seiner Meinung nach, der Schweizer Volkswirtschaft zufüge und fordert meine exemplarische Bestrafung.
Dann stellt er einen weiteren, für Prozesse dieser Art sehr ungewöhnlichen Antrag: Er verlangt, mich vom »Beweisantritt auszuschließen«. Der vorgeschobene Grund: Meine Angriffe gegen den Finanzier seien »allgemein und undifferenziert«. Wird diesem Antrag stattgegeben, könnte ich die in meinem Besitz befindlichen beweiskräftigen Dokumente, auf die sich die Analysen in meinem Buch stützen, dem Gericht nicht vorlegen. Auf diese Weise würde verhindert, daß die Strategien zur Ausbeutung der Völker der Dritten Welt, die so manche Schweizer Banken schon seit Generationen so meisterlich beherrschen, öffentlich diskutiert werden.
Nessim Gaons Anwalt ergreift das Wort; nach ihm mein Verteidiger David Lachat. Hinter den hohen Fensterscheiben des Gerichtssaals färbt sich die Sonne golden, dann rot, schließlich versinkt sie am Horizont.
Das Urteil wird gesprochen. Das Gericht gibt allen Anträgen des Staatsanwalts statt.
Der Rechtsstreit, den ich im Juni 1992 verloren habe, ist der letzte in einer langen Serie. Seit dem Erscheinen meines Buches Die Schweiz wäscht weißer im Februar 1990 haben mich nicht weniger als sieben Bankiers, Finanziers, Spekulanten und Wirtschaftsanwälte in fünf Ländern auf Schadensersatz – Gesamtsumme über 24 Millionen FF – verklagt. Während ich diese Zeilen niederschreibe, sind einige dieser Prozesse im Gange. Andere habe ich bereits verloren. Im Juni 1991 wurde meine parlamentarische Immunität aufgehoben.
Estoy parado (ich bin gefangen), sagt – schicksalsergeben – der garimpeiro, der Goldsucher und Kautschuksammler, an den Ufern des Rio Madre de Dios im bolivianischen Tiefland, wenn der Wasserspiegel des schlammigen Flusses in den ersten Tagen der Regenzeit plötzlich um über zwanzig Meter ansteigt.
Im Zentralgebiet der Anden dauern die sintflutartigen Regenfälle von Dezember bis März. Viele hundert Kilometer weiter östlich, im bolivianischen (brasilianischen, peruanischen, kolumbianischen, ecuadorianischen) Amazonasgebiet, flüchten sich die Garimpeiros jetzt mit ihren Frauen, ihren Kindern, ihren Ziegen und Schweinen auf die wenigen Hügel, die von den Fluten umschlossen werden.
Die Wasserfluten stürzen über zehn Meter hohe Palmen um, legen die Wurzeln hundertjähriger Mammutbäume frei, verwüsten Plantagen und reißen von den Ufern Millionen Kubikmeter brauner Erde mit sich.
Die Männer binden die Tiere an den Stämmen der mächtig-sten Bäume fest. In der Nähe ihrer Hütte vergraben sie ihre Vorräte: gebündelte Maiskolben und Yamswurzeln, Fässer mit getrocknetem Fleisch und gepökeltem Fleisch, Bohnen und Maniok. Dann löschen sie sorgfältig das Herdfeuer in ihrer Küche.
Der Himmel ist schwarz – in der Nacht wie am Tage. Manchmal züngelt ein Blitz aus den Wolken und entzündet das aus Schilfrohr und verdorrten Blättern gefertigte Dach einer Hütte.
An manchen Morgen rüttelt ein heftiger, orkanartiger Sturm am Zentralmast der nach Indianerart erbauten Hütten, wo sich die Familien zusammendrängen.
Bei jedem Abflauen des Sturmes gehen die Männer zum Ufer hinunter, um abzuschätzen, wie weit das Wasser gestiegen ist, und mit den Augen suchen sie den Himmel und die reißenden Fluten ab, die, gleich einem tobenden Meer, nunmehr Zehntausende Quadratkilometer des umliegenden Landes unter sich begraben haben.
Dauert das Hochwasser mehrere Wochen, werden mitunter ganze Hügel fortgerissen – und mit ihnen die darauf lebenden Garimpeiros, ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Hütten und ihre Tiere.
Als Schriftsteller, Abgeordneter und Professor bemühe ich mich seit Jahrzehnten, die Methoden der Mächtigen dieser Welt zur Ausbeutung der Ressourcen und der Arbeit der ärmsten Menschen dieser Erde anzuprangern und sie, wenn möglich, außer Kraft zu setzen.
Heute bin ich in gewisser Weise genauso »gefangen« – wie der obenerwähnte Garimpeiro. Die Mächtigen meines Landes haben beschlossen, mich zum Schweigen zu bringen – endgültig.
Wird mein angenehmes Dasein als biederer Schweizer Bürger und Hochschullehrer in der schwarzen Flut der Prozesse versinken? Ich weiß es nicht.
Wenn ich als Schriftsteller nicht mehr das schreiben kann, was ich für die Wahrheit halte, wenn ich nicht mehr das Recht habe, vor dem Parlament das Unrecht, von dem ich Kenntnis habe, anzuprangern, wenn ich als Professor meinen Studenten nicht mehr meine eigenen Überzeugungen, die Quintessenz meiner Erkenntnisse, Erfahrungen und Analysen, vortragen kann, welchen Zweck hat dann mein Kampf noch? Oder genauer gesagt: Unter welchen Umständen und auf welche Weise kann ich ihn fortführen?
Die persönliche Niederlage, die ich heute erlebe, trifft mit einer kollektiven Niederlage zusammen, die viel weiter reichende und schwerer wiegende Folgen hat.
Eine Weltordnung, die den rasch wachsenden Reichtum einiger weniger und die fortwährende Verelendung der großen Mehrheit als natürlich, universell und notwendig darstellt, in der die Gewährleistung der Grundrechte mit der Ausbeutung der europäischen Arbeiter und dem Blut der gesichtslosen Masse der Bewohner Afrikas, Asiens und Lateinamerikas bezahlt wird, ist eine inakzeptable Ordnung.
Mit meiner Arbeit als Soziologe wollte ich, wie viele meiner Kollegen, in den westlichen Staaten ein Bewußtsein des Widerstands erzeugen und den Völkern der Dritten Welt Analysen und Begriffe bereitstellen, die ihnen in ihrem Kampf von Nutzen sein könnten.
Mit welchem Erfolg? Keinem oder doch so gut wie keinem.
Heute leben auf unserem Planeten 5,3 Milliarden Menschen; davon 3,8 Milliarden in einem der 122 Länder der sogenannten Dritten Welt. Die Mehrheit von ihnen fristet ein menschenunwürdiges Dasein. In Somalia, in Mosambik, im Tschad, im Hochland der Anden, in den Elendsvierteln asiatischer Städte sterben täglich Zehntausende von Kindern – unter den abgestumpften, gleichgültigen Blicken ihrer Mitmenschen. Chronische Krankheiten, Arbeitslosigkeit und Verzweiflung zerstören die Familien.
Auf der Erde werden jede Minute 153 Menschen geboren – davon 117 in einem Land der Dritten Welt. Die meisten der letzteren sind von Geburt an Gekreuzigte.
Von Vietnam bis Angola, von den Philippinen bis Nicaragua und Kambodscha sind die bewaffneten nationalen Befreiungsbewegungen, die einst Hoffnung und Gerechtigkeit verkörperten, im Blut ertränkt worden oder zu erbärmlichen Repressionsmaschinerien verkümmert.
Viele postkoloniale Staaten (Zaïre, Sudan, Liberia, Malawi, Sierra Leone usw.) wiederum implodieren und verwandeln sich unter unseren Augen in Schlachtfelder, auf denen sich Stämme und Clans bekämpfen.
Die wirtschaftliche, technologische, wissenschaftliche und politische Weltgeschichte ereignet sich künftig fast ausschließlich innerhalb eines Dreiecks, dessen Eckpfeiler Stockholm, New York und Tokio bilden. Die Dritte Welt mit ihren Milliarden Menschen gleicht einem riesigen Floß voller Schiffbrüchiger, die ihrem Schicksal überlassen werden.
Von Jugend auf, von dem Tag an, da ich versuchte, meinen Standort in der Welt zu bestimmen, bin ich für Werte eingetreten, die meiner Ansicht nach keiner weiteren Begründung bedurften: soziale Gerechtigkeit, Selbstbestimmung des einzelnen und der Völker, Schutz der Natur und des Lebens, freie Entfaltung der Persönlichkeit und Glück für alle.
Schon sehr bald bemühte ich mich, meinen Protest in den Dienst einer umfassenderen Bewegung zu stellen. Ich habe nie geglaubt, daß der bolschewistische Totalitarismus, wie er in den Staaten des Ostblocks und von einigen kommunistischen Parteien im Westen praktiziert wurde, die Werte verwirklichen könnte, von denen ich träumte. Nie habe ich mir Illusionen gemacht über die furchtbare Verirrung, die Phraseologie und die Verlogenheit dieses »Kasernenkommunismus«. Daher hat mich auch sein Zusammenbruch als solcher nicht überrascht.
Ich glaubte an die gemeinsame Aktion freiwillig zusammengeschlossener Frauen und Männer und an ihre Fähigkeit – im Kampf der Meinungen, im gewerkschaftlichen Kampf und durch Wahlen –, diese Welt der Ungleichheit und des Tötens in ein Reich der Freiheit und der Vernunft zu verwandeln. Aus demselben Grund hatte ich mich in der Sozialdemokratischen Partei und in der Sozialistischen Internationale engagiert.
Dienstag, 15. September 1992, im Berliner Reichstagsgebäude: Felipe González eröffnet den 19. Kongreß der Sozialistischen Internationale. Er verliest den Abschiedsbrief Willy Brandts, den dieser von seinem Sterbelager in Unkel aus an die Kongreßteilnehmer gerichtet hat.
Ein strahlender Tag. Ein eindrucksvolles Polizeiaufgebot.
Kurz zuvor waren, begleitet von Motorradstaffeln der deutschen Polizei (deren Blaulichter und Martinshorngeheul vier Tage lang das Zentrum von Berlin lahmlegten), die gepanzerten Mercedes-Limousinen der wichtigsten weißen Führer der Internationale vor der Prunktreppe der Ostseite vorgefahren. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hält eine Gruppe ärmlich gekleideter kurdischer Kinder und Frauen hinter einem dreifachen Kordon von Bereitschaftspolizisten den Ankommenden übergroße Porträts ihrer von der türkischen Armee ermordeten Väter, Ehemänner und Söhne entgegen.
Mehr als sechshundert Delegierte aus fünf Kontinenten, Hunderte von Journalisten und Kameraleute aus aller Welt drängten sich in dem riesigen weißen Saal im ersten Stock des Gebäudes.
González erteilt dem ersten Redner des Tages, einem eleganten, spindeldürren und hochgewachsenen älteren Herrn mit Glatze, das Wort. Erdal Inönü, stellvertretender Ministerpräsident der Regierung in Ankara (und Vizepräsident der Internationale) stimmt, in gepflegtem Englisch, ein Loblied auf die türkische »Befriedungspolitik« in Anatolien an. Höflicher Beifall des Saales. Erwiderungen sind nicht erlaubt.
Dann ist der israelische Premierminister Yitzak Rabin an der Reihe. Bevor er das Wort ergreift, verlangt er, Faiz Abu Rhamé, der Vertreter der PLO, solle den Saal verlassen. González entspricht seinem Wunsch und läßt den Palästinenser aus dem Saal weisen.
Im Labyrinth der Flure des Reichstagsgebäudes irren afrikanische, maghrebinische, lateinamerikanische und asiatische Delegierte in dem – meist vergeblichen – Bemühen um ein Treffen mit einem europäischen, kanadischen, japanischen oder australischen Politiker umher. Sie sind auf Protektion, finanzielle Unterstützung und diplomatische Interventionen zugunsten ihrer verschwundenen, verhafteten oder gefolterten Genossinnen und Genossen angewiesen.
Abel Goumba, ein unbeugsamer Arzt, der erst vor kurzem aus dem Gefängnis in Bangui entlassen wurde, fleht mich um Hilfe an. Er ist Kandidat für die am 25. Oktober 1992 stattfindenden Präsidentschaftswahlen in der Zentralafrikanischen Republik und weiß, daß General Kolingba diese Wahlen – wie gewöhnlich – mit Unterstützung Frankreichs fälschen wird. Vier Tage lang bemühe ich mich, für ihn ein wenige Minuten dauerndes Gespräch mit Laurent Fabius, dem Generalsekretär der Sozialistischen Partei Frankreichs, zu erwirken. Vergeblich.
Einziger überzeugender Augenblick: Am Mittwochmorgen halten Journalisten des italienischen Fernsehens in der Eingangshalle plötzlich große Schilder mit der Aufschrift: Vergogna, Craxi! (Schäm dich, Craxi!) hoch. Sofort stürzen sich Sicherheitsbeamte auf jene, die es wagen, die haarsträubende Korruption der Sozialistischen Partei Italiens anzuprangern.
Donnerstag, 17. September: Pierre Mauroy, der neue Präsident der Internationale, hält mit seiner wohlklingenden, ernsten Stimme die Schlußansprache: ein Loblied auf die »großen finanziellen Gleichgewichte« (harte Währung, Verringerung der Haushaltsdefizite, usw.), die Mitterrand und dem multinationalen Kapital so sehr am Herzen liegen; über die Dritte Welt kein Wort. Enttäuscht verlassen Pierre Schorri, der Führer des linken Flügels der schwedischen Sozialdemokraten, und ich vorzeitig den Saal. Auf dem Weg nach draußen machen wir vor der letzten Reihe der Beobachter halt und verabschieden uns von Jalal Talabani, dem Führer der irakischen Kurden, und seinem Freund, dem scheuen Dr. Sadiq Sherefkendi, dem iranischen Kurdenchef.
Die weißen und die japanischen Sozialistenführer steigen wieder in ihre gepanzerten Limousinen. Die Blaulichter drehen sich, die Martinshörner heulen. Die Konvois fahren zu den in der Innenstadt gelegenen Luxushotels, die Festungen gleichen.
Um 22.15 Uhr desselben Tages werden Dr. Sherefkendi und drei weitere Mitglieder der Demokratischen Partei Iranisch-Kurdistan (PDKI) in einem kleinen Restaurant im Berliner Stadtteil Wilmersdorf von einem Kommando maskierter Killer ermordet.
Sie hatten vergeblich um Polizeischutz gebeten.
Meine Gedanken schweifen zwanzig Jahre zurück zu einem strahlenden Tag im Herbst 1972 in Santiago de Chile. Ich gehörte zu einer Abordnung der Sozialistischen Internationale, die der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky leitete. Die Begegnung mit Salvador Allende fand in dessen Privatdomizil, einer schlichten weißen Villa im Stadtviertel Tomas Moro, statt.
Ich sehe den Präsidenten so deutlich vor mir, als sei es gestern gewesen: Er saß in einem hohen Kolonialsessel, zu dessen Füßen ein großer brauner Hund lag. Kreisky, ein schwedischer Genosse und ich hatten auf dem Sofa Platz genommen, der massige Clodomiro Almeida auf einem Stuhl uns gegenüber. Durch das Fenster sah man die schneebedeckten Gipfel der Anden. Gemälde von Miró und Portinari schmückten die Wände.
Die Regierung der Unidad Popular durchlebte dramatische Tage: die amerikanische Blockade, Sabotageakte in den Bergwerken, Morde an Gewerkschaftern. »Wir erleben ein stummes Vietnam«, erklärte uns Allende. Kreisky plädierte für den Beitritt der Sozialistischen Partei Chiles zur Internationale.2 Salvador Allende hörte schweigend zu, richtete sich dann unvermittelt in seinem Sessel auf, wobei seine kleinen kurzsichtigen Augen vor Zorn funkelten. Seine kurze Antwort: Jamas! (Nie!)
Aus der Sicht Allendes hatte die Internationale ihre eigenen fundamentalen Prinzipien verraten. Sie war nichts als ein Anhängsel der europäischen Staatsräson, schlimmer noch: eine Organisation im Dienst der Strategien des multinationalen Kapitals.
Damals hatte mich seine Ablehnung schockiert. Heute erscheint sie mir prophetisch.
So viele Niederlagen werfen zahlreiche Fragen auf: Beschreite ich seit Jahrzehnten den falschen Weg? Sind meine Waffen ungeeignet? Meine radikale Kritik an der Bankenpolitik und der internationalen Rolle der Schweiz wird von einer tiefen Liebe zu diesem Land, seiner Geschichte und seinem Volk getragen. Und doch stoße ich bei den Mächtigen, die ja nicht alle böswillig sind, und bei den meisten meiner Kollegen und Kolleginnen im Parlament, die nicht alle Heuchler sind, auf völlige Ablehnung. Habe ich mithin nicht vermocht, die wahren Triebfedern meiner Kritik an der Schweiz deutlich zu machen?
Der Mißerfolg meines jahrzehntelangen Einsatzes für die Befreiung der Völker der Dritten Welt und für die Umwandlung unserer europäischen Gesellschaften in gerechtere, solidarischere Gemeinwesen ist ein Geschick, das ich mit vielen tausend anderen teile. In der Dritten Welt und in Europa glaubte eine ganze Generation von Frauen und Männern felsenfest an die baldige Verwirklichung einer freieren, gerechteren Gesellschaftsordnung, an das gleichberechtigte Miteinander der einzelnen und der Völker, an das Verschwinden von Elend und Unterdrückung.
Doch leider haben die Sozialdemokraten in Frankreich, in der Schweiz, ja in ganz Europa ihre Prinzipien verraten und sich der Staatsräson gebeugt.
Waren wir verblendet? Haben wir den falschen Weg beschritten, seit im Dschungel von Kamerun und in der Sierra Maestra die ersten Schüsse der Aufständischen fielen? Haben die Rationalität der Warengesellschaft und die Staatsräson der Industrienationen das Solidaritätsbewußtsein in Europa zerstört, ohne daß wir in unserer Verblendung dies bemerkten?
Noch beunruhigender: Geht die Geburt einer neuen geschichtlichen Phase immer mit der Freisetzung immenser Gewaltpotentiale einher? Ein Befreiungsschlag, auf den furchtbare Katastrophen folgen? Pol-Pot und sein Wahnsinn? Anders formuliert: Wird die Hoffnung, die jeder Befreiungskrieg weckt, zwangsläufig durch eine repressive, korrupte Bürokratie wieder erstickt? Wird die gewaltige Hoffnung, die in Europa nach dem Zusammenbruch der totalitären Staaten aufkam, notwendigerweise im Blutbad ethnischer Säuberungen und Kriege versinken?
Und doch ist keiner der Werte, für die ich kämpfe und denen meine Hoffnung gilt, veraltet. Im Gegenteil: Diese Werte scheinen mir heute aktueller denn je zu sein. Auf der Nordhalbkugel weht ein eisiger Wind. Die neue Barbarei hat Einzug gehalten mit ihrer grenzenlosen Vergötzung des individuellen Erfolgs und eines brutalen Konkurrenzdenkens, das die Vernichtung des Schwachen durch den Starken, die Absage an jede Form von Solidarität als einen geistigen Sieg feiert. Seid berechnend und pragmatisch! Der Reiche hat recht, der Arme unrecht. Gewiß ist ein geheimes Laster schuld an seiner Armut…
Der Siegeszug des übersteigerten Individualismus, des Konkurrenzdenkens über das Solidaritätsbewußtsein und die Einschränkung des Menschen auf seine ökonomische Funktion ebnen einer kulturellen Regression den Weg.
Nicht alles ist austauschbar. Es gibt Hierarchien und Identitäten. Die politische Linke ist nicht die Rechte, und das »Zeitalter der Leere«, das die postindustrielle Mediengesellschaft verheißt, ist kein Fortschritt. Die Welt ist mehr als ein bloßes Medienspektakel.
Die Achtung vor der rationalen Erkenntnis, das Primat der Vernunft über Aberglaube, Feudalismus und Irrsinn, die Forderung nach Solidarität und Gerechtigkeit, all diese Grund-werte des demokratischen Sozialismus – wie übrigens auch der soziologischen Praxis – sind so wahr wie eh und je. Ich verwerfe keinen dieser Werte. Fraglich sind vielmehr die bisheri-gen Strategien und Konzepte zu ihrer Verwirklichung.
Hinter meinen früheren politischen Entscheidungen stand nicht so sehr persönlicher Ehrgeiz, Prestigesucht oder Gewinnstreben. Sie waren vor allem von meinem Gewissen diktiert. Somit stellt sich die Frage nach den Erfahrungen, die mein Gewissen geformt haben. Aus diesem Grund scheint mir heute eine Rückbesinnung auf das eigene Leben, meine Kindheit und Jugend, meine Familie, meine Freundschaften und meine Liebesbeziehungen, auf die Ereignisse und Begegnungen, deren Produkt ich bin, nützlich zu sein. Ja, sie ist eine unaufschiebbare Notwendigkeit.
Aus Überzeugung und aus ihrem Berufsethos heraus setzen Soziologen meist alles daran, die eigene Subjektivität auszublenden. Auch ich habe mir über Jahrzehnte hinweg meine Erkenntnisobjekte vom Leibe gehalten und zwischen den Phänomenen, die ich analysierte, und meiner Person die größtmögliche Distanz zu schaffen versucht. Jahrzehntelang habe ich nichts anderes getan, als Machtverhältnisse, soziale Beziehungen, Produktionsverhältnisse und ideologische Zusammenhänge zu erforschen. Nie ging es mir darum, das Innenleben der Menschen, ihre Identität zu verstehen. Meine eigene genausowenig wie die der anderen.
Ich war präsent in der Welt, aber mir selbst fremd.
Anders gesagt, ich habe gewissermaßen umgekehrt autistisch gelebt: In intensivem Kontakt mit der Welt und meinen Mitmenschen stehend, hatte ich praktisch keinerlei Beziehung zu mir selbst.
Die gegenwärtige Rückbesinnung auf mich bringt mir zu Bewußtsein, daß ich seit jeher, stillschweigend und ohne es mir einzugestehen, zu den Objekten, die ich erforschte, eine höchstpersönliche Beziehung hatte. Meine soziologischen Abhandlungen hatten nur den Anschein der Objektivität. Ja sogar die Wahl der Themen stand in engem Zusammenhang mit meinem Leben, meinem Gewissen, meinen Neigungen, meinen Vorlieben und Abneigungen, meinen dumpfen Ängsten, meinen Wünschen und meinen Liebschaften.
Daher muß ich heute den Blickwinkel umdrehen, einen für mich ganz und gar neuen Weg beschreiten. Muß ich doch ein Ich erkunden, das mir praktisch unbekannt ist. Der Weg dorthin führt durch Morast, dichtes Gestrüpp und ist gegen Irrwege nicht gefeit, kurz: Es ist ein Weg voller Hindernisse.
Dieses Buch soll die Wurzeln der Entscheidungen offenle-gen, die mein Leben ausmachen.
In ihrer scheinbaren Unabhängigkeit und ihrer Pracht gleichen die Ideen jenen riesigen Lilien des Amazonasbeckens, die während der Regenzeit im Mangrovenlabyrinth zwischen den Stämmen der Tamarinden sprießen. Ihre überwältigende Schönheit ist von kurzer Dauer. Sie blühen nur ein paar Stunden, allenfalls ein bis zwei Tage, zwischen zwei Fluten. Aber sie treiben – für den Betrachter unsichtbar – tiefe Wurzeln in den schlammigen Untergrund des überschwemmten Landes.
Seit ich als Soziologe arbeite, beteilige ich mich am Kampf der Ideen. Dabei habe ich niemals nach ihren Wurzeln in meiner Person gefragt. Nun waren es aber gerade die prägenden Erfahrungen meines Lebens, die mich für bestimmte Ideen eintreten ließen und die den Stengeln, die die Blüten tragen, die nötige Festigkeit verliehen. Das verborgene Leben, das diese Blüten hervorgebracht hat, das Gewirr der nützlichen oder vergifteten Wurzeln, aus denen sie ihre Lebenskraft beziehen – dies gilt es, als erstes ans Tageslicht zu bringen.
Wie soll ich vorgehen, um zu diesem mir weithin unbekannten Ich vorzudringen? Eine begriffliche Analyse scheidet von vornherein aus. Der zergliedernde Intellekt kann die Wurzeln nicht offenlegen, weil er selbst aus ihnen gewachsen ist. Daher scheint mir die Erzählung meines Lebens der sicherste Weg zu sein.
Von jeder meiner Forschungsaufenthalte und Reisen in Afrika, Asien und Lateinamerika brachte ich eine stattliche Zahl Notizbücher mit, in denen Porträts der Männer und Frauen, denen ich begegnet bin, meine Gespräche mit ihnen, soziologische Beobachtungen und Daten über die jeweiligen Länder, meine Eindrücke und persönlichen Erlebnisse festgehalten sind. Als ich dieses Buch in Angriff nahm, habe ich mich erneut in ihre Lektüre vertieft.
Ich bin an die Stätten meiner Kindheit und meiner Jugend zurückgekehrt. Ich habe meine Familie, meine Freunde, alte Alben, Fotos, vertraute Gegenstände, das Pflaster der Straßen und die Fassaden der Häuser befragt.
Roger Bastide spricht vom »heimlichen Wissen«, das durch die einzigartige, unvorhergesehene Begegnung von Menschen unterschiedlicher Erfahrung, Kultur und Biographie, durch den zufälligen, gelegenheitsbedingten Erfahrungsaustausch erworben werde.
Dieses »heimliche Wissen« ist in keinem Reisebericht, keinem Computerausdruck, keinem Notizheft enthalten. Nur das Gedächtnis meiner Sinne, meiner Träume und meiner Gefühle vermag dieses Wissen zu rekonstruieren.
Das Gedächtnis, ein unerschöpfliches Reservoir der Ereignisse und Gefühle des vergangenen Lebens, funktioniert auf seltsame Weise. Es gleicht jenen Wadis der Saghiat El Hamra, die die Kameltreiber vom Volk der Saharaouis durchqueren: Stunden-, ja tagelang hinterlassen die Schritte keinerlei Spuren auf dem Gestein des Reg. Keine einzige. Dann, plötzlich, hört die Geröllwüste auf und die Sandwüste beginnt – aus dem Reg wird der Erg –, und noch der zarteste Tritt des zierlichsten Esels, der Huf des vorsichtigsten Kamels, die leichten Sohlen der Kameltreiber hinterlassen ihre deutlichen Abdrücke.
In meinem Gedächtnis gibt es ausgedehnte Nebelgebiete, in denen ich vergeblich nach Konturen Ausschau halte. Nebelschwaden durchziehen sie. Weiße, graue, ockerfarbene Nebelstreifen und dickes watteartiges Gewölk verdecken die Landschaft. Dann, plötzlich, bricht ein Lichtstrahl durch. Den Blick auf die Lichtung richtend, finde ich vertraute Gestalten, Häuser, Städte und Dschungel wieder. Ich sehe die vereinzelten, aber deutlich erkennbaren Erinnerungsfragmente meines Lebens.
Die meiste Zeit aber verdeckt Nebel den Sumpf, die Ebenen, die Mangroven und die Spalten. Was soll ich tun? Auf das hervorbrechende Sonnenlicht warten, von Lichtung zu Lichtung gehen?
Ich werde zunächst über meine Kindheit in Thun, Kanton Bern, über meine Familie und meine chaotische Jugend berichten, dann über meine Entwicklung in Paris, wo ich ein selbständiger, geistig unabhängiger Mensch wurde. Zwei Kontinente spielen in meinem Leben eine entscheidende Rolle: Afrika und Südamerika (Brasilien). Dort hat sich meine Persönlichkeit geformt, und dort wurden die Weichen gestellt für meine tiefsten emotionalen, intellektuellen und politischen Entscheidungen. Der letzte Teil des Buches beschreibt die Kämpfe, die ich gegenwärtig in der Schweiz zu bestehen versuche.
Beruht die Auswahl dieser Episoden auf einer sachimmanenten, zwingenden Logik oder einfach auf subjektiver Willkür? Ich weiß es nicht. Es ist möglich, daß ich mich irre, daß andere als die hier beschriebenen Episoden mich noch stärker geprägt haben. Fest steht nur: Ich spüre das Bedürfnis und den dringenden Wunsch, das zu schildern, was ich in Thun, in Paris, in Kalina und in São Salvador da Bahia erlebt habe.
Meine Familie, meine nächsten Freunde, die Frau, die ich liebe – sie alle erscheinen nicht auf diesen Seiten. Mich erfüllt eine ständige dumpfe, niemals zum Verstummen zu bringende Angst um jene, die ich liebe und deren Leben ich teile. Gewisse magische Vorstellungen afrikanischer Völker haben tief auf mich eingewirkt. Spräche ich hier die Namen der mir nahestehenden Menschen aus, würde ich sie dem bösen Blick, unheilbringenden Dämonen und zahllosen Gefahren aussetzen.
Ob es stürmt oder regnet, ob die Sonne scheint oder Schnee fällt – jeden Morgen geht ein Mann unter den Fenstern meines Büros an der Place des Philosophes in Genf vorbei. Leicht gebückt, den würdevollen Kopf versonnen nach vorn geneigt – wie gebeugt unter der Last seines strengen, erhabenen Denkens –, eilt er an seinen Arbeitsplatz in der Universität. Jean Starobinski ist einer der klügsten Köpfe dieses ausgehenden 20. Jahrhunderts. In seinem Buch Le Remède dans le mal (Das Rettende in der Gefahr) schreibt er: »(…es bleibt die Frage), ob die Energie der ›Entmystifizierung‹ nicht ihrerseits aus einer ›mystifizierenden‹ Quelle stammt… Wer von Aufrichtigkeit spricht, ist nicht des Irrtums enthoben.«3 Mein Buch möchte mit der größtmöglichen Wahrhaftigkeit die verstreuten Ereignisse nacherzählen, denen ich meine Identität verdanke. Lange zurückliegende, kaum bewußte Entscheidungen bestimmen die Anliegen, für die ich mich heute einsetze. Wird es diesem Buch gelingen, sie transparent zu machen? Ist meine Wahrhaftigkeit des »Irrtums enthoben«? Habe ich tief genug gegraben? Meinen Blick sorgfältig genug von Heuchelei, Lüge, Illusionen und Eitelkeit gereinigt, um nicht schielend fortwährend von meinem Gegenstand abzugleiten?
Von der Gefahr war Friedrich Dürrenmatt überzeugt: »daß Wahrhaftigkeit allein nicht ins Allgemeine transponieren würde, viel mehr ins Medizinische, Psychologische bestenfalls.«4 Was fehlt noch? Mit einer Spur von Arroganz möchte ich sagen: die Geschichte. Wie jeder Mensch bin auch ich das einzigartige Produkt einer vielschichtigen Dialektik von Allgemeinem und Besonderem, von Gesellschaft und Individuum, von der Geschichte und meiner Geschichte, von den Umständen, die mich formen, und meiner Freiheit, die sich regt, lebt, sich erhebt und das Gesetz, das sie leugnet, zu zerstören trachtet.
Eine Autobiographie? Der Begriff mißfällt mir. Er ist gleichbedeutend mit etwas Vollendetem, Unwandelbarem, Endgültigem. Mein Leben aber – und mein Buch, das dieses Leben ausschnittweise nachzeichnet – ist alles andere als »vollendet«.
Wie Roger Bastide in seinem Werk Anthropologie appliquée5 fordere auch ich das Recht, »eine Pause am Wegesrand« einzulegen, die Lektionen meiner verlorenen Kämpfe lernen und sorgenvoll die mir noch verbleibende kurze Zeit erkunden zu dürfen.
Jean Ziegler
Genf, im Juli 1993
ERSTER TEIL
Thun, Kanton Bern
Caminante, son tus huellas
Wanderer, deine Schritte
el camino, y nada mas;
bahnen den Weg – niemand sonst;
caminante, no hay camino,
Wanderer, es gibt keinen Weg,
se hace el camino al andar.
der Weg entsteht im Gehen.
Al andar se hace el camino,
Im Gehen entsteht der Weg,
y al volver la vista atrás
und wer zurückblickt,
se ve la senda que nunca
sieht den Weg,
se ha de volver a pisar.
den er nie wieder gehen wird.
ANTONIO MACHADO, 1938
I
Ich wurde in der Schweiz geboren, an einem Tag im April des Jahres 1934 um 15.30 Uhr.
Damals war mein Vater Richter in Interlaken, das am Fuße eines von ewigem Schnee bedeckten Berges – der »Jungfrau« – liegt. Zwei Jahre zuvor hatte er meine Mutter geheiratet. Sie liebten sich und haben sich, wie ich glaube, ihr ganzes Leben lang geliebt – mit einer starken, oftmals stürmischen, doch, soweit ich weiß, immer treuen Liebe.
1936 kam meine Schwester Barbara zur Welt. Zwanzig Jahre später, nach dem Blutbad in Ungarn, wurden zwei junge Mädchen, Esther und Julia, die in einem Flüchtlingslager in Österreich überlebt hatten, in unsere Familie aufgenommen. Sie wurden für meine Eltern wie leibhaftige Töchter und für mich und Barbara zwei kluge, quicklebendige Schwestern.
Meine Vorfahren, aufrechte seßhafte Bürger alemannischer Herkunft, die einen altertümlichen germanischen Dialekt sprachen, lebten seit Jahrhunderten in diesem »Mittelland«, das sich, begrenzt vom Gebirgszug des Jura und den Ausläufern der Alpen, über Hügel und Wälder, tiefe Täler und Ebenen erstreckt. Zu den prägenden Personen meiner Kindheit gehörten – neben meiner Mutter und meinem Vater – meine beiden Großväter. Der eine praktizierte als Landarzt in dem Dorf Steffisburg unweit des Thuner Sees. Der untersetzte, energische Mann war ein Liebhaber der Dichtkunst, sehr gebildet und immer fröhlich. Er hatte meinen Vater und meine Tante gezeugt. Mein anderer Großvater, ein sittenstrenger, schwieriger und widersprüchlicher Charakter, war ein hervorragender Pianist; er hatte, bevor er nach der furchtbaren Krise des Jahres 1918 die ersten regionalen Bauernverbände gründete und leitete, einen Bauernhof in Bangerten bewirtschaftet.
In Liebe gedenke ich meiner beiden Großmütter: Johanna führte die Apotheke in Steffisburg und schrieb die Arztrechnungen, die mein Großvater sehr oft an seine Patienten zu schicken vergaß. Schön, sanftmütig und zurückhaltend, hegte Marie, meine Großmutter mütterlicherseits, eine Leidenschaft für Küche und Garten; die einzige Schwester meiner Mutter war im Alter von zwanzig Jahren an einer Blutvergiftung gestorben. Diesen Schicksalsschlag hatte Marie nie völlig verwunden.
Meine Mutter, meine Großeltern und mein Vater gehörten zu einem Menschenschlag, der heute in der Schweiz im Aussterben begriffen ist: dem der Unbeugsamen, der rechtschaffenen Menschen, die in einer Weise leben, denken, träumen (ein wenig) und handeln, die Lichtjahre von dem Gebaren der modernen Kapitalisten des Landes entfernt ist. Anachronistische Gestalten in einem Land, das sich der Kapitalakkumulation und dem Profit verschrieben hat, haben diese Menschen mir für mein ganzes Leben den unbequemen (und meist trügerischen) Wunsch eingeimpft, anständig zu bleiben.
An meine früheste Kindheit habe ich keine Erinnerungen. Es mag seltsam anmuten, doch meine ersten klaren und exakten Erinnerungen reichen zurück zum Beginn meines sechsten Lebensjahres.
Wenige Tage nach meinem fünften Geburtstag wurde mein Vater zum Präsidenten des Thuner Amtsgerichts gewählt.
II
Ende des 12. Jahrhunderts bauten die Herzöge von Zähringen, die mit den Habsburgern verbündet waren, genau an der Stelle, wo die eisigen Wasser der Aare – durch ein Labyrinth kleiner Inseln, sandiger Uferstreifen und Kanäle – den Thuner See verlassen, die Ortschaft Thun zur Stadt aus. Sie kontrollierte mehrere Jahrhunderte lang einen der wichtigsten Handelswege zwischen Nordeuropa und Italien.
Thun verdankt seinen Namen keltischen Sippen, die im 2. Jahrhundert v. Chr. ihre Pfahlbauten auf dem steil abfallenden Hügel über der Flußmündung errichteten. Das keltische Wort dunum bedeutet soviel wie »befestigter Fels«.
Heute stehen auf dem Felsvorsprung drei Festungen aus verschiedenen Epochen und von unterschiedlichster Funktion. Am eindrucksvollsten ist zweifellos die 1191 fertiggestellte Burg der Zähringer. Das quadratische, sechsstöckige Hauptgebäude, von einem der steilsten und berühmtesten Ziegeldächer Europas bedeckt, wird von vier hohen, schlanken und runden Ecktürmen flankiert, die vorzüglich erhalten und weithin sichtbar sind. Die Ähnlichkeit mit normannischen Festungen ist verblüffend (sie ist auf verwandtschaftliche Beziehungen zwischen dem Erbauer der Burg und den feudalen Baumeistern Westfrankreichs zurückzuführen). Am Fuß der Türme wachsen dunkle Tannen.
1429 haben die Gnädigen Herren von Bern den Hügel in Besitz genommen. Westlich der mittelalterlichen Festung ließen sie das Amtshaus erbauen, wo hinfort ihre Schultheißen, Richter und Beamten walteten. Das Schloß der Berner mit seinen hohen der Ebene zugewandten Fenstern ist in spätgotischem Stil erbaut. Ein elegantes, vierstöckiges Gebäude, das von Terrassengärten umgeben ist, in denen schon im April Magnolien, hohe Margeriten und Gladiolen blühen.
Die dem heiligen Mauritius geweihte Stadtkirche, ihr befestigter Friedhof und die zugehörigen Pfarrgebäude liegen im Süden der Anhöhe.
Die Aare umfließt den Thuner Schloßberg von Westen her. Die Altstadt erstreckt sich zwischen ihrem Ostufer und der steil abfallenden Anhöhe. Um eine Längsachse angelegt, wurde sie im 13. und 14. Jahrhundert nach Norden hin und auf die Aare-Inseln erweitert. Vier guterhaltene Türme markieren heute die Grenzen der ehemaligen Befestigungsanlagen. Die Obere Hauptgasse säumen hohe Häuserzeilen, deren Fassaden mit leuchtenden Farben bemalt sind. Die Gehsteige verlaufen erhöht, oberhalb der Kellergeschosse (die früher als Pferdeställe dienten).
Westlich der Stadt dehnt sich eine weite Ebene bis zu den Gebirgsstöcken des Stockhorn und des Niesen. Dort unterhält die Schweizer Bundesarmee seit dem 19. Jahrhundert einen Waffenplatz. 1846 wurde hier der junge Louis Bonaparte zum Artilleristen ausgebildet. Damals stand der Platz unter dem Befehl des Genfers Guillaume-Henri Dufour, eines Zöglings der Pariser Ecole Polytechnique, der – bevor er in seine Heimat zurückkehrte – als Genieoffizier in der Armee Napoleons I. gedient hatte. Östlich der Stadt: von abschüssigen Gärten überzogene Hügel, auf denen bei wolkenlosem Himmel die untergehende Sonne ihr prächtiges Farbenspiel aufführt und seit dem 19. Jahrhundert Wohngebiet der wohlsituierten Bürger.
Der Schloßberg überragt die Aarebrücken, die Altstadt, die Kasernen und die neuen Stadtviertel.
In meiner Kindheit zählte die Stadt etwa 25000 Einwohner.
Nach Süden hin bilden die Berner Alpen eine über 4000 Meter hohe Mauer. Im Rhythmus der Jahreszeiten schimmern ihre Felswände, Firnfelder und Seraks in allen erdenklichen Farben.
Erst viele Jahre später werde ich auf die Voyage en Suisse von Victor Hugo stoßen. Auch mich erfüllte als Kind das Felsenmeer der Alpen – »dieser ungeheure Ozean, durch einen Hauch Gottes mitten im Sturm versteinert« – mit Schrecken.
Wir bewohnten ein großes, schönes, nach Süden gelegenes Haus inmitten eines abschüssigen Gartens. In den Kirsch-, Birn- und Lindenbäumen nisteten Vögel, die im Herbst über die Alpen flogen und im Frühling zurückkehrten. Schon im April erfüllte der Duft der Magnoliensträucher, die meine Mutter gepflanzt hatte, den Garten. Rote Rosen rankten sich an einem Spalier an der Vorderseite des Hauses empor. Im Sommer verschwanden die Balkons unter dem lebhaften Rot der Blütenblätter. Jedes Kind hatte sein eigenes Zimmer. Meines befand sich im ersten Stock, in der Ostecke des Hauses. Es hatte nur ein einziges, dafür hohes Fenster, das den Blick auf einen Nußbaum, die darunterliegenden Gladiolenteppiche und auf das nahe Gebirge freigab.
Während meiner gesamten Kindheit und Jugend hat dieses Gebirge meinen Horizont versperrt.
Ich sah, wie die gleißende Augustsonne die strahlendweißen Laken der Gletscher rot färbte, als seien dort Ströme von Blut vergossen worden. Ich erinnere mich auch an das unheimliche, grellweiße Licht jener Novembermorgen, an denen sich keine Sonne zeigte, doch eine verborgene Lichtquelle den Schnee anstrahlte. Und erst die Nächte!
Winter- und Frühlingsnächte, in denen im Schein des Vollmondes auf den Gletschern Milliarden winziger Funken tanzten. So als habe eine wundersame Hand Körbe voller Sterne über die Eiswüste ausgestreut.
Mit seinen erstarrten Serakmeeren, seinen unzähligen weitverzweigten Gletscherspalten, seinen verstreuten Felsblöcken, seinen zerklüfteten Felsschluchten, mit all den Toten, die unter Tonnen Eises begraben sind, mit den Wolken, die sich immer wieder in seinen Gipfeln verfangen, und schließlich dem Licht, dem sich ständig wandelnden Licht – strahlend, dann wieder fahl wie der Tod –, das unablässig mit den Schatten der Gletscher spielt, hat dieses Gebirge meine Kindheit beherrscht und meine geistige Welt geprägt. Es faszinierte mich wie ein lebendiges Wesen. Dieses Massiv aus Abgründen und Spalten war mein Horizont, die grandiose Welt, die meine Phantasie erregte und in die sich meine kindliche Einbildungskraft flüchtete.
Dieses gefrorene Wunder aus Licht und Schnee heißt »Blümlisalp«. Meine Vorfahren, die die unbezähmbare Wildheit des Hochgebirges, das jahrtausendealte Geheimnis dieser chaotischen Welt und die trotzige Herausforderung, die diese von Abgründen durchzogenen Felder ewigen Eises für das vergängliche Leben darstellt, wahrscheinlich in Furcht und Schrecken versetzte, versuchten die Gefahren, die ihnen von diesem Bergmassiv drohten, durch eine die Wahrheit ins gerade Gegenteil verkehrende Bezeichnung zu bannen. »Blümlisalp«, »Alp der Blumen«, man stelle sich das einmal vor! Wo doch in dieser Eiswüste nicht einmal im Sommer ein einziger Grashalm wächst, eine verkrüppelte Brombeerhecke oder ein gekrümmter Dornenbusch gedeiht!
Diese paradoxe Benennung scheint mir sehr bezeichnend zu sein für die Gesellschaft, in der ich meine Kindheit und Jugend verbrachte und die mir auf viele Jahre hinaus ihre Verdrängungen, Neurosen und ihre unermeßliche Heuchelei aufzwingen sollte.
An meine ersten Jahre in Thun habe ich nur eine lückenhafte Erinnerung. Im Alter von sechs Jahren trat ich in die Götti-Bach-Schule ein. Das vom Lauf der Jahrhunderte geschwärzte Châlet liegt am Ufer des gleichnamigen Gebirgsbaches, der von den bewaldeten Felsen oberhalb der westlichen Stadtviertel zu Tal stürzt.
In der Götti-Bach-Schule blieb ich bis zum Ende meines zehnten Lebensjahres. Dann wechselte ich ins »Progymnasium«, ein plumpes Gebäude aus gelbem Stein am anderen Ende der Stadt.
Meinen Vater bekam ich kaum zu Gesicht. Es war Krieg. Als Artillerieoffizier war er, wie Hunderttausende anderer Schweizer seines Alters, an der Grenze stationiert. Ich erinnere mich an einen Sonntag im Juni 1940. Wie jedesmal, wenn mein Vater auf Urlaub kam, erwarteten meine Mutter, meine Schwester und ich ihn auch diesmal am Bahnhof: Er stieg immer aus dem letzten Wagen aus, wobei die prächtigen roten Epauletten und die Goldknöpfe seiner Offiziersuniform in der Sonne funkelten. Meistens liefen wir ihm schon entgegen, bevor er auf den Bahnsteig gesprungen war. An diesem Tag aber wurde unser Elan von einem unsichtbaren Schatten gebremst. Schwerfälligen Schritts kam mein Vater auf uns zu. Einige Meter vor uns blieb er – ohne seine Arme auszubreiten – stehen, betrachtete uns nacheinander und sagte dann: »Paris ist gefallen.«
Ich sah Tränen in seinen Augen.
Hätte er uns das Erlöschen der Sonne verkündet, seine Stimme wäre nicht ernster gewesen.
Als Schüler der ersten Grundschulklasse wußte ich natürlich nicht, wo Paris lag, noch welchen Stellenwert diese Stadt in der Geschichte der menschlichen Freiheit einnahm. Ich begriff jedoch, daß sich eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes ereignet hatte.
Seltsamerweise gab mir diese Katastrophe meinen Vater zurück: Künftig sollte ich ihn viel häufiger zu Gesicht bekommen. Die Schweiz war nun vollends eingekreist. Am 25. Juli 1940 beschlossen der Oberfehlshaber der Armee, der sanftmütige und melancholische General Henri Guisan, und die Regierung, die Truppen von den Grenzen abzuziehen, um ein uneinnehmbares »Réduit« in den Alpen aufzubauen. Das war eine scheinbar völlig unmenschliche Entscheidung: Sie lief darauf hinaus, zwei Drittel des Staatsgebietes und fast die gesamte Bevölkerung schutzlos den SS-Horden preiszugeben, während man die Schneefelder, Gletscher und Felsen der Alpen bis zum letzten Blutstropfen verteidigen wollte.
Tatsächlich war die sogenannte Réduitpolitik weniger absurd, als es den Anschein hatte, denn die Wehrmacht und die SS konnten die Schweizer Armee jederzeit innerhalb weniger Stunden überrennen. Doch das mit dem faschistischen Italien verbündete Dritte Reich, das in Afrika einen schweren Krieg führte, konnte nicht auf die Schweizer Alpentunnel verzichten, durch die ein Großteil seines Nachschubs nach Süden rollte.
Bis 1942 kämpfte das deutsche Afrikakorps in Libyen und Tunesien. Seine Nachschubbasen befanden sich auf Sizilien. Am 25. Juli 1943 wurde Mussolini in Rom gestürzt; am 3. September landeten die Alliierten in Salerno, fünf Tage später kapitulierte die italienische Regierung. Daraufhin besetzte die Wehrmacht den gesamten Norden der Halbinsel. In jenen Jahren waren somit die Alpentunnel für Hitler von größter Bedeutung. General Guisan hatte die Tunnel allerdings verminen lassen: Hätten die Deutschen die Schweiz angegriffen, hätten sich der Simplon, der Lötschberg- und der Gotthardtunnel (sowie zahllose Viadukte und Staudämme) sofort in Trümmerhaufen verwandelt. Ihr Wiederaufbau hätte Hitler Jahre gekostet.
Guisan wußte dieses Druckmittel geschickt einzusetzen: Die Eisenbahnverbindungen zwischen Nord und Süd blieben intakt. Als Gegenleistung verzichtete Hitler darauf, Zürich, Basel, Bern und die übrigen Schweizer Städte in Schutt und Asche legen zu lassen.
Da Thun am Fuß der Alpen, also am Eingang des Réduit lag, kam mein Vater oft nach Hause. Aufgrund eines glücklichen Zufalls war er zum Kommandanten der Festung Beatenberg ernannt worden, einer im Gebirge über dem Ostufer des Sees versteckten Artilleriebasis, die dem Feind den nördlichen Zugang zum Réduit verwehren sollte. An einem Sonntag wurden meine Mutter, meine Schwester und ich ins Innere des Heiligtums vorgelassen.
Ich war damals acht Jahre alt und ein eifriger Leser von Karl May, insbesondere seiner endlosen Winnetou-Saga (der fiktiven Geschichte eines Apatschen-Häuptlings, der sein Volk verteidigt und mit einem »guten« Weißen, Old Shatterhand, befreundet ist).1 Die Festung Beatenberg war mir daher sogleich wohlvertraut.
Die auf den vorgelagerten Felsen postierten Wachen, die mit Adlerblick den fernen Horizont absuchten, die hinter Hecken versteckten Biwaks, der Rauch der Lagerfeuer, der über einer von einigen verkümmerten Tannen eingefaßten Lichtung aufstieg, mit Zweigen getarnte Munitionskisten; die leise sprechenden Männer, die Kanoniere, die – man weiß nicht weshalb – unablässig die im Tunnel untergestellten Kanonen polierten: All dies erinnerte mich an das hoch in den Rocky Mountains gelegene Feldlager des 5. Kavallerieregiments der Vereinigten Staaten, das von dem guten Old Shatterhand, dem Bundesgenossen Winnetous, befehligt wurde.
Die Apatschen und Old Shatterhand hatten den Auftrag, feindlichen Söldnern der Western-Pacific-Eisenbahngesellschaft den Zugang zu den Pässen der Rockys zu verwehren. Mein Vater und seine Soldaten schützten den nördlichen Eingang des Réduit gegen die Horden Hitlers.
Thun, das an einer wichtigen Bahnstrecke liegt, die Basel – über den Lötschberg- und Simplontunnel – mit Domodossola verbindet, besitzt einen großen Rangierbahnhof. In jenen Jahren 1941–1944 drang allnächtlich fast ununterbrochen ein dumpfer Lärm von dort zu uns herauf. Er stammte von den endlosen deutschen Güterzügen, die gen Süden, nach Italien, rollten, und von italienischen und deutschen Zügen, die nach Norden, ins Rheinland, fuhren.
Nach Schulschluß eilten mein Freund Hans Berner und ich oftmals den Hang des Götti-Bachs hinunter, auf den hohen, mit Stacheldraht bedeckten Gitterzaun zu, der die Seestraße vom Rangierbahnhof und von dem Gewirr der Gleise trennte. Respektvoll und von einer dumpfen Unruhe erfüllt (deren Ursache keiner von uns anzugeben vermochte), betrachteten wir die endlosen Schlangen dunkler Waggons, die mit den drei gelben Buchstaben DRB (Deutsche Reichsbahn), über denen ein schwarzer Adler schwebte, gekennzeichnet waren. Auf den Waggons zeichneten sich unter grünen Planen bedrohlich erscheinende Formen ab. Andere Waggons – weniger an der Zahl – trugen das rote Kürzel FSI (Ferrovie Statale Italiane). Ihre Fracht, die ebenfalls von Planen bedeckt und folglich nicht zu erkennen war, zeigte weniger bizarre Formen.
Rangiert wurden die deutschen und italienischen Waggons von Schweizer Lokomotiven. Behelmte Posten der Schweizer Armee bewachten den Gitterzaun, den Bahnhof und die Gleise. Andere waren in den Führerständen der riesigen Lokomotiven postiert, die die nicht enden wollenden Züge mit überladenen Waggons über die Steigungen von Kandersteg, von Goppenstein und des Simplontunnels ziehen sollten.
Die Schweiz beteuerte lauthals ihre Neutralität in diesem Krieg. In dem Abkommen zwischen dem Bundesrat und Hitler hatte man vereinbart, daß ausschließlich zivile Güter – Lebensmittel, Medikamente, Kohle, Ersatzteile und so weiter – durch die Schweizer Tunnel transportiert werden durften. Immer wieder fragte ich meinen Vater, was für eine Ladung sich unter den grünen Planen, die meine Neugier erregten, verberge. Getreu seinem Offizierseid, kein Geheimnis zu verraten, und vermutlich bestrebt, meine – wie er glaubte – hohe Meinung von meinem Vaterland nicht zu trüben, antwortete er lakonisch: »Du brauchst nur den Anschlag des Bundesrates in der großen Bahnhofshalle zu lesen. Der erklärt dir alles.«2
An einem Spätnachmittag im Dezember 1943 ging ein ungewöhnlich heftiger Schneesturm über Thun nieder. Der von Norden, aus dem Aaretal, heraufziehende Sturm wütete vor allem in der Altstadt, riß Dachziegel herunter und heulte fürchterlich. Unter der Kraft des Windes knickten die Platanen am Kai und brach die Metallstange, die seit Jahrhunderten den rostigen Hahn der Stadtkirche trug. Der Himmel war pechschwarz und die Luft vom Geruch mehrerer Brände erfüllt. Tote Schwäne und vor Schreck gelähmte Enten strandeten am Seeufer.
Am Bahnhof kam es unterdessen zu einer Katastrophe: Dutzende mit dem Kürzel DRB und dem schwarzen Adler gekennzeichnete Waggons stürzten wie tödlich getroffene Tiere um. Fetzen grüner Planen wirbelten durch die Luft. Ein Flügel des Eingangstors war aus den Angeln gerissen. Lokomotiven entgleist.
Aufgeschreckt von dem Lärm, liefen Hans Berner und ich unter Mißachtung des Verbots meiner Mutter zum Bahnhof. Der Lärm hatte nicht getäuscht: Gleich Leichen auf einem Schlachtfeld lagen Flugabwehrkanonen, Panzertürme, LKWs mit zerbrochenen Scheiben und schwere Maschinengewehre verstreut auf den Gleisen. Das Kanonenrohr eines umgestürzten Panzers hatte sich verbogen. Nun glich er einem sterbenden Elefanten. Überall riesige aufgerissene Metallkisten: Artilleriegranaten waren aus dem Innern eines Waggons herausgerollt, der beim Umstürzen die Gleise beschädigt hatte.
Der Bahnhof glich einem Schlachtfeld – und die in der Bahnhofshalle ausgehängte offizielle Bekanntmachung, auf die mich mein Vater verwiesen hatte und die besagte, nur zivile deutsche Güter dürften durch die neutrale Schweiz reisen, enthüllte sich als das, was sie war: eine gewaltige Lüge.
Zum ersten und wahrscheinlich einzigen Mal in seinem Leben hatte mir mein Vater nicht die Wahrheit gesagt. Ich brauchte Jahre, um dieses Trauma zu überwinden.
Gegen Abend trafen auf dem Bahnhofsvorplatz Militärlastwagen ein, gefolgt von einer Eskorte dunkler Limousinen, de-ren Nummernschilder sie als Diplomatenautos auswiesen. Den Limousinen entstiegen Männer mit Filzhüten und in Leder-mänteln. Ein Gendarm erklärte mir, es seien Mitarbeiter der Botschaft des Deutschen Reichs in Bern. Die Männer in den Ledermänteln erteilten den Schweizer Soldaten und den Thuner Gendarmen in barschem Ton kurze Befehle, die diese voller Respekt vor den Fremden sogleich ausführten. Eine tausendköpfige Menge Schaulustiger hatte sich in der unmittelbaren Umgebung der Gleise eingefunden. Auf Befehl der Nazis wurde sie von den Schweizer Soldaten rücksichtslos abgedrängt.
Ein dichtes Schneetreiben setzte ein. Völlig verwirrt machte ich mich auf den Nachhauseweg.
Mein Vater – ein Mann von kräftiger Statur, mit sanften, ausdrucksvollen blauen Augen –, der über große geistige Fähigkeiten verfügte, fühlte sich der Gesellschaft, in die er hineingeboren worden war, nicht sonderlich verbunden. In meinen Augen kam erschwerend hinzu, daß er diese Gesellschaft als völlig wandlungsunfähig ansah. Er fügte sich in seine soziale Existenz und in die ihm auferlegten Rollen wie in ein unentrinnbares Martyrium, eine Prüfung seiner Demut, Selbstverleugnung und Geduld.
Kraft seiner großen Sensibilität und seines unverstellten Blicks war er sich völlig über die Ungerechtigkeiten, die Lügen und die Heuchelei im klaren, die seinen Alltag als Richter prägten. Obwohl er sehr darunter litt, lehnte er sich niemals offen gegen diese Gesellschaft auf, deren Produkt er war und die den vermeintlich unüberschreitbaren Horizont seines Lebens darstellte. Sein Widerstand war ein stummer und heimlicher. (Jahre später, in den schmerzzerissenen Tagen meiner Adoleszenz, sollte mich sein ewiges schicksalsergebenes »Da ist nichts zu machen« in rasende Wut versetzen.)
Mein Vater glaubte an die »Welten der Vernunft«, die Valéry so teuer waren. Nur der Geist kann das Chaos der Welt aufheben. Seine Werke sind Trost und Schutz für die verletzte Würde, die nie zu stillende Sehnsucht des Menschen. Er rezitierte mir häufig die folgenden Verse von Saint-John Perse, deren Sinn ich damals nicht verstand:
»Vernimm, o Nacht, in den öden Höfen und unter den einsamen Bogen, zwischen heiligen Trümmern und dem Zerbröckeln alter Termitenbauten den großen herrscherlichen Schritt der unbehausten Seele.«
Auf unseren ausgedehnten Wanderungen im Gebirge hörte ich auch die wundervollen Verse des Gedichts Exil, das mein Vater leise und mit gesenktem Blick, als spreche er zu seinen Füßen, aufsagte:
»Wir werden mehr als ein Trauergepränge geleiten, singend das Gestern, singend das Anderwärts, singend das Leiden an seiner Geburt und die Herrlichkeit des Lebens, die sich verbannt… außer Reichweite der Menschen.«
Schon in früher Jugend hatte ich das Gefühl, daß das Leben meinem Vater eine Last war.
Am Tag nach seinem Tod im Jahre 1991 überließ ich es meiner Schwester Barbara, die Todesanzeige aufzusetzen. Die Berner Protestanten wählen dafür immer einen Bibelvers oder eine philosophische Maxime, die das Leben des Verstorbenen auf den Punkt bringt. Meine Schwester, die in einem viel vertrauteren und innigeren Verhältnis zu unserem Vater gestanden hatte als ich, entschied sich für einen Ausspruch von Schlieffen: »Mehr sein als scheinen.« Alle fanden, daß es eine kluge Wahl war.
Im Frühling, wenn der Abend über die Gärten und Häuser unseres Viertels hereinbrach, stieg ich oftmals den Hang hinab, durchquerte das kleine Tal und erklomm den Schloßberg auf der anderen Seite. Ich durchschritt das hohe mittelalterliche Portal der äußersten Ringmauer, ging über die Zugbrücke und betrat den Hof des Amtsschlosses. Eingerahmt von Gefängnis und Museum erhebt sich das Hauptgebäude, in dem die Ämter untergebracht sind. An der Außenmauer sind Kupfertafeln angebracht, auf denen zu lesen ist: »Amt des Gerichtspräsidenten«, »Gerichtsschreiberei«, »Gefängnis: Besuchszeiten«.
Die Atmospähre im Amtsschloß war familiär: Der Gerichtsschreiber – ein kleiner, hagerer, altersloser Mann mit Brille –, der Gefängniswärter und seine Frau, die zweimal täglich die Suppe für die drei bis vier Häftlinge zubereitete, der Schreiber und die Beisitzer (Bauern, Handwerker und Bürger, die von den Bewohnern des Bezirks in ihre Ämter gewählt wurden), sie alle waren sehr freundlich zu mir.
An den Tagen, an denen Plädoyers gehalten wurden, verfolgte ich von einer der hinteren Bänke des Gerichtssaals die Reden und sah das verschlossene Gesicht, den abwesenden Blick meines Vaters. Ich hatte den Eindruck, er verkrafte das vor ihm ausgebreitete Elend nicht.