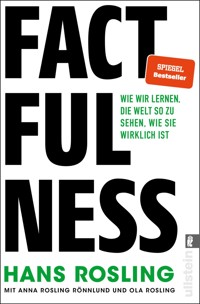14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hans Rosling war der "Popstar der Vernunft" (Süddeutsche Zeitung Magazin), der Herr der Fakten – und zeitlebens ein Kämpfer für eine bessere und gerechtere Welt. In seiner Autobiografie erzählt der schwedische Kultautor, wie er Schritt für Schritt eigene Vorurteile überwand und zu echter FACTFULNESS fand. Für seine faktenbasierte Weltsicht war Hans Rosling international bekannt und berühmt. Doch wurde er nicht als FACTFULMAN geboren: Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, ging er als junger Arzt zunächst nach Mosambik. Seine Arbeit im Krankenhaus der Hafenstadt Nacala wie auch die Begegnungen mit Bewohnern abgelegener afrikanischer Dörfer wurden zur Initialzündung für sein späteres Handeln. Vorlesungen vor Studierenden in Stockholm, Vorträge auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Freundschaften wie mit Melinda und Bill Gates oder Gespräche mit dem Revolutionsführer Fidel Castro bestärkten ihn in seiner Botschaft: Wir müssen unser vermeintliches Wissen über den Zustand der Welt hinterfragen und uns den Fakten zuwenden – denn die Wirklichkeit ist oft viel besser als wir glauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Mit FACTFULNESS hat Hans Rosling unser grundlegendes Verständnis von der Welt verändert. In seinen Erinnerungen erzählt der geniale Querdenker und Kultautor nun, wie Wissensdrang und Neugierde ihn zu einer fundamental neuen, weil faktenbasierten Sicht der Dinge führten. Aufgewachsen in einer Familie, in der Bildung von Generation zu Generation erkämpft werden musste, konnte er als Erster studieren und die Welt bereisen. Trotz einer schweren Krebserkrankung ging er als junger Arzt nach Mosambik, um dort den Ärmsten der Armen zu helfen. Seine Arbeit im Krankenhaus von Nacala wie auch die Begegnungen mit Bewohnern abgelegener afrikanischer Dörfer initiierten sein späteres Handeln. Vorlesungen vor Studierenden in Stockholm, Vorträge auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Begegnungen mit Melinda und Bill Gates oder Gespräche mit Fidel Castro bestärkten ihn in seiner Botschaft: Wir müssen unser vermeintliches Wissen über den Zustand der Welt hinterfragen und uns den Fakten zuwenden – denn die Wirklichkeit ist oft viel besser, als wir glauben.
Über die Autoren
HANS ROSLING, geboren 1948, gestorben im Februar 2017, war Professor für Internationale Gesundheit am Karolinska Institutet und Direktor der Gapminder-Stiftung in Stockholm. Er war Gründungsmitglied von Ärzte ohne Grenzen e.V. in Schweden und Mitglied der Internationalen Gruppe der Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Zusammen mit seinem Sohn Ola Rosling und seiner Schwiegertochter Anna Rosling Rönnlund gründete Hans Rosling die Gapminder-Stiftung, die heute seine Idee der FACTFULNESS weiterführt.
FANNY HÄRGESTAM, geboren 1983, lebt als Journalistin in Paris.
Aus dem Schwedischen von Maike Barth
Ullstein
Die Originalausgabe erschien 2017
unter dem Titel
Hur jag lärde mig förstå världen
bei Natur & Kultur, Stockholm.
Der Verlag dankt dem Swedish Arts Council,
der sich an den Übersetzungskosten beteiligt hat,
für die freundliche Unterstützung.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-2117-2
© 2017 by Rosling Education AB 2017. All rights reserved.
© der deutschsprachigen Ausgabe
2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Jorgen Hildebrandt / TT / picture alliance
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
VORWORT
Ein Telefonat am 5. Februar 2016 ließ es plötzlich unaufschiebbar erscheinen, Bücher zu schreiben. Mein Arzt rief an und eröffnete mir, dass ich an Bauchspeicheldrüsenkrebs litt.
Ich war auf die schlechte Nachricht vorbereitet.
Das Gespräch an jenem Nachmittag bestätigte lediglich, was mir während der Untersuchungen der vergangenen Tage allmählich klar geworden war. Die Prognose war schlecht. Ich hatte noch ungefähr ein Jahr zu leben.
Fast den ganzen Abend hindurch weinte ich. Glücklicherweise hatte ich Agneta, meine Jugendliebe und Ehefrau. Mit ihr als Trost und mit der Unterstützung unserer Kinder und Freunde konnte ich mich an die neuen Umstände gewöhnen. Ich würde nicht schon im nächsten Monat sterben. Das Leben würde trotz der tödlichen Krankheit weitergehen. Zumindest im Frühling und Sommer würde ich mein Leben noch genießen können.
Durch den Krebs ist meine Tagesform unvorhersehbar geworden. Deshalb hat sich auch meine Arbeit verändert. Nur wenige Tage nach der Diagnose sagte ich alle Vorträge sowie Film- und Fernsehproduktionen ab. Das war sehr schade, aber ich hatte keine Wahl. Außerdem gab es einen ganz bestimmten Grund dafür, dass ich mit der dramatischen Veränderung in meinem Leben zurechtkommen konnte. Etwas anderes stand nämlich ganz oben auf meiner Wunschliste: gemeinsam mit meinem Sohn Ola und seiner Frau Anna das Buch Factfulness zu schreiben. Wir haben achtzehn Jahre lang im Bereich der politischen Erwachsenenbildung zusammengearbeitet und gemeinsam die Gapminder-Stiftung gegründet.
Auf das Buchkonzept und den Titel waren Anna und Ola im Herbst 2015 gekommen. Wir hatten bereits geplant, das Buch im Laufe der nächsten Jahre parallel zu unserer Arbeit für Gapminder zu schreiben. Der Krebs machte es für mich nur noch drängender.
Bald stellte sich heraus, dass das Material für zwei Bücher reichen würde. Während Factfulness sich damit beschäftigt, warum wir Menschen uns so schwer damit tun, die Entwicklungen in der Welt zu begreifen, handelt dieses Buch von mir und davon, wie ich lernte, die Welt zu verstehen.
Dieses Buch beinhaltet also nur sehr wenige Zahlen. Stattdessen handelt es von meinen Begegnungen mit Menschen, die mir die Augen geöffnet, mich zum Umdenken gebracht haben.
Hans Rosling
Uppsala, Januar 2017
KAPITEL 1
VON ANALPHABETEN ZUM PROFESSORENTITEL
Wenn mein Vater abends von der Arbeit nach Hause kam, duftete er immer nach Kaffee. Er war bei Lindvalls Kaffe in Uppsala in der Rösterei angestellt. Deshalb lernte ich den Duft von Kaffee lieben, lange bevor ich selbst welchen trank. Ich war meist draußen und wartete darauf, dass er die Straße hinunterkam, von seinem Fahrrad absprang und mich umarmte. Dann stellte ich ihm immer dieselbe Frage:
»Hast du heute etwas gefunden?«
Der Kaffee wurde in der Rösterei in Säcken angeliefert, die auf ein Fließband geleert wurden. Zunächst passierten die Kaffeebohnen einen starken Magneten, der alle Metallgegenstände entfernen sollte, die beim Trocknen und Verpacken in den Sack geraten waren. Diese Gegenstände brachte mein Vater mir mit. Was sie für mich so spannend machte, waren die Geschichten, die er über sie erzählte. Manchmal waren auch Münzen dabei.
»Schau, diese hier ist aus Brasilien«, sagte er zum Beispiel, »aus dem Land, das in der Welt den meisten Kaffee produziert.«
Ich saß auf seinem Schoß, und vor uns lag ein Weltatlas, während er für mich die Geschichte jeder einzelnen Münze nachzeichnete.
»Das ist ein großes Land, in dem es sehr warm ist. Der Sack mit dieser Münze ist aus Santos gekommen«, sagte er und zeigte auf die brasilianische Hafenstadt.
Er berichtete mir von den vielen Arbeitern, die Teil jener menschlichen Kette waren, die dafür sorgte, dass wir in Schweden Kaffee trinken konnten. Ich lernte früh, dass innerhalb dieser Kette die Kaffeepflücker diejenigen waren, die am schlechtesten bezahlt wurden.
An einem anderen Abend war die Münze aus Guatemala.
»In diesem Land sind die Kaffeeplantagen im Besitz der Weißen aus Europa. Den Ureinwohnern, die zuerst dort lebten, bleibt die schlecht bezahlte Arbeit, die Bohnen zu pflücken.«
Besonders deutlich erinnere ich mich daran, wie er mit einer Kupfermünze nach Hause kam. Es war eine Fünfcentmünze aus Britisch-Ostafrika (dem heutigen Kenia) mit einem Loch in der Mitte.
»Der Mann, der die Bohnen auf dem Sand zum Trocknen ausgebreitet und sie später wieder in den Sack geschüttet hat, trug diese Münze vermutlich an einem Riemen um den Hals. Wahrscheinlich ist der Riemen gerissen, und als er seine Münzen wieder aufsammelte, hat er wohl diese übersehen, die dann mit in den Sack geriet. Nun gehört sie dir.«
Noch heute bewahre ich die Holzkiste mit den Münzen auf, die mein Vater mir mitgebracht hat. Anhand der ostafrikanischen Münze erklärte er mir den Kolonialismus. Im Alter von acht Jahren hörte ich zum ersten Mal von der Mau-Mau-Bewegung, die in Kenia für die Unabhängigkeit kämpfte.
Aus den Erzählungen meines Vaters gewann ich den Eindruck, dass die Menschen, die in Lateinamerika und Afrika den Kaffee pflückten, trockneten und verpackten, seine Kollegen waren. Zweifellos hat meine große Sehnsucht, die Welt zu verstehen, ihren Ursprung in den aus Kaffeesäcken geretteten Münzen sowie in den Geschichten, die mir vor einem Weltatlas erzählt wurden. Diese Sehnsucht wurde allmählich zu einer lebenslangen Besessenheit und später zu meinem Beruf.
Heute habe ich verstanden, dass mein Vater mir die Erhebungen gegen die Kolonialmächte in aller Welt genauso erklärt hat, wie er mir die Geschichte vom Kampf gegen den Nazismus in Europa nahegebracht hat. Während unserer langen Waldspaziergänge an den Wochenenden erzählte er mir ausführlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs.
Meine Eltern hatten keine extremen politischen Ansichten, sondern im Gegenteil ganz gewöhnliche, fast schon langweilige. Beide lehnten die extreme Linke genauso ab wie die extreme Rechte. Mein Vater bewunderte all jene Menschen, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpften.
Ich wuchs ohne Religion, aber mit klaren Wertvorstellungen auf. »Es spielt keine Rolle, ob jemand an Gott glaubt, das Entscheidende ist, wie er seine Mitmenschen behandelt«, hieß es. Und: »Der eine geht in die Kirche, der andere geht in den Wald und genießt die Natur.«
Unser kleiner Radioapparat aus lackiertem braunen Holz stand auf einem String-Regal über dem Esstisch, und beim Abendessen hörten wir immer die Nachrichten. Nicht die Nachrichten als solche beeinflussten mich in jungen Jahren, sondern die Erläuterungen meiner Eltern. Meine Mutter kommentierte meistens die nationalen Meldungen und mein Vater die internationalen. Er reagierte oft sehr heftig darauf: hörte auf zu essen, setzte sich gerade hin, lauschte aufmerksam und zischelte, wir sollten still sein. Hinterher sprachen wir noch eingehend über das Gehörte.
———
Meine früheste Erinnerung handelt davon, wie ich als Vierjähriger aus einem Abwassergraben vor dem Haus meiner Großmutter gerettet wurde. Ich war aus dem Garten gelaufen und jenseits des Zauns am Straßengraben entlangspaziert. Der Graben war bis oben hin mit einer Mischung aus dem nächtlichen Regen und stinkenden Abwässern aus der Fabrikarbeitersiedlung angefüllt.
Irgendetwas in dieser Brühe weckte meine Neugier, und ich stieg in den Graben, um es mir genauer anzusehen. Dabei rutschte ich aus und fiel hinein. Ich bekam keine Luft mehr und fand keinen Halt am Grabenrand. Es wurde dunkel um mich. Als ich in Panik versuchte, mich umzudrehen, sank ich nur noch tiefer in den Schlamm ein. Meine neunzehnjährige Tante, die nach mir gesucht hatte, bekam meine strampelnden Füße zu fassen und zog mich heraus.
Ich erinnere mich an das Gefühl der Erleichterung, als meine Großmutter mich in die Küche trug. Sie hatte Wasser zum Geschirrspülen erhitzt, das sie jetzt vom Holzherd nahm und in eine Wanne goss, die sie auf den Küchenfußboden gestellt hatte. Als ich mich ausgezogen hatte, prüfte sie die Wassertemperatur mit ihrem Ellenbogen, bevor sie mich ins Bad steigen ließ. Sie wusch mich von Kopf bis Fuß mit einem weichen Schwamm und Seife. Bald war ich wieder guter Dinge und spielte mit dem Schwamm. Erst viele Jahre später wurde mir bewusst, dass ich damals beinahe ertrunken wäre. 1952 besaß der Stadtteil Eriksberg, wo meine Großeltern wohnten, noch keine Kanalisation.
Ich wohnte als Vierjähriger bei meinen Großeltern, weil meine Mutter mit Tuberkulose im Krankenhaus lag. Mein Vater verbrachte seine freien Samstage mit mir, aber unter der Woche, wenn er arbeiten musste, lebte ich bei meiner Großmutter. So konnte er meine Mutter jeden Abend im Krankenhaus besuchen. Meine Großmutter hatte sieben Kinder großgezogen. Die zwei jüngsten, neunzehn und dreiundzwanzig Jahre alt, wohnten noch zu Hause, als ich als achtes Kind zum Haushalt stieß.
Meine Großeltern väterlicherseits waren auf Bauernhöfen geboren und aufgewachsen, hatten sich aber später der wachsenden städtischen Arbeiterklasse angeschlossen. Großvater arbeitete sein ganzes Erwachsenenleben hindurch in der Ziegelei Ekeby Tegelbruk in Uppsala. Er war ein freundlicher und hart arbeitender Mann, der liebevoll mit seiner Frau umging. Sein ganzer Stolz war das zweistöckige Holzhaus, das er an den Wochenenden und Abenden gemeinsam mit seinen Söhnen erbaut hatte. Das Waldgrundstück hatte er mithilfe eines ziegeleieigenen Finanzierungsplans gekauft, und das Haus wurde Teil der Fabrikarbeitersiedlung am Stadtrand.
Es war überwiegend aus dem Holz der hohen Kiefern errichtet, die auf dem Grundstück wuchsen. Im Laufe eines Sommers hatte Großvater sie mit einer Trummsäge zu Brettern zersägt. An diese mühevolle Arbeit sollte er sich noch sein ganzes Leben lang erinnern. Das Haus konstruierte er so modern, wie er es sich leisten konnte, aber wie bei den meisten Häusern im Arbeiterstadtteil ließen die hygienischen Vorrichtungen zu wünschen übrig. Der einzige Wasserhahn war über dem Ausguss in der Küchenecke angebracht. Darin landete auch der Urin aus den Nachttöpfen, einschließlich meines kleinen Töpfchens. Die Gräben, die entlang der Straßen in der Siedlung verliefen, waren mit schmutzigem und ungesundem Morast angefüllt. Meine Großmutter sorgte dafür, dass Haus und Garten immer sauber und ordentlich waren, aber im Sommer zog ständig der Gestank aus den Gräben herüber. Wenn ich später irgendwo auf der Welt durch Slums ging, erinnerte mich der üble Geruch aus den offenen Abwasserkanälen immer an die Sommer meiner Kindheit bei Großmutter.
Meine Eltern und meine Großeltern väterlicherseits waren zwar Niedriglohnempfänger, aber wir mussten keine Not leiden. In Schweden verbesserten sich sowohl die Einkommen als auch die allgemeine Gesundheit während meiner Jugend kontinuierlich. Meine Mutter wurde mit neuen Medikamenten, die sie vom Gesundheitssystem des sich entwickelnden schwedischen Wohlfahrtsstaats kostenlos erhielt, von der Tuberkulose geheilt. Die Anzahl der Todesfälle durch Infektionskrankheiten sank deutlich. Stattdessen wurden Unfälle zur häufigsten Todesursache bei Kindern. Wasseransammlungen in der Nähe von Wohnhäusern – wie der Graben, in den ich gefallen war – stellten eine häufig anzutreffende Bedrohung für meine Generation schwedischer Kinder dar.
———
Schon als Teenager war ich wie besessen davon, menschliche Lebensumstände zu begreifen, und seither habe ich meine Großeltern eingehend über ihr Leben ausgefragt. Nichts hat mir so sehr dabei geholfen, unsere moderne Welt zu verstehen, wie die Parallelen zur Lebenswirklichkeit meiner Verwandten aus vorangegangenen Generationen.
Meine Großmutter väterlicherseits, Berta, erzählte mir, wie sie und mein Großvater Gustav 1915 als jung Verheiratete in ein gemietetes Holzhaus auf dem Lande bei Uppsala einzogen. Das Haus hatte einen Holzfußboden, aber nur ein Zimmer und Küche. Als Lichtquelle diente eine Petroleumlampe, und Großmutter holte ihr Wasser aus einer nahen Quelle. Zwölf Jahre und fünf Kinder später zogen sie näher zum Arbeitsplatz meines Großvaters. Ihr zweites Heim war ebenfalls sehr klein, nur vierundzwanzig Quadratmeter, aber es hatte Strom und fließendes Wasser. Während der drei Jahre, die sie dort wohnten, bekam meine Großmutter ihr sechstes Kind. Zwei der Kinder schliefen bei den Eltern in der Küche, die anderen vier in der Kammer. Großmutter erzählte mir, welch enorme Verbesserung das elektrische Licht mit sich brachte – für ihre Tätigkeiten im Haushalt, für die Hausaufgaben der Kinder und wenn einmal jemand nachts krank wurde. Ihre Lobeshymnen auf das elektrische Licht wollten gar kein Ende nehmen.
Die ersten zwei Wohnungen meiner Großeltern hatten eine Außentoilette in Form eines Lochs in der Erde. Doch 1930, als sie in das Haus einzogen, das mein Großvater gebaut hatte, bekamen sie eine Latrine im Keller. Das neue Haus hatte vier Zimmer, die alle mit einem Stromanschluss ausgestattet waren. Der Strom diente allerdings nur der Beleuchtung, und noch 1952 heizte meine Großmutter zum Kochen und Abwaschen den Holzherd an. In dem Jahr, als ich bei meinen Großeltern wohnte, bekamen sie ihr erstes Telefon.
Großvater hatte im Keller über zwei großen Behältern aus Zement einen Wasserhahn angebracht. Darin konnte meine Großmutter nun die gesamte Bettwäsche und Kleidung ihrer großen Familie waschen, statt an einen der nahe gelegenen Flüsse zu gehen. Trotzdem war die Wäsche auch weiterhin eine anstrengende und zeitraubende Arbeit. Meine Großmutter, die das Aufkommen so vieler Neuerungen durch die industrielle Revolution miterlebt hatte, träumte nur von einem: der »magischen« Waschmaschine.
Mein Vater war ihr zweites Kind. Das heißt, eigentlich das dritte. Ihr Erstgeborenes starb bei der Geburt im Krankenhaus. Mit vierzehn Jahren hatte mein Vater seine sechsjährige Schulzeit beendet und begann als Hilfsarbeiter in der Ziegelei. Heute nennt man so etwas Kinderarbeit. Die älteren Arbeiter behandelten die Jungen schlecht, aber für einen jungen Mann war es wichtig, in einer Familie mit stetig wachsender Geschwisterschar seinen Beitrag zur Haushaltskasse zu leisten.
Mit schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigem Lohn konnte mein Vater leben, aber dass er mit siebzehn Jahren seine Arbeit verlor, war eine Katastrophe. Dabei teilten viele andere während der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre das gleiche Schicksal. In seinen Augen war es eine Schande, keine Arbeit zu haben. Um trotzdem etwas zum Haushalt beizutragen, reparierte er die Schuhe der Nachbarn.
Als Deutschland am Morgen des 9. April 1940 in Norwegen und Dänemark einmarschierte, dauerte es nur wenige Stunden, bis mein Vater einberufen wurde. Am folgenden Tag war er bereits in Landskrona und hob Schützengräben aus, um eine deutsche Invasion in Schweden zu verhindern.
Im Zweiten Weltkrieg war mein Vater drei Jahre lang bei der schwedischen Armee und bewachte die Grenzen zu Dänemark, Norwegen und Finnland. Immer wieder erzählte er, welch ein Glück er gehabt hatte, dass er nie angegriffen worden war – während seiner gesamten Zeit bei der Truppe hörte er nicht einen Schuss fallen.
Er ermahnte mich zur Dankbarkeit gegenüber denjenigen Soldaten und Nationen, die die schwere Aufgabe übernommen hatten, die Nazis und ihre Verbündeten zu besiegen.
»Wir sind gegen den Nazismus und gegen den Kommunismus«, sagte mein Vater immer.
Dieses Wir schloss mich schon früh mit ein. Er verfiel nie in Pathos, wenn er sich äußerte, doch darüber, dass die europäischen Länder, die von den Deutschen besetzt gewesen waren, selbst Kolonialkriege führten, war er ehrlich entsetzt.
Mein Vater fürchtete stets, sich vor gebildeten Menschen zu blamieren. Er mochte nicht mit dem Bus fahren, weil er nicht wusste, wie man dort bezahlte. Aus dem gleichen Grund ging er auch in keine Buchhandlung. Während seiner Zeit als Laufbursche für einen Laden kam es hin und wieder vor, dass er von feinen Leuten zum Essen eingeladen wurde, aber er lehnte immer ab. Er wusste sich bei Tisch nicht zu benehmen.
In den ICA-Geschäften einzukaufen kam nicht infrage. Man ging zu Konsum, den heutigen Coop-Läden. Jugendliche waren Mitglied in der Jugendorganisation der Sozialdemokraten Unga Örnar (Junge Adler). Die Arbeiteridentität vermittelte meinem Vater ein Gefühl der Geborgenheit. Darin fühlte er sich zu Hause.
Nach dem Krieg erhielt er, nach verschiedenen kürzeren Beschäftigungen, schließlich die Stelle als Kaffeeröster bei Lindvalls Kaffe, wo er fast vierzig Jahre lang blieb. Abends tischlerte er im Keller. In unserer Familie warf man kaputte Dinge nicht weg, sondern reparierte sie. Als der Henkel unseres ersten Plastikeimers kaputtging, machte mein Vater einen neuen, aus Holz.
Er war der beste Orientierungsläufer in der Provinz Uppland, durchtrainiert und athletisch. Ich war zwei Jahre alt, als er in der achten Etappe der Einhundert-Kilometer-Stafette Tiomilaorienteringen in Führung ging und gewann, wovon er später noch oft erzählte. Was ihn interessierte, glückte ihm auch, und man konnte immer auf ihn zählen. Das kennzeichnete sein gesamtes Handeln. Auch damals, als mein unachtsamer Freund Hasse beim Fahrradfahren mit einem Auto zusammenstieß, wobei das Vorderrad eine Acht bekam. »Heute Abend kriegt Hasse aber so richtig Prügel«, sagten die Kinder des Stadtteils, denn das Fahrrad gehörte seiner Mutter. Hasse wurde zu Hause oft geschlagen.
Blitzschnell war mein Vater mit Hasse und dem Fahrrad in unserem Keller verschwunden, wo er das Vorderrad ausbaute, begradigte und wieder in die perfekte Form brachte. Der Schlauch war kaputtgegangen und musste ausgetauscht werden. Die Kratzer im Lack deckte meine Vater mit Farbe ab. Eineinhalb Stunden später ging Hasse mit einem heilen Fahrrad durch unsere Siedlung nach Hause.
———
Während mein Vater aus einer gewöhnlichen Arbeiterfamilie kam, stammte meine Mutter aus der Unterschicht. Großmutter Agnes war es, die sie beide aus der Schande der Armut in ein anständiges Leben geführt hatte.
Oberflächlich betrachtet, war Agnes genau wie alle anderen im Altersheim, aber für uns war sie eine Heldin.
Als meine Mutter ihre damals achtundachtzigjährige Mutter fragte, womit sie ihr auf ihre alten Tage eine Freude bereiten könne, antwortete sie: Finde heraus, wer mein Vater war.
Agnes war 1891 in einem winzigen Haus am Rande eines uppländischen Dorfes geboren worden. Sie bezeichnete es als Schuppen mit Lehmboden. Ihre Mutter war bei Agnes’ Geburt neunzehn Jahre alt und verriet niemals, wer der Vater des Mädchens war.
Trotz ihrer umfassenden Nachforschungen hatte meine Mutter außer der Angabe »Vater unbekannt« nichts weiter herausfinden können. Mehrere Jahre nachdem Großmutter ihren Wunsch geäußert hatte, fuhren meine Mutter und ich mit dem Auto in das kleine Dorf Holm, in dem meine Großmutter geboren war. Zu Fuß gingen wir einen schmalen Weg entlang, der sich zwischen einer Handvoll rot gestrichener Holzhäuser hindurchschlängelte.
Meine Mutter sprach einen Mann an und erzählte ihm, dass ihre Mutter hier im Dorf geboren war. Wenige Minuten später saßen wir auf seinen weiß gestrichenen Gartenstühlen bei Kaffee mit selbst gebackenem Hefegebäck und Keksen.
»Ja, ich weiß, Agnes wurde in der kleinen Hütte geboren, die früher hinter der Wiese da hinten stand.«
Aber er hatte keine Ahnung, wer der Vater gewesen war.
Nach dem Kaffeetrinken gingen wir über die Wiese und sahen uns das Steinfundament an, das von der Hütte übrig geblieben war.
Man verwies uns an entfernte Verwandte in umliegenden Dörfern, doch erst am späten Nachmittag hatten wir Erfolg. Und zwar dank Lars-Erik Sundin, dem Pastor der Gemeinde Tärnsjö. Es stellte sich heraus, dass er außerdem mein Cousin war und meine Mutter bereits vorher Kontakt zu ihm aufgenommen hatte. Nachdem wir von ihm mit noch mehr Kaffee und Hefegebäck bewirtet worden waren, berichtete er von seinen Nachforschungen in den alten Kirchenbüchern. Fast alle schwedischen Kirchengemeinden besitzen vollständige Verzeichnisse aller Geburten, Eheschließungen und Todesfälle. Nach einer zweihundert Jahre währenden Friedensperiode in Schweden sind diese Dokumente gut erhalten und mittlerweile außerdem frei im Internet einzusehen. Dort findet man auch nach Jahreszahlen geordnete Listen darüber, wer in welchem Haus wohnte, da der lutherische Pfarrer regelmäßig Hausbesuche machte, um sich zu vergewissern, dass alle das Neue Testament beherrschten.
Lars-Erik bestätigte, dass Agnes in der Hütte am Rand der Wiese geboren worden war. Im Jahr davor, also bei Agnes’ Zeugung, stand meine Urgroßmutter Brita jedoch auf einem Bauernhof in der näheren Umgebung in Diensten. Im selben Jahr gebar die Frau des Bauern ein Mädchen. Doch Lars-Erik hatte noch mehr zu berichten: Er hatte außerdem herausgefunden, dass die Tochter, die auf dem Hof geboren wurde, während meine Urgroßmutter dort arbeitete, auf den Namen Agnes getauft worden war. Ein halbes Jahr später erhielt dann meine Großmutter denselben Namen. Das war eine der wenigen Möglichkeiten für eine unverheiratete Frau, einen Fingerzeig zu geben, wer der Vater war. Sie konnte es nicht offen sagen, weil ihr das als üble Nachrede ausgelegt worden wäre und man sie als Hure bezeichnet hätte. Dagegen, dass sie das Kind genauso nannte wie sein anderes Kind, konnte der Vater jedoch nichts unternehmen, und die Menschen in ihrer Umgebung wussten Bescheid.
Als ich erwachsen war, fragte ich meine Großmutter, ob sie als Kind arm gewesen sei. Sie antwortete, ohne zu zögern und unmissverständlich:
»Nein, nie! Wir hatten immer zu Essen auf dem Tisch, wir hatten ein Dach über dem Kopf und jede Nacht ein sauberes, warmes Bett. Wir trugen Schuhe und konnten jeden Tag zur Schule gehen.«
Doch wie viel lernten meine Großeltern während ihrer vier Schuljahre?
Ich erinnere mich, wie mein Großvater väterlicherseits, Gustav, sich Wort für Wort durch die Zeitung hindurchbuchstabierte. Keine meiner beiden Großmütter konnte mir Märchen vorlesen, und Großvater und Großmutter väterlicherseits konnten sich auch nicht gegenseitig aus der Zeitung vorlesen. Meine Eltern hingegen lasen viele Romane. Es gab verschiedene Stufen der Lesekompetenz – vom Analphabetismus über elementare Lesefähigkeit bis zum flüssigen Lesen und schließlich bis zum Lesen anderer Sprachen. Meine Großeltern väterlicherseits erreichten nur das mittlere Niveau. Mein Großvater riet sogar vom Lesen ab – er behauptete, es schade den Augen. Er fühlte sich ausgeschlossen, wenn seine Kinder und Enkel so viel lasen. Er wollte, dass wir gemeinsam Holzarbeiten machten und uns über Dinge unterhielten, die er verstand und die ihn interessierten.
Ich fragte meine Großmutter Agnes auch, warum sie – nach einer Kindheit mit einem schwierigen Stiefvater – einen Alkoholiker geheiratet hatte.
»Ich war verliebt«, antwortete sie ernst.
Sie fand die anderen Männer im Dorf schmuddelig und unverschämt.
»Die Männer, die zum Arbeiten auf den Hof kamen, nutzten jede Gelegenheit, mir einen Klaps auf den Po zu geben oder mich auf übelste Weise anzufassen und mir dabei alle möglichen Schimpfnamen zu geben«, sagte sie. »Sie wussten, dass ich ein Bankert war und es deshalb nie wagen würde, meinem Stiefvater davon zu erzählen.«
Eines Sommers tauchte Ville auf, der in der Gemeinde beim Grabenbau arbeitete. Der Sohn eines besitzlosen Landarbeiters war am Rande von Stockholm aufgewachsen und hatte in der Armee gedient. Er half Agnes, die Milchkannen zu tragen, und machte ihr Komplimente für ihr Haar. Er wusch sich am Ende jedes Arbeitstags, war reinlich und höflich und behandelte Agnes wie einen Menschen und nicht wie einen Bastard. Das hatte es im Dorf noch nie gegeben. Innerhalb eines Monats war sie schwanger. Ville folgte den ungeschriebenen moralischen Gesetzen, die damals galten: Du darfst vor der Ehe Sex haben, aber wenn deine Partnerin schwanger wird, heiratest du sie.
Es stellte sich heraus, dass Ville Alkoholiker war und dies auch phasenweise sein Leben lang bleiben sollte. Er war ein geschickter Maurer, verdiente während seiner nüchternen Perioden Geld und schlug niemals seine Frau oder seine Kinder. Agnes bekam drei Kinder, und ihr Lebensziel war es, ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, als sie es selbst gehabt hatte. Als das größte Hindernis auf diesem Weg erwies sich ihre Erkrankung an Tuberkulose und Dickdarmkrebs. Kostenlose medizinische Versorgung heilte sie von der Tuberkulose und wie durch ein Wunder auch vom Krebs.
Während der Zeiten, die sie im Krankenhaus lag, kümmerte sich ein aus staatlichen Mitteln finanziertes Kinderheim um meine Mutter und ihre Geschwister, solange sie noch nicht zur Schule gingen. Frauen von der Heilsarmee brachten Agnes den Umgang mit der Nähmaschine bei. Sie überredete ihren Mann, ihr eine Maschine zu kaufen, mit dem Argument, dass es auf die Dauer billiger käme, wenn sie die Kleidung der Kinder selbst nähen könnte. Das Nähen bedeutete für sie nicht nur Kleidung, sondern auch Würde.
Die Kindheit meiner Mutter war unsicher und unvorhersehbar. An einem Herbsttag 1927 wurde sie eingeschult. Sie sollte in eine Schule in einem neu errichteten, schönen Gebäude an einem Platz unweit ihrer Wohnung in Uppsala gehen. Am feierlichen Tag der Einschulung trug sie ein neues Kleid und hielt Großmutters Hand. Als sie den Vaksala-Platz erreichten, blieb Großmutter beim Anblick der Schule stehen. Agnes’ Schule war ein Holzhaus gewesen, und es übertraf ihre wildesten Fantasien, dass ihre Tochter in eine Schule gehen würde, die wie ein Märchenschloss aussah. Sie drückte die Hand meiner Mutter, sah ihr in die Augen und sagte:
»Sie müssen wohl auch in solchen wie uns einen Wert sehen, da sie so eine schöne Schule für dich gebaut haben.«
Die Schule bot sogar etwas, das noch besser war als ihre Architektur: die Lehrerin meiner Mutter, Fräulein Brunskog. Sie war gut ausgebildet, hoch motiviert und nutzte die neuesten Unterrichtsmethoden. Damit war ihr Unterricht ein Baustein dessen, was die staatlich finanzierten Schulen den Kindern aus den noch verbleibenden Slumgebieten in Uppsala schenkten, wo die Gassen noch namenlos waren: eine sehr gute Ausbildung und – beinahe genauso wichtig – ein starkes Selbstvertrauen. Diese Lehrerin sorgte auch dafür, dass meine Mutter in ein Ferienlager für Kinder tuberkulosekranker Eltern fahren konnte. Meine Mutter hörte nie auf, von diesen wundervollen Sommern zu schwärmen. Deren Höhepunkt war ein Besuch bei Selma Lagerlöf auf ihrem Hof Mårbacka in der Nähe des Ferienlagers. Meine Mutter erinnerte sich daran, wie sie zusammen mit den anderen Kindern auf dem Fußboden gesessen und der Titanin der schwedischen Literatur gelauscht hatte, die aus ihren Büchern vorlas.
Meine Mutter erkrankte während ihrer Schulzeit ebenfalls an Tuberkulose. Doch das staatliche Gesundheitssystem nahm sich ihrer an, und während ihrer Rekonvaleszenz erhielt die Familie Wertmarken, auf die es im Laden an der Ecke gratis Milch gab. Meine Mutter erzählte, wie peinlich es war, mit den Marken zu bezahlen, weil dann diejenigen, die in der Schlange hinter einem standen, wussten, dass man aus einer Tuberkulosefamilie kam. Als sie sich bei ihrer Mutter darüber beklagte, seufzte Agnes und sagte:
»Aber die Milch magst du doch gern, oder?«
Meine Großmutter war damit zufrieden, die materiellen Bedürfnisse für ein sicheres Leben befriedigen zu können, doch meine Mutter wollte mehr. Allerdings wurde ihr das, was sie sich am meisten wünschte, verwehrt – eine Ausbildung. Meine Mutter lernte für ihr Leben gern, aber nach sechs Jahren Grundschule konnte sie ihren Vater nicht dazu überreden, sie auf die weitergehende Schule zu schicken.
Als besonders erniedrigend empfand sie es, dass der Lehrer sie während des letzten Schuljahrs bat, den Klassenkameraden aus wohlhabenderen Familien bei ihren Aufgaben zu helfen. So sollten sie die Noten erreichen, die sie brauchten, um zu jener höheren Ausbildung zugelassen zu werden, für die sich meine Mutter nicht bewerben durfte. Mit fünfzehn Jahren begann meine Mutter als Laufmädchen im örtlichen Lebensmittelgeschäft.
———
Die Geschichten, die mir meine Verwandten von früher erzählten, machten mir die Entwicklung der Welt verständlich. Vor der Zeit meiner Großmutter mütterlicherseits herrschten Hungerjahre, also extreme Armut. Das war der Hauptgrund dafür, dass nach 1846 viele der Verwandten meiner Vorfahren nach Illinois, Minnesota und Oregon auswanderten. Meine Großmutter Agnes und meine Mutter Britta schafften es dank verschiedener Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussten und verstärkten, aus extremer Armut zu einem richtig guten Leben aufzusteigen.
Zum einen war da das Wirtschaftswachstum in Schweden, das erklärt, warum mein Großvater trotz seines Alkoholismus eine Arbeit fand. Sein Lohn als Maurer war ständig im Steigen begriffen, und obwohl er so viel Geld vertrank, konnte er es sich leisten, eine Nähmaschine zu kaufen.
Zum anderen waren da die Errungenschaften des Sozialstaats wie die Schulen, das Gesundheitswesen, das staatlich finanzierte Kinderheim und die Entzugsklinik für Alkoholkranke. Ohne letztere wäre Großvaters Alkoholsucht womöglich noch schlimmer gewesen. Ein Liebesbrief, der sich aus seiner Zeit in der Klinik erhalten hat, so voller Liebe und inständiger Bitten um Verzeihung, macht verständlich, warum meine Großmutter in einem Leben ständiger Unberechenbarkeit ausharrte.
Zum Dritten bot die Zivilgesellschaft in vielerlei Hinsicht Hilfe und Rettung für meine Familie. Von den Nähstunden meiner Großmutter bei den »Slumschwestern« der Heilsarmee bis zu den kulturellen Erlebnissen, die ehrenamtlich arbeitende Studenten meiner Mutter im Ferienlager ermöglichten. Ich betrachte meine Herkunft als eine Kombination aus Bestrebungen des Marktes, der Regierung und der Zivilgesellschaft, die gemeinsam meine Großmutter und meine Mutter aus der Misere holten und mich auf der Schwelle des Wohlfahrtsstaats absetzten.
Langsamer als die wirtschaftliche Situation veränderten sich jedoch kulturelle Normen. Einer der Lebensbereiche, die über erstaunlich lange Zeit in Schweden als absolut tabu galten, ist die Sexualität. Ich spreche hier in erster Linie von der Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln sowie von etwas, was wir heute etwas umständlich »reproduktive Gesundheit und reproduktive Rechte« nennen. Meine Großmutter und meine Mutter konnten aufgrund politischer Entscheidungen und kultureller Normen weder unbeschwert sexuelle Intimität genießen noch ihre Schwangerschaften planen.
Nachdem sie drei Kinder geboren und die Tuberkulose und eine Krebserkrankung nur knapp überlebt hatte, beschloss meine Großmutter, keine weiteren Kinder zu bekommen. Drei waren genug der Verantwortung für sie. Sie hörte von einem Mann, der erklärte, wie man Kondome benutzt. Über die Nutzung von Kondomen aufzuklären war zwischen 1910 und 1938 in Schweden gesetzlich verboten. Doch an einem Tag Mitte der 1920er-Jahre erfuhren meine Mutter und ihre Freundinnen davon, dass ein unerschrockener Mann auf dem Marktplatz von Uppsala über Kondome sprechen würde. Sie nahmen all ihren Mut zusammen und gingen hin. Beschämenderweise für alle demokratischen Parteien in Schweden wagte es nur der Vorsitzende der Partei am äußersten linken Rand, für die Redefreiheit einzutreten, mit anderen Worten: über Kondome zu informieren. Er kletterte auf eine Holzkiste und sprach unverblümt über das Recht eines jeden Paares, selbst zu entscheiden, ob und wann es Kinder haben will. Doch als er ein Kondom aus der Innentasche seiner Jacke zog, um es dem Publikum zu zeigen, wurde er von der Polizei festgenommen.
1935, als meine Mutter vierzehn Jahre alt war, wurde ihre beste Freundin schwanger. Sie war im gleichen Alter wie meine Mutter und wohnte ihr direkt gegenüber, in der zweiten Etage des einfachen Wohnblocks. Durch die Schwangerschaft kam ans Licht, dass ihr Vater sie schon seit Langem sexuell missbrauchte. Das war natürlich eine dramatische Enthüllung, die im ganzen Haus bekannt wurde. Einige Tage nachdem der Vater von der Polizei verhört worden war, besuchte der Gemeindepfarrer die Familie. Er erklärte der Mutter, es sei ihre eigene Schuld, dass der Vater sich an der Tochter vergangen hatte, weil sie selbst ihm nicht »zu Willen« gewesen sei.
Das war die Realität, in der meine Mutter aufwuchs. Mit achtzehn verliebte sie sich in meinen Vater. Keiner von beiden wusste wirklich über Verhütungsmittel Bescheid, und sie wurde schwanger. Damals arbeitete sie ganztags als Laufmädchen und verfolgte ihren Traum von einer höheren Bildung, indem sie Abendkurse belegte. Die wirtschaftliche Situation meiner Eltern war schlecht, und meine Mutter wollte mit der Familiengründung noch warten. Sie hörte sich nach einer Möglichkeit zur Abtreibung um und erhielt den Namen eines anerkannten Arztes mit einer Privatpraxis. Er war dafür bekannt, von Patientinnen, die wenig Geld hatten, ein niedrigeres Honorar zu verlangen.
An einem Spätnachmittag ging meine Mutter zu ihm in die Praxis. Sie wurde gebeten, sich auszuziehen und nackt im Raum herumzugehen, was sie als demütigend empfand. Als der Arzt dann sexuelle Dienste als Gegenleistung für die Abtreibung forderte, verließ meine Mutter die Praxis. Ihre einzige Alternative war eine Arbeitskollegin, die billig Abtreibungen vornahm. Diese Frau besuchte meine Mutter eines Abends zu Hause und führte die Abtreibung durch, indem sie eine Stricknadel in die Gebärmutter einführte. In der Nacht brachte meine Mutter allein einen toten Fötus zur Welt, den sie, wie man es ihr gesagt hatte, im Kamin in der Ecke ihrer Einzimmerwohnung verbrannte. Glücklicherweise traten danach keine lebensbedrohlichen Blutungen oder Infektionen auf, wie es sonst häufig der Fall war.
Der Durchbruch zu freier Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln kam mit dem staatlichen Verband für sexuelle Aufklärung RFSU unter der Leitung von Elise Ottesen-Jensen, im Volksmund Ottar genannt. Diese Organisation trug viel dazu bei, dass der Reichstag das Verbot, über Kondome zu informieren und sie zu verteilen, aufhob. Bis heute werden die meisten Kondome in Schweden von RFSU ausgegeben. Meine Mutter und Großmutter nahmen jede Gelegenheit wahr, Ottar für die Verbesserungen zu preisen, zu denen sie beigetragen hatte.
———
Während meiner ersten Schuljahre nahm mein Vater mich oft zu Abendvorträgen des Bildungsverbands der Arbeiter ABF mit, die in einem Saal stattfanden, der mehrere Hundert Personen fasste. Die Vortragenden waren Entdeckungsreisende, die von ihren Erlebnissen in weit entfernten Ländern erzählten. Mithilfe einer modernen Form der Laterna magica, der Technologie vor dem Diaprojektor, projizierten sie Schwarz-Weiß-Fotos auf eine Leinwand. Ich war sieben Jahre alt, und dies waren magische Abende für mich – mit Papa zu Veranstaltungen für Erwachsene gehen zu dürfen und mich von Geschichten über das Leben der Menschen in weit entfernten Kolonien fesseln zu lassen. Es gab unterschiedliche Arten von Vorträgen.
Am beliebtesten war Eric Lundqvist, ein schwedischer Forstwissenschaftler, der in den 1930er-Jahren nach Indonesien gereist war, um für die holländische Kolonialverwaltung zu arbeiten. Er heiratete eine indonesische Frau und wurde als Autor mit Verständnis sowohl für das Ökosystem als auch für die Gesellschaft, in der er lebte und arbeitete, berühmt. Meine Eltern lasen seine Bücher. In Schweden war er als einer der führenden Antirassisten seiner Zeit bekannt.
In krassem Gegensatz zu Lundqvist stand der Entdeckungsreisende und Redner Sten Bergman, ein Biologe mit umfassenden Kenntnissen der Vogelwelt und der Natur. Bei einem seiner Abendvorträge, zu dem mein Vater mich mitgenommen hatte, sprach er nicht nur über Vögel. Er zeigte auch einen schwarz-weißen Stummfilm aus einem Dorf in Neuguinea, wo er gelebt und Vögel beobachtet hatte. In dem Film sah man, wie Bergman einen vier Meter hohen, glatten Pfahl aufstellte, an dessen oberem Ende eine Axt befestigt war. Dann wurde der Pfahl mit Seife eingerieben. Die Dorfbewohner waren gefilmt worden, wie sie vergeblich versuchten, den glatten Pfahl hinaufzuklettern, um an die Axt zu gelangen. Mitten im Film stand mein Vater auf, nahm meine Hand und sagte: »Wir gehen.« Draußen sah ich, dass er ganz blass im Gesicht war, wie bei den seltenen Gelegenheiten, wenn er wütend wurde. Er flüsterte mir zu:
»Dieser Mann hat keine Achtung vor den Menschen. Bergman ist ein Snob. Er zwingt andere, sich um einer Axt willen zum Gespött zu machen. Weil sie im Wald wohnen, brauchen sie die Axt natürlich dringend. Ich ertrage seine Haltung nicht.«
Eines Abends traf ich bei AFB meinen Klassenkameraden Ingmar. Er ging auch gemeinsam mit seinem Vater, der Pfarrer in der Schwedischen Missionskirche war, zu den Vorträgen. Ingmars Vater war Missionar in Französisch-Kongo gewesen. In der dritten Klasse besuchte er uns in der Schule und zeigte Bilder von seiner Arbeit. Ich erinnere mich an seine Schilderungen von einem so völlig anderen Land beziehungsweise der Kolonie, die es damals war. Obwohl er Pfarrer war, sprach er vor allem von dem Bau von Schulen und dem Aufbau einer medizinischen Versorgung für die Eingeborenen, die Kongolesen. Während der dritten Klasse verließen Ingmar und seine Familie Schweden, um zum dritten Mal in den Kongo zu gehen. Für ein Kind wie mich war es ungewöhnlich, einen Auswanderer nach Afrika in seinem Bekanntenkreis zu haben. Nachdem Ingmar abgereist war, erhielt ich von unserem Lehrer den Auftrag, einen Brief von uns Klassenkameraden an ihn zur Post zu bringen. Ich spüre noch heute meine Aufregung, zum ersten Mal einen Brief per Luftpost zu verschicken. Die Adresse des Internats für die Kinder der Missionare war so eigenartig. Der erste afrikanische Städtename, den ich lernte, war Pointe-Noire, die wichtigste Hafenstadt der Republik Kongo.
In der Schule habe ich viel über Geografie gelernt, aber ich habe den Eindruck, dass ich erstaunlich wenig darüber erfuhr, wie Menschen in anderen Teilen der Welt lebten. Im Grunde eigneten wir uns eine Weltsicht an, die auf dem Prinzip »der Westen und der Rest der Welt« (da, wo die »Eingeborenen« lebten) basierte. Es schien, als ob die meisten der Bewohner dieser Welt Eingeborene in primitiven Kulturen waren.
Ich erinnere mich daran, wie mein Lehrer – ich glaube, es war in der fünften Klasse – uns erklärte, dass die Inder Hindus und fatalistisch seien. Man brachte uns bei, dass die Inder sich zum Christentum bekehren müssten, um Fortschritt und Entwicklung zu ermöglichen. Ich begriff nicht, dass Indien schon Zivilisationen mit eigenen Alphabeten und Literaturen besessen hatte, lange bevor die Schweden lernten, ein paar Zeichen in einen Runenstein zu ritzen. Wie die Sowjetunion, Japan und Lateinamerika in dieses Weltbild passten, ob sie zum Westen gehörten oder nicht, wurde nie erklärt. Wie die Kolonien eine nach der anderen unabhängig wurden, lernte ich eher von meinem Vater zu Hause als von meinem Lehrer in der Schule.
Mein Weltbild wurde von meinem Vater, meiner Mutter und unserem Radio zu Hause sowie von Begegnungen mit Menschen geprägt. Nicht von der Schule.
Meine Mutter wurde von der Tuberkulose geheilt, und die schwedische Wirtschaft sowie der Lohn meines Vaters wuchsen schneller, als meine Eltern je zu hoffen gewagt hätten. Als ich vier Jahre alt war, zogen wir in ein Haus mit Garten und vielen Obstbäumen. Für meine Eltern war das Leben ein Traum, der in Erfüllung ging. Sie konnten das Haus kaufen, weil sie jahrelang gespart hatten und über die wachsende staatliche Wohnbauförderung mit dem Ziel, der Arbeiterklasse die eigenen vier Wände zu ermöglichen, einen staatlichen Kredit erhielten. Außerdem nahmen sie einen privaten Bankkredit auf und bekamen einen großzügigen Betrag von meinem unverheirateten Onkel Martin geliehen. Das Haus war modern, mit Zentralheizung, warmem und kaltem Wasser, einem Badezimmer mit emaillierter Badewanne, Elektroherd, Kühlschrank und Waschmaschine.
In unserer Straße gab es eine Bibliothek. Meine Mutter nahm mich regelmäßig dahin mit, und wir liehen uns stapelweise Bücher aus, die sie mir vorlas. In den umgebenden Häusern wohnten Kinder in meinem Alter, und ich fand gute Freunde. Mein Vater zeigte mir die beeindruckende Stromleitung vom Kraftwerk Bergeforsen und erklärte mir, wie die Wasserkraft den Strom für unsere Waschmaschine produzierte.
Er sammelte auf den Kahlschlägen vor der Stadt dicke Kiefernäste ein, die dort liegen geblieben waren. Sein Arbeitgeber stellte ihm an den Wochenenden den Firmenlaster zur Verfügung, damit er die Äste nach Hause transportieren konnte, und das Holz nutzten wir, um Wasser zu erhitzen und im Winter zum Heizen. Meine Eltern bauten in ihrem Garten Kartoffeln, Gemüse, Äpfel und Erdbeeren an.
Meine Mutter nähte die meiste Kleidung selbst. Gekaufte Kleidung war teuer. Das Einzige, was sie nicht selbst nähte, waren Unterhosen. Die kauften wir, von der Marke Fix. Ich erinnere mich noch an das Jahr, als erstmals importierte Unterwäsche auf den schwedischen Markt kam und meine Mutter mit der Nachbarin über die Hecke erörterte, ob es für Kinder wirklich gesund sei, im Ausland gefertigte Unterwäsche zu tragen. Dem ersten kleinen Anzeichen einer Globalisierung von Konsumgütern, in diesem Fall Unterwäsche aus Portugal, begegnete man sogleich mit Misstrauen.
Nach einigen Jahren in unserem neuen Haus konnten wir es uns dank unserer Sparsamkeit leisten, in den Urlaub zu fahren. Meine Eltern kauften ein rotes Moped und ein blaues Tandem, und meine Mutter nähte ein Zelt. Im ersten Jahr fuhren wir durch die Provinz Uppsala, wobei wir uns nie mehr als hundert Kilometer von zu Hause entfernten. Den Abschluss der Reise bildete ein Besuch bei den unverheirateten Geschwistern von Großmutter Agnes, die ihr ganzes Leben auf einem Bauernhof verbracht hatten. Sie empfingen uns herzlich, und ich durfte ohne Sattel auf ihrem großen Pferd reiten.
Doch der Besuch endete mit einem Kulturschock. Mein Vater fotografierte mich auf dem Pferd, das von Agnes’ ältestem Bruder Petrus geführt wurde. Eins der Bilder war besonders gelungen, mit dem alten Bauern in Arbeitsstiefeln und Overall und dem Jungen auf dem Rücken des starken Pferdes. Mein Vater machte einen Abzug davon, den er Petrus als Dank für die Gastfreundschaft zuschickte. Dort wurde das Foto jedoch als Beleidigung des alten Bauern aufgefasst. Er war nicht damit einverstanden, dass man ihn in Stiefeln und Overall fotografiert hatte. Auf einem Foto wollte er in seinem einzigen dunklen Anzug erscheinen. Wenn Verwandte aus der Stadt ihn in seiner Arbeitskleidung fotografierten, dann offenbar, um ihren Familienangehörigen vom Lande der Lächerlichkeit preiszugeben. Zwar gelang es meinen Eltern schließlich, den Konflikt beizulegen, aber es dauerte zwei Jahre. Die Lehre daraus – kulturelle Unterschiede zu respektieren – wurde noch dadurch unterstrichen, dass Petrus wirklich ein freundlicher und kluger Mensch war.
Unser zweiter Mopedurlaub führte uns bis nach Kopenhagen. 1960 wurde mein Bruder Mats geboren, und drei Jahre später konnten wir einen grauen VW kaufen und mit der ganzen Familie Urlaub in Norwegen machen.
1972 konnten meine Eltern ein Grundstück am Meer erwerben, wo mein Vater ein Sommerhaus baute, und mit dem Geld, das er von seiner Mutter Berta geerbt hatte, kaufte er ein kleines Boot mit Außenbordmotor und benannte es nach ihr.
Nach über zehn Jahren als Hausfrau bekam meine Mutter eine Teilzeitstelle in einer Bibliothek im Stadtteil Gamla Uppsala. Parallel dazu ging sie zur Abendschule und erreichte in Schwedisch, Englisch und Gemeinschaftskunde Gymnasialniveau. Doch erhielt sie nie die Ausbildung, von der sie geträumt hatte, um Lehrerin oder Journalistin werden zu können.
Das Leben meiner Verwandten spiegelt also eine sehr schnelle und positive Entwicklung in allen Lebensbereichen wider. Von der vierjährigen Grundschulbildung meiner Großmutter mütterlicherseits bis zu meinem Professorentitel dauerte es nur drei Generationen. Oder noch dramatischer ausgedrückt: Meine Urgroßmutter war Analphabetin, und von ihr bis zu mir vergingen vier Generationen. Wir alle repräsentieren die unterschiedlichen Ausbildungsniveaus, die heute auf der Welt vorkommen.
Die vier verschiedenen Stufen sind leicht zu erkennen: im Bereich der Gesundheit beginnend bei großer Krankheitslast durch Infektionskrankheiten am einen Ende der Skala bis zum langen, gesunden Leben am anderen Ende, im materiellen Bereich von einem kleinen Schuppen mit Lehmfußboden bis zu großen modernen Häusern, alles innerhalb weniger Generationen. Doch nichts davon geschah schlagartig, sondern alles entwickelte sich schrittweise.
KAPITEL 2
DIE WELT ENTDECKEN
Ich war neugierig auf die Welt, sparte Geld zusammen und begann, allein zu reisen. Mit sechzehn Jahren fuhr ich mit dem Rad durch Großbritannien. In dem ersten Dorf, das ich besuchte, sah ich ein Denkmal aus Stein mit vielen Namen darauf. Diese Namen standen für fast zwanzig Menschen aus dem Dorf, die dem Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen waren. Als ich um den gut erhaltenen grauen Stein herumging, fand ich eine weitere Inschrift mit fast genauso vielen Namen von Opfern des Zweiten Weltkriegs.
In Schweden hatten meine Eltern mich zu dem Gedenkplatz für die Schüsse von Ådalen mitgenommen, wo 1931 fünf Personen vom Militär erschossen worden waren. Mein spontaner Eindruck war deshalb, dass dieses erste Dorf, das ich besuchte, ganz besonders unter den Kriegen gelitten haben musste. Auf meiner anschließenden sechswöchigen Fahrradtour durch England und Wales, an die Südküste und wieder zurück nach London sah ich in fast jedem Dorf ähnliche Denkmäler, mit unterschiedlich vielen Namen. Ich erinnere mich an Gespräche mit Gleichaltrigen, denen ich unterwegs begegnete und deren Eltern im Krieg verwundet oder getötet worden waren.
Jetzt begriff ich, was mein Vater mir über das Ausmaß und die außerordentliche Grausamkeit der beiden Weltkriege zu vermitteln versucht hatte, und dass die einzelnen Länder in Europa unterschiedlich hart betroffen gewesen waren. Uns, die wir in Schweden aufgewachsen waren, fiel es oft schwer, die grausame Geschichte des neuzeitlichen Europas zu verstehen.
Im Sommer 1966 fuhr ich per Anhalter nach Paris, weiter an die Riviera und nach Rom, dann zum Stiefelabsatz Italiens und hinüber nach Griechenland. Die ländlichen Regionen Griechenlands waren anders als alles, was ich bisher gesehen hatte. Auf den Straßen sah man alte, schwarz gekleidete Frauen, die ihr Haar bedeckt hatten und riesige Lasten aus Brennholz auf dem Rücken trugen. Viele Familien lebten in recht einfachen Behausungen.
Die Heimreise über Mazedonien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Österreich und Deutschland war eine gute Lektion in schrittweiser Verbesserung der Lebensumstände. Als ich durch Berlin fuhr, wurde die Mauer gerade fünf Jahre alt. Ich ging über den Grenzübergang Checkpoint Charlie und spazierte einen Tag lang durch Ostberlin, eine gute Imprägnierung gegen linksextreme Ansichten. Nach diesem ersten kurzen Besuch in der DDR fiel es mir schwer, den Kommunismus nicht zu hassen.
Seit 1967 teile ich mein Leben mit Agneta. Im gleichen Sommer reisten wir gen Süden. Zunächst mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zu einer der südlichsten U-Bahn-Stationen Stockholms. Ab da wollten wir trampen. Und genau dort, vor dem Hauptsitz von Ericsson, hatten wir unsere erste Auseinandersetzung. Die Autobahn Richtung Süden lag nur hundert Meter entfernt, also sollten wir den Daumen raushalten, fand ich. Agneta zeigte zur Sonne, die hoch am Himmel stand, und meinte, dass es Mittagszeit sei und wir darum zuerst etwas essen sollten. Wir schauten einander unschlüssig an, und ich sagte:
»Wir können doch am Straßenrand eine Kleinigkeit essen, während wir versuchen, ein Auto anzuhalten.«
»Jede Minute kommen Hunderte Autos vorbei, und wir haben noch den ganzen Sommer vor uns. Hier ist eine Bank im Schatten mit einer schönen Aussicht über den Park. Wir essen das Picknick, das ich in deine Tasche gepackt habe, hier und jetzt«, sagte sie.
Ich habe die schlechte Angewohnheit, Mahlzeiten auszulassen, und an diesem ersten Tag unseres ersten Urlaubs gab sie mir deutlich zu verstehen, dass ich meine Gewohnheiten ändern sollte. Wir aßen ein romantisches Picknick im Park, trampten eine lange Strecke und checkten am Abend in Südschweden in einer gemütlichen Jugendherberge ein. Das neunzehnjährige Paar nahm sich für diese erste Nacht ein »Familienzimmer«. Das bedeutete, dass wir das Zimmer für uns hatten. Als ich aus der Dusche kam, lag Agneta schon im Bett.
»Ich habe den Kulturbeutel mit den Zahnbürsten auf den Waschbeckenrand gestellt«, sagte sie.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.