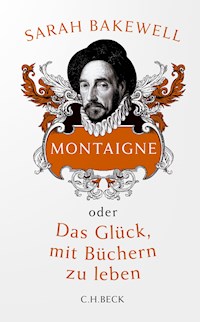17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer Entscheidungen lieber aus Verantwortung und Mitgefühl als nach Gesetzen und Geboten trifft, wer das Leben einzelner Menschen interessanter findet als kollektive Visionen, und wer davon träumt, unbekannte Welten zu entdecken, der steht, ob er will oder nicht, in der Tradition des Humanismus. Sarah Bakewell macht mit den wichtigsten Humanisten bekannt, die uns bis heute etwas zu sagen haben – von den Literaten und Künstlern der Renaissance bis zu engagierten Denkerinnen und Denkern des 20. Jahrhunderts. Ihr fesselndes, vor klugen Gedanken und ungewöhnlichen Geschichten vibrierendes Buch ist eine verführerische Einladung zu einem menschlichen – glücklichen, freien, neugierigen – Leben und Denken. Vor 700 Jahren kam die unverschämte Idee auf, dass der Mensch im Kern gut und frei ist und dass er auf der Suche nach Glück allein mit dem Kompass der Vernunft durch stürmische Zeiten steuern kann. Sarah Bakewell macht mit den italienischen Humanisten bekannt, die diese Idee in die Welt setzten, und beschreibt, wie inspirierend deren Neugierde, Forschergeist und Optimismus bis in die Gegenwart gewirkt haben, trotz aller Anfeindungen durch Theologen, Tyrannen und Ideologen. Sie erzählt von den mutigen Lebenswegen und überraschenden Entdeckungen der Humanisten und geht so deren großer Frage nach, wie man Mensch wird. Denn wir werden zwar als Menschen geboren, aber erst in einer Welt voller Beziehungen, Geschichten, Wissen, Liedern oder Bildern können wir wirklich Mensch werden: aufgeschlossen, neugierig, frei und glücklich im Hier und Jetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 764
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SARAH BAKEWELL
WIE MAN MENSCH WIRD
Auf den Spuren der HUMANISTEN
Freies Denken, Neugierde und Glück von der Renaissance bis heute
Aus dem Englischen von Rita Seuß
C.H.BECK
Zum Buch
Wer Entscheidungen lieber aus Verantwortung und Mitgefühl als nach Gesetzen und Geboten trifft, wer das Leben einzelner Menschen interessanter findet als kollektive Visionen, und wer davon träumt, unbekannte Welten zu entdecken, der steht, ob er will oder nicht, in der Tradition des Humanismus. Sarah Bakewell macht mit den wichtigsten Humanisten bekannt, die uns bis heute etwas zu sagen haben – von den Literaten und Künstlern der Renaissance bis zu engagierten Denkerinnen und Denkern des 20. Jahrhunderts. Ihr fesselndes, vor klugen Gedanken und ungewöhnlichen Geschichten vibrierendes Buch ist eine verführerische Einladung zu einem menschlichen – glücklichen, freien, neugierigen – Leben und Denken.
Über die Autorin
Sarah Bakewell lebt als Schriftstellerin in London, wo sie außerdem Creative Writing an der City University lehrt und für den National Trust seltene Bücher katalogisiert. Bei C.H.Beck erschienen von ihr «Wie soll ich leben? oder Das Leben Montaignes in einer Frage und zwanzig Antworten» (C.H.Beck Paperback, 2. Aufl. 2019) sowie «Das Café der Existenzialisten. Freiheit, Sein und Aprikosencocktails» (C.H.Beck Paperback, 4. Aufl. 2021).
Inhalt
Only connect!: Eine Einleitung
1: Das Land der Lebenden – Das 14. Jahrhundert
2: Schiffe bergen – Ab 79 n. Chr., hauptsächlich aber 15. Jahrhundert
3: Provokateure und Heiden – Hauptsächlich 1440–1550
4: Wundernetz – Hauptsächlich 1492–1559
5: Menschliche Angelegenheiten – Hauptsächlich 16. Jahrhundert
6: Fortwährende Wunder – 1682–1819
7: Ein Wirkungskreis für alle menschlichen Wesen – 1405–1971
8: Die Menschheit entfalten – Hauptsächlich 19. Jahrhundert
9: Ein Traumland – Hauptsächlich 1859–1910
10: Doktor Hoffnungsvoll – Hauptsächlich ab den 1870er Jahren
11: Das menschliche Gesicht – Hauptsächlich 1919–1979
12: Der Ort, um glücklich zu sein – 1933 bis heute
Dank
Humanists International Erklärung des modernen Humanismus
1. Humanisten streben danach, ethisch zu sein
2. Humanisten streben nach Rationalität
3. Humanisten streben nach Erfüllung in ihrem Leben
4. Der Humanismus erfüllt das weit verbreitete Bedürfnis nach einer Quelle von Sinn und Zweck, die eine Alternative zu dogmatischer Religion, autoritärem Nationalismus, Sektierertum und Stammesdenken und egoistischem Nihilismus darstellt
Bildnachweis
Anmerkungen
Only connect! Eine Einleitung
1. Das Land der Lebenden
2. Schiffe bergen
3. Provokateure und Heiden
4. Wundernetz
5. Menschliche Angelegenheiten
6. Fortwährende Wunder
7. Ein Wirkungskreis für alle menschlichen Wesen
8. Die Menschheit entfalten
9. Ein Traumland
10. Doktor Hoffnungsvoll
11. Das menschliche Gesicht
12. Der Ort, um glücklich zu sein
Personenregister
Fußnoten
Only connect!
Eine Einleitung
Was ist Humanismus?» Diese Frage wird in David Nobbs’ 1983 erschienenem humoristischen Roman Second from Last in the Sack Race bei der Eröffnungssitzung der Bisexual Humanist Society des Gymnasiums von Thurmarsh gestellt – «bisexual», weil sowohl Jungen als auch Mädchen teilnehmen können. Sofort geht alles wild durcheinander.
Ein Mädchen sagt, Humanismus sei der Versuch der Renaissance, das Mittelalter hinter sich zu lassen. Sie meint die literarische und kulturelle Erneuerung, die im 14. und 15. Jahrhundert von entschlossenen, unkonventionellen Intellektuellen in italienischen Städten wie Florenz ausging. Falsch, widerspricht eine andere. Humanismus bedeute, «freundlich zu sein und nett zu Tieren und sowas, Wohltätigkeit zu üben und ältere Leute und so zu besuchen».
Ein drittes Mitglied lässt das nicht gelten; damit verwechsle man Humanismus mit Humanitarismus. Und ein viertes Mitglied beschwert sich, sie verschwendeten doch nur ihre Zeit. Die Menschenfreundin reagiert gereizt: «Nennst du es Zeitverschwendung, wenn man verletzte Tiere bandagiert und sich um ältere Leute und so kümmert?»
Ihre Kritikerin schlägt eine andere Definition vor. Humanismus sei «eine Philosophie, die das Übernatürliche ablehnt, den Menschen als ein natürliches Wesen betrachtet und seine grundlegende Würde, seinen Wert und seine Fähigkeit zur Selbstverwirklichung durch den Gebrauch der Vernunft und der wissenschaftlichen Methode verteidigt». Das kommt gut an, bis einer der Diskutanten ein Problem anspricht: Manche Leute glauben an Gott, bezeichnen sich aber dennoch als Humanisten. Am Ende der Sitzung sind alle verwirrter als am Anfang.[1]
Doch die Thurmarshianer hätten sich keine Sorgen machen müssen: Sie waren alle auf der richtigen Spur. Jede ihrer Beschreibungen – und vieles andere – trägt zu einem umfassenden und facettenreichen Bild dessen bei, was Humanismus bedeutet und was Humanisten im Laufe der Jahrhunderte getan, untersucht und geglaubt haben.
Eine Schülerin hatte von einer nicht übernatürlichen Sicht auf das Leben gesprochen, und tatsächlich ziehen es viele moderne Humanisten vor, ohne religiöse Überzeugung zu leben und ihre moralischen Entscheidungen auf der Basis von Empathie, Vernunft und dem Gefühl der Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen zu treffen. Ihre Weltsicht wurde von dem Schriftsteller Kurt Vonnegut auf den Punkt gebracht, als er schrieb: «Ich bin Humanist, was unter anderem bedeutet, dass ich versuche, mich anständig zu verhalten, ohne Belohnung oder Strafe nach dem Tod zu erwarten.»[2]
Aber auch der Thurmarshianer hatte Recht, der sagte, dass es Humanisten mit religiösen Überzeugungen gebe. Diese könnten trotzdem als Humanisten bezeichnet werden, insofern für sie das Leben und die Erfahrungen der Menschen hier auf der Erde im Vordergrund stehen, nicht Institutionen, Doktrinen oder eine Theologie des Jenseits.
Andere Bedeutungen von «Humanismus» haben mit religiösen Fragen überhaupt nichts zu tun. Ein humanistischer Philosoph zum Beispiel ist einer, der die ganze lebendige Person in den Mittelpunkt stellt, statt sie in Systeme aus Worten, Zeichen oder abstrakten Prinzipien zu zerlegen. Ein humanistischer Architekt entwirft Gebäude nach menschlichem Maß, damit die Menschen, die darin wohnen müssen, sich nicht davon erdrückt oder überwältigt fühlen. Genauso kann es eine humanistische Medizin, Politik oder Bildung geben. Humanismus gibt es auch in Literatur, Fotografie und Film. In jedem Fall steht das Individuum an erster Stelle und wird keinem alles überwölbenden Konzept oder Ideal untergeordnet. Das kommt dem nahe, was die «humanitäre» Schülerin meinte.
Aber was ist mit den Gelehrten im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts und späterer Epochen, von denen die erste Thurmarshianerin spricht? Sie waren Humanisten eines anderen Typs: Sie übersetzten und edierten Bücher und unterrichteten Schüler, sie korrespondierten mit klugen Freunden, diskutierten über verschiedene Textauslegungen, förderten das geistige Leben und schrieben und redeten überhaupt viel. Sie waren Spezialisten der studia humanitatis oder humanistischen Studien, also der Geisteswissenschaften, die im Englischen humanities genannt werden. Ausgehend vom lateinischen Begriff wurden sie als umanisti bekannt, auch sie sind also Humanisten. Viele teilten die ethischen Anliegen von Humanisten anderen Typs und waren überzeugt, dass das Erlernen und Lehren der studia humanitatis zu einem tugendhafteren und zivilisierteren Leben befähige. Dozentinnen und Dozenten humanistischer und geisteswissenschaftlicher Fächer allgemein halten, wenn auch in modernisierter Form, oft immer noch an dieser Überzeugung fest. Sie versuchen, die Studenten mit literarischen und kulturellen Erfahrungen und mit den Instrumenten der kritischen Analyse vertraut zu machen, um ihre Sensibilität für die Perspektiven anderer zu schärfen, ihr Verständnis für politische und historische Ereignisse zu verfeinern und eine differenziertere und reflektiertere Sicht des Lebens allgemein zu vermitteln. Sie möchten die humanitas pflegen, was im Lateinischen Menschsein oder Menschlichkeit bedeutet und Nuancen von kultiviert, kenntnisreich, wortgewandt, wohlwollend und gesittet enthält.[3]
Was also verbindet religiöse, nichtreligiöse, philosophische, praktische und Geisteswissenschaften lehrende Humanisten, falls sie überhaupt etwas gemeinsam haben? Die Antwort steckt schon im Namen: Sie alle haben die menschliche Dimension des Lebens im Blick.
Was ist das für eine Dimension? Das lässt sich schwer definieren, aber sie liegt wohl irgendwo zwischen dem physischen Reich der Materie und einer wie auch immer vorstellbaren rein spirituellen oder göttlichen Sphäre. Natürlich bestehen wir Menschen aus Materie, wie alles um uns herum. Am anderen Ende dieses Spektrums können wir, wie manche glauben, auf irgendeine Weise mit dem Numinosen in Verbindung treten, während wir uns gleichzeitig in einem Wirklichkeitsraum befinden, der weder rein physisch noch rein spirituell ist. Hier üben wir kulturelle, geistige, moralische, rituelle und künstlerische Tätigkeiten aus, wie sie, wenn auch nicht ausschließlich, für unsere Spezies charakteristisch sind. In diese Tätigkeiten investieren wir einen Großteil unserer Zeit und Energie: indem wir reden, Geschichten erzählen, Bilder oder Modelle anfertigen, ethische Urteile fällen und darum ringen, das Richtige zu tun; indem wir soziale Vereinbarungen aushandeln, in Tempeln, Kirchen oder heiligen Hainen beten, Erinnerungen weitergeben, unterrichten, musizieren, Witze erzählen und zur Belustigung anderer herumalbern; indem wir versuchen, Dinge zu ergründen oder einfach nur die Art von Lebewesen zu sein, die wir sind. Das ist die Sphäre, die Humanisten jeder Couleur in den Mittelpunkt ihres Interesses stellen.
Während Naturwissenschaftler die physische und Theologen die göttliche Welt studieren, befassen sich Humanisten der geisteswissenschaftlichen Tradition mit der menschlichen Welt der Kunst, Geschichte und Kultur. Nichtreligiöse Humanisten treffen ihre moralischen Entscheidungen auf der Grundlage des menschlichen Wohlergehens, nicht einer göttlichen Weisung. Religiöse Humanisten konzentrieren sich zwar gleichfalls auf das menschliche Wohlergehen, aber sie tun es im Rahmen ihres Glaubens. Philosophische und andere Humanisten gleichen ihre Ideen permanent mit der realen menschlichen Erfahrungswelt ab.
In diesem Ansatz, der den Menschen in den Mittelpunkt rückt, klingt eine Bemerkung des griechischen Philosophen Protagoras an, der vor zweieinhalbtausend Jahren schrieb: «Der Mensch ist das Maß aller Dinge.»[4] Das mag arrogant klingen, bedeutet aber nicht, dass sich das gesamte Universum unseren Vorstellungen anpassen muss, und noch weniger, dass wir das Recht haben, uns gegenüber anderen Lebensformen als Herrscher aufzuspielen. Wir können es so verstehen, dass wir als Menschen unsere Wirklichkeit auf eine menschlich geprägte Weise erleben. Wir sind mit menschlichen Angelegenheiten vertraut und beschäftigen uns mit ihnen. Sie sind uns wichtig, nehmen wir sie also ernst.
Zugegeben, nach dieser Definition ist fast alles, was wir tun, in gewisser Weise humanistisch. Andere Definitionsvorschläge sind sogar noch umfassender. E. M. Forster – ein zutiefst «humaner» Schriftsteller und zahlendes Mitglied humanistischer Organisationen – antwortete auf die Frage, was Humanismus für ihn bedeute:
Der Humanismus könnte angemessener gewürdigt werden, wenn man all die Dinge auflistete, die man genossen oder bemerkenswert gefunden hat, all die Menschen, die einem geholfen haben, und die Menschen, die man geliebt und denen man zu helfen versucht hat. Die Liste wäre nicht dramatisch, ihr würde der Wohlklang eines Glaubensbekenntnisses und die Feierlichkeit einer Sanktion fehlen, aber sie könnte getrost vorgetragen werden, denn aus ihr spräche menschliche Dankbarkeit und menschliche Hoffnung.[5]
Das ist unwiderstehlich, kommt aber dem völligen Verzicht auf eine Definition nahe. Forsters Weigerung, irgendetwas Abstraktes oder Dogmatisches über den Humanismus zu sagen, ist allerdings an sich schon typisch humanistisch. Für ihn ist es eine persönliche Angelegenheit – und genau das ist der Punkt. Denn oft ist Humanismus tatsächlich etwas Persönliches, weil es um Personen geht.
E. M. Forster, 1924
Auch für mich ist er etwas Persönliches. Ich bin eine Humanistin im nichtreligiösen Sinn. In meiner Weltsicht und Lebenspraxis bin ich immer mehr zur Humanistin geworden und habe begonnen, dem Individuum mehr Wert beizumessen als den großen Ideen, die ich früher spannend fand. Und nachdem ich jahrelang über geisteswissenschaftliche Humanisten vergangener Epochen gelesen und geschrieben habe, bin ich fasziniert von diesem gemeinsamen Fundament aller humanistischen Studien.
Ich habe das Glück, meinen Humanismus relativ ungestört praktizieren zu können. Doch für viele ist er etwas, für das sie ihr Leben riskieren – und persönlicher geht es ja wohl nicht. Und da, wo der Humanismus nicht genau verstanden wird, kann sich diese Gefahr noch verschärfen, wie der Fall eines jungen Humanisten in Großbritannien zeigt.
Hamza bin Walayat stammt aus Pakistan, aber im Jahr 2017 lebte er im Vereinigten Königreich und beantragte eine Aufenthaltsgenehmigung mit der Begründung, er habe wegen seiner humanistischen Überzeugungen und seines Bruchs mit dem Islam in seinem Heimatland Morddrohungen erhalten, besonders auch aus seinem eigenen familiären Umfeld. Er fürchtete, im Fall einer Abschiebung getötet zu werden. Eine berechtigte Angst, denn Humanismus gilt in Pakistan (aber auch in einigen anderen Ländern) als Blasphemie und kann sogar mit dem Tod bestraft werden. In der Praxis wurden pakistanische Humanisten meist von einem Selbstjustiz übenden Mob getötet, während die Behörden wegschauten. Ein berüchtigter Fall ereignete sich in jenem Jahr 2017. Der Student Mashal Khan, der in sozialen Medien als «der Humanist» auftrat, wurde von einem Mob aus Mitstudenten zu Tode geprügelt.[6]
Als Mitarbeiter des britischen Innenministeriums Hamza im Rahmen des Verfahrens für seine Aufenthaltsgenehmigung befragten, forderten sie ihn auf, den Begriff Humanismus zu definieren. Hamza sprach von den Werten aufklärerischer Denker des 18. Jahrhunderts. Eine ausgezeichnete Antwort, denn das aufklärerische Denken war humanistisch in einer Weise, die mehreren Definitionen der Humanist Society von Thurmarsh entspricht. Ob aus Unwissenheit oder weil sie Gründe brauchten, um seinen Antrag abzulehnen, wollten sie von ihm den Namen eines antiken griechischen Philosophen – Platon oder Aristoteles – hören. Was merkwürdig ist, denn in Büchern über Humanismus werden Platon und Aristoteles kaum erwähnt, und das aus gutem Grund, denn sie waren in vieler Hinsicht nicht besonders humanistisch. Das britische Innenministerium jedoch kam zu dem Schluss, Hamza sei kein Humanist, und lehnte seinen Asylantrag ab.
Die Organisation Humanists UK und andere Sympathisanten nahmen sich des Falls an. Sie wiesen auf die falsche Auswahl der Philosophen hin[7] und argumentierten, Humanismus sei ohnehin kein Glaubenssystem, das sich auf einen Kanon von Autoritäten stütze.[8] Ein Humanist müsse nicht über bestimmte Denker Bescheid wissen, so wie man beispielsweise von einem Marxisten erwarten könne, dass er über Marx Bescheid weiß. Humanisten lehnen es oft sogar ganz ab, sich einer ideologischen «heiligen Schrift» verpflichtet zu fühlen. Mit so viel Unterstützung und starken Argumenten erhielt Hamza im Mai 2019 schließlich doch noch das Bleiberecht. Später wurde er Vorstandsmitglied der Humanists UK. Nach Hamzas Erfolg müssen Beamte des britischen Innenministeriums, die Asylanträge zu prüfen haben, einen Einführungskurs in humanistisches Denken absolvieren.[9]
Humanismus ist also etwas Persönliches, doch der Begriff hat so viele Bedeutungen und Implikationen, dass er nicht auf die Theorie oder Praxis einer bestimmten Person bezogen werden kann. Außerdem haben sich Humanisten bis vor kurzem nur selten zu offiziellen Organisationen zusammengeschlossen und oft sogar nicht einmal die Bezeichnung Humanisten für sich in Anspruch genommen. Selbst wenn sie sich glücklich schätzten, umanisti zu sein, verwendete bis ins 19. Jahrhundert keiner von ihnen «Humanismus» im Sinn eines allgemeinen Begriffs oder einer allgemeinen Praxis. (Es hat etwas angenehm Humanistisches, dass die Menschen dem Begriff um ein paar Jahrhunderte voraus sind.) Es erscheint alles ein bisschen nebulös – und doch glaube ich, dass es so etwas wie eine kohärente, von allen geteilte humanistische Tradition gibt und dass es sinnvoll ist, deren Vertreter in einem gemeinsamen Rahmen zu betrachten. Sie sind durch verschiedenfarbige, aber bedeutsame Fäden miteinander verbunden. Diese Fäden möchte ich in dem vorliegenden Buch nachverfolgen – und ich lasse mich dabei von einem anderen großen humanistischen Satz von E. M. Forster leiten: «Only connect!»
So lautet das Motto und Mantra seines 1910 erschienenen Romans Howards End, und Forster meinte damit ein ganzes Spektrum von Dingen: dass wir auf das schauen sollten, was uns verbindet, statt auf das Trennende; dass wir versuchen sollten, die Sicht anderer Menschen auf die Welt genauso wertzuschätzen wie unsere eigene; und dass wir die durch Selbstbetrug oder Heuchelei verursachte innere Zersplitterung unserer selbst vermeiden sollten. Ich stimme all dem zu – und nehme es als Ermunterung, eine Geschichte des Humanismus im Geist des Verbindenden und nicht des Trennenden zu erzählen.
Im persönlich geprägten Geist von E. M. Forster werde ich auch mehr über Humanisten als über Ismen schreiben. Ich hoffe, meine Leserinnen und Leser lassen sich – wie ich – faszinieren und manchmal inspirieren von diesen Geschichten über die Abenteuer, Auseinandersetzungen, Bemühungen und Beschwernisse der Humanisten in einer Welt, die ihnen oft mit Unverständnis oder Schlimmerem begegnet ist. Einige machten zwar gute Erfahrungen und fanden beneidenswerte Nischen in einem akademischen oder höfischen Umfeld, konnten aber ihre Position nur selten lange behalten. Andere führten ein wechselvolles und schwieriges Leben als Außenseiter. Über die Jahrhunderte hinweg waren Humanisten gelehrte Exilanten oder Wanderer, die von ihren geistigen und sprachlichen Fähigkeiten lebten. In der frühen Neuzeit gerieten einige von ihnen in die Fänge der Inquisition oder anderer Institutionen, die sie wegen Ketzerei verfolgten. Andere verheimlichten, was sie wirklich dachten, um sich zu schützen, manchmal so erfolgreich, dass wir es bis heute nicht wissen. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein konnten nichtreligiöse Humanisten (oft «Freidenker» genannt) verunglimpft, eingesperrt und entrechtet werden. Im 20. Jahrhundert wurde ihnen verboten, sich frei zu äußern. Sie wurden von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen, strafrechtlich verfolgt und ins Gefängnis gesteckt. Und noch im 21. Jahrhundert haben Humanisten unter all dem zu leiden.
Der Humanismus provoziert heftige Reaktionen. Es geht um den menschlichen Faktor, aber der ist kompliziert und betrifft jeden von uns in seinem tiefsten Inneren: das Menschsein ist ein unergründliches Rätsel und eine beständige Herausforderung. Da so vieles von unseren Vorstellungen über uns selbst abhängt, ist es nicht verwunderlich, dass Menschen, die sich offen zu humanistischen Ansichten bekennen, leicht zu Opfern werden können, vor allem in Situationen, in denen religiöse oder politische Konformität mit allen Mitteln durchgesetzt wird. Doch langsam, leise und immer wieder von Rückschlägen begleitet, haben diese unbeugsamen Humanisten über Generationen hinweg ihre Ansichten mit Eloquenz und Verstand vorgetragen, so dass ihre Ideen heute in vielen Gesellschaften verbreitet sind, ob sie als humanistisch erkannt werden oder nicht.
Die Personen, die wir in diesem Buch kennenlernen werden, lebten in einer Zeit, als der Humanismus allmählich die Gestalt annahm, in der wir ihn heute kennen. Die Geschichte, die ich erzähle, umfasst im Wesentlichen siebenhundert Jahre, vom 14. Jahrhundert bis heute. Die meisten (nicht alle) Personen, die in diesem Buch auftauchen, haben in dieser Zeit gelebt, und die meisten (nicht alle) waren Europäer. Ich habe meine Geschichte auf diesen Zeitraum begrenzt, weil er eine Menge interessante Ereignisse aufweist, aber auch, weil er eine gewisse Kontinuität garantiert. Viele, von denen ich erzähle, wussten, was die anderen geschrieben hatten, und reagierten darauf, auch wenn sie einander nicht persönlich kannten. Der historische und geographische Ausschnitt, den ich gewählt habe, hilft, Grundformen des humanistischen Denkens zu skizzieren und ihre Entwicklung nachzuverfolgen.
Aber auch der größere Zusammenhang soll im Blick behalten werden: die breitere und umfassendere Geschichte des humanistischen Lebens und Denkens überall auf der Welt. Humanistisches Gedankengut hat sich in vielen Kulturen und Epochen entwickelt. Ich bin sicher, dass es in der einen oder anderen Form existiert, seit unsere Spezies begonnen hat, über sich selbst nachzudenken und ihre Optionen und ihre Verantwortung in dieser Welt zu erwägen.
Betrachten wir also, bevor wir anfangen, diesen größeren Horizont und erkunden einige humanistische Schlüsselideen.
Beginnen wir mit der ersten von den Thurmarshianern genannten Variante, dass das menschliche Leben nicht übernatürlich, sondern irdisch ist. Von allen Möglichkeiten, die auf dieser Sitzung zur Sprache kommen, lässt sich diese historisch am weitesten zurückverfolgen. Die erste uns bekannte Darlegung materialistischer Ansichten stammt aus Indien, aus der Cārvāka-Schule, die bereits vor dem 6. Jahrhundert v. Chr. von dem Denker Bṛhaspati gegründet wurde. Ihre Anhänger glaubten, dass mit dem Tod unseres Körpers auch wir selbst enden.[10] Der Philosoph Ajita Kesakambalî wurde mit den Worten zitiert:
Aus den vier Hauptstoffen hier ist der Mensch entstanden; wenn er stirbt, geht das Erdige in die Erde ein, in die Erde über, geht das Flüssige in das Wasser ein, in das Wasser über, geht das Feurige in das Feuer ein, in das Feuer über, geht das Luftige in die Luft ein, in die Luft über, in den Raum zerstreuen sich die Sinne. […] Seien es Toren, seien es Weise: bei der Auflösung des Körpers zerfallen sie, gehn zugrunde, sind nicht mehr nach dem Tode.[11]
Ein ähnlicher Gedanke taucht hundert Jahre später in der Küstenstadt Abdera im nordöstlichen Griechenland auf, der Heimat des Philosophen Demokrit. Demokrit lehrte, dass alle Entitäten in der Natur aus Atomen bestehen, unteilbaren Teilchen, die sich auf verschiedene Weise zu all den Objekten zusammensetzen, die wir jemals berührt oder gesehen haben. Und auch wir selbst bestehen aus diesen Teilchen, geistig wie körperlich. Solange wir leben, verbinden sie sich zu unseren Gedanken und Sinneserfahrungen. Wenn wir sterben, zerstreuen sie sich – und deshalb enden auch wir.
Ist das humanistisch? Ist es nicht einfach nur deprimierend? Nein; es hat, ganz im Gegenteil, ermutigende und tröstliche Folgen für unser Leben. Wenn nichts von mir in einem Leben nach meinem Tod weiterexistiert, hat es keinen Sinn, in Angst zu leben und mir Sorgen zu machen, was die Götter mir antun oder welche Qualen oder Abenteuer mich erwarten könnten. Seine Theorie der Atome machte Demokrit so heiter und unbeschwert, dass er als «lachender Philosoph» in die Geschichte einging. Von kosmischer Furcht befreit, konnte er über menschliche Schwächen lachen, statt sie, wie andere, zu beweinen.
Porträt Demokrits nach einem Kupferstich
Demokrit gab seine Ideen an andere weiter. Zu denen, die sie aufgriffen, gehörte Epikur, der mit seiner Schule in Athen, dem «Garten», eine Gemeinschaft von Schülern und gleichgesinnten Freunden gründete. Die Epikureer suchten ihr Glück hauptsächlich in der Pflege von Freundschaften, in einer einfachen Ernährung mit einem porridgeartigen Brei und in der Kultivierung heiterer Gelassenheit. Ein Schlüsselelement dieser Gelassenheit war, wie Epikur in einem Brief schrieb, die Vermeidung «jener falschen Vorstellungen über die Götter und den Tod, die die Hauptquelle geistiger Störungen sind».[12]
Dann gab es noch Protagoras, den mit dem «menschlichen Maß». Er stammte ebenfalls aus Abdera und kannte Demokrit persönlich. Seine Aufforderung, alles mit dem menschlichen Maß zu messen, wurde schon zu seiner Zeit als beunruhigend empfunden. Aber noch berüchtigter war er wegen seines Buchs über die Götter, das offenbar auf folgende überraschende Weise begann:
Über die Götter kann ich nichts wissen, weder dass sie sind noch dass sie nicht sind. Vieles macht dieses Wissen unmöglich, so ihre Unsichtbarkeit und die Kürze menschlichen Lebens.[13]
Nach einem solchen Einstieg würde man gern wissen, was im Rest des Buches steht. Aber bereits dieser erste Satz ist ein Paukenschlag: Vielleicht gibt es Götter, vielleicht auch nicht, aber für uns sind sie zweifelhafte und unauffindbare Wesen. Was auf diese Einleitung folgte, war wahrscheinlich die Feststellung, dass wir unser kurzes Leben nicht damit verschwenden sollten, uns über sie den Kopf zu zerbrechen. Wir sollten uns mit unserem irdischen Leben beschäftigen, solange es dauert. Das ist eine andere Art zu sagen, dass das richtige Maß für uns das menschliche ist.
Wir wissen nicht, wie das Buch weiterging, weil außer diesen wenigen Zeilen nichts davon erhalten ist – und wir können uns gut vorstellen, warum. Der Biograph Diogenes Laertios berichtet, dass Protagoras, sobald sein Werk über die Götter erschienen war, «von den Athenern verbannt wurde; seine Bücher, die durch einen Gerichtsboten bei allen Besitzern wieder eingesammelt worden waren, hat man auf der Agora verbrannt».[14] Auch von dem, was Demokrit und die Denker der Cārvāka-Schule geschrieben haben, ist nichts direkt überliefert, vielleicht aus ähnlichen Gründen. Von Epikur kennen wir einige Briefe, doch seine Lehre wurde sehr viel später von dem römischen Dichter Lukrez in Versform gebracht. Auch Lukrez’ langes Gedicht mit dem Titel Über die Natur der Dinge (De rerum natura) wäre fast verloren gegangen, aber eine spätere Abschrift überdauerte in einem Kloster, wo sie im 15. Jahrhundert von humanistischen Büchersammlern gefunden und erneut verbreitet wurde. Trotz dieser fragilen Momente und fast vollständigen Verluste haben also Demokrits Ideen bis heute überlebt – und konnten von der amerikanischen Schriftstellerin Zora Neale Hurston in ihren 1942 erschienenen Memoiren Dust Tracks on a Road in die Worte gefasst werden:
Wozu Furcht? Der Stoff meines Seins ist Materie, stets im Wandel begriffen, stets in Bewegung, aber nie verloren. Wozu also Konfessionen und Religionen, die mir den Trost versagen, den sie all meinen Mitmenschen schenken? Der weite Gürtel des Universums macht Fingerringe entbehrlich. Ich bin eins mit dem Unendlichen und brauche keine andere Gewissheit.[15]
Die Tradition lebt auch in einer Kampagne aus dem Jahr 2009 im Vereinigten Königreich weiter, die von der British Humanist Association (jetzt Humanists UK) unterstützt wurde. Die auf Bussen und anderswo plakatierte Botschaft gab die geistige Gelassenheit im Sinne Demokrits wieder: «Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Hör also auf, dir Sorgen zu machen, und genieße dein Leben.» Die Idee zu dieser Kampagne stammte von Ariane Sherine, einer jungen Schriftstellerin und Comedian. Nachdem sie Busse mit der Werbung einer evangelikalen Organisation gesehen hatte, deren Website den Sündern ewige Höllenqualen prophezeite, wollte sie eine andere, beruhigende Botschaft anbieten.[16]
Zora Neale Hurston, um 1935
Die Verlagerung des Schwerpunkts auf das Hier und Jetzt ist bis heute eines der Grundprinzipien moderner humanistischer Organisationen. Es wurde sogar als «Credo» oder Glaubensbekenntnis formuliert, was ganz unhumanistisch klingt. Der Verfasser war Robert G. Ingersoll, ein amerikanischer Freidenker (oder nichtreligiöser Humanist) des 19. Jahrhunderts. Sein Credo lautete:
Glück ist das einzige Gut. Die Zeit, um glücklich zu sein, ist jetzt. Der Ort, um glücklich zu sein, ist hier.
Und es endet mit der entscheidenden Zeile:
Der Weg, um glücklich zu sein, ist, andere glücklich zu machen.[17]
Dieser letzte Satz führt uns zu einer zweiten großen humanistischen Idee: Der Sinn unseres Lebens liegt in unseren Beziehungen und Bindungen zu anderen Menschen.
Prägnant formuliert wurde dieses Prinzip der Verbundenheit in einer Komödie von Publius Terentius Afer, der als Terenz bekannt ist. Sein Beiname Afer («der Afrikaner») bezieht sich auf seine Herkunft, denn er wurde, wahrscheinlich als Sklave, um 190 v. Chr. in oder unweit des nordafrikanischen Karthago geboren. Später erlangte er in Rom als Komödiendichter Berühmtheit. Eine seiner Figuren sagt – und ich gebe den lateinischen Text wieder, weil er immer noch oft im Original zitiert wird:
Homo sum, humani nihil a me alienum puto.
Oder:
Ich bin ein Mensch, und nichts Menschliches erachte ich als mir fremd.[18]
Der Satz ist eigentlich nur eine witzige Bemerkung. Die Figur, die ihn äußert, ist als neugieriger Nachbar bekannt, und der Satz ist seine Antwort auf den Vorwurf, er kümmere sich um Dinge, die ihn nichts angehen. Das Publikum hat sicher gelacht, weil es davon überrascht wurde und weil der Satz philosophischen Tiefsinn verspottet. Auch mich amüsiert die Vorstellung, dass ein Ausspruch, der seit vielen Jahrhunderten mit tiefem Ernst zitiert wird, ursprünglich aus einer Slapstickkomödie stammt. Und doch bringt er eine wichtige humanistische Überzeugung auf den Punkt: dass unser Leben mit dem unserer Mitmenschen verbunden ist. Wir sind von Natur aus gesellige Wesen, und wir alle können in den Erfahrungen anderer etwas von uns selbst erkennen, auch in den Erfahrungen von Menschen, die so ganz anders zu sein scheinen als wir selbst.
Ein ähnlicher Gedanke kommt vom anderen, südlichen Ende des afrikanischen Kontinents: ubuntu. Der Begriff stammt aus der Bantu-Sprache der Zulu und Xhosa, findet aber in vielen anderen südafrikanischen Sprachen eine Entsprechung. Er bezeichnet ein allumfassendes Netz von Beziehungen zwischen Menschen großer oder kleiner Gemeinschaften.[19] Erzbischof Desmond Tutu, in den 1990er Jahren nach dem Ende der Apartheid in Südafrika Vorsitzender der Wahrheits- und Versöhnungskommission, betrachtete neben seinen christlichen Grundsätzen ubuntu als Inspiration für seinen Ansatz. Ihm zufolge hatten die repressiven Beziehungen der Apartheid Unterdrücker und Unterdrückte gleichermaßen beschädigt und die natürliche Verbundenheit der Menschen untereinander zerstört. Seine Hoffnung war, dass ein Prozess in Gang gesetzt werden könnte, um diese Verbundenheit wiederherzustellen, statt sich allein darauf zu konzentrieren, begangenes Unrecht zu rächen. Seine Definition von ubuntu lautete: «Wir gehören in ein Bündel des Lebens. Wir sagen: ‹Ein Mensch ist ein Mensch durch andere Menschen›.»[20]
Auch die Tradition der konfuzianischen Philosophie, wiederum in einem anderen Teil der Welt, misst dem gemeinsamen Menschsein entscheidende Bedeutung zu. Meister Kong oder Kongzi, der in Europa als Konfuzius bekannt wurde, lebte etwa hundert Jahre früher als Demokrit und Protagoras und gab eine Fülle von Verbesserungsvorschlägen weiter. Nach seinem Tod 479 v. Chr. sammelten und erweiterten seine Schüler die Aussprüche ihres Meisters zu Fragen der Moral und der gesellschaftlichen Etikette, aber auch seine politischen Ratschläge und philosophischen Erkenntnisse. Daraus entstanden die Gespräche. Ein Schlüsselbegriff dieser Sammlung ist ren, was man mit Wohlwollen, Güte, Tugend, ethische Weisheit übersetzen kann – oder einfach mit «Humanität», die man kultivieren muss, wenn man ein vollständiger Mensch werden will.[21] Ren kommt der humanitas schon sehr nahe.
Als Konfuzius von seinen Schülern gebeten wurde, ren genauer zu erklären, und man ihn fragte, ob es einen Ausdruck gebe, an den man sich sein ganzes Leben lang halten könne, nannte er shu, ein Netzwerk der «Gegenseitigkeit». Shu bedeute: «Was du selbst nicht wünschst, füge andern nicht zu.»[22] Wenn einem das bekannt vorkommt, dann deshalb, weil dieser Grundsatz in religiösen und ethischen Traditionen weltweit zu finden ist. Manchmal wird er als Goldene Regel bezeichnet. Der jüdische Theologe Hillel der Ältere sagte: «Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora, und alles andere ist nur die Erläuterung. Geh hin und lerne sie.»[23] Im hinduistischen Mahābhārata und im christlichen Neuen Testament wird es genau andersherum formuliert: Tu anderen, wie du willst, dass sie dir tun – eine Variante, die, wie George Bernard Shaw trocken feststellte, weniger verlässlich ist, weil «der Geschmack [der anderen] ein anderer sein könnte als deiner».[24]
All dies besagt, dass unser moralisches Leben in der Zugewandtheit zu anderen Menschen verwurzelt sein sollte. Es ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das unsere Ethik begründet, nicht das Überwacht- und Beurteiltwerden nach göttlichen Vorgaben. Die gute Nachricht ist, dass wir – meistens jedenfalls – diesen Funken der Zusammengehörigkeit spontan spüren, weil wir hochgradig sozialisierte Wesen sind, die bereits in einer tiefen Verbundenheit mit den Menschen in unserem Umfeld aufgewachsen sind.
Mengzi (Meister Meng oder Menzius), ein späterer Nachfolger des Konfuzius, machte dieses spontane Gefühl der Zusammengehörigkeit zur Grundlage einer Theorie der menschlichen Güte und Barmherzigkeit. Er fordert seine Leser auf, deren Ursprung in sich selbst zu suchen. Stell dir vor, du gehst spazieren und siehst, wie ein Kind ins Wasser fällt. Was empfindest du? Mit ziemlicher Sicherheit verspürst du den Impuls, hineinzuspringen und das Kind zu retten. Diesem Impuls geht keine Überlegung oder Berechnung voraus und auch kein Gebot. Es ist vielmehr die Veranlagung zu einem moralischen Leben, der Keim zum Guten, der freilich erst zu einer umfassenden Ethik entwickelt werden muss.[25]
Dass unser Potenzial auf diese Weise zum Keimen gebracht und kultiviert werden muss, ist ein weiterer Gedanke, der sich durch die gesamte humanistische Tradition zieht. Deshalb spielt die Erziehung eine wichtige Rolle. Als Kinder lernen wir von unseren Eltern und Lehrern, später entwickeln wir uns durch Erfahrung und vertieftes Studium weiter. Natürlich können wir auch ohne eine fortgeschrittene Bildung und Erziehung menschlich sein, aber um unser ren, unsere humanitas, bestmöglich zu verwirklichen, sind Unterstützung von außen und die Erweiterung unserer Perspektive von unschätzbarem Wert.
Eine gute Bildung ist besonders wichtig für all jene, die später politische und administrative Aufgaben übernehmen werden. Für Konfuzius und seine Anhänger sollten Führungskräfte und Staatsbeamte ihre Aufgaben im Zuge einer langen und eifrigen Lehrzeit erlernen und sich Redegewandtheit und Kenntnis der Traditionen ihres Berufs, aber auch der Literatur und Geisteswissenschaften aneignen. Solche kultivierten Menschen an der Spitze nützten der Gesellschaft insgesamt, sagte Konfuzius, weil tugendhafte Führungspersönlichkeiten andere dazu inspirieren können, ähnlichen Standards gerecht zu werden.[26]
Auch Protagoras in Griechenland glaubte an die Bildung, schließlich verdiente er gut (manche fanden, zu gut) als Wanderlehrer, der junge Männer auf eine politische oder juristische Laufbahn vorbereitete, indem er ihnen beibrachte, wie man überzeugend spricht und argumentiert. Er behauptete sogar, er könne ihnen helfen, «gut und trefflich» zu werden, also «einen guten und edlen Charakter zu erwerben, der in der Tat das Honorar wert ist, das ich verlange, und sogar noch mehr».[27]
Um neue Schüler zu gewinnen, erzählte Protagoras eine Geschichte, die zeigen sollte, warum Bildung elementar ist. Am Anfang, so sagte er, besaßen die Menschen keine besonderen Fähigkeiten – bis die Titanen Prometheus und Epimetheus den Göttern das Feuer stahlen, zusammen mit der Kunst des Ackerbaus, des Nähens, des Bauens, der Sprachfertigkeit und sogar der Religionsausübung. Der Mythos von Prometheus’ Diebstahl des Feuers und seiner Bestrafung wurde oft erzählt, aber Protagoras’ Version enthält eine neue Wendung. Als Zeus sieht, was geschehen ist, fügt er ein zusätzliches Geschenk hinzu: die Fähigkeit, Freundschaften zu schließen und andere soziale Bindungen zu knüpfen. Nun können die Menschen zusammenarbeiten. Aber noch besitzen sie lediglich die Fähigkeit dazu – es ist eine Saat, die erst aufgehen muss. Um ein blühendes und gut verwaltetes Gemeinwesen zu entwickeln, müssen sie diese Saat zum Wachsen bringen, indem sie Fertigkeiten erlernen, die sie einander beibringen. Das ist etwas, das wir selbst in die Hand nehmen müssen. Die Gaben, mit denen wir beschenkt wurden, sind nichts wert, wenn wir nicht herausfinden, wie wir sie gemeinsam nutzen können.[28]
Der Liebe der Humanisten zur Bildung liegt ein großer Optimismus hinsichtlich ihres Nutzens für uns zugrunde. Wir sind fürs Erste schon recht gut, aber wir können noch besser werden. Wir können auf unseren bisherigen Leistungen aufbauen – und uns gleichzeitig an dem erfreuen, was wir schon erreicht haben.
Und so wurde das Lob der menschlichen Vortrefflichkeit ein beliebtes Genre der humanistischen Literatur. Der römische Staatsmann Cicero schrieb in seinem Dialog De natura deorum einen Abschnitt über die menschliche Vortrefflichkeit, und andere folgten seinem Beispiel.[29] Einen Höhepunkt erreichte das Genre in Italien mit Werken wie Über die Würde und Erhabenheit des Menschen, die der Diplomat, Historiker, Biograph und Übersetzer Giannozzo Manetti in den 1450er Jahren verfasste. Seht nur, sagt Manetti, was wir Menschen an Schönem geschaffen haben. Seht euch unsere Bauwerke an, von den Pyramiden bis zu Filippo Brunelleschis Kuppel des Doms von Florenz und zu den vergoldeten Bronzetüren des Baptisteriums von Lorenzo Ghiberti gleich gegenüber. Oder die Malerei Giottos, die Dichtung Homers und Vergils oder die Geschichten Herodots und anderer. Ganz zu schweigen von den Philosophen, die die Natur erforscht haben, von den Ärzten oder von Archimedes, der die Bewegungen der Planeten studiert hat.[30]
Folgendes ist nämlich unser, also Menschenwerk, weil es offensichtlich von Menschen hervorgebracht worden ist: alle Häuser, alle großen und kleinen Städte, überhaupt alle Gebäude des Erdkreises. […] Unser sind die Bilder, unser die Skulpturen, unser sind die Künste, unser die Wissenschaften, unser ist die Weisheit. […] Unser sind alle Formen von verschiedenen Sprachen und Schriften.[31]
Manetti feiert die sinnlichen Freuden des Lebens, aber auch die subtileren Genüsse, die sich aus der vollständigen Nutzung unserer geistigen und spirituellen Fähigkeiten ergeben. Wie viel Freude, schreibt er, macht uns doch unsere Fähigkeit, uns das, «was wir mit einem speziellen Sinn erfasst haben, geistig vorzustellen, zu ordnen, einzuschätzen, ins Gedächtnis einzuprägen und zu verstehen».[32] Manetti lässt das Herz des Lesers vor Stolz höher schlagen – aber es sind unsere Aktivitäten, die er lobt, und das soll uns anspornen, noch besser zu werden, statt uns zurückzulehnen und in dem Erreichten zu schwelgen. Wir sind im Begriff, eine zweite, menschliche Schöpfung zu gestalten, die Gottes Schöpfung ergänzt. Auch wir selbst sind ein solches Work in progress. Wir haben noch viel zu tun.
Manetti, Terenz, Protagoras, Konfuzius – sie alle schufen Stränge der humanistischen Tradition, über Jahrtausende hinweg und in unterschiedlichen Kulturen. Sie alle verbindet ein Interesse an dem, was Menschen zu tun imstande sind, und die Hoffnung, dass wir mehr tun können. Sie legen großen Wert auf Studium und Wissen, und sie vertreten eine Ethik, die sich auf die Beziehungen zu anderen und auf die irdische, sterbliche Existenz statt auf ein erhofftes Leben nach dem Tod stützt. Und ihnen allen geht es darum, Forsters Maxime «Only connect» zu folgen: um gut zu leben innerhalb unserer kulturellen und moralischen Netzwerke und als Teil jenes großen «Bündels des Lebens», aus dem wir alle hervorgehen und aus dem wir Sinn und Bedeutung schöpfen.
Doch humanistisches Denken umfasst noch sehr viel mehr, und wir werden in diesem Buch viele weitere Stränge und viele andere Humanisten kennenlernen. Doch zunächst muss eine andere, parallel laufende Geschichte erzählt werden.
Die humanistische Tradition wurde seit jeher von einem breiten und langen Schatten begleitet, den man als die antihumanistische Tradition bezeichnen könnte.
Während Humanisten die Elemente des menschlichen Glücks und der menschlichen Vortrefflichkeit benennen, zählen die Antihumanisten ebenso eifrig unser Elend und unsere Schwächen auf. Sie weisen auf unsere zahlreichen Defizite hin, auf die Unzulänglichkeit unserer Talente und Fähigkeiten, Probleme zu bewältigen und einen Lebenssinn zu finden. Antihumanisten missbilligen oft die Vorstellung, sich an irdischen Vergnügungen zu erfreuen, und plädieren stattdessen für eine radikale Umgestaltung unseres Lebens, entweder indem wir uns von der materiellen Welt abwenden oder indem wir unsere Ansichten – oder uns selbst – dramatisch verändern. In der Ethik halten sie Wohlwollen oder persönliche Bindungen für weniger bedeutsam als Gehorsam gegenüber den Vorschriften einer höheren Autorität, sei sie religiös oder säkular. Und statt unsere Spitzenleistungen als Ausgangspunkt für weitere Verbesserungen wertzuschätzen, neigen sie zu der Ansicht, der Mensch müsse vor allem erniedrigt werden.
Im konfuzianischen Denken zum Beispiel fand die von Mengzi vertretene Philosophie ihren Gegenpol in Xunzi (Hsün-Tse), der die menschliche Natur in ihrem ursprünglichen Zustand als «verabscheuenswürdig» bezeichnete. Sie könne nur durch Umgestaltung verbessert werden, in der Art eines Stellmachers, der Holz mit Wasserdampf erhitzt, um es in eine andere Form zu biegen.[33] Er und Mengzi waren sich einig, dass Bildung nützlich ist, aber Mengzi zufolge brauchen wir sie, um unsere natürliche Veranlagung zur Tugend zur Entfaltung zu bringen, während Xunzi meinte, wir bräuchten sie, um uns in eine ganz andere Form zu biegen.
Auch das Christentum bot beide Möglichkeiten an. Es gab frühe Christen, die extrem humanistisch waren. Für sie war das Lob des Menschen zugleich das Lob Gottes. Schließlich hat Gott uns so geschaffen. Der Theologe Nemesius von Emesa aus dem 4. Jahrhundert klingt sehr nach Manetti, wenn er schreibt: «Wer könnte alle Vorzüge dieses Lebewesens mit Worten ausmalen? Es durchquert die Meere, es erhebt sich in der Betrachtung zum Himmel, es erkennt die Bewegung der Sterne […], es verachtet die wilden Tiere und die Seeungeheuer, es weiß jede Wissenschaft, jede Kunst und Methode zu verbessern, es pflegt mit Fremden, mit welchen es will, schriftlichen Umgang.»[34] Doch ein paar Jahre später formulierte Nemesius’ einflussreicher Kollege, der Theologe Augustinus von Hippo, die Lehre von der Erbsünde, der zufolge (dank Adam und Eva) das Böse in uns verwurzelt ist und sogar Neugeborene sich in einem defizitären Zustand befinden, aus dem sie ihr Leben lang Erlösung suchen sollten.[35]
Den verheerendsten Angriff auf die menschliche Selbstwertschätzung führte in den 1190er Jahren Kardinal Lotario dei Segni, bevor er Papst Innozenz III. wurde, mit seinem Traktat Vom Elend des menschlichen Daseins. (Gegen diesen Traktat wandte sich später Manetti mit seiner Schrift, in der er versuchte, ihn Punkt für Punkt zu widerlegen.) Der Kardinal erzählt eine wirklich düstere Geschichte von der angeblich niederen und bösen Natur der menschlichen Existenz von der Empfängnis an. Vergesst niemals, warnt er, dass ihr in einem Moment der fleischlichen Begierde aus einem Klumpen Schleim, Staub und schmutzigem Samen hervorgegangen seid. Als Fötus im Mutterleib nährt ihr euch «vom Blut der Menstruation», das so abscheuerregend und unrein ist, dass «in der Berührung mit ihm die Früchte zu sprossen aufhören, Weingärten verdorren […] und Hunde, die davon essen, tollwütig werden». Dann, so fährt er fort, werdet ihr nackt oder, schlimmer noch, mit einem «hässlichen, mit Blut beschmierten Fell» bekleidet geboren. Ihr wachst heran zu der lächerlichen Gestalt eines umgedrehten Baumes, die Haare vergleichbar mit dessen Wurzeln, Kopf und Nacken mit dem Stamm, der Rumpf mit der Verlängerung des Stamms und die Beine mit den Ästen. Seid ihr stolz darauf, Berge zu besteigen, die Meere zu befahren, Steine zu behauen und zu glätten, um Edelsteine zu fertigen, Eisen oder Holz zu bearbeiten, um Häuser zu bauen, Kleider aus Fäden zu weben oder tiefgründig über das Leben nachzudenken? Das solltet ihr nicht, denn all das sind sinnlose Aktivitäten, die der Gier oder Eitelkeit entspringen. In Wahrheit ist das Leben Mühsal, Angst und Leid – bis zum Tod, nach dem eure Seele womöglich in der Hölle schmort, während euer Körper den Hunger der Würmer stillt. «Welch schändliche Wertlosigkeit des menschlichen Daseins, welch wertlose Schande!»[36]
Sinn und Zweck dieser Feier des Horrors ist es, uns wachzurütteln, damit wir die Notwendigkeit erkennen, einen anderen Weg einzuschlagen; damit wir uns von dem abwenden, was Augustinus den Menschenstaat genannt hat, und dem Gottesstaat zuwenden. Was wir in dieser Welt für Vergnügen und Errungenschaften halten, ist nur Eitelkeit. «Sucht keine irdische Zufriedenheit, erhofft nichts von den Menschen», schrieb sehr viel später der Mystiker und Mathematiker Blaise Pascal. «Euer wahres Gut liegt allein in Gott.»[37] In seinen Vorlesungen 1901–1902 analysierte der Philosoph William James, wie dieser zweistufige Prozess in der Religion abläuft. Da ist zuerst das Unbehagen, «das Gefühl, dass mit uns in unserem natürlichen Zustand irgend etwas nicht stimmt». Befreiung aus diesem Unbehagen bietet die Religion: «Die Befreiung besteht aus dem Gefühl, dass wir von der Unstimmigkeit geheilt werden, wenn wir mit den höheren Mächten in die richtige Verbindung treten.»[38]
Dies geschieht jedoch nicht nur in der Religion, sondern auch in der Politik. Im 20. Jahrhundert erklärten die Faschisten, mit der gegenwärtigen Gesellschaft stimme etwas nicht, was jedoch behoben werden könne, wenn das persönliche Leben den Interessen des Nationalstaats untergeordnet würde. Auch die kommunistischen Regime diagnostizierten Fehler im kapitalistischen System und schlugen vor, sie durch eine Revolution zu eliminieren. Auch wenn die neue Gesellschaft eine Zeitlang durch Anwendung von Gewalt gestützt werden müsse, werde die Bevölkerung in ein ideologisches gelobtes Land geführt und in einen Stand der Gnade versetzt, wo es keine Ungleichheit und kein Leid mehr gibt. Beide Systeme waren offiziell nicht theistisch, allerdings nur insofern, als sie Gott durch etwas ähnlich Transzendentes ersetzten: den nationalistischen Staat beziehungsweise die marxistische Theorie und einen auf den Führer konzentrierten Personenkult. Faschismus und Kommunismus nahmen den Menschen ihre Freiheiten und ihre Werte und boten ihnen dafür die Chance, sich auf eine höhere Sinnstufe zu erheben, auf die Stufe der «wahren» Freiheit. Wann immer politische Führer oder Ideologien das Gewissen, die Freiheit und das Denken realer Menschen mit dem Versprechen von etwas Höherem außer Kraft setzen, ist wahrscheinlich der Antihumanismus auf dem Vormarsch.[39]
Der Gegensatz zwischen Humanismus und Antihumanismus war also nie exakt identisch mit dem Gegensatz zwischen Religion und Zweifel. So wie es Atheisten gibt, die antihumanistisch sind, gibt es in den meisten Religionen nach wie vor humanistische Elemente, die vom Erbsünde-/Erlösungsmodell weit wegführen. Oft ist es ein Balanceakt. Selbst Innozenz III. beabsichtigte offenbar, nach seinem Traktat über das Elend des Menschen auch einen über die menschliche Vortrefflichkeit zu schreiben, hat es aber aufgrund seiner Hauptaktivitäten – der Ketzerverfolgung und der Aufrufe zum Kreuzzug – nicht geschafft. Wir Menschen haben einen langen Tanz mit uns selbst getanzt: Humanistisches und antihumanistisches Denken haben einander bekämpft, aber auch erneuert und beflügelt.
Oft findet man beides in ein und derselben Person. Ich habe ganz bestimmt beides in mir. Wenn es in der menschlichen Welt düster aussieht, wenn Krieg, Tyrannei, Fanatismus, Gier und Umweltzerstörung die Oberhand zu gewinnen scheinen, flucht die Antihumanistin in mir, weil die Menschen verdammt nochmal nicht gut sind. Ich verliere die Hoffnung. Wenn ich aber von Wissenschaftlerteams höre, die gemeinsam ein neues Weltraumteleskop entwickelt und auf die Reise geschickt haben, das imstande ist, uns weit entfernte Regionen des Universums so zu zeigen, wie sie vor 13,5 Milliarden Jahren – also relativ kurz nach dem Urknall – ausgesehen haben, denke ich: Was für außergewöhnliche Lebewesen wir doch sind, dass wir so etwas schaffen! Oder wenn ich die leuchtend blauen Glasfenster der Kathedrale von Chartres betrachte, die im 12. und 13. Jahrhundert von Künstlern geschaffen wurden: Was für eine Könnerschaft, was für eine Hingabe! Und wenn ich Zeugin kleiner oder großer Gesten der Freundlichkeit oder der Heldentaten werde, die Menschen jeden Tag füreinander vollbringen, werde ich zur unverbesserlichen Optimistin und Humanistin.
Ein solcher innerer Balanceakt ist gar nicht schlecht. Der Antihumanismus mahnt uns, nicht eitel oder selbstgefällig zu sein, und ruft uns unsere Schwächen und Schändlichkeiten in Erinnerung. Er mahnt uns, nicht naiv zu sein, und macht uns klar, dass wir und unsere Mitmenschen jederzeit etwas Dummes oder Böses tun können. Er zwingt den Humanismus dazu, sich immer wieder zu rechtfertigen.
Der Humanismus wiederum ermahnt uns, die Aufgaben unserer gegenwärtigen Welt nicht zugunsten des Traums von einem Paradies auf Erden oder anderswo zu vernachlässigen. Er hilft uns, den verführerischen Versprechungen von Extremisten zu widerstehen, und bewahrt uns vor der Verzweiflung, in die uns eine obsessive Beschäftigung mit unseren Defiziten stürzen kann. Er bewahrt uns vor einem Defätismus, der alle Probleme auf Gott, unsere Biologie oder historische Unausweichlichkeit schiebt. Er erinnert uns daran, dass wir für das verantwortlich sind, was wir aus unserem Leben machen, und drängt uns, unsere Aufmerksamkeit auf die irdischen Herausforderungen und unser gemeinsames Wohlergehen zu richten.
Dennoch bin ich meistens Humanistin und glaube, dass der Humanismus die bessere Fahne schwenkt.
Ich sage das mit Bedacht, denn Humanisten sind von Natur aus nur selten Fahnenschwenker. Aber wenn sie etwas auf eine Fahne schreiben würden, könnten es drei Prinzipien sein: freies Denken, Forschung und Hoffung. Je nach Spielart des Humanismus, die man vertritt, nehmen sie unterschiedliche Ausprägungen an – für einen Geisteswissenschaftler bedeutet «Forschung» etwas anderes als für den Verfechter einer nichtreligiösen Ethik –, doch in den vielen humanistischen Geschichten, denen wir auf den nächsten Seiten begegnen werden, tauchen alle diese Ausprägungen immer wieder auf.
Freies Denken: weil Humanisten oft als Leitprinzip ihres Lebens lieber ihr moralisches Gewissen, die Beweiskraft der Evidenz oder ihre soziale oder politische Verantwortung für andere wählen und nicht Dogmen, die sich nur auf Autoritäten berufen können.
Forschung: weil Humanisten an Studium und Bildung glauben und heilige Texte und andere als unanfechtbar geltende Quellen kritisch hinterfragen.
Und Hoffnung: weil Humanisten überzeugt sind, dass es – trotz all unserer Defizite während unseres kurzen Daseins auf der Erde – menschenmöglich ist, etwas Sinnvolles zu schaffen, sei es in Literatur und Kunst, in der historischen Forschung, in der Förderung wissenschaftlicher Erkenntnis oder in der Verbesserung des Wohlergehens der Menschen und anderer Lebewesen.
Während ich an diesem Buch gearbeitet habe, haben sich in der Welt düstere Entwicklungen vollzogen. Nationalistische und populistische Führer sind auf dem Vormarsch, die Kriegstrommeln werden gerührt, und es fällt schwer, nicht an unserer menschlichen und planetarischen Zukunft zu verzweifeln. Dennoch halte ich daran fest, dass diese Entwicklungen uns nicht dazu bringen sollten, das freie Denken, die Forschung oder die Hoffnung aufzugeben, im Gegenteil. All dies brauchen wir mehr denn je. Diese Überzeugung hat mich beim Schreiben dieses Buches geleitet.
Und nun – für den Fall, dass wir glauben, uns ginge es schlecht – wenden wir uns dem südlichen Europa des 14. Jahrhunderts zu. Inmitten von Wirren, Krankheit, Leid und Tod griffen ein paar Enthusiasten die Bruchstücke einer fernen Vergangenheit auf, um ganz neu anzufangen. Dabei erfanden sie auch sich selbst neu: Sie wurden die ersten großen literarischen Humanisten.
1
Das Land der Lebenden
Das 14. Jahrhundert
Petrarca und seine Bücher – Giovanni Boccaccio, Geschichtenerzähler und Gelehrter – für sie ist alles Griechisch – der zottelige Übersetzer Leontius Pilatus – die Pest – Tod und Trost – Beredsamkeit – Heilmittel gegen das Glück – eine Vision des Lichts
Hätte man die Wahl, würde man wahrscheinlich nicht im frühen 14. Jahrhundert auf der italienischen Halbinsel geboren sein wollen. Das Leben war unsicher, verfeindete Städte und politische Gruppierungen bekämpften einander regelmäßig. Der lang andauernde Konflikt zwischen der Partei der Guelfen und der Ghibellinen wurde zwar beigelegt, aber die siegreichen Guelfen spalteten sich in eine «weiße» und eine «schwarze» Fraktion, und so gingen die Auseinandersetzungen weiter. Rom, der historische Mittelpunkt der Christenheit, wurde von dem bedrängten Papst Clemens V. verlassen. Er floh vor seinen Feinden und verlegte den Hof nach Avignon, einem schlecht gerüsteten Städtchen jenseits der Alpen mit einem entsetzlichen Klima. Die Päpste blieben jahrzehntelang in Avignon, während Rom im Chaos versank und inmitten seiner überwucherten Ruinen buchstäblich vor sich hin vegetierte. Die Toskana wurde von Wetteranomalien und Hungersnöten heimgesucht. Und es sollte noch schlimmer kommen.
Doch irgendwie sammelte sich in diesem schwer geplagten Teil der Welt eine enorme literarische Energie. Im 14. Jahrhundert tauchten neue Generationen von Schriftstellern auf, die vom Geist des Aufschwungs und der Wiederbelebung erfüllt waren. Sie wollten über die Probleme ihrer Zeit, ja über das Fundament des Christentums hinaus zurückgehen und an die Autoren der römischen Welt anknüpfen, deren Werke in unterschiedlichem Maß in Vergessenheit geraten waren. Diese neuen Schriftsteller orientierten sich an einem alten Modell des guten Lebens, das auf Freundschaft, Weisheit, Tugend und der Kultivierung von sprachlicher Macht und Eloquenz beruhte. Aus diesen Elementen schufen sie eine eigenständige Literatur in einer Vielzahl von Gattungen. Ihre Waffe waren die studia humanitatis, die humanistischen Studien.
Anzeichen für ein wiedererwachtes Interesse an den humanistischen Studien hatte es bereits in den Jahrzehnten zuvor gegeben, vor allem bei dem kosmischen Visionär Dante Alighieri, dem Förderer des Toskanischen als Literatursprache und Meister der Kunst, sich an seinen Feinden zu rächen, indem er eine Hölle erfand und sie hineinsteckte. Der eigentliche Neuanfang jedoch begann erst eine Generation nach ihm, mit zwei Schriftstellern, die wie er aus der Toskana stammten: Francesco Petrarca und Giovanni Boccaccio. Sie waren mehr oder weniger die Erfinder dessen, was für die nächsten zwei Jahrhunderte der humanistische Lebensstil war – auch wenn sie sich selbst nicht als Humanisten bezeichneten. Der Begriff umanisti kam erst später in Gebrauch, aber Petrarca und Boccaccio schufen dessen Profil, und so erscheint es angemessen, sie als solche zu bezeichnen.
Ihr erster Schritt auf diesem Weg war die Rebellion gegen den Brotberuf, den ihre Väter für sie vorgesehen hatten. Bei Petrarca war es die juristische Laufbahn, Boccaccio hatte die Wahl zwischen Kaufmann und Kirche. Unabhängig voneinander entschieden sich beide für einen neuen Weg: das literarische Leben. Eine jugendliche Gegenkultur kann verschiedene Formen annehmen. Im 14. Jahrhundert konnte es bedeuten, viel Cicero zu lesen und eine Büchersammlung aufzubauen.
Der ältere von beiden war Petrarca. Er wurde 1304 in Arezzo geboren, nicht in Florenz, aus dem seine Eltern als Anhänger der «Weißen» fliehen mussten, als die schwarzen Guelfen die Macht übernahmen. Zu denen, die die Stadt verließen, gehörte auch Dante, gleichfalls ein weißer Guelfe. Weder Dante noch Petrarcas Eltern kehrten jemals wieder nach Florenz zurück.
Petrarca, Kupferstich von Raffaele Morghen, um 1803
Petrarca wurde also bereits als Exilant geboren. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er teils auf der Flucht, teils an Orten, wo die Familie ein paar Monate oder Jahre blieb, bevor sie weiterzog. Dabei erlebte er einige Abenteuer. Als Säugling wäre er auf einer dieser Reisen fast ertrunken. Ein Diener, der ihn beim Überqueren eines Flusses wie ein Bündel auf dem Arm trug, wurde von seinem strauchelnden Pferd abgeworfen und hätte Petrarca fast fallen lassen. Später hätte die Familie in den gefährlichen Gewässern vor Marseille beinahe Schiffbruch erlitten. Sie überlebten und gelangten nach Avignon, wo Petrarcas Vater eine Stelle am päpstlichen Hof fand. Sie ließen sich in der Nähe nieder, und hier wuchs Petrarca auf: unweit einer Stadt, die er überhaupt nicht mochte, obwohl er als junger Mann das Nachtleben durchaus genoss. Jahre später erinnerte er in einem Brief an seinen jüngeren Bruder daran, wie sie schicke, parfümierte Kleider anprobierten und «die gefälligen Locken» überprüften, bevor sie ausgingen, um sich zu amüsieren.[1]
Petrarcas Vater war Notar, und so lag es nahe, dass auch sein Sohn eine juristische Karriere anstrebte. Aber Petrarca hasste das Jurastudium. Während er vorgab, zuerst in Montpellier und dann in Bologna fleißig zu studieren, steckte er einen Großteil seiner Energie in das Sammeln von Büchern. Der Buchdruck war noch lange nicht erfunden, und die einzige Möglichkeit, an Lesestoff zu gelangen, bestand darin, Manuskripte zu kaufen, zu erbetteln, zu leihen oder abzuschreiben – was er eifrig tat.
Einen Rückschlag erlitt er, als sein Vater die erste bescheidene Handschriftensammlung seines Sohnes ins Feuer warf, vermutlich in der Hoffnung, dass dies dem jungen Mann helfen würde, sich auf sein Jurastudium zu konzentrieren. Doch im letzten Moment lenkte Petrarcas Vater ein und rettete immerhin zwei Bücher aus den Flammen: Ciceros Werk über Rhetorik, das für eine juristische Laufbahn ohnehin nützlich sein konnte, und einen Band mit Gedichten Vergils. Petrarca durfte sie als Lektüre für seine Mußestunden behalten.[2] Beide Autoren blieben Sterne am Himmel Petrarcas und wurden auch von späteren Humanisten verehrt: Vergil aufgrund seiner dichterischen Schönheit und seiner Neuerfindung der klassischen Legende, Cicero aufgrund seiner Überlegungen zu Moral und Politik und seiner eleganten lateinischen Prosa.
Zunächst fügte sich Petrarca. Er studierte und hielt seine Neigungen geheim, aber als er zweiundzwanzig Jahre alt war und sein Vater starb, brach er das Studium ab und kehrte nach Avignon zurück, um einen völlig anderen Weg einzuschlagen: den der Literatur. Dabei folgte er einem Muster, das er lebenslang beibehielt: Er übernahm Tätigkeiten im Umfeld mächtiger Gönner, die ihm finanzielle Sicherheit garantierten und ein schönes Haus (oder auch zwei) zur Verfügung stellten, in dem er wohnen konnte. Diese Gönner waren Adlige, Territorialfürsten oder kirchliche Würdenträger, um deretwillen er die niederen Weihen empfing. Zu seinen Aufgaben gehörten diplomatische Missionen und Sekretärsarbeiten, vor allem aber musste er gefällige, schmeichlerische, ermunternde oder tröstende Texte produzieren. Seine Hauptaktivität war das, was er ohnehin liebte: lesen und schreiben.
Er hat geschrieben, und wie! Er verfasste Abhandlungen, Dialoge und persönliche Geschichten, Kurzbiographien und Triumphe, lateinische Gedichte, tröstende Betrachtungen und scharfe Invektiven. Um sich und andere zu erfreuen, schrieb er Liebesgedichte in der Volkssprache und entwickelte und perfektionierte eine eigene Sonettform, die noch heute als Petrarca-Sonett bezeichnet wird. Viele dieser Verse waren an eine idealisierte Frau gerichtet, die er Laura nannte und die er, wie er sagte, am 6. April 1327 in einer Kirche in Avignon zum ersten Mal sah – ein Datum, das er auf den kostbaren Seiten eines Vergil-Manuskripts[3] festhielt. Sein schwärmerisches Schmachten für diese junge Frau, die so unerreichbar wie schwer fassbar war, inspirierte Generationen von Dichtern nach ihm.
Als Belohnung für seine Tätigkeit im Dienst von Gönnern in verschiedenen Städten erhielt Petrarca immer wieder die Möglichkeit zum Aufenthalt in attraktiven Häusern auf dem Land. Dies verschaffte ihm weitere Anregungen, denn er verbrachte diese kreative Zeit der Muße damit, in Wäldern und an Flussufern zu wandern, sich mit Freunden zu treffen oder einfach nur Zeit mit seinen geliebten Büchern zu verbringen. Mit Mitte dreißig kaufte er sich ein Haus im Dorf Vaucluse (heute Fontaine-de-Vaucluse) an der Quelle der Sorgue, nicht weit von Avignon entfernt. Später zog er sich nach Arquà in den Euganeischen Hügeln bei Padua zurück. Davor bewohnte er ein Haus in Garegnano bei Mailand, das an einem anderen Fluss lag, wo er dem Gesang «von Vögeln jeder Art in den Zweigen» lauschen und im Garten botanische Experimente durchführen konnte, indem er Lorbeerbäume pflanzte.[4]
Lorbeerbäume zu pflanzen war eine mit Bedeutung aufgeladene Wahl, und das gilt wahrscheinlich auch für Laura als Pseudonym für seine große Liebe. In der Antike wurden Dichter mit Kränzen aus Lorbeerblättern gekrönt, um ihre Leistung zu würdigen. Der Brauch war nicht lange zuvor von dem Dichter Albertino Mussato aus Padua wiederbelebt worden, der sich selbst zum poeta laureatus gekrönt hatte.[5] Im Jahr 1341 erhielt Petrarca den Lorbeerkranz im Rahmen einer sehr viel offizielleren feierlichen Zeremonie in Rom, nachdem er einem mündlichen Examen zu seinem Versepos Africa über den römischen Feldherrn Scipio Africanus unterzogen und für würdig befunden worden war. Auch hatte er eine Rede zum Lob der Poesie zu halten. Er fühlte sich geschmeichelt, überglücklich und mit sich selbst zufrieden, war er sich doch der Bedeutung der diesem Brauch zugrundeliegenden antiken Tradition sehr bewusst. Petrarca war Eitelkeit nicht fremd, und manchmal verstieg er sich ins geradezu Pompöse. Er behauptete stets, den Ruhm zu verachten und der vielen Bewunderer, die an seine Tür (oder seine Türen) kamen, überdrüssig zu sein. Aber natürlich liebte er Ruhm und Ehre. Er wuchs ganz in seine Rolle hinein – und zu beachtlicher Größe, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Gestützt auf Berichte von Personen, die Petrarca gekannt hatten, beschreibt Giannozzo Manetti ihn als hochgewachsen und von einer «majestätischen» Aura.[6]
Trotz dieses Gestus der Erhabenheit hatten die wechselvollen Erfahrungen seiner frühen Lebensjahre in seiner Psyche Spuren hinterlassen. Neben Momenten der Selbstzufriedenheit erlebte er Episoden der Depression oder accidia, der Unfähigkeit, überhaupt etwas zu empfinden, ja sogar des Unglücklichseins. Manchmal erschien ihm alles undurchschaubar und ungewiss. In seinen Fünfzigern beschrieb er sich in einem Brief als «mir nichts zuschreibend, nichts bejahend, alles bezweifelnd, ausgenommen das, was zu bezweifeln ich für ein Sakrileg halte».[7]
Dann wieder klang er selbstsicherer, was vor allem daran lag, dass ihm seine Berufung zu einem literarischen Leben Sinn und Erfüllung schenkte. Obwohl literarisch versierte Sekretäre schon seit langer Zeit im Dienst der Kirche standen, füllte keiner die Rolle des literarischen Gelehrten mit solcher Hingabe aus wie Petrarca. Er scheint sich all der großen Vorbilder der klassischen Antike stets bewusst gewesen zu sein: eine ferne Epoche, doch gerade deshalb umso machtvoller und großartiger. In seinem Geist stellten sie ihm moralische Aufgaben.
Wenn er nicht an die Vergangenheit dachte, verknüpfte er sein Leben und seine Schriften mit dem Leben seiner Zeitgenossen. Er schuf sich einen großen Kreis interessanter Freunde: gebildete Männer, selbst mit literarischen Neigungen, manche von ihnen reich und mächtig. Unter ihnen ließ er seine Werke zirkulieren, so dass seine Schriften nicht nur von den Gönnern gelesen wurden, denen sie gewidmet waren. Dieser Kreis war für Petrarca ein wertvolles Netzwerk von Leuten, die wie er auf der Suche nach Büchern waren. Ging einer seiner Freunde auf Reisen, gab er ihnen eine Einkaufsliste mit. Eine solche Liste schickte er an Giovanni dell’Incisa, Prior des Klosters San Marco in Florenz, und bat ihn, sie allen seinen Bekannten in der Toskana zu zeigen: «Heiße sie, Tuszien durchforschen, die Schränke der Mönche und auch diejenigen anderer Bildungsbeflissener durchwühlen, ob irgendetwas auftauche, was geeignet wäre, meinen Durst zu stillen oder neu zu erregen.»[8] Mühsam kopierte und entliehene Handschriften waren auf gefährlichen, von Räubern bedrohten Straßen der italienischen Halbinsel unterwegs, und wenn sie nur geliehen waren, mussten sie ihren Weg wieder zurück finden. Petrarca war selbst oft auf Reisen, um berufliche, aber auch gesellschaftliche Verpflichtungen zu erfüllen, und wo er auch hinkam, machte er Halt, wenn er ein Kloster entdeckte. «Wer weiß», sagte er sich, «ob hier nicht etwas ist, was ich suche?»[9] Er ging hinein und bat, stöbern zu dürfen. Wenn er einen wertvollen Text fand, blieb er manchmal tage- oder wochenlang, um eine Abschrift anzufertigen.
Man muss sich das vorstellen: Jedes Wort eines jeden Buches, das man seiner Sammlung hinzufügen wollte, musste man von Hand abschreiben. Sogar Petrarca fand das anstrengend. In einem Brief erzählt er, wie er einen langen Cicero-Text, den ihm ein Freund geliehen hatte, abschrieb, was so langsam ging, dass er dabei versuchte, ihn im Kopf zu behalten. Seine Hand verkrampfte und schmerzte. Doch in dem Moment, als er glaubte, aufgeben zu müssen, kam er zu einer Stelle, wo Cicero erwähnte, dass auch er die Reden eines anderen kopiert hatte. «Als ich das gelesen hatte», schrieb Petrarca, «geriet ich in Hitze […] wie ein beschämter Soldat, den ein Wort seines hochgeschätzten Heerführers getadelt hat.»[10] Wenn Cicero das geschafft hatte, würde er es auch schaffen.
Zu anderen Zeiten schenkte ihm die Tätigkeit des Schreibens eher Trost als Erschöpfung. Es war fast wie eine Sucht. «Ich quäle mich immer und langweile mich, außer wenn ich schreibe», gestand er. Ein Freund, der sah, wie hart er an einem epischen Gedicht arbeitete, versuchte etwas, was wir heute als Intervention bezeichnen würden. Er bat Petrarca ganz unschuldig um den Schlüssel zu seinem Schrank. Dann griff er nach Petrarcas Büchern und Schreibmaterial, warf sie hinein, drehte den Schlüssel um und ging. Am nächsten Tag hatte Petrarca von morgens bis abends Kopfschmerzen, und am Tag darauf bekam er Fieber. Der Freund gab ihm den Schlüssel zurück.[11]
Oft schrieb Petrarca einen Text nicht einfach mechanisch ab. Er versuchte nicht nur, sich das Gelesene einzuprägen, sondern bemühte sich auch, seine wachsende Gelehrsamkeit praktisch anzuwenden. Als Wegbereiter der sorgfältigen Textedition nutzte er neue Handschriftenfunde, um vollständigere Fassungen antiker Texte zu erstellen und die verschiedenen Fragmente korrekt zusammenzufügen. Seine bedeutendste Leistung dieser Art war eine Ausgabe des Historikers Livius, dessen umfangreiches Werk über die Geschichte Roms nur in Teilen erhalten war. (Es ist immer noch unvollständig, auch wenn der Text heute weniger Lücken aufweist als zur Zeit Petrarcas.) Nachdem Petrarca in verschiedenen Manuskripten mehrere neue Abschnitte gefunden hatte, fügte er sie mit seinen Abschriften anderer vorhandener Teile in einem Band zusammen. Das so entstandene Buch kam in den Besitz eines großen Gelehrten des nachfolgenden Jahrhunderts: Lorenzo Valla, den wir noch genauer kennenlernen werden. Valla fügte in das von Petrarca erstellte Manuskript weitere hilfreiche Anmerkungen ein.[12] Dasselbe taten weitere Generationen von Humanisten. Sie erweiterten das Wissen, indem sie die Befunde nutzten, um vollständigere und genauere Texte zu erstellen. Es war Petrarca, der diesen Weg vorgab.
Die Autoren, mit denen er sich beschäftigte, schenkten ihm nicht nur Anstöße für seine editorische Tätigkeit, sondern auch für sein eigenes Schreiben. Besonders anregend war eine seiner frühesten Entdeckungen: Ciceros Rede Pro Archia. Sie wurde im Jahr 62 v. Chr. in Rom zur Verteidigung des Dichters Archias gehalten, dem als Einwanderer aufgrund einer Formalität das Bürgerrecht verweigert werden sollte. Ciceros Argument lautete, dass «das Studium der Literatur», das Archias fördere, der römischen Gesellschaft so viel Vergnügen und moralischen Nutzen bringe, dass man ihm dafür das Bürgerrecht verleihen müsse, Formalität hin oder her.[13