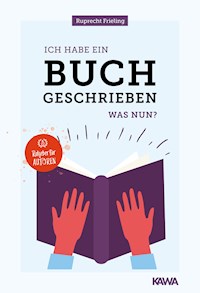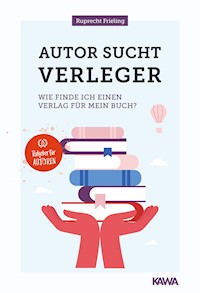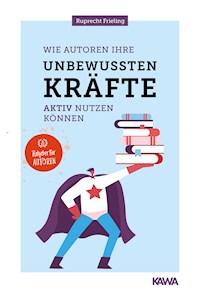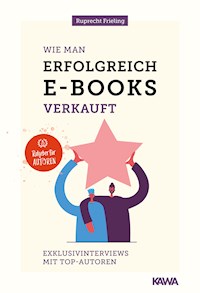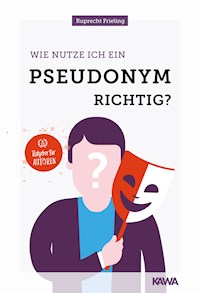
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampenwand Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Ratgeber für Autoren
- Sprache: Deutsch
Der Ratgeber »Wie nutze ich ein Pseudonym richtig?« schöpft aus 50 Berufsjahren im Verlagswesen. Beantwortet werden alle Fragen rund um offene und geschlossene Pseudonyme. Der Leser erfährt, welche Risiken am Pseudonym haften und wie man Künstlernamen in die Personalpapiere einträgt.Autor Ruprecht Frieling erweitert das Thema durch grundsätzliche Aspekte des Marketings. Er erklärt anschaulich, wie Markenbildung funktioniert und ein Markenname gebildet wird.Der populärwissenschaftlich verfasste Ratgeber begleitet den Leser schließlich auf einer kulturgeschichtlichen Reise durch die mysteriöse Welt der Tarn-, Deck- und Künstlernamen. Dabei werden faszinierende Geschichten enthüllt.Erfolgreiche jüngere Autoren kommen im vierten und letzten Teil zu Wort. Sie schildern in eigenen Worten, wie sie mit ihrem Pseudonym umgehen und was dies für ihren schriftstellerischen Lebensweg bedeutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An den Leser
In diesem Buch werden Bezeichnungen wie »Autor«, »Verleger«, »Buchhändler«, »Selfpublisher«, »Schriftsteller« usw. ausdrücklich nicht gegendert und stehen gleichberechtigt für männliche, weibliche oder diverse Geschlechter. Der Autor begründet dies mit dem Wohlklang der Worte im Konzert seiner Sprache.
Dieses Buch bietet keine Rechtsberatung. Es schildert letztlich Erfahrungen. In konkreten Fällen ist die Hilfe des dafür standesrechtlich vorgesehenen juristischen Personals angezeigt.
»Wie nutze ich ein Pseudonym richtig?« entstand im 1. Bücherhotel Deutschlands in Groß Breesen. Ich danke der Belegschaft für die Gelegenheit der Abgeschiedenheit und kreativen Ruhe.
Ruprecht Frieling
Es ist komplizierter,
ein gutes Pseudonym zu finden
als einen Kindernamen.
Ruprecht Frieling
1. TEIL:FAKTEN, FAKTEN, FAKTEN
PSEUDONYME SIND TARNKAPPEN
Zwergenkönig Alberich war abgrundtief hässlich. Selbst für wohlwollende Betrachter schaute er abstoßend aus. Sein Anblick erzeugte Abscheu, und kein Strahl der Sonne wollte ihn berühren. Doch der Schwarzalbe suchte die Nähe der Menschen und ersann dazu manche List.
Als dem Fiesling der Leichtsinn der Rheintöchter das Rheingold in den Schoß spielte, schlug Alberichs Stunde. Denn neben dem güldenen Ring der Macht schuf er aus dem Raubgold die legendäre Tarnkappe. Die gab ihm die Möglichkeit, seine Gestalt in jede gewünschte Form zu verwandeln.
Der Schwarzalbe bemächtigte sich mit der mythologischen Verhüllung einer geheimnisumwitterten Macht und nutzte sie für sich. Die im »Nibelungenlied« beschriebene Geschichte seiner Tarnkappe ist das früheste literarische Zeugnis vom Reiz der Verwandlung und des Unsichtbarwerdens.
Wen juckt es nicht in den Fingern, würde sich die Möglichkeit eröffnen, unerkannt umher zu wandeln? Erführe man dabei vielleicht das eine oder andere über sich und sein Werk, das man lieber nicht gehört hätte.
Pseudonyme sind Tarnkappen. Wir begegnen ihnen täglich. Vor allem im künstlerischen Bereich ist es weit verbreitet, sich einen anderen Namen zuzulegen. Einige machen das, um sich zu schützen. Die überwiegende Mehrheit aber sieht im eigenen Namen, dem Klarnamen, ein Hindernis, einen einprägsamen Markennamen aufzubauen und diesen vernünftig zu vermarkten.
Dieses Buch bietet alles, um sich zum Stichwort Pseudonym zu informieren, fortzubilden und mitreden zu können. Es liefert alles, das zum Stichwort wichtig zu wissen ist.
ZWEITNAMEN IM ZEITSTRAHL
»Eine Literaturgeschichte ohne das Rätsel der Pseudonyme – das wäre wie eine Suppe ohne Salz«, schreibt Jörg Weigand in der Einleitung seines Lexikons »Pseudonyme«. In 25-jähriger Detektivarbeit hat Weigand rund 9.000 Pseudonyme von etwa 2.200 Autoren aufgelistet. Wer sich für diese Veröffentlichung interessiert, findet das 1991 bei Nomos erschienene Werk antiquarisch.
Neunzig Jahre zuvor hatten Dr. Michael Holzmann und Dr. Hanns Bohatta im Akademischen Verlag Leipzig ein »Deutsches Pseudonymen-Lexikon« herausgegeben. Das 1906 lediglich in 700 nummerierten Exemplaren erschienene, 322 Seiten starke Werk verzeichnet circa 20.000 Tarnnamen allein innerhalb der deutschsprachigen Literatur. Es bietet einen schier unerschöpflichen Fundus, zudem jeweils die Quelle gelistet wurde.
Die Fleißarbeit der beiden Herren war eine Antwort auf Emil Wellers 1886 vorgelegtes »Lexicon Pseudonymorum. Wörterbuch der Pseudonymen aller Zeiten und Völker oder Verzeichnis jener Autoren, die sich falscher Namen bedienen«. Weller hatte seinerzeit auf Quellenangaben verzichtet, was eine Nachprüfung streckenweise unmöglich machte. Seine Zusammenstellung galt deshalb als unzuverlässiger Führer im Reich der Tarnnamen.
Ählich wie bei ihrem zuvor veröffentlichten »Deutsches Anonymen-Lexikon 1501–1850« mit 83.000 Einträgen in sieben Bänden bildeten auch hier die in Jahrzehnten zu privatem Zwecke angelegten Aufzeichnungen von Holzmann und Bohatta den Ausgangspunkt der Sammlung. Die beiden Autoren fühlten sich durch ihre Beschäftigung mit dem Anonymen-Lexikon zu der Arbeit aufgefordert und wollten jenes Werk durch dieses ergänzen.
Vor Emil Weller gab es keine Verzeichnisse von Deck- und Tarnnamen, die über die ersten Anfänge hinausgegangen wären. Nur der Vollständigkeit halber seien hier Joannis Rhodii mit »Dani auctorum suppositiorum catalogus Haraburgi« aus dem Jahre 1674 und Frid. Geisler »Disputatio de Noniinum mutatione et anonymis scriptoiibus Lipsiae 1669« genannt. Es gab auch Verzeichnisse über die Tarnnamen der Verfasser religiöser Werke, doch diese sind unvollständig und weisen selten Quellen nach.
WAS IST EIN PSEUDONYM?
Pseudonyme sind Fantasienamen, unter denen eine natürliche Person, meist ein Künstler oder Literat, öffentlich auftritt. Es besteht dabei keine Verpflichtung, seinen Klarnamen zu offenbaren.
Haben Sie schon mal ein Lied von Cherilyn Sarkisian gehört? Die berühmte Sängerin und Schauspielerin macht es uns leicht, indem sie den ersten Teil ihres Vornamens herauslöste und sich schlicht Cher nannte.
Einen Buchtitel von Charles Lutwidge Dodgson kennt jedes Kind. Pardon, ich hätte besser nach Lewis Caroll und seinem weltbekannten Kinderbuch »Alice im Wunderland« fragen sollen, denn so lautet Dodgsons Pseudonym.
Schon mal Samuel Clemens gelesen und gelacht? – Möglicherweise wissen Sie, dass dahinter der amerikanische Schriftsteller Mark Twain steckt. Der Humorist wurde vor allem als Verfasser der Bücher über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn bekannt.
Wagen wir einen vierten Versuch: Die Stimme von Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos war weltberühmt. Die griechisch-amerikanische Opernsängerin galt als eine der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts. Aber unter welchem Namen berührte die Stimme die Welt? – Es handelt sich um Maria Callas, als Institution nur »die Callas« geheißen.
Noch ein Namensrätsel zum Aufwärmen? Iny Lorentz zählt im Kreis der deutschen Autoren von historischen Romanen zu den bekanntesten Namen. Dabei ist Iny Lorentz ein Pseudonym des Autoren-Ehepaars Iny Klocke und Elmar Wohlrath. Zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen des Duos Iny Lorentz gehört vor allem die Wanderhuren-Reihe, die mit Alexandra Neldel in der Hauptrolle verfilmt wurde.
WARUM WERDEN PSEUDONYME VERWENDET?
Der spätere Erfolg eines Künstlers kann über die Prägnanz seines Namens mitbestimmt werden. Denken wir nur an John, Paul, George und Ringo – die legendären Beatles. In diesem wundervollen Fallbeispiel prägte der Name der Gruppe gleich den Namen der Musikrichtung, den Beat, und wurde damit in doppelter Hinsicht markenwirksam.
»Man muss aus dem eigenen Namen kein Heiligtum konstruieren,« meint Andreas Eschbach auf Befragen zum Thema. »Wenn man mit einem Namen geschlagen ist, der sich auf einem Buchdeckel nicht gut macht, sei es, weil er seltsame Assoziationen erzeugt, sei es, weil er zu blass ist, zu unauffällig oder was immer – dann kann man schon über einen Künstlernamen nachdenken. Ein gewisser Heinz Günther etwa war seinerzeit sicher gut beraten, sich den Mädchennamen seiner Mutter als Pseudonym zuzulegen. Der lautete übrigens Konsalik. Bleibt deutlich besser haften, oder?«
Zwischen Aufwertung und Täuschung
Sprachkritiker Wolf Schneider, einer der Päpste der deutschen Sprache, vermutet in seinem Buch »Missdeute Dich selbst!« folgende Gründe für eine Namensverkleidung:
»Erstens. Der echte Name war zu schwierig auszusprechen, zumal wenn man im Ausland wirkte: Jozef Konrad Korzeniowski wurde zu Joseph Conrad, der Filmregisseur Sean Alysius O’Fearna zu John Ford.
Zweitens. Der echte Name wurde als lächerlich empfunden. Für einen amerikanischen Folksänger ist es nicht günstig, Robert Zimmermann zu heißen, so nannte er sich Bob Dylan. Die italienischen Schriftsteller Suckert, Schmitz und Pincherle zogen es vor, sich in Malaparte, Svevo und Moravia umzutaufen, und Oskar Bschließmayer hieß als Schauspieler Oskar Werner. (Andere blieben bei der angeborenen Hässlichkeit wie der deutsche Dramatiker August von Kotzebue und der amerikanische Schriftsteller William Kotzwinkle.)
Drittens. Der echte Name wurde als nicht pompös genug empfunden. So nannten sich die Herren Bitzius, Filipepi, Fliegerl lieber Gotthelf, Botticelli, Stefan Heym und die Herren Stowasser, Dschugaschwili, Wiesengrund lieber Hundertwasser, Stalin und Adorno.
Viertens. Frauen wollten einen Mann vortäuschen: Madame Dudevand verwandelte sich in George Sand, Ms Evans wurde zu George Eliot.«
Autobiografie oder Roman?
Die Münsteraner Autorin, Lektorin und Dozentin Maike Frie schrieb zum Stichwort in dem lesenswerten Newsletter »The Tempest«: »Es gibt AutorInnen, die sehr erfolgreich und strikt ihr Pseudonym hüten wie Elena Ferrante oder Jean-Luc Bannalec. Da steht jeweils der Verlag hinter. Für mich wäre klar, dass dies nur für Bücher / Autoren funktionieren kann, an die Verlage eine sehr hohe Erwartungshaltung haben, da Lesungen ja automatisch unmöglich werden und alle anderen Maßnahmen persönlichen Marketings.`
Für mich wäre für die Namenswahl die entscheidende Frage, ob der Text tatsächlich als Autobiografie erscheint (dann sollten Autorenname und Name der Hauptfigur identisch sein) oder als Roman (dann kann der Künstlername Autorenname sein und die Hauptfigur einen ganz anderen Namen tragen).
Zum Schreiben würde ich erst einmal die Variante wählen, mit der ich mich am wohlsten fühle. Für eine Verlags- oder Agentursuche würde ich hingegen den Künstlernamen nehmen, wenn dieser in der Öffentlichkeit schon etabliert ist, und dann mit dem Verlag / der Agentur das weitere Vorgehen absprechen.«
Spielerei mit Identitäten
Sylvia Englert, die mal als Katja Brandis oder Siri Lindberg veröffentlicht, äußert sich wie folgt zum Thema:
»Schon als Jugendliche hatte ich für meine Geschichten ein AutorenPseudonym. Wahrscheinlich mag ich es einfach, mit Identitäten zu spielen. Als ich dann später tatsächlich Bücher bei Verlagen veröffentlichte, wählte ich für meine Sachbücher meinen richtigen Namen, Sylvia Englert, und später für meine Jugendromane den Namen Katja Brandis. Dahinter stand die Überlegung, dass niemand einen Fantasyroman von einer Sachbuchautorin lesen mag und auch niemand ein Sachbuch von einer Fantasyautorin!«
»Generell kann ich ein Pseudonym immer dann empfehlen, wenn man verschiedene Sachen schreibt und Gefahr läuft, die Leser zu verwirren. Außerdem kann man dadurch aus einer »Schublade« herauskommen, in die Leser, Buchhändler und Verlage einen gesteckt haben, in der man sich aber nicht mehr wohlfühlt. Nützlich ist es auch, wenn man nach ein paar gefloppten Projekten noch mal neu anfangen möchte, denn allzu schnell meinen die Buchhändler: »Nee, von dem kaufe ich nichts ein, der letzte Roman von dem ist überhaupt nicht gelaufen.« Dann einen neuen Namen zu wählen hat bei einer Autorenfreundin von mir prima funktioniert. Sehr praktisch. Ein Schauspieler hat diese Möglichkeit nicht.«
Verschönerung des Namens
Ein für das Publikum schwieriger, ungewöhnlicher oder fremdsprachlicher Name wird vereinfacht: Klaus Nakszyński nennt sich Klaus Kinski, Mladen George Sekulovich wird zu Karl Malden, Henry John Deutschendorf zu John Denver, Reginald Kenneth Dwight nennt sich Elton John.
Lange Namen werden verkürzt: Jürgen Udo Bockelmann wird Udo Jürgens, Peter Alexander Neumayer zu Peter Alexander.
Allerweltsnamen gestalten sich klangvoller: Der österreichische Schriftsteller und Übersetzer Gustav Meyer verschönert sich zu Gustav Meyrink, Marion Robert Morrison wird John Wayne und die Schauspielerin Michaela Schaffrath nannte sich in Auftritten als Pornodarstellerin Gina Wild.
Vermeidung von Eintönigkeit
In journalistischen Kreisen zählt die Verwendung von Pseudonymen zum Tagesgeschäft. Oft soll damit der Eindruck erweckt werden, eine größere Schar mitwirkender Autoren und Redakteure zu beschäftigen, als tatsächlich vorhanden sind. Anders ausgedrückt: Die Vielfalt von Autorennamen suggeriert dem Leser größere Vielfalt und Abwechslungsreichtum.
Kurt Tucholsky gehörte zu den gefragtesten und am besten bezahlten Journalisten der Weimarer Republik. In den 25 Jahren seines Wirkens veröffentlichte er in fast 100 Publikationen mehr als 3.000 Artikel, die meisten davon, etwa 1.600, in der Wochenzeitschrift Weltbühne, die er mit herausgab.
Tucholsky schrieb unter den Tarnnamen Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel. Der Autor warnte früh vor dem Nationalsozialismus und floh bereits vor der Machtergreifung 1929 nach Schweden. Zu Lebzeiten erschienen bereits sieben Sammelbände mit kürzeren Texten und Gedichten, die zum Teil dutzende Auflagen erzielten. Manche Werke und Äußerungen Tucholskys polarisieren bis heute, wie die Auseinandersetzungen um seinen Satz »Soldaten sind Mörder« bis in die jüngere Vergangenheit belegen.
Schutz vor beruflichen Nachteilen
Im Bereich der Fachbuchautoren sind Decknamen üblich. Sabine M. Kempa, ist bei der Schlüterschen Verlagsgesellschaft tätig. Sie betreut Autorinnen, die unter verdecktem Pseudonym schreiben. Den Grund dafür nannte sie in einem Interview mit der Lektorin Claudia Luz:
»Diese Veröffentlichungen sind persönliche Einschätzungen zu brisanten Themen des eigenen Berufsfeldes. Die Autoren geben darin viel von sich preis. Befürchten sie berufliche Nachteile, weil sie sich auf diese Weise äußern, kann ein Pseudonym eine Option sein. Und auch, wenn Text und Thema schlicht nicht zum bisherigen Profil passen.«
RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN DES PSEUDONYMS
Haarig wird es für einen namentlich getarnten Autor beim ersten Interview. Journalisten wollen gern hinter die Dinge schauen und wissen, wer hinter der aufgesetzten Fassade steckt. Treffen in den eigenen vier Wänden fallen damit flach, Hotels und Restaurants sind in einem derartigen Fall geeignete Plätze für ein Gespräch.
Je mehr Boulevard in einem Medium steckt, desto stärker bohrt ein Reporter, um an eine Homestory zu kommen, also den Autor in seinem intimen Umfeld zu erleben. Nur so lassen sich Details herauskitzeln, die eine Story interessanter macht als die der Konkurrenz. Das ist eine Situation, in der vieles schiefgehen kann, wie jeder weiß, der gelegentlich in Massenblätter schaut.
Berufsanfänger lassen besser die Finger davon und sich auf keine Homestory ein. Begründete Ausnahme wäre ein Vertrauensverhältnis zu dem jeweiligen Journalisten.
Heiß wird die Situation, wenn Bildberichterstattung geplant ist. Die Wirkung beim Leser ist größer als bei einem reinen Textbeitrag, deshalb ist der Autor daran besonders interessiert. Fotografen haben ihre eigene Sicht der Dinge und wissen, was ihr Auftraggeber will. In diesem Sinne machen sie einen Topjob. Ob das immer im Interesse des jeweiligen Interviewpartners ist, bezweifle ich aufgrund meiner Branchenkenntnis lebhaft.
Schwierig wird es bei der Weitergabe von Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Wer sich perfekt abschirmen will, muss für diese Situationen gerüstet sein. Dazu gehört letztlich eine entsprechende Bankverbindung, denn an wen sollen Honorare gezahlt werden, wenn ein Pseudonym gewählt wird?
Deshalb wird es in den meisten Fällen praktischer sein, den Tarnnamen offenzuhalten, denn es dauert meistens so oder so nicht lange, bis jemand den profanen Namen herausfindet. Lediglich in einigen wenigen Fällen, beispielsweise bei B. Traven, mussten Kohorten von Literaturwissenschaftlern nach dem Klarnamen des Autors von »Das Totenschiff« und anderen Bestsellern fahnden, bis das Rätsel endlich gelöst wurde.
Pseudonyme können zu lustigen Verwicklungen führen. Viele Gesprächspartner wissen nicht genau, wie sie den Träger eines offenen Pseudonyms ansprechen sollen. So kommt es zu einem bunten Durcheinander von Namen und Bezeichnungen. Mir ist es auf Messen wiederholt passiert, dass ich nicht mehr genau wusste, ob ich mit einem Klarnamen oder einem Pseudonym plauderte.
Bestsellerautorin Monika von Ramin kenne ich seit Jahrzehnten. Für mich war sie stets Monika. 2011 entwickelte sie ihr offenes Pseudonym Nika Lubitsch, und inzwischen spreche ich mit Nika, wenn wir uns schreiben oder telefonieren.
Auch bei öffentlichen Lesungen kann schon mal einiges durcheinanderrutschen. Ich habe Buchhändler erlebt, die im Moment der Ankündigung ihres abendlichen Gastes nicht wussten, wie sie diesen denn genau vorstellen sollten: unter Klarnamen, Pseudonym 1, Pseudonym 2 …
»Mit drei Namen zu jonglieren«, schreibt Autorin Katja Brandis zu diesem Aspekt, »macht das Leben wirklich nicht einfacher, zumal ich für alle drei Namen eine eigene Homepage brauche und pflegen muss«.
Wer bin ich, und wenn ja wie viele, fragt sich mit Richard David Precht vielleicht manch ein Leser. Der Begriff der multiplen Persönlichkeit fällt bisweilen in dem Zusammenhang.
Julia Kröhn veröffentlichte 2005 bei Random House ihren Erstling »Engelsblut« und ist seitdem unter den offenen Pseudonymen Kiera Brennan, Catherine Aurel, Sophia Cronberg, Carla Federico und Leah Cohn aufgetreten. Die experimentierfreudige Autorin veröffentlicht durchschnittlich zwei bis drei Bücher pro Jahr und begründet ihre vielen Tarnnamen so:
»Bei meinen Büchern ist es so, dass sie sich nicht nur hinsichtlich Genre oder Subgenre unterscheiden, also vom Inhalt her, sondern auch, was den Stil, den literarischen Anspruch, die Tonalität, die Happy End-Tauglichkeit anbelangt. Die vielen Namen bieten folglich eine Orientierungshilfe für recht unterschiedliche Zielgruppen und beugen enttäuschten Erwartungen vor. Zum anderen hatte ich schon immer den Anspruch, vom Schreiben leben zu können.