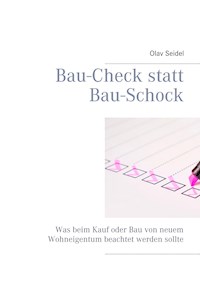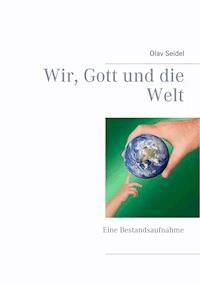
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben seit rund 200 Jahren über unsere Verhältnisse. Unsere Angst, etwas zu verpassen, wird es wahrscheinlich nicht zulassen, daran etwas zu ändern, dabei verpassen wir genau deshalb ganz Wesentliches. Welche Bedürfnisse hat der Mensch? Was kommt nach den fossilen Brennstoffen? Brauchen wir Religionen? In seiner gesellschaftskritischen Auseinandersetzung widmet sich Olav Seidel diesen und vielen weiteren aktuellen Fragen; er vermittelt einen Eindruck, wo wir heute stehen und welche Möglichkeiten uns bleiben, die Entwicklung der Welt positiv zu beeinflussen. Kompakt und gut verständlich vermittelt er für ein breites Publikum einen Überblick über die wesentlichen Themen unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Olav Seidel, 1961 in Hannover geboren, ist selbständiger Architekt, Dozent an der HWK-Osnabrück und veröffentlicht seit vielen Jahren Artikel zu gesellschaftlichen Themen. “Wir, Gott und die Welt“ ist sein erstes Sachbuch, in dem er sich mit den Fragen, die ihn seit Jahren bewegen, intensiv auseinandersetzt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Woher kommen wir?
Wo stehen wir heute?
Welche Bedürfnisse hat der Mensch?
Brauchen wir noch Gesellschaft(en)?
Wie alt werden wir?
Welche Macht haben die Medien?
Was unterscheidet uns Europäer von den US-Amerikanern?
Brauchen wir Datenschutz?
Wie moralisch sind wir noch?
Welche Rolle spielt die Familie heute noch?
Welche Rolle spielt die Bildung?
Was bedeutet das eigentlich, weise zu sein?
Wie organisieren wir uns?
Wozu gibt es Grenzen zwischen Ländern?
Was haben wir von der Politik zu erwarten?
Sollten wir Subventionen begrenzen?
Wie viel Infrastruktur brauchen wir?
Wie lassen sich Konflikte lösen?
Wohlstand – geht da noch was?
Brauchen wir Wachstum?
Macht und Geld
Sind wir satt?
Warum gibt es Geld?
Macht Geld glücklich?
Zuviel Geld verdirbt den Charakter, Gier verdirbt unsere Gesellschaft
Der Preis des Aufstiegs
Wie lebt „der Rest“ der Welt?
Folgen der Kolonialisierung
Nordafrika, Vorderasien und der Nahe Osten
Indien und China
Sind Flüchtlinge willkommen?
Warum geht es einigen Menschen besser als den meisten anderen auf der Welt?
Wie helfen wir den Entwicklungsländern?
Wie geht es weiter?
Wann geht das Licht aus?
Was kommt nach den fossilen Brennstoffen?
Welche Folgen hat der Lebenswandel der Menschen für Tiere und Pflanzen?
Wie entwickelt sich der gefürchtete CO2-Ausstoß?
Können wir die Entstehung von Müll deutlich reduzieren?
Wie verändert sich unser Klima?
Sind Werte unsere Rettung?
Brauchen wir Religionen?
Wie könnten Ansätze aussehen, nach denen sich die Religionen weiterentwickeln?
Was gibt es für Alternativen zur Religion?
Wie muss eine solche Weltordnung aussehen?
Sind das christliche Vaterunser und das Glaubensbekenntnis aktueller denn je?
Geht es auch ohne Kapitalismus?
Was bringt die Zukunft?
Danksagung
Quellenverzeichnis
Einleitung
„Das Einfache ist nicht immer das Beste.
Aber das Beste ist immer einfach.“
Heinrich Tessenow (1876–1950, Deutscher Architekt und Hochschullehrer)
Wir leben seit rund 200 Jahren über unsere Verhältnisse. Dies ist kein Vorwurf. Es ist menschlich. Es gibt auch wenig Hoffnung, dass sich daran grundsätzlich etwas ändern wird. Dabei wäre es durchaus möglich. Unsere Angst, etwas zu verpassen, wird es jedoch wahrscheinlich nicht zulassen, dabei verpassen wir genau deshalb ganz Wesentliches. Wir haben verlernt, den einfachen, aber grundlegenden Fragen des Lebens die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken. Für fast alle Probleme unserer Welt gibt es einfache Lösungen.
Wir selbst machen die Dinge kompliziert. Viele bedeutende Menschen, angefangen von den religiösen Führern (z.B. Jesus, Buddha), den Freiheitskämpfern (z.B. Gandhi, Nelson Mandela) bis hin zu den Führern unserer so gepriesenen Wirtschaft (z.B. Steve Jobs) waren bemüht, einfache Lösungen zu finden, die vielen einen größtmöglichen Nutzen bringen sollten.
Zu vielen Fragen gibt es unterschiedliche Lösungen. Manchmal können mehrere nebeneinander bestehen, häufig wird ein gleichberechtigter Kompromiss benötigt. Unsere Wahrheit muss nicht die der anderen sein, ohne dass eine der beiden Seiten falsch urteilt.
In diesem Sinne möchte ich die nachfolgenden Gedanken und Fakten verstanden wissen.
Woher kommen wir?
Wie die Sonne und andere Planeten auch, entstand die Erde vor rund 4.600.000.000 (4,6 Milliarden) Jahren. Das sind Zeiträume, die wir uns nur schwer vorstellen können. Deshalb werden auch die nachfolgenden Zahlen, deren Dimension besonders hervorgehoben werden soll, ausgeschrieben. Seit rund zwei Millionen Jahren bevölkert der Mensch die Erde – ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum, wenn man die Geschichte unserer Erde betrachtet. Über die weitaus längste Zeit unserer Erdgeschichte gab es also gar keine Menschen.
Die nachfolgenden Ausführungen sollen auch deutlich machen, in welch unglaublichem Tempo sich seitdem die Erde durch den Einfluss des Menschen verändert hat. Trotzdem hat es nach unserem Zeitempfinden recht lang gedauert, bis sich nennenswerte Veränderungen im Leben dieser Menschen entwickelt haben.
Erst vor 300.000 Jahren entdeckte der Mensch das Feuer für seine Nahrungszubereitung. Dadurch erweiterte sich seine Speisekarte (hauptsächlich um Pflanzen) erheblich, konnte er vorher doch viele Lebensmittel im rohen Zustand nicht verdauen. Dies ermöglicht es ihm, seine Energie, anstelle der Verdauung, seinem Gehirn bereitzustellen. Das Gehirn benötigt immerhin 25% der Körperenergie. Der Lebensraum des Menschen war klimatisch stark begrenzt. Er wurde durch die Jahreszeiten, die Wanderung der Tiere und den Wachstumszyklus der Pflanzen bestimmt.
Heute glauben wir, auf dem höchsten Stand unserer Entwicklung zu stehen und es ginge eher aufwärts. Doch Jäger und Sammler waren die intelligentesten Menschen der Geschichte. Sie wussten viel über die sie umgebenden Tiere und ihre Umwelt. Dies war für sie lebensnotwendig.
Sie waren äußerst geschickt, ernährten sich abwechslungsreich, hatten eine breite Auswahl an Lebensmitteln, hauptsächlich Obst und Gemüse, und das Fleisch der zu ihrem Speiseplan gehörenden Wildtiere hatte einen geringeren Fettgehalt als das der heutigen Nutztiere.
Wir dagegen stellen bei den Menschen in unserem Umfeld in den letzten Jahren einen zunehmenden Verlust praktischer Fähigkeiten fest. Heute gibt es ein großes, verfügbares theoretisches Wissen, aber der Einzelne kann damit im Alltag wenig anfangen. Wir ernähren uns bekanntermaßen trotz eines scheinbar reichhaltigen Angebots immer einseitiger und häufig ungesund.
Sobald die Jäger und Sammler ihre Kindheit überstanden hatten, waren sie selten krank und konnten bis zu 80 Jahre alt werden. An dieser Altersgrenze hat sich bis heute trotz aller medizinischen Möglichkeiten grundsätzlich nichts Wesentliches geändert, weshalb bezweifelt werden darf, dass sich die Lebenszeit eines Menschen, allen gegenteiligen Meinungen einiger Wissenschaftler zum Trotz, lebenswert wesentlich verlängern lässt. Überhaupt ist das Leben vieler moderner Menschen weniger lebenswert als das unserer frühen Vorfahren.
Dass die Jäger und Sammler schon so alt wurden, lag daran, dass sie, außer zu Hunden, wenig Kontakt mit Tieren hatten, auch nicht zu anderen Menschen, da sie meist in kleinen Gruppen unterwegs waren. Täglich waren sie rund 20 Kilometer in Bewegung.
Wir verbringen heute immer mehr Zeit sitzend vor dem Bildschirm, bewegen uns weniger und halten uns überwiegend in Gebäuden auf.
Mancher geht nur noch mit Mundschutz aus dem Haus.
Die Bewegung versuchen wir nach dem Feierabend nachzuholen, in dem wir, wieder in geschlossenen Räumen (vorwiegend Fitnesszentren), einseitige Übungen machen und anschließend möglicherweise noch unnötige, muskelaufbauende oder schlankmachende Präparate zu uns nehmen.
Jäger und Sammler haben vergleichsweise wenig gearbeitet. Sie arbeiteten kooperativ mit Freunden und Verwandten und teilten ihre Ressourcen innerhalb der Gruppe gleichmäßig auf, da sie keine Vorräte anlegen konnten. Privater Besitz hatte wenig Sinn.
Heute versucht jeder für sich das Maximum zu erlangen. Wir horten zahlreiche Besitztümer, von denen wir die wenigsten wirklich benötigen und die uns zusätzlich belasten. Gemeinschaft dagegen geht zunehmend verloren.
Aber es gab auch Konflikte unter unseren Vorfahren. Begegnungen mit anderen Gruppen verliefen auch damals oft blutig. Dies hatte meist persönliche Gründe, die sich gelegentlich zu kleinen Gemetzeln aufschaukelten. Kriege, wie wir sie heute kennen, gab es jedoch nicht. Sie erfordern politische Hierarchien, die es damals nicht gab.
Anführer, die anderen Gruppenmitgliedern Befehle erteilten, kannten sie nicht. Mitglieder, die sich über andere stellen wollten, wurden, wenn nötig, sogar getötet. Im Durchschnitt hatten die Jäger und Sammler vier Kinder, die ihre Frauen in großen Abständen gebaren.
Vor ca. 70.000 Jahren begann der Mensch damit, sich auf der Erde zu verbreiten und unterschiedliche Kulturen aufzubauen. Der Lebensraum wurde kleiner.
Die Bevölkerung begann zu wachsen und begab sich damit in eine Abhängigkeit, die bis heute unser Leben bestimmt. Eine Rückkehr zu den Lebensverhältnissen der Jäger und Sammler war nicht mehr möglich, da diese Lebensform die wachsende Bevölkerung nicht mehr hätte ernähren können. Der Mensch war in die entscheidende Falle getappt. Von nun an ging es um Wachstum.
Heute leben noch etwa fünf Millionen Menschen, z.T. unter unveränderten Umständen, in den tropischen Regenwäldern, wie in der Steinzeit. Ihr Lebensraum ist zunehmend gefährdet.
Mit Beginn der ortsgebundenen Landwirtschaft vor ca. 10.000 Jahren (ein Wimpernschlag in der Geschichte der Erde) änderte sich vieles und so manches wurde schlechter. Der Mensch wurde sesshaft, da er sich um seine Felder kümmern musste. Die Landwirtschaft erforderte Grundbesitz und ermöglichte Vorratshaltung. Geeignete Tiere und Pflanzen wurden domestiziert, was die Vielfalt der Nahrungsmittel verringerte und zu einer Reduzierung der Nährstoffe führte; Viehzucht entstand.
Die Bauern dieser Zeit wussten nur zu gut, dass sie die Tiere für ihre Zwecke ausbeuteten. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Religionen, die dieses Verhalten rechtfertigen sollten und dem Menschen das Recht gaben, über den Rest der Schöpfung zu herrschen.
Im Gegenzug wurden den Göttern Tiere geopfert1. Mit der Sesshaftigkeit stellten sich neue Aufgaben. Die Rücklagen an Nahrungsmitteln und der Grundbesitz mussten beschützt werden, da andernfalls die Gefahr bestand, dass sich an deren Erzeugung Unbeteiligte, Einzelne oder Gruppen außerhalb der eigenen Gemeinschaft dieser ermächtigten. Es kam zu ungleichen Besitzverhältnissen, die wiederum die Entstehung einer Herrscherkaste möglich machten.
An die Stelle gleichberechtigter, egalitärer Gruppen traten ähnliche Organisationen wie Staaten, die hierarchisch organisiert und verteidigt werden mussten. Es kam zu größeren und oft blutigen Auseinandersetzungen. Städte mit beengten und schmutzigen Lebensverhältnissen und erhöhtem Aufkommen von Abfall, Abwasser und Fäkalien hatten mit sich immer schneller ausbreitenden Krankheiten zu kämpfen. Die Haustiere, die oft in allernächster Nähe zu ihren Besitzern lebten, übertrugen neue Infektionskrankheiten. Die Lebenserwartung in den Städten stieg nicht etwa, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern sie fiel. Die vielen Menschen waren häufig schlecht ernährt und in der Folge kleinwüchsig. Ihre Verhältnisse besserten sich erst viele Generationen später, als die Betroffenen mehr Rechte erhielten und ihren Einfluss für die Verbesserung der Lebensverhältnisse geltend machen konnten.
Landwirtschaft war harte Arbeit. Die Ernährung wurde einseitiger.
Die Gehirne schrumpften wieder.
Kurz gesagt: Die Verhältnisse verschlechterten sich stetig. Aber es gab kein Zurück mehr. Trotzdem nahm die Landwirtschaft noch bis vor 600 Jahren lediglich 2% der Erdoberfläche in Anspruch, obwohl zwei Drittel der Weltbevölkerung Bauern waren. Die größten Siedlungen hatten meist nur wenige 100 Einwohner2. Heute müssen wir in den Ballungszentren die Menschen in vielen Ebenen übereinander in Hochhäuser unterbringen, da die Fläche nicht ausreicht.
Man versuchte, den zunehmenden Krankheiten durch die Entwicklung von Impfstoffen, z.B. gegen Pocken, aber auch durch größere Hygiene und verbesserte Haltbarkeit von Lebensmitteln Herr zu werden.
In Afrika und Asien kannte man schon vor 1000 Jahren das Verfahren der Variolation, bei der abgeschwächte Viren von Pockenkranken, die die Krankheit überstanden hatten, übertragen wurden, um ihre Mitmenschen so zu impfen, was nicht immer gelang, aber immerhin die Zahl der Pockentoten um rund 50% reduzierte. Dennoch waren in Schweden noch im Jahr 1750 allein 15% aller Todesfälle auf Pocken zurückzuführen. Medikamente waren nicht für alle erschwinglich. Die Verbesserung der Bedingungen sorgte aber erneut für einen Bevölkerungsanstieg.
Bis dahin hatte die hohe Kindersterblichkeit die Weltbevölkerung nur langsam wachsen lassen. Erst in den letzten 500 bis 1000 Jahren begann die Weltbevölkerung wieder stärker zu wachsen. Auch heute noch sind Krankheiten in einigen Gebieten der Erde eine der häufigsten Todesursachen, wie etwa die Durchfallerkrankungen in den Entwicklungsländern.
Aber erst mit Beginn der ungehemmten Nutzung von fossilen Energiequellen in den letzten 100 bis 150 Jahren explodierte die Weltbevölkerung und wächst nach wie vor. Noch 1850 waren mehr als 90% der Menschen Bauern3.
Heute sind es in Amerika nur noch 2%. Auch die industrielle Revolution liegt, was die Zahl der Beschäftigten angeht, schon zu einem großen Teil hinter uns. Auch hier sind nur noch 20% der Amerikaner beschäftigt. Der Rest (78%) ist in Dienstleistungsberufen tätig, und die nächste, digitale Revolution ist bereits auf dem Vormarsch.
Der Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen und Flächen beschleunigte sich jedoch nicht nur entsprechend dem Wachstum der Bevölkerung, wie man meinen könnte. Auch das wäre schon mehr als bedenklich gewesen wäre, da die Erde schon sehr bald an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stieß, sondern er stieg um ein Vielfaches.
Heute gibt es allein in China mehr als 150 Städte mit mehr als einer Million Einwohnern. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht gelungen wäre, diese Menschen auch weitgehend zu ernähren, was nur durch die Erfindung des Stickstoffdüngers gelang. Da die Herstellung von Kunstdünger abhängig ist von der Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe (insbesondere Erdgas), aus denen der notwendige Wasserstoff gewonnen wird, könnte das Ende der fossilen Brennstoffe dazu führen, dass sich die Weltbevölkerung wieder auf ca. zwei Milliarden Menschen reduziert, was zu dramatischen Begleiterscheinungen führen dürfte.
Wachstum bestimmt bis heute das Leben der Menschen. Einmal erschaffener, vermeintlicher Fortschritt und der mit ihm verbundene Luxus ließen und lassen sich scheinbar kaum mehr umkehren. Luxus verursacht steigende Bedürfnisse, die in immer größeren, teilweise kriegerischen Auseinandersetzungen, der Ausbeutung von ganzen Kontinenten und der Vernichtung von ganzen Völkern enden.
Großen Anteil an dieser Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit haben diesbezüglich die Kolonialherren, die vorwiegend aus Europa kamen und unter deren Folgen heute noch große Teile der Erdbevölkerung leiden. Die gewaltigen Flüchtlingsströme aus Afrika sind nur eine späte Folge dieser früheren Herrschaftsmächte.
Vor rund 5000 Jahren erfanden die Sumerer die Schrift; es entstanden die ersten Netzwerke, Religionen verbreiteten sich, Königreiche entstanden. Allerdings begannen die Menschen erst vor 100 bis 200 Jahren in großer Zahl zu lesen und zu schreiben. In Deutschland hatte die Übersetzung der Bibel ins Deutsche und damit die Möglichkeit, diese eigenständig zu studieren, großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen Strukturen. Heute müssen wir uns fast ständig mit Veränderungen auseinandersetzen.
Veränderungen, die früher Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende brauchten, erleben wir heute innerhalb weniger Jahre. Viele der neuen Möglichkeiten erweisen sich im Alltag zunehmend als zusätzliche Belastung. Als die Mobiltelefone sich verbreiteten, war es zunächst ein Vorteil, andere besser erreichen zu können und selbst besser erreichbar zu sein. Viele Dinge konnten mobil bereits unterwegs erledigt werden. Heute verbringen wir viel Zeit damit, Nachrichten auf unserem Smartphone oder am PC zu beantworten, die wir früher gar nicht bekommen hätten, weil es viel zu aufwendig gewesen wäre, sie über mehrere Tage per Post zu versenden.
Nachrichten wurden nur versandt, wenn man etwas wirklich Wichtiges mitzuteilen hatte.
Veränderungen vollziehen sich in immer kürzeren zeitlichen Abständen. In wenigen Jahren wurden aus Menschen, die nur gelegentlich ein Telefon benutzten, Kunden mit einem festen Handyvertrag.
Vor 500 Jahren begann der Mensch damit, sich wissenschaftlich zu betätigen, wodurch der Fortschritt noch einmal deutlich an Tempo zulegte. Außerdem wurden viele ungeklärte Fragen gelöste, für die bis dahin die Religionen Erklärungen angeboten hatten.
Wo stehen wir heute?
Das lässt sich kaum mehr genau sagen, weil bereits morgen die Welt schon wieder ein ganzes Stück anders aussieht als in dem Augenblick, in dem Sie diese Zeilen lesen.
Wenn wir nur ein paar Jahre zurückblicken, lässt sich das noch besser nachvollziehen. Unsere Kindheit hat sich, ich glaube, da sind wir uns weitgehend einig, noch wesentlich anders abgespielt als die unserer Kinder, also nur eine Generation später.
Wie wir schon erfahren haben, war dies über viele Generationen eher nicht so. Kein Wunder also, dass unsere Welt heute schon entscheidend anders aussieht als die Welt zu der Zeit, mit der ich das vorherige Kapitel beendet habe.
Beschränken wir uns also zunächst auf die Fakten.
Heute gibt es rund 200 unabhängige Staaten, die jedoch kaum noch in der Lage sind, unabhängig voneinander zu wirtschaften.
Wir leben überwiegend von einigen, wenigen Pflanzenarten (Mais, Reis, Weizen, Kartoffeln, Hirse und Gerste).
Die Industrialisierung hat zu einer immer größer werdenden Spezialisierung geführt.
Berufe werden in immer kleinere Disziplinen unterteilt.
Das Angebot für die nachwachsenden Generationen wird immer unüberschaubarer.
Die Familie, die den Einzelnen Halt und Orientierung geboten hat, zerfällt.
Dies birgt große Gefahren.
Familie ist nicht alles, aber ohne Familie ist alles nichts, wie ich an anderer Stelle noch ausführen werde.
Unser Aktionsradius hat sich nahezu unbegrenzt erweitert. Während die Generation unserer Eltern zum Teil bis heute über ihre unmittelbare Umgebung nie hinausgekommen ist, haben viele von uns große Teile der Welt bereist und fremde Kulturen kennengelernt.
Die häufigsten Begriffe in der modernen Welt sind:
Geschwindigkeit, Flexibilität, Mobilität und Effektivität.
In der Folge wurden soziale Strukturen in Familien und Unternehmen zerstört.
Diese Entwicklung hat eine solche Dynamik entwickelt, dass sie viele Menschen überfordert und Ängste erzeugt, die sich in Ablehnung und Abgrenzung äußert, auch innerhalb der eigenen Gesellschaft.
Die jüngsten Entwicklungen in der EU und den Vereinigten Staaten geben dies nur in Ausschnitten wieder.
Karl Rabeder, ein Österreicher, der sein Vermögen abgegeben hat, weil er eine zunehmende Sinnlosigkeit darin entdeckt hatte, nach immer mehr Reichtum zu streben, vergleicht unsere Gesellschaft mit einer Schafherde:
„Einer (der Schäfer) bestimmt, in welche Richtung die Masse sich bewegen soll. Andere sind abgerichtet und führen die entsprechenden Befehle aus (die Hunde). Die Masse (die Schafe) bewegt sich nicht, wie es ihrer Natur entspricht, sondern so, wie die Herrscher es wollen.“
Schon als Kind lernen wir, zu Hause, im Kindergarten und in der Schule zu gehorchen.
Wir werden immer stärker kontrolliert. Während meine Generation als Kinder noch halbe Tage, in den Ferien auch ganze Wochen, häufig unbeaufsichtigt unterwegs war, leben wir heute unter ständiger Beobachtung. Nicht nur, dass ganze Städte, z.T. bis in den letzten Winkel, kameraüberwacht werden, sondern auch, weil wir ständig und überall erreichbar sind.
Wenn bei unserem Smartphone der Akku leer ist, machen sich zahlreiche Mitmenschen bereits nach Stunden Gedanken, ob uns etwas zugestoßen ist, weil wir nicht erreichbar sind. Leute, die ihr Handy freiwillig ein paar Tage abgeben, informieren ihre Bekanntenkreise bereits vorher darüber, um größere Verwirrung zu vermeiden.
Befriedigung wird in Form von Konsum erreicht (Spiele, Events, Urlaub, Musik, Drogen, Essen und Trinken).
Unsere Fantasie wird immer seltener angeregt. Dies ändert sich bei vielen bis zum Ende ihres Lebens nicht mehr wesentlich.
Das Netzwerk „Attac“, das sich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen einsetzt, hat sehr anschaulich beschrieben, in welcher Welt wir unterwegs sind:
„Falls Du heute Morgen gesund und nicht krank aufgewacht bist, bist du besser dran als 1 Millionen Menschen, welche die nächste Woche nicht erleben werden.
Falls du nie einen Kampf des Krieges (persönlich) erlebt hast, nie die Einsamkeit der Gefangenschaft, die Agonie (einen länger andauernden Todeskampf) des Gequälten oder Hunger gespürt hast, dann bist du glücklicher als 500 Millionen Menschen der Welt.
Falls du deine Religion ausüben kannst, ohne die Angst, dass dir gedroht wird, dich zu verhaften oder dich umzubringen, bist du glücklicher als 3 Milliarden Menschen der Welt.
Falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, du angezogen bist, ein Dach über dem Kopf hast und ein Bett, bist du reicher als 5,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde.
Falls du ein Konto bei der Bank hast, etwas Geld im Portemonnaie und etwas Kleingeld in einer Schachtel, gehörst du zu den 8 Prozent der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt.“
Für die meisten von uns sind dies alles vermutlich Selbstverständlichkeiten.
Nicht wenige müssen im Internet entsprechende Plattformen aufsuchen, wo ihnen Vorschläge gemacht werden, was sie anderen zum Geburtstag schenken oder sich selbst wünschen könnten. Eigentlich müssten wir doch im wahrsten Sinnen des Wortes „wunschlos glücklich“ sein. Stattdessen suchen wir ständig nach mehr Befriedigung.
Dieser Entwicklung gilt es sich in allen Lebensbereichen und in allen Bevölkerungsschichten aktiv entgegenzustellen.
Junge Leute nehmen heute ihre Umgebung zunehmend eingeschränkt wahr. Die Kreativität, Lösungen für Probleme des täglichen Lebens zu finden, geht ihnen immer mehr verloren. Ihre Aufmerksamkeit beschränkt sich auf ausgewählte Themen. Dadurch geht ihnen praktische Intelligenz, die wir lange als selbstverständlich erachtet und der wir daher wenig Wertschätzung entgegengebracht haben, mehr und mehr verloren. Die scheinbare Verfügbarkeit allen Wissens ersetzt jedoch nicht deren Anwendung.
Intelligenz wird allgemein als kognitive Leistungsfähigkeit beschrieben. Zu den kognitiven Fähigkeiten gehören u.a. auch die Wahrnehmung, Problemlösung und Kreativität.
In unserer Gesellschaft wird jedoch zunehmend „Kognition“ mit „Denken“ gleichgesetzt.
Dies ist ein sehr einseitiger Intelligenzbegriff, der die Anforderungen an unsere Gesellschaft nicht ausreichend darstellt.
Schwache haben in unserer Leistungsgesellschaft häufig keinen Platz. Singles suchen sich ihre Partner bei Partnervermittlungen und den Nachwuchs aus der Retorte (natürlich nur von Studenten).
Designerbabys mit ausgewählten Fähigkeiten sind keine allzu ferne Illusion mehr.
Kinder mit Down-Syndrom haben da weniger Chancen.
90% der Frauen mit dieser Diagnose beenden die Schwangerschaft.1 Ich erlaube mir kein Urteil über diese Frauen, sie entscheiden jedoch über Leben und Tod und den Wert von Menschen, die den heutigen Ansprüchen scheinbar nicht genügen.
Wer Menschen mit Down-Syndrom einmal selbst erlebt hat, kommt nicht auf den Gedanken, dass sie ein weniger lebenswertes Leben führen als gesunde Menschen. Zweifellos brauchen sie eine intensivere Betreuung, die nicht jeder ohne Weiteres gewährleisten kann.
Aber können wir dies, wenn wir gesunde Kinder zur Welt bringen?
Wissen wir heute in unserer schnelllebigen Zeit, ob unserer Leben so weiter verläuft, wie wir es geplant haben?
Welche Bedürfnisse hat der Mensch?
Denken Sie einfach einmal darüber nach, welche Bedürfnisse Sie haben, wenn Sie morgens aufwachen und welche im Laufe des Tages, eines Monats, Jahres und schließlich bis zu Ihrem Lebensende hinzukommen.
Diese Bedürfnisse können, je nachdem, wo Sie geboren wurden, schon innerhalb einer Stadt, eines Landes oder auch nur aufgrund der sozialen Verhältnisse in Ihrer Familie sehr unterschiedlich sein.
Alle Menschen befriedigen jedoch zunächst Ihre Grundbedürfnisse.
Man unterscheidet körperliche Grundbedürfnisse (auch „biologische Grundbedürfnisse“ genannt), wie
Essen und Trinken,
Schlaf,
Atmung (saubere Luft)
Wärme (Kleidung),
das Bedürfnis nach Sicherheit, Schutz vor Gefahren und Ordnung (Regeln, Gesetze),
eine geeignete Unterkunft,
Gesundheit und
das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen, Partnerschaft, Liebe, Fürsorge und Kommunikation.
Herrschaftsformen wie der Kommunismus haben diese Grundbedürfnisse lange Zeit ausreichend befriedigen können und deshalb erstaunlich lange überlebt, denn ohne Befriedigung dieser Grundbedürfnisse lässt sich ein Volk, auch mit Gewalt, nicht dauerhaft kontrollieren.
Alle Probleme dieser Welt haben damit zu tun, dass eines oder mehrere dieser Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt werden. Sogar Hitler hat im Zweiten Weltkrieg darauf geachtet, dass die Versorgungslage im Deutschen Reich nie wirklich schlecht war.
Im Speziellen gehören zu den Grundbedürfnissen auch der Wunsch nach Veränderung, Anerkennung, Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstachtung.
Dabei reden wir bisher noch nicht von Luxusbedürfnissen, wie sie die westliche Welt prägen.
Menschen, die ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen können, sind meistens bereit, dafür zu kämpfen. Deshalb wird es keinen dauerhaften Frieden geben, solange die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung um die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse kämpfen muss.
Auch die zunehmenden sozialen Unterschiede in der westlichen Gesellschaft werden die Bereitschaft, für Grundrechte zu kämpfen, wieder wachsen lassen.
Wenn eine Rentnerin nach einem Arbeitsleben weniger als 700 Euro Rente bekommt, sind maximal die Grundbedürfnisse unserer Gesellschaft befriedigt.
Der Mensch ist an sich genügsam und weitgehend zufrieden, wenn seine Grundbedürfnisse befriedigt werden, was ja in vielen Teilen der Welt, im Gegensatz zu unserem Lebensraum, nicht gelingt. Die Grundbedürfnisse weichen aber z.T. erheblich voneinander ab, da sich jeder ständig mit seiner unmittelbaren Umgebung vergleicht.
Werbung vermittelt ihm den Eindruck, seine Umgebung würde sich anders verhalten als er. Sie kleidet sich anders, fährt ein anderes, größeres Auto, hat ein schöneres Haus, ernährt sich üppiger usw.
Dies führt zu teilweise seltsamem Verhalten.
Mir erschließt sich beispielsweise nicht, was so erstrebenswert daran sein soll, sich bis zu 30 Minuten anstellen zu müssen, wenn man in einem der vielen Hamburgerlokale überteuerte Burger, in sehr begrenzter Auswahl und auf unbequemen Bänken serviert bekommt.
Immerhin muss man in den asiatischen Lokalen, in denen man für einen Festbetrag per Tablet bestellen und zeitlich begrenzt so viel essen kann, wie man schafft, wenigstens für nicht verzehrte Speisen eine Zusatzgebühr entrichten.
Fallen Vergleiche weg, wie es über Jahrzehnte in Teilen des Ostens der Fall war, vergleicht der Mensch sich nur mit seiner wahrnehmbaren Umgebung, der es auch nicht besser geht als ihm. Die Ostdeutschen haben ihre Verhältnisse jedoch vielfach mit denen im Westen verglichen, die ihnen, trotz aller Bemühungen seitens der DDR-Regierung, nicht vorenthalten werden konnten.
Fehlende Vergleiche führen natürlich zu einem anderen Konsumverhalten, die Wirtschaft schrumpft.
Diese Option kommt in unserem Denken nicht vor. Die Wirtschaft muss wachsen.
Die Frage ist, ob sie das wirklich muss und was passiert, wenn sie das nicht mehr kann, weil kein entsprechendes Angebot mehr hergestellt werden kann. Spätestens, wenn die fossilen Energieträger verbraucht sind, wird sich das Angebot reduzieren und Wachstum nur noch begrenzt und in Teilbereichen möglich sein. Dies wird die Unterschiede und mit ihnen die Konflikte vergrößern.
Häufig wird argumentiert, wir könnten nichts ändern, weil in unserer globalen Wirtschaft alle mitmachen müssen.
Das ist grundsätzlich nicht falsch, die Frage ist nur, ob wir nicht umgekehrt durch nationale Vorgaben die globale Wirtschaft zwingen können, sich unseren strengeren Vorgaben anzupassen.
Wenn wir beispielsweise Vorgaben hinsichtlich des Stromverbrauches von Geräten machen, wird sich der Hersteller, für den Deutschland ein wichtiger Markt ist, überlegen, ob er zwei Produkte mit unterschiedlichem Stromverbrauch entwickelt oder eines mit geringerem Verbrauch, das er überall anbieten kann.
Brauchen wir noch Gesellschaft(en)?
Was für eine Frage, werden Sie denken. Und Sie haben Recht. Jeder Mensch braucht Gesellschaft. Lange Zeit wäre deshalb diese Frage auch völlig abwegig gewesen. Die Frage ist, wohin wir uns entwickeln. Die meisten Menschen meiner Generation (ich bin Jahrgang 1961) sind wahrscheinlich in Familien aufgewachsen.
Wenn man dort niemanden fand, der Zeit für einen hatte, ging man einfach nach draußen. Dort hat man immer jemand gefunden, der auch gerade Gesellschaft suchte. Meistens bekam man eine Zeit mit auf den Weg, wann man wieder zu Hause zu sein hatte (in der Regel zu den Mahlzeiten oder wenn es draußen dunkel wurde). Verabredungen traf man höchsten für den nächsten Tag. Alle anderen Verabredungen (z.B. für das Wochenende oder die nächsten Ferien) trafen die Eltern für einen. Telefoniert wurde nur in dringenden Fällen, z.T. musste man sogar telegraphieren, alles andere wurde per Brief oder Postkarte erledigt.
Manche hatten schon ein Fernsehgerät, auf dem aber nur drei Programme liefen; für Kinder gab es in der Regel nur das Nachmittagsprogramm, das man bestenfalls bei Regenwetter schauen durfte. Ansonsten gab es Radios.
Dies hat sich geändert. Heute kommuniziert man ständig über die verfügbaren sozialen Medien, auch wenn man eigentlich nichts mitzuteilen hat. Gesprochen wird dabei immer seltener, wenn man mal von Sprachnachrichten absieht. Niemand geht mehr einfach auf die Straße. Man würde in den meisten Fällen auch niemanden dort antreffen. Für Kinder wäre das auch viel zu gefährlich. Die werden stattdessen heute von den Eltern zu allerlei Veranstaltungen gebracht. Mit dem Auto selbstverständlich, auch wenn es sich in einigen Fällen nur um kurze Distanzen handelt.
Verabredungen mit sozialen Gruppen werden oft kurzfristig abgesagt.
Mein Sohn ärgerte sich als engagierter Trainer einer Jugendfußballmannschaft jede Woche über die fehlende Zuverlässigkeit der Jugendlichen, beim Training oder Spiel zu erscheinen. Die Begründungen für ihr Fehlen waren teilweise frei erfunden, sofern sie sich überhaupt abmeldeten.
Es bilden sich immer mehr Randgruppen in unserer Gesellschaft, die sich durch außergewöhnliche Ansichten oder Regeln von ihrer Umgebung abgrenzen.
Unsichere, schwache Menschen fühlen sich von solchen Gruppen angezogen, geben sie ihnen doch das Gefühl von Sicherheit.
In Deutschland gelten 4.000.000 (4 Millionen) Menschen als alkoholabhängig.1 Weitere vier Millionen Menschen leiden an Depressionen und ca.
10.000 begehen jährlich Suizid, weltweit sind es sogar fast 1 Million jährlich.2 Depressionen sind die häufigste Ursache von Suizid.
Suizid begeht man, wenn man für sich keinen Ausweg mehr sieht, sei es aus gesundheitlichen Gründen (hier ist nur eine begleitende Hilfe möglich, sofern es sich nicht um heilbare Krankheiten handelt) oder aus einer scheinbar aussichtslosen Lebenssituation.
Es sollte möglich sein, die meisten Menschen aus dieser Sackgasse zu befreien.
Dazu bedarf es funktionierender sozialer Kontakte, Freund- und Partnerschaften, die diese Bezeichnung in ihrer ursprünglichen Bedeutung verdienen und nicht nur als Modebegriff verwendet werden.
Was sind 100 Freunde auf Facebook wert, wenn ich mit kaum einem einen persönlichen Kontakt pflege?!
Vielleicht vertraue ich mich zwar aus dieser Anonymität einem solchen Freund sogar eher an als einem wahren Freund, vor dem es mir unangenehm ist, mein scheinbares Versagen im Leben zuzugeben. Die Frage ist nur: Hilft mir dieser „Freund“ dann auch oder flüchtet er vor der Verantwortung?
Wir missbrauchen die gewonnene Freiheit, um Schaden anzurichten, zu betrügen, unsere Mitmenschen zu verraten und herabzuwürdigen.
Fairness, Fürsorge und sozialer Instinkt, Respekt und Anerkennung gehen immer mehr verloren.
Wenn unsere Beziehungen unseren Erwartungen nicht entsprechen, arrangieren wir uns nicht damit. In Partnerschaften wird nur noch zehn bis zwölf Minuten am Tag miteinander gesprochen, im Gegensatz zum stetig steigenden Medienkonsum, der bereits mehrere Stunden am Tag ausmacht.3 Wir arbeiten nicht an der Verbesserung unserer Partnerschaft, sondern beenden die Beziehung und versuchen, unsere Ansprüche in einer neuen Partnerschaft zu realisieren.
Im Zweifelsfall suchen wir vorübergehend Befriedigung in den zahlreichen Alternativangeboten der Freizeitindustrie oder bei einem anderen Event, zu dem ja selbst die Abholung von Neuwagen oder unser Mittag- und Abendessen geworden sind.
Die Familie als kleinste Einheit und älteste Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte geht allmählich verloren, obwohl sie die Voraussetzung für ein glückliches Leben ist.
Glück lässt sich nicht erarbeiten, nicht kaufen, nicht festhalten oder einsperren.
Die Evolution hat dafür gesorgt, dass wir nie zu glücklich oder zu unglücklich sind. Beides würde unser Überleben als Spezies gefährden. Trotzdem laufen wir dem Wohlstand als vermeintlichem Ersatz für Glück fast blind hinterher und machen uns meist unbemerkt immer abhängiger vom Erfolg, dessen Definition wir selbst ständig den Möglichkeiten anpassen und damit die Latte unbemerkt immer ein wenig höher hängen als für uns kurzfristig erreichbar.
Die Fälle von Arbeitsunfähigkeit in Deutschland haben sich zwischen 2005 und 2012 laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund verneunfacht (!). Immer mehr Menschen gehen immer früher aus psychischen Gründen vorzeitig in den Ruhestand.
In der Geschichte der Menschheit haben die Gesellschaften immer auch auf dem Glauben an unbezahlbare Werte, wie Moral, Ehre und Liebe, beruht.
Diese Werte sind an sich nicht käuflich.
Das Vertrauen ist in der modernen Gesellschaft immer mehr verloren gegangen.
Mit dem Mangel an finanziellem Vermögen sinkt in unserer Gesellschaft auch das Vertrauen in die betroffenen Personen.
Man hat den Eindruck, dass Menschen mit Gewissen in unserer Gesellschaft immer öfter zu Außenseitern werden.
Möglicherweise werden sie als Verräter empfunden.
Unsere Gesellschaft ist davon überzeugt, alle Probleme technisch lösen zu können.
Das geht so weit, dass man alte Leute nicht betreuen, sondern technisch überwachen will. Es sind Systeme in der Entwicklung, sogenannte „Alltagsunterstützende Assistenzlösungen“ (AAL), die z.B. Stürze erkennen und Hilfestellungen einleiten.
Natürlich geht es dabei in erster Linie um Geld. Das erwartete Umsatzpotenzial liegt bei geschätzten 87.000.000.000 (87 Milliarden) Euro.
Wahrscheinlich werden diese Menschen dann von selbstfahrenden Autos abgeholt und ins nächste Krankenhaus gebracht, wo sie dann von einem Roboter operiert werden.
Vielleicht wollen diese Menschen aber auch gar nicht überleben, weil sie offensichtlich nur zur Umsatzsteigerung gebraucht werden und sich sonst niemand für sie interessiert.
Wie alt werden wir?
In den meisten Fällen nicht alt genug. Wenn man einmal davon absieht, dass jeder Verlust einer geliebten Person schmerzlich ist, kann man heute davon ausgehen, dass in jedem Fall alles nur Erdenkliche getan wird, um das jeweilige Leben zu verlängern. Der Einzelne wird in der Regel nicht einmal gefragt.
In Deutschland ist es gar nicht möglich, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, wenn man selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, sein Leben zu beenden. Stattdessen werden, nicht selten mit großem technischen Aufwand, alle Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des bisweilen gar nicht mehr lebenswerten Zustandes ausgeschöpft, und sei es auch nur, um das Leben für wenige Tage zu verlängern.
Auch zu meiner Kindheit war es natürlich schmerzlich, einen nahen Angehörigen oder Freund zu verlieren, es war jedoch gleichzeitig auch nicht ungewöhnlich, wenn jemand vor dem Erreichen seines 70. Lebensjahres verstarb. Curd Jürgens (1915-1982) fand es gar ungewöhnlich, dass er nach eigenem Bekunden mit 60 Jahren noch kein bisschen Weisheit erlangt hatte. Er hat es immer vorgezogen „den Jahren mehr Leben zu geben und nicht dem Leben mehr Jahre“.1 Der Körper erneuert alle Zellen innerhalb von sieben Jahren. Trotzdem werden wir älter und sterben eines Tages. Dabei geht nur die Materie verloren, unsere Energie wird nur umgewandelt und bleibt erhalten.
Niemand weiß natürlich, wann sein Leben endet, sofern man es nicht selbst beendet.
Trotzdem haben wir aufgrund statistischer Erhebungen eine Lebenserwartung. Diese ist nicht überall gleich. Auch zwischen Männern und Frauen gibt es Unterschiede, die sich aber immer stärker ausgleichen.
Im vergangenen Jahrhundert stieg die Lebenserwartung in den reichen Ländern um 30 Jahre.
Arme Menschen, davon jährlich allein zwei Millionen Kinder, sterben dagegen immer noch an Krankheiten, die sich durch Impfstoffe vermeiden ließen.
Auch heute noch ist in Indien, das nicht mehr zu den armen Ländern zählt, die Hälfte der Kinder massiv unterernährt und 25% leben noch immer von weniger als einem Dollar am Tag.
In den reichen Ländern sterben die meist älteren Menschen überwiegend an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Schlaganfall, Arteriosklerose, Herzinfarkt etc.) und an Krebs.