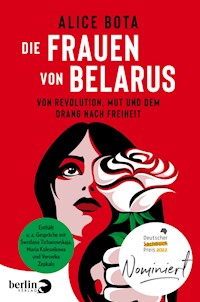9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Ein Gefühl war der Auslöser für dieses Buch, und dieses Gefühl war Wut. Darüber, in einer Gesellschaft zu leben, in deren Selbstverständnis wir nicht vorkommen. Darüber, Teil einer Veränderung zu sein, die von den meisten lieber verdrängt wird. Und darüber, nicht zu wissen, ob wir dieses Land ‹unser Deutschland› oder ‹euer Deutschland› nennen sollen. Wir waren überrascht, wie sehr wir drei ein Lebensgefühl teilten, obwohl wir aus unterschiedlichen Familien und unterschiedlichen Kulturen kommen. Wir sprachen über Themen, die uns gleichermaßen beschäftigten, über unsere gemischten Identitäten, unsere Gefühle von Heimatlosigkeit und Entfremdung. Plötzlich sprachen wir von ‹den Deutschen› hier und ‹den Deutschen› da. Plötzlich teilten wir das Land. Wir machten denselben Fehler wie die, die wir kritisieren: Wir dachten in wir und ihr. Die Migranten, die neuen Deutschen, das sind wir. Und die Deutschen, das seid ihr. Wir vertieften den Graben, den wir überwinden wollen. Auf der Suche nach unserem Selbstverständnis fingen wir an, den fremden Teil in uns zu betonen. Warum? So widersprüchlich es klingt: Es scheint uns der einzige Weg zu sein, diesen Graben zu überwinden.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alice Bota • Khuê Pham • Özlem Topçu
Wir neuen Deutschen
Wer wir sind, was wir wollen
Über dieses Buch
«Ein Gefühl war der Auslöser für dieses Buch, und dieses Gefühl war Wut. Darüber, in einer Gesellschaft zu leben, in deren Selbstverständnis wir nicht vorkommen. Darüber, Teil einer Veränderung zu sein, die von den meisten lieber verdrängt wird. Und darüber, nicht zu wissen, ob wir dieses Land ‹unser Deutschland› oder ‹euer Deutschland› nennen sollen. Wir waren überrascht, wie sehr wir drei ein Lebensgefühl teilten, obwohl wir aus unterschiedlichen Familien und unterschiedlichen Kulturen kommen.
Wir sprachen über Themen, die uns gleichermaßen beschäftigten, über unsere gemischten Identitäten, unsere Gefühle von Heimatlosigkeit und Entfremdung. Plötzlich sprachen wir von ‹den Deutschen› hier und ‹den Deutschen› da. Plötzlich teilten wir das Land. Wir machten denselben Fehler wie die, die wir kritisieren: Wir dachten in wir und ihr. Die Migranten, die neuen Deutschen, das sind wir. Und die Deutschen, das seid ihr. Wir vertieften den Graben, den wir überwinden wollen. Auf der Suche nach unserem Selbstverständnis fingen wir an, den fremden Teil in uns zu betonen. Warum?
So widersprüchlich es klingt: Es scheint uns der einzige Weg zu sein, diesen Graben zu überwinden.»
Vita
Alice Bota, geboren 1979 im polnischen Krapkowice, kam 1988 mit ihren Eltern nach Deutschland. Seit 2007 ist sie Politikredakteurin bei der ZEIT. 2009 erhielt sie den Axel-Springer-Preis für junge Journalisten.
Khuê Pham wurde 1982 in Berlin geboren. Studium an der London School of Economics, danach arbeitete sie für The Guardian und das amerikanische National Public Radio. Seit 2010 ist sie Politikredakteurin bei der ZEIT.
Özlem Topçu wurde 1977 in Flensburg geboren. Seit 2009 ist sie Politikredakteurin bei der ZEIT. Ausgezeichnet wurde sie mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Regino-Preis.
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Fotos der Autorinnen: Thies Rätzke
ISBN Buchausgabe 978-3-498-00673-0 (1. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-02211-9
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
I. Eigentlich ganz schön hier
Nicht Ausländer, nicht Deutsche
Die Angst vor Veränderung
Neue Patrioten
II. Wer wir sind
Ein Polenkind wird deutsch
«Wo kommst du wirklich her?»
Wir unsichtbaren Türken
III. Meine Heimat, keine Heimat
German Angst
Das Zuhause in der Ferne
IV. Unser anderes Land
Verrat an Polen
Die Sache mit der Türkei
Mein vietnamesisches Ich
V. Schönen Dank fürs Erbe
Das Mädchen aus dem Vietnamkrieg kommt an
Meine türkische Mutter bleibt
Nazifes deutscher Sieg
Der stille Pole, der stille Deutsche
VI. Scheitern ist keine Option
«Ihr Vietnamesen seid doch so fleißig»
Mein Migrantenticket
Vom Scheißgefühl, eine Hochstaplerin zu sein
VII. Wir sind alle Muslime
Muslimische Probleme sind deutsche Probleme
Im Namen der Religion
Plötzlich Muslime
VIII. Neue Deutsche braucht das Land
Wir wollen keine Fremden sein
Berlin, Hauptstadt der Zukunft
Neues Deutschland
Danksagung
I.Eigentlich ganz schön hier
Wir finden, dass es sich verdammt gut lebt in diesem Land, von dem wir nicht wissen, wie wir es nennen sollen: Heimat? Zuhause? Fremde? Unser Deutschland – oder doch: euer Deutschland?
Wir sind hier aufgewachsen, wir haben hier Deutsch gelernt, sind hier zur Schule gegangen und haben uns an den Wohlstand gewöhnt, der uns immer dann bewusst wurde, wenn wir die Kargheit in der Heimat unserer Eltern sahen; wenn wir Verwandte besuchten und unsere Eltern ihnen Geld gaben oder Geschenke aus Deutschland mitbrachten. Wir sahen unser Spielzeug, das vielleicht nicht so schön war wie das von deutschen Kindern, aber wenn wir es mit dem unserer Cousins und Cousinen in Polen, Vietnam oder in der Türkei verglichen, spürten wir: Ganz gleich, wie arm oder reich unsere Familien waren, in unseren Leben gab es keinen wirklichen Mangel. Und keine Angst, zumindest nicht solch eine, wie wir sie bei unseren Verwandten ahnten: weil sie kaum genug zum Leben verdienten, weil bei ihnen die Lebensmittel knapp waren, weil sie nicht frei ihre Meinung sagen durften. Wir dagegen fuhren auf Klassenfahrt, jobbten nach der Schule im Altenheim, gaben Nachhilfe oder räumten für zehn Mark die Stunde im Supermarkt Regale ein, um unser Taschengeld aufzubessern. Wir waren Heranwachsende in Deutschland.
Ungläubig saßen wir vor dem Fernseher, als die Berliner Mauer fiel und in den Jahren darauf erst in Hoyerswerda, dann in Mölln und Solingen Wohnungen von Ausländern brannten. Wir gingen auf die Straße, Schweigemarsch, Seite an Seite mit Lehrern und Schulfreunden. Mit den Anschlägen fühlten auch wir uns gemeint, weil es Menschen wie uns in diesem Land betraf. Wahrscheinlich wäre es uns nicht in den Sinn gekommen, aus Sorge um Vietnam, die Türkei oder Polen einen Fuß vor die Tür zu setzen. Wenn die Verwandten bei ihren seltenen Besuchen oder den kostbaren Telefonaten davon erzählten, was daheim in der Ferne passierte, dann hörten wir uns diese Geschichten an, nahmen sie zur Kenntnis. Aber sie waren weit weg von unserem Alltag.
Erst sehr viel später verstanden wir, dass es einen großen Unterschied macht, ob man Heranwachsender in Deutschland ist oder deutscher Heranwachsender.
Spätestens wenn wir nach der Schule heimgingen und die Türschwelle überschritten, kehrten wir zurück in die Fremde, die sich vertraut anfühlte. Es lief irgendein türkischer Fernsehsender, Polnisch oder Vietnamesisch erklang aus der Küche, und abends baten uns die Eltern, ihre Briefe auf Fehler durchzusehen. Daheim erlebten wir eine andere Welt als tagsüber in der Schule. Unser Zuhause war nicht deutsch, unsere Familien waren nicht deutsch. Wir waren anders, weil unsere Eltern, ihre Leben und ihre Sorgen anders waren als die der Familien unserer Mitschüler.
Das alles wussten wir, aber wir können uns nicht mehr daran erinnern, wann es begann, eine Rolle zu spielen, das Anderssein. Über die Jahre schlich sich dieses Gefühl ein, weil jede von uns irgendwann Geschichten erlebt hat, die bloßlegten, wer in Deutschland als fremd gilt und was es heißt, fremd zu sein. Meistens traf es unsere Eltern. Da wurde die türkische Mutter in einem Geschäft nicht bedient, weil sie gebrochenes Deutsch sprach. Da sagte ein Kollege zu dem polnischen Vater, er würde am liebsten die ganzen Polacken und Russen über den Haufen schießen, weil sie den Deutschen die Arbeitsplätze wegnähmen. Da sagte der Lehrer, als es Ärger in der Schule gab, es solle doch der Elternteil anrufen, der besser Deutsch spreche; man habe keine Lust, sich abzumühen. Dabei sprachen beide Deutsch, nur eben mit diesem fremden Akzent.
Unsere Eltern hielten sich nicht lange mit solchen Bemerkungen auf, sie gaben sich unempfindlich. Wir aber speicherten diese Beweise der Ausgrenzung in unseren Köpfen ab. In kleinen Mengen tropften sie über die Jahre in unsere Leben und ließen ein Gefühl der Entfremdung wachsen. Noch heute hören wir, Migranten sei Bildung nicht wichtig, Türken seien rückständig, nicht integrierbar, und die billige polnische Putzfrau könne man sich bald nicht mehr leisten, so teuer sei sie geworden. Mittlerweile sind wir nur noch selten persönlich gemeint, aber in diesen Geschichten schwingt eine Ablehnung mit, die auch uns trifft. Es fällt uns schwer, sie zu vergessen und einfach beiseitezulegen.
Als Jugendliche schämten wir uns manchmal für unser Anderssein, und auf die Scham folgte Wut. Wenn wir die Sticheleien hörten, hätten wir uns am liebsten irgendwie gewehrt, am besten eine wahnsinnig kluge Antwort in perfektem Hochdeutsch gegeben, die den anderen noch lange in den Ohren nachklingen würde. Stattdessen hielten wir irritiert den Mund, wenn uns jemand sagte, dafür spreche man wirklich gut Deutsch.
Heute sind wir jene, von denen die anderen sagen, dass sie es geschafft haben: jung, weiblich, Kinder von Ausländern und trotzdem Redakteurinnen bei einer großen Zeitung. Und dennoch trauen wir unseren Biographien nicht, dennoch fühlen wir, dass wir nicht Teil des Ganzen sind.
Nicht Ausländer, nicht Deutsche
Nach und nach haben wir begriffen, dass wir trotz aller Anstrengungen immer anders bleiben werden. Deutsche hinterfragen vielleicht dieses Land, diese Gesellschaft, so wie wir auch. Vielleicht plädieren sie dafür, Menschen anderer Hautfarbe und anderer Herkunft gleich zu behandeln, so wie wir auch. Aber sie sind nicht diese Menschen – wir sind es. Wir sind die, bei denen nicht klar ist, ob sie hierhergehören: ob wir die Sprache gut genug sprechen, die Regeln gut genug kennen; ob wir die deutsche Geschichte als die unsere ansehen und die Werte dieser Gesellschaft verinnerlicht haben. Die Deutschen fühlen mit ihrem Herzen, dass sie von hier kommen und hierhergehören. Wir wissen es nur mit unserem Verstand. Und so kommen wir uns manchmal wie Hochstapler vor, wenn wir versuchen, unsere deutschen Leben zu führen.
Wir sind zwar anders als unsere Eltern: Unsere Geschichte ist eine andere, unsere Werte und unsere Vorstellungen vom Leben in Deutschland auch. Sie sind die Ausländer, nicht wir. Aber Deutsche sind wir deshalb noch lange nicht. Was sind wir eigentlich? Was wollen wir sein?
Unsere Biographien sind sperrige Hybriden, die für Eindeutigkeiten nicht taugen. Khuê Pham mag ein vietnamesischer Name sein und Özlem Topçu ein türkischer, aber weder ist die eine Vietnamesin noch die andere Türkin. Beide wurden in Deutschland geboren; die eine wuchs hier auf, die andere lebte lediglich als Kind für drei Jahre in der Türkei. Der Name Alice Bota klingt deutsch, aber er hat diesen Klang erst angenommen, als aus einer Alicja eine Alice gemacht wurde. Sie kam als Achtjährige nach Deutschland, als Einzige von uns dreien besitzt sie zwei Pässe. Khuê Pham stammt aus einer aufgestiegenen Bildungsbürgerfamilie, Özlem Topçu ist ein Arbeiterkind und hat als Erste in der Familie studiert; Alice Bota hat erlebt, wie ihre Akademikereltern in Deutschland wieder von vorn anfangen mussten. Unsere größte festzustellende Gemeinsamkeit: Wir haben einen Migrationshintergrund.
Es ist ein merkwürdiges Wortungetüm. Die deutsche Verwaltung hat es vor einigen Jahren eingeführt, um Ordnung zu schaffen, weil die Dinge unübersichtlich geworden sind. Weil in Deutschland Eingebürgerte leben, die bleiben möchten; Ausländer, die womöglich wieder gehen wollen; weil sie Kinder haben, von denen einige einen bundesrepublikanischen Pass haben und andere nicht. Das Wort verrät sich selbst: Es versucht eine Definition, die offenbart, wie vage das Konzept von Deutsch-Sein und Nicht-deutsch-Sein ist.
Auch wir wissen nicht, wie die richtige Bezeichnung lauten könnte: Ein-bisschen-Deutsche? Deutsche mit Verwandten und einem zweiten Leben im Ausland? Wir sind uns nicht einmal einig darüber, ob es überhaupt eine solche Definition braucht. Doch wir wissen, dass ein statistisches Merkmal wie «Migrationshintergrund» nicht viel über einen Menschen verrät. Wir sind Musliminnen, Katholikinnen, Atheistinnen; wir sind Schwestern, Töchter, Ehefrauen, wir kommen aus unterschiedlichen Städten, wir haben unterschiedliche Interessen, und für die Zukunft stellt sich jede von uns etwas anderes vor. Nur eines kommt uns nicht in den Sinn: zurückzukehren in ein ominöses Heimatland. Denn das haben wir nicht. Wir sind hier daheim.
Wer bestimmt, wer zu dieser Gesellschaft gehört, wer definiert, was deutsch ist? Es sind von jeher jene, die in den Institutionen, den Redaktionen, den Vorständen oder der Regierung sitzen. Männer wie der frühere Bundesinnenminister Otto Schily, der vor zehn Jahren sagte, die beste Integration sei Assimilation, und dafür eine Menge Beifall bekam. Doch jetzt wollen wir, die mit dieser Aussage gemeint sind, selbst benennen, wer wir sind. Und was deutsch ist. Wir, Kinder von Ausländern, groß geworden in einem bundesrepublikanischen Leben, herumgekommen in einem geeinten Europa nach 1989, suchen Worte für ein Selbstverständnis, das nicht ganz einfach zu finden ist.
Uns fällt die Bezeichnung «neue Deutsche» ein.
Es ist kein Pass, der jemanden zum neuen Deutschen macht, es ist nicht sein Erfolg oder das Ergebnis eines Einbürgerungstests – es ist ein Selbstbewusstsein, das wir genährt haben aus Wut und Stolz. Wut, weil wir das Gefühl haben, außen vor zu bleiben; weil es ein deutsches Wir gibt, das uns ausgrenzt. Und Stolz, weil wir irgendwann beschlossen haben, unsere eigene Identität zu betonen. Sie einzubringen. Ohne danach zu suchen, haben wir dieses Gefühl, diesen Begriff bei anderen gefunden, denen wir begegnet sind. Harris, Sohn einer deutschen Mutter und eines schwarzen Amerikaners, Rapper, hat sich selbst zum neuen deutschen Patrioten erklärt. Naika Foroutan, Soziologin, deutsche Mutter, iranischer Vater, benutzt den Begriff, um in ihrer Forschung die neuen Deutschen von den alteingesessenen zu unterscheiden. Es gibt viele andere, die sich intuitiv so nennen. Unsere Gleichung ist einfach: Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir sind anders. Also gehört die Andersartigkeit zu dieser deutschen Gesellschaft.
Mehr als 16 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Vielen von ihnen geht es so wie uns: Sie fühlen sich als Deutsche, weil sie hier geboren sind und keine andere Heimat kennen. Oder weil sie beschlossen haben, hier ihre Leben zu verankern. Ihre Biographien, vor allem aber die ihrer Kinder, Migranten der zweiten oder dritten Generation, werden in der deutschen Gesellschaft immer sichtbarer. Sie treten gegeneinander im Finale der Sendung Deutschland sucht den Superstar an, die den Spitznamen Migrantenstadl trägt, sie beherrschen die Fußballnationalmannschaft, sie schießen bei der Fußballweltmeisterschaft oft die entscheidenden Tore. Kinder von Migranten repräsentieren Deutschland in der Welt.
Diese bemerkenswerten Geschichten beweisen, dass sich das Land durch die Einwanderung wandelt. Aber noch sind die Erzählungen vom Erfolg Ausnahmen. Wie kommt es, dass in der Unterhaltungsbranche oder beim Fußball gelingt, was in anderen Bereichen bisher nicht funktioniert? Noch immer ist es ungewöhnlich, dass Leute wie wir bei einer großen deutschen Zeitung arbeiten. Sehr wenige neue Deutsche sind in Stiftungen, Verbänden oder DAX-Vorständen vertreten, sehr wenige sitzen im Bundestag, sind Polizisten oder Beamte in Stadtverwaltungen. Noch sind wir neuen Deutschen in der Mitte der Gesellschaft unterrepräsentiert. Aber das wird sich ändern. Wir können nicht außen vor bleiben.
Die Angst vor Veränderung
Vielen fällt es schwer, sich an diese Veränderung zu gewöhnen. Auf der Straße sehen wir Frauen mit Kopftuch, Frauen mit High Heels, Frauen mit Kopftuch und High Heels. Im Alltag westdeutscher Großstädte scheint die Verschiedenheit selbstverständlich. Aber manchmal reicht eine laute Stimme, und eine Art Gegenwut bricht hervor: die Wut jener Menschen, die enttäuscht darüber sind, dass alles anders wird; dass es nicht schnell genug vorangeht mit der Integration; dass die neuen so lange brauchen, um so zu werden wie sie. Sie halten die Integration für gescheitert und sehen es in Büchern wie «Deutschland schafft sich ab» von Thilo Sarrazin endlich ausgesprochen. Wir aber fragen uns: Von was für einer Gesellschaft ist dort eigentlich die Rede? Sarrazins Buch, die Masse an hasserfüllten Blogs im Internet, das Gerede von der deutschen Leitkultur, die Gehört-der-Islam-zu-Deutschland-Diskussion – für uns bietet nichts davon eine positive Vorstellung an von dem, wie unser Deutschland sein könnte. Es kommt uns so vor, als wollte man Leute wie uns einfach nur abwehren. Als gebe es da eine Angst vor Menschen, die wie wir eine andere Herkunft haben.
Wir können uns vorstellen, woher diese Angst kommt. Sind es die Berichte über abgeschottete Viertel wie in Berlin-Neukölln oder Hamburg-Mümmelmannsberg? Über Ehrenmorde und Russenmafia? Diese Geschichten gibt es wirklich. Aber warum fürchten sie gerade diejenigen am meisten, die keine Migranten kennen? Die von den Problemen allenfalls aus den Medien hören? Uns scheint, dass es hier um etwas anderes geht: die Suche nach einem Ventil in unsicheren und globalisierten Zeiten. Menschen sehen ihren Wohlstand und ihre Arbeitsplätze in Gefahr, sagen aber, dass sie sich um die deutschen Werte sorgen. Sie haben Angst vor der Zukunft, sagen aber, dass Migranten den Sozialstaat ausnehmen. Sie fürchten, verdrängt zu werden, sagen aber, dass die deutsche Identität bewahrt werden muss. Viele Deutsche haben Angst, dass das Land, wie sie es kennen, verschwindet. Sich abschafft. Aber Deutschland schafft sich nicht ab. Es ist lebendig und entwickelt sich weiter.
Sicher, wir bedeuten Veränderung. Weil wir hier sind, werfen wir Fragen auf, mit denen sich Deutschland vorher nicht beschäftigen musste. Reicht es, dass nur deutsche Geschichte auf dem Lehrplan steht, oder gehören die polnischen Teilungen und der türkische Völkermord an den Armeniern dazu? Darf eine Lehrerin ein Kopftuch tragen? Und wenn nicht, darf dennoch in Klassenzimmern ein Kruzifix hängen? Darf ein Mädchen dem Schwimmunterricht fernbleiben, weil ihre Eltern es so wollen? Sollten wir zwei Staatsangehörigkeiten besitzen dürfen, oder stellt das unsere Loyalität als deutsche Staatsbürger in Frage? Und funktioniert dieses Verständnis überhaupt noch in der globalisierten Welt? Was bedeutet es eigentlich, sich zu integrieren?
Für uns bedeutet es, hier zu arbeiten, die Sprache zu sprechen, deutsche Freunde und Partner zu haben. Doch es bedeutet eben auch, unseren Glauben zu leben, eines Tages vielleicht unsere Kinder in der Sprache ihrer Großeltern zu erziehen und sich einem weiteren Land verbunden zu fühlen. Die deutsche Einwanderungsgesellschaft ist noch jung, und wir alle ringen darum, wie wir am besten zusammenleben. Auch wir wollen, dass alle Eingewanderten und ihre Kinder Deutsch lernen, damit sie ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen können. Auch wir wollen, dass sich Migranten mit dem Grundgesetz und dem Rechtsstaat identifizieren. Aber warum müssen sie deutscher sein als mancher Deutscher? Warum müssen Migranten in Einwanderungstests beantworten können, was am 9. November 1938 in Deutschland geschah oder zu welchem Fest Menschen bunte Kostüme und Masken tragen? Warum wurden bis vor kurzem Muslime in Baden-Württemberg gefragt, ob sie einen homosexuellen Sohn akzeptieren würden? Darf man von einem konservativen Muslim eine Antwort erwarten, die man von einem gläubigen Katholiken aus Bayern nicht verlangen würde? Und wie kann es sein, dass diese Frage von der nächsten Regierung sogleich gestrichen wurde? Müsste das Bekenntnis zu Deutschland und seinen Werten nicht über aller Parteipolitik stehen?
Es gibt Werte, die nicht verhandelbar sind: Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehören dazu. Eine Gesellschaft, die auf diesen Werten beruht, respektiert die Selbstbestimmung der Menschen, auch wenn es nicht allen gefällt, was Einzelne mit ihr anfangen. Sie muss viel aushalten, manchmal muss sie ertragen, was nicht zu ertragen ist. Sie ist nicht von Angst getrieben, sondern von Mut. So eine Gesellschaft akzeptiert, dass Scheitern ein Teil von ihr ist, weil Scheitern immer auch ein Teil des Lebens ist. Und sie fragt danach, warum jemand scheitert, warum ihr jemand entgleitet – und nicht, wann diese Menschen endlich wieder weggehen und wie man sie loswerden könnte. Doch genau das schwingt mit, wenn darüber diskutiert wird, wer zu dieser Gesellschaft gehört und wer nicht. Was für ein Land Deutschland sein will.
Neue Patrioten
Es ist nicht die erste Auseinandersetzung über das deutsche Selbstbild seit 1945. Bisher wurde es in zwei großen Debatten verhandelt. Zuerst diskutierte die Gesellschaft den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Sie verständigte sich darüber, wie über bestimmte Themen gesprochen wird: dass die Solidarität mit Israel Staatsräson ist, dass der Holocaust das größte Verbrechen der Menschheit ist, dass die Deutschen nicht unbefangen Stolz für ihr Land empfinden können. Doch der Umgang mit der deutschen Schuld verändert sich, je weiter die Zeit voranschreitet. Auch in Deutschland werden Komödien über Hitler gedreht, und bei der WM 2006 waren die Deutschlandfahnen ausverkauft.
Die zweite große Debatte wurde durch die Wiedervereinigung ausgelöst. Wir waren Kinder, Jugendliche, und erlebten, wie dieses Land auf einmal mächtig wurde, das mächtigste Europas, und wie sich die Deutschen freuten. Aber West und Ost waren sich fremd, die stärkere und reichere Gesellschaft sah auf die schwächere herab. Und irgendwann wurden jene, die noch schwächer waren, Afrikaner, Türken, Vietnamesen, durch die Straßen gejagt. Irgendwann explodierten Molotowcocktails an den Hauswänden von Asylbewerberwohnheimen. Die Zeitungen druckten damals das Foto eines betrunkenen Mannes, der den hässlichen Deutschen zu verkörpern schien. Er stand in einem Deutschlandtrikot vor einem brennenden Asylbewerberwohnheim in Rostock-Lichtenhagen, der Blick glasig, der Arm zum Hitlergruß gereckt, die Hose vollgepisst. Diese Ausländerfeindlichkeit machte uns und unseren Familien Angst. Aber sie ließ auch die Deutschen sich selbst misstrauen, ganz so, als fürchteten sie, dass es ein böses Gen in der DNA dieses Landes gäbe, das sie wieder wüten ließ.
Heute wird wieder über das deutsche Selbstbild verhandelt, aber diesmal ist es auch unsere Debatte. Menschen wie wir, mit Bindestrich-Identitäten, verkörpern ein neues Deutschland und eine neue Haltung zu dem Land. Manche von uns sind sogar Patrioten und denken sich nichts dabei: Bei der WM 2010 hängten zwei Deutsch-Libanesen in Berlin eine 20 Meter große schwarzrotgoldene Fahne aus ihrer Wohnung, die nachts von deutschen Linken abgerissen wurde. Am nächsten Tag kauften die beiden eine neue. Neue Deutsche reisen gern ins Land ihrer Eltern, schreiben darüber Bücher und kehren noch lieber zurück nach Deutschland. Sie verändern das Bild von den Migranten und das von den Deutschen. Manche werden zum Aushängeschild dieser Gesellschaft, die seit kurzem in der Welt den Ruf hat, offen, innovativ und vielfältig zu sein. Der Regisseur Fatih Akin wird bei den Filmfestspielen von Cannes als deutscher Filmemacher gefeiert. Touristen, die nach Berlin reisen, kehren beschwingt zurück, erzählen zu Hause von den Sehenswürdigkeiten, dem Reichstag, dem Holocaust-Mahnmal, aber auch von Stadtteilen wie Kreuzberg und Neukölln, die anders deutsch sind. Sie sehen in Deutschland ein kreatives und lebendiges europäisches Land. Es gibt sie, diese andere Wahrnehmung der Migration in Deutschland.
So, wie einige nostalgisch der Vergangenheit nachhängen und sich ein überschaubares Deutschland mit Bonn als Hauptstadt zurückwünschen, so malen wir uns ein Deutschland der Zukunft aus. Darin gibt es keine Parallelwelten, sondern nur eine Gesellschaft. Das Wort Migrationshintergrund ist aus dem Wortschatz gestrichen, denn die Kinder von Einwanderern werden einfach Deutsche genannt. Manche von ihnen haben die Teilung erlebt, manche hatten einen Großvater im Krieg, und manche haben eine Mutter, die aus Polen stammt. Der eine Deutsche hat auch einen türkischen Pass, die andere Deutsche hat schwarze Haare, und niemand wundert sich darüber. Manche machen Probleme, andere haben Erfolg. Manche sind Straftäter, andere Geschäftsleute, aber niemand würde auf die Idee kommen, die Statistik danach aufzudröseln, wer deutsche Eltern hat und wer ein Kind von Iranern, Vietnamesen, Türken, Polen, Russen oder Arabern ist.
Wir finden, dass es nach einer ziemlich konkreten Utopie klingt. Mit weniger wollen wir uns nicht zufriedengeben.
II.Wer wir sind
Ein Polenkind wird deutsch
Von unserer Ankunft in Westdeutschland gibt es ein Foto, aufgenommen im Hauptbahnhof von Hannover: Mein Vater, der schon Wochen zuvor nach Deutschland gekommen war, trägt die zwei Koffer, mit denen meine Mutter, mein Bruder und ich angereist sind. Meine Mutter blickt auf einen großen Blumenstrauß in ihrer Hand, der in blaue Folie eingeschlagen ist. Sie strahlt, sie sieht unfassbar glücklich aus. Ich aber stehe ratlos herum. Ich trage eine beige Jacke und eine graue Hose, die Farben des Sozialismus. Ich bin acht Jahre alt und sehe aus wie ein verlorenes Polenkind, dem gerade etwas abhandengekommen ist.
Es ist ein schlechtes Foto, ziellos geschossen, dunkel und unscharf. Aber diese eingefrorene Szene erzählt viel von der Ahnungslosigkeit, mit der wir in unser neues Leben stolperten.
Der 20. Mai 1988 brach heran, gut 16 Stunden hatte der Zug gebraucht, um uns aus dem oberschlesischen Opole nach Hannover zu bringen. Da waren wir, die Polen in Deutschland, die glaubten, nun Deutsche werden zu können. Vor dem Bahnhof parkte der silberne Opel Senator, mit dem mein norddeutscher Onkel und mein Vater uns in die neue Heimat bringen wollten.
Der Opel raste mit 230 Stundenkilometern über die Autobahn. In einem Auto wie diesem hatte ich nie zuvor gesessen, aus Polen kannte ich nur unseren kleinen Fiat Polski, der schnell überhitzte. Auf die Rücksitze hatte mein Onkel eine Decke gelegt, um die Sitze zu schonen. Dennoch sollten wir nicht essen. Das war mein erster Eindruck davon, was deutsch ist. Wir fuhren auf Hamburg zu, und ich war überrascht, wie hell die Stadt leuchtete in der Nacht. Sie war eingetaucht in diesen merkwürdigen orangenen Schimmer, den ich bis dahin nicht gekannt hatte. Das Licht schien mir wärmer zu sein als in Polen.
Die beiden Gepäckstücke im Kofferraum waren das Einzige, was wir aus unserem alten Leben mitgenommen hatten. Wir Kinder wussten da noch nicht, dass die Eltern längst beschlossen hatten, nicht mehr zurückzukehren. Sie sagten es uns erst eine Woche später. Meine erste Reaktion: eine schwere Mittelohrentzündung und hohes Fieber. Eine Woche lang war ich fast bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, stellte ich keine Fragen.