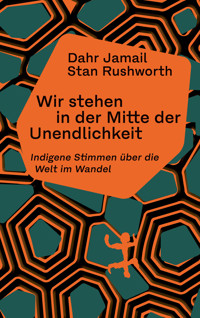
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie können wir den immer häufigeren Hitzewellen begegnen? Wie bereiten wir uns am besten auf nahende Überflutungen und Lebensmittelknappheit vor? Und wie behalten wir Hoffnung in krisengeplagten Zeiten? Fragen wie diese scheinen westlichen Gesellschaften angesichts der Klimakrise, die weltweite soziale und ökologische Umwälzungen verursacht, aktueller denn je. Doch zahlreiche Bevölkerungsgruppen waren schon vor Jahrhunderten mit ihnen konfrontiert. Für Indigene Gruppen sind sie Teil einer generationenüberdauernden Geschichte von Unterdrückung, Pandemie, Hungersnot, Umsiedlung und zerstörerischem Krieg. Allein dank ihrer Resilienz sind Indigene Menschen noch heute in Nordamerika präsent und verfügen mit ihren Erfahrungen über ein einzigartiges Verständnis für zivilisatorische Zerstörungen. In Gesprächen mit Stan Rushworth und Dahr Jamail teilen Angehörige verschiedener nordamerikanischer Nations und ganz unterschiedlichen Alters ihre Sicht auf die Welt. Das Ergebnis ist ein innovatives Forschungs- und Reportagewerk, das Indigene Stimmen in den Mittelpunkt der Gespräche über die heutige Umweltkrise stellt. Von geschmolzenen Gletschern über Migration, Generationentraumata, den unbändigen Willen zu überleben und Visionen für eine mögliche Zukunft, die sich aus einer Tausende Jahre umspannenden Geschichte ableiten, kann die Welt lernen, was es braucht, um sich den aktuellen Krisen der Gegenwart zu stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WIR STEHEN IN DER MITTE DER UNENDLICHKEIT
Dahr Jamail |Stan Rushworth (Hg.)
WIR STEHEN INDER MITTE DERUNENDLICHKEIT
Indigene Stimmen über die Welt im Wandel
Aus dem Englischen von
Simoné Goldschmidt-Lechner
Für all unsere Verwandten
Wir stehen in der Mitte der Unendlichkeit.
– John Trudell (Santee)
INHALT
ANMERKUNGEN DER ÜBERSETZERIN
VORWORT
FRÜHE WARNUNGEN
DIE INTERVIEWS: ANMERKUNG DER REDAKTION
1 | Präsidentin Fawn Sharp (Quinault) STÄRKE
2 | Gregg Castro (Salinan/Ohlone) EIN GEFÜHL VON BESTÄNDIGKEIT
3 | Ilarion Merculieff (Unangan) AUS DEM HERZEN LEBEN
4 | Raquel Ramirez (Ho-Chunk, Ojibwe, Lenca) BEWUSSTSEIN
5 | Lyla June Johnston (Diné [Navajo], Tsétsêhéstâhese [Cheyenne]) VERTRAUEN
6 | Dr. Kyle Powys Whyte (Potawatomi) VERWANDTSCHAFT
7 | Terri Delahanty (Cree) HEILIGE WEIBLICHKEIT UND HEILIGE MÄNNLICHKEIT
8 | Steven Pratt (Amah Mutsun) ZUM FEUER ZURÜCKKEHREN
9 | Marita Hacker (Hunkpapa, Norwegerin) VERÄNDERUNG
10 | Shannon Rivers (Akimel O'otham) GLEICHGEWICHT
11 | Edgar Ibarra (Chicano, Yoeme, Tarahumara) HEILUNG
12 | Alexii Sigona (Amah Mutsun) VERWALTUNG
13 | Tahnee Henningsen (Konkow Maidu) DER MUT, SICH ZU ERINNERN
14 | Melissa K. Nelson, PhD (Anishinaabe/Métis [Schildkrötenberge Chippewa]) WAHNVORSTELLUNGEN MIT ALCHEMIE ZERSTREUEN
15 | Kanyon Sayers-Roods (Mutsun Ohlone/Chumash) KULTURELLE KOMPETENZ
16 | Der Ehrenwerte Ron W. Goode (North Fork Mono) RESTAURATION
17 | Corrina Gould (Confederated Villages of Lisjan) ANERKENNUNG
18 | Natalie Diaz (Mojave/Akimel O'odham) DIE MÖGLICHKEITEN DER SPRACHE
19 | Melina Laboucan-Massimo (Lubicon Cree) PARADIGMENWECHSEL
20 | MEDIZIN
DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN DER ÜBERSETZERIN
In diesem Buch sind Interviews verschiedenster insbesondere nord- und mittelamerikanischer Indigener Menschen versammelt. Einige Aussagen, die sich auf das inhärent Feminine und inhärent Maskuline beziehen, muten im aktuellen Diskurs in Deutschland problematisch an. Darüber hinaus ist in Deutschland die Sichtweise auf Indigene Personen nach wie vor stark von Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert, von Wanderschauen mit Indigenen Personen, Völkerschauen in Zoos wie Hagenbecks Tierpark und Karl May geprägt. Insbesondere die hochproblematische rassistische Vorstellung des »edlen Wilden« oder von Indigenen Menschen als »naturbelassenem Volk«, das »eins ist mit der Natur«, ist in der deutschen Gesellschaft, angereichert durch theosophische und esoterische Strömungen und deren Traditionen, nach wie vor präsent.
Wenn also einzelne hier in den Interviews vertretene Positionen im Westen populäre problematische Vorstellungen teilweise aufgreifen, so darf nicht vergessen werden, dass auch Indigene Menschen nicht frei sind von internalisierten Rassismen und von teilweise problematischen Weltanschauungen und dass es vor allem darüber hinaus einen Unterschied macht, aus welcher Positionierung heraus bestimmte Aussagen getätigt werden. Was dieses Buch aber gerade so besonders macht, ist die unredigierte Vielzahl von Meinungen und Stimmen zur Klimakatastrophe, die aus der Perspektive Indigener Menschen erzählt werden.
Mit dieser Vorbemerkung soll verhindert werden, dass Aussagen interviewter Personen unkritisch und ohne Bezugnahme auf den jeweiligen Kontext übernommen und neu gesetzt werden.
Es folgen einige Hinweise zu den Übersetzungsentscheidungen für bestimmte Begriffe: Eine Zeit lang wurde der Begriff »weiß« in Übersetzungen kursiv gesetzt, um darauf hinzuweisen, dass es sich nicht (nur) um Hautfarbe, sondern um eine Gruppe handelt, die diesen Status aufgrund bestimmter Privilegien in der Gesellschaft genießen und dass dies vom Kontext abhängig ist. Zum Beispiel gelten armenische und türkische Personen in Deutschland als Personen of Color, im nordamerikanischen Kontext jedoch häufig nicht. Da aber den Begriff kursiv zu setzen das Weißsein hervorhebt und betont, ist es mittlerweile gängiger, diese Bezeichnung nicht kursiv zu schreiben oder nur den ersten Buchstaben kursiv zu setzen. Die im Deutschen auf besondere Weise rassistische Entsprechung des Begriffs »Indian« wird nur als Selbstbezeichnung ins Deutsche übertragen. Analog zum Begriff Schwarz als politischer Selbstkategorisierung, wird Indigen stets groß geschrieben. Der Begriff »Indigen« selbst ist nicht unumstritten, greift er doch, insbesondere im Deutschen, auf eine lange Geschichte rassistischer Stereotype zurück. Allerdings beinhaltet das englische Wort »indigenous« dieselben Problematiken, sodass hier entschieden wurde, durch die Großschreibung im Deutschen die politische Selbstkategorisierung in den Vordergrund zu rücken, die im Englischen häufig durch den Begriff »Indian« erfolgt. Der Begriff »Stamm« oder »in Stämmen lebend« ist ebenfalls problematisch. Im Englischen wird unterschieden zwischen »nation«, im Sinne von Volk, und »tribe«, das dieselben problematischen Konnotationen wie das Wort »Stamm« beinhaltet. Um bestmöglich die Bedeutung des Gesagten zu übertragen, wurde daher »tribe« meist als »Volk« übersetzt, und in den Fällen, in denen es um eine klare Zuschreibung von außen oder eine gewollte Eigenbezeichnung geht, als »Stamm« übertragen.
VORWORT
von Stan Rushworth
Oft hören wir: »Wir waren noch nie an diesem Punkt.« Es gibt ein großes Artensterben, wir erleben eine globale Pandemie, globale Veränderungen der Wettermuster verursachen weltweit soziale und ökologische Umwälzungen, die Erde befindet sich auf einem Weg hin zu einer Erwärmung, die mit Sicherheit weitere Umwälzungen in menschlichen und nicht-menschlichen Gemeinschaften verursachen wird, und Wissenschaftler*innen debattieren über die Ursprünge dessen, was sie als Anthropozän bezeichnen, von dem sie sagen, es sei die Ursache für all diese Verwüstungen. Für viele Menschen bedeutet die Aussage »Wir waren noch nie an diesem Punkt«, dass sie die Auswirkungen des menschlichen Verhaltens auf die Erde und die Zukunft noch nie bemerkt haben, aber das gilt nicht für alle Menschen und Kulturen. Für die Indigenen Völker der Welt ist die radikale Veränderung des Planeten und des Lebens selbst eine Geschichte, die viele Generationen umfasst. Bei den Bewohner*innen der nordamerikanischen Prärie dauerte die Ausrottung der Büffel, deren Population von 60 Millionen auf einige Hundert zurückging, nur eine Menschengeneration, von Anfang bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert sagte ein Indigener Mann der Prärie: »Ich kenne mehr Tote als Lebende.« In der kalifornischen Indigenen Bevölkerung kam es in der letzten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zu einem Bevölkerungsrückgang um mehr als 90 Prozent, der auf die von den Siedler*innen in Kauf genommenen Gräueltaten zurückzuführen ist. Dies sind nur zwei Beispiele innerhalb eines kurzen Zeitraums, für einen gewaltigen und radikalen Wandel, der Jahrhunderte zuvor für eine riesige Zahl von Menschen begann, wenn kolonisierende Völker sie erreichten. Für die Indigene Bevölkerung in ganz Amerika haben Krankheiten, Hunger, Ressourcenabbau und Versklavung einen hohen Tribut gefordert, und die Auswirkungen, wenn nicht sogar die absichtliche Fortführung dieser Aspekte, führen weiterhin zu radikalen Veränderungen des »Lebens, wie wir es kennen«. Die gleiche Erfahrung gilt für die Welt als Ganzes.
Auf der Suche nach Lösungen für die vielfältigen Probleme, mit denen die Weltgemeinschaft heute konfrontiert ist, suchen viele Menschen in anderen Kulturkontexten nach neuen Ideen; Ideen, die auch als sehr alte Lebensweisen angesehen werden können, die auf lange Sicht nicht so zerstörerisch sind. Sie suchen nach »Indigener Weisheit«, wie sie sie sich vorstellen, denn beim Blick in die Vergangenheit und vor allem bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass Indigene Gesellschaften größtenteils eine viel stärker integrierte Beziehung zur Erde und ihren Mitgestalter*innen hatten.
Diese Zusammenstellung von Interviews soll all jenen eine Hilfestellung sein, die nach Ideen und Antworten auf die heutigen Lebensumstände suchen, indem sie eine große Vielfalt von Perspektiven auf das präsentiert, was geschehen ist, was weiterhin geschieht und was angesichts der uns umgebenden Entwicklungen in naher und ferner Zukunft wahrscheinlich geschehen wird. Die Indigenen Völker mussten sich anpassen, ausharren, mutig und einfallsreich sein angesichts der Zerstörung, und dies war und ist kein einfaches Unterfangen. Es ist ein sehr komplexer und langwieriger Prozess, und man kann viel lernen, wenn man sich die individuellen und kollektiven menschlichen Erfahrungen dazu anhört. In diesem Sinne repräsentieren die Menschen auf diesen Seiten viele verschiedene Indigene Kulturen und Gemeinschaften, Generationen und Orte innerhalb der Indigenen und nicht-Indigenen Gesellschaft gleichermaßen. Sie erzählen ihre eigenen Geschichten, vermitteln ihre Ideen und Gefühle darüber, wo wir alle jetzt stehen, und jede*r von ihnen versucht, einen Beitrag zu einem tieferen Verständnis darüber zu leisten, wie wir am besten reagieren können. Für viele Indigene Kulturen besteht die Kraft des Erzählens darin, sich in der Geschichte wiederzufinden und, wenn sie vor einer wichtigen Entscheidung im eigenen Leben stehen, von ihr zu zehren. Sie wird zu einem aktiven Werkzeug, und in diesem Sinne ist auch unsere Sammlung ein Angebot.
FRÜHE WARNUNGEN
von Stan Rushworth
Diese Begebenheit wurde 1992 von einem Professor der Anthropologie und Archäologie in einer Vorlesung über die Geschichte der nicht-westlichen Völker Nordamerikas erzählt, und ist mir seither im Gedächtnis geblieben:
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die industrielle Revolution in vollem Gange war, erkannten die Industriellen, dass das Land der Indigenen Reservate, das einst als wertlos galt, die Mineralien, das Öl und das Gas enthielt, die eine industrielle Wirtschaft benötigte. Sie wandten sich an die Anführer*innen Indigener Gemeinschaften, von denen viele noch ihre alten Regierungsmethoden beibehalten hatten, in denen Frauen eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung spielten und die alle betroffenen Stammesmitglieder anhörten. Die Industriellen versprachen Reichtum und Geld, um in der modernen Welt Fuß zu fassen, aber die Gemeinschaften der Indigenen Völker und insbesondere ihre Großmütter, sagten: »Nein, das ist nicht die richtige Art, mit Mutter umzugehen, und das wird Konsequenzen haben.« Die Industriellen wandten sich daraufhin an den Kongress und baten ihn, eine Lösung für dieses Problem zu finden, was zu den folgenden Worten führte: »Wir müssen den Gemeinschaftssinn zerstören, den Sinn für das Individuum fördern und eine gute protestantische Arbeitsmoral schaffen.« Der Professor fuhr fort und beschrieb die daraus resultierende Neuordnung Indigener Gemeinschaften durch die US-Regierung nach ihrem eigenen Bild, die Etablierung von Stammesräten mit Männern an der Spitze, von denen viele aus Internaten kamen, die ihnen die traditionellen Werte, die Sprache und die Kultur nehmen wollten. Mehrheitsentscheidungen traten oft an die Stelle von Formen des Konsenses, und viele Gebiete Indigener Gemeinden wurden mit verheerenden Folgen, die bis heute nachwirken, überrannt. Die Warnungen der Großmütter von vor 120 Jahren sind unser Erbe. Die Erzählung des Professors war vor fast dreißig Jahren eine Seltenheit in der akademischen Welt und für die breite Öffentlichkeit völlig unsichtbar. Das bedeutet jedoch nicht, dass Indigene Völker dazu geschwiegen hätten, wie es zu unserer heutigen Situation gekommen ist. Viele haben sich direkt an ihre eigenen Gemeinschaften und auch an die Weltgemeinschaft gewandt.
Als Ella Cara Deloria 1944 in ihrem Buch Speaking of Indians das präkoloniale Leben ihres Volkes erläuterte, schrieb sie: »Die Zielsetzung des Dakota-Lebens war, von allem Beiwerk befreit, recht einfach: Man muss die Regeln der Verwandtschaft befolgen; man muss ein guter Verwandter sein. Kein Dakota, die*der dieser Lebensart gefolgt ist, wird das bestreiten. Letztlich waren alle anderen Überlegungen zweitrangig: Besitz, persönlicher Ehrgeiz, Ruhm, gute Zeiten, das Leben selbst. Ohne dieses Ziel und den ständigen Kampf, es zu erreichen, wären die Menschen in Wirklichkeit keine Dakotas mehr. Sie wären nicht einmal mehr Menschen. Ein guter Dakota zu sein, bedeutete also menschlich und zivilisiert zu sein.«
Wenn wir fünfundsiebzig Jahre später auf diese Werte zurückblicken, unter einem tiefgrauen, orangefarbenen Himmel, der von den Waldbränden im gesamten Westen der Vereinigten Staaten erhellt wird, inmitten einer unkontrollierten globalen Pandemie, inmitten tiefgreifender sozialer Unruhen, einschließlich gewalttätiger Proteste und Morden sowohl durch die Polizei als auch durch verschiedene protestierende Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen; in einer Zeit, in der eine große Zahl von Arten ausstirbt, weil die Menschenpopulation wächst und ihre Lebensräume bedroht werden, und in der ein Großteil der wissenschaftlichen Welt eine rasch eskalierende Klimakrise beschreibt, die alle sozialen und ökologischen Ungleichgewichte noch verschärft, müssen wir Delorias Beschreibung der Zivilisation ehrlich in Erwägung ziehen. Ihren Worten zufolge hat diese Zivilisation versagt. Sie hat ihr eigenes Volk im Stich gelassen, ihren Lebensraum und diejenigen, in deren Leben sie eingegriffen hat, Indigene und nicht-Indigene, menschliche und nicht-menschliche. Wir befinden uns in einer Zeit und in einem Zustand, in dem wir keine guten Verwandten sind, und sind daher nicht »menschlich, zivilisiert«. Deloria spricht zwar im Hinblick auf ihr eigenes Volk, aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass alle Indigenen Völker der Schildkröteninsel, die heute die Vereinigten Staaten heißt, sowie ihre Nachbarn ähnliche, wenn nicht sogar genau dieselben Werte teilten. Dies zeigt sich auch an den frühen Warnungen vieler Indigener Völker weltweit vor den heutigen Katastrophen. Die folgenden sind nur einige von vielen, und sie stammen aus relativ naher Vergangenheit.
1976 sprach der Hopi-Älteste Thomas Banyacya vor dem Habitat-Forum der Vereinten Nationen in Vancouver, British Columbia, mit klare Worten. »Es ist an der Zeit, sich an sinnvollen Maßnahmen zu beteiligen. Die Zerstörung von Land und Leben findet statt und beschleunigt sich in rasantem Tempo. Unser Indigenes Land wird weiterhin auseinandergerissen und von den Konzernen dieser Nation seiner Heiligkeit beraubt.« Seine Warnung ist unmissverständlich, und seine Ermahnung zum Wandel ist ebenso direkt. »Wir haben eine Alternative zu dieser Situation. Die Menschheit hat die Chance, die Richtung dieser Bewegung zu ändern, eine Kehrtwende zu machen und sich in Richtung Frieden, Harmonie und Respekt für Land und Leben zu bewegen. Die Zeit ist jetzt reif. Später wird es zu spät sein.«
1948 kam eine Versammlung der Ältesten der Hopi zusammen, um sich mit dem Stand der Dinge um sie herum zu befassen. Thomas ging aus diesem Rat mit einer Botschaft hervor, die er für das nächste halbe Jahrhundert vertrat. Er war sich sehr wohl bewusst, dass seine Stimme eine unter vielen war, und er widmete sein Leben der Verbreitung dieser wichtigen Botschaft an alle Menschen. Seine Vision umfasste das gesamte Leben und war politisch nicht auf ein Volk, sondern auf alle Menschen ausgerichtet. Auf dem erwähnten Habitat-Forum der Vereinten Nationen 1976 deklarierte Thomas außerdem: »Die Hopi und andere spirituelle Führer der Indigenen Völker sind sehr besorgt über den Zustand unserer Mutter Erde. Sie haben beobachtet, wie die weißen Brüder systematisch die Indigenen Völker und die natürlichen Ressourcen zerstört haben. Unserem Glauben und unseren Prophezeiungen zufolge wird die Existenz des Menschen auf dieser Welt bald beendet sein, wenn diese Zerstörung weitergeht. Wir bitten die Vereinten Nationen nicht um Hilfe in materieller Hinsicht. Gemäß der Hopi-Prophezeiung versuchen wir lediglich, die Welt darüber zu informieren, was passieren wird, wenn die Zerstörung der Erde und ihrer ursprünglichen Völker, wie sie bereits unsere religiösen Hopi-Ältesten erfuhren, weitergeht.«
Er wies auch darauf hin, dass ein Leben auf dem richtigen Weg Anstrengung erfordere, dass diese Anstrengungen seit sehr langer Zeit unternommen würden und dass sie sich auf die grundlegendsten Werte konzentrierten. »Die Hopi und alle Indigenen Brüder haben in ihrer Existenz ständig darum gekämpft, die Harmonie mit der Erde und dem Universum zu erhalten. Für die Hopi ist das Land heilig, und wenn das Land missbraucht wird, verschwindet die Heiligkeit des Lebens der Hopi und auch alles andere Leben. Das Land ist die Grundlage der Hopi, allen Lebens und die Grundlage des Hopi-Standes.«
Seine Vision beinhaltet Anweisungen des »Großen Geistes Massau'u« darüber, wie man auf heilige Weise leben solle. »Massau'u sagte, man solle nichts von der Erde für zerstörerische Zwecke nutzen und nicht wahllos Lebewesen zerstören.« Er sah das Kommen der Atombombe als den »Becher aus Asche« der Hopi-Prophezeiung, die besagt, »dass viele Menschen sterben werden und dass [wenn dies geschieht] das Ende der materialistischen Lebensweise nahe ist«. Die Anweisungen von Massau'u besagen weiter, »dass der Mensch in Harmonie leben und ein gutes, sauberes Land für alle zukünftigen Kinder erhalten soll und dass er sich um das Land und ein Leben für den Großen Geist kümmern soll«.
Thomas wies darauf hin, dass die Hopi dies aus eigener Erfahrung wussten, weil wir jetzt in der »vierten Welt« lebten. »Bei dem Treffen im Jahr 1948 erklärten 80-, 90- und sogar 100-jährige Hopi-Führer, dass der Schöpfer die erste Welt in perfektem Gleichgewicht erschaffen habe, dass in dieser Welt die Menschen eine einzige Sprache gesprochen, sich aber von moralischen und spirituellen Prinzipien abgewandt hätten. Sie missbrauchten ihre spirituellen Kräfte für egoistische Zwecke. Sie hielten sich nicht an die Regeln der Natur. Schließlich wurde die Welt durch das Versinken von Land und die Trennung von Land durch das, was ihr als große Erdbeben bezeichnen würdet, zerstört. Viele starben und nur eine kleine Handvoll überlebte. Dann kam diese Handvoll friedlicher Menschen in die zweite Welt. Sie wiederholten ihre Fehler und die Welt wurde durch eine Vereisung zerstört, die ihr die große Eiszeit nennt.« Er fuhr fort und erzählte von den wenigen Menschen, die dann in die dritte Welt gelangten, eine Welt der Technologie, der Maschinen und der Annehmlichkeiten. »Sie hatten sogar geistige Kräfte, die sie für das Gute einsetzten. Aber das Gleiche passierte wieder. Sie wandten sich allmählich von den Naturgesetzen ab und strebten nur noch nach materiellen Dingen ... während sie geistige Prinzipien verhöhnten. Niemand hielt sie von diesem Kurs ab, und die Welt wurde durch eine große Flut zerstört, an die sich viele Völker in ihrer alten Geschichte oder in ihren Religionen noch erinnern.« Er sagte, dass wir uns jetzt in der vierten Welt befänden und dass »unsere Welt wieder in einem schrecklichen Zustand ist, obwohl der Große Geist uns verschiedene Sprachen gegeben hat und uns in die vier Ecken der Welt geschickt hat und uns gesagt hat, dass wir uns um die Erde und alles, was auf ihr ist, kümmern sollen«.
Wie auch immer man sich der Hopierzählung, die uns in diese vierte Welt gebracht hat, nähern mag, das Muster dahinter, die Tatsache ist unverkennbar: Unsere Existenz in der vierten Welt verstößt gegen die Art, wie wir existieren sollten, und widersetzt sich ebenso der Notwendigkeit zu handeln. In dieser Rede spricht Thomas nachdrücklich über den Zustand der heutigen Nation, darüber, wie diese Anweisungen ignoriert werden: »Das System der Vereinigten Staaten hat gegen diese religiösen Anweisungen verstoßen und nun fast unser ganzes Land und unsere Lebensweise zerstört. Alle Hopi und andere First Nations, die ersten Völker Amerikas, stehen zu diesem religiösen Prinzip. Nicht nur die Hopi haben darum gekämpft, die Erde und ihre Existenz zu schützen und zu erhalten, sondern die First Nations der Amerikas haben darum gekämpft, sich in der heutigen Welt zu behaupten. Die gegenwärtigen repressiven Regierungen beider Amerikas machen die Existenz der First Nations weiterhin zu einem ständigen Kampf ums Überleben.«
»Die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen sollten begreifen, dass sie weder Frieden und Harmonie noch das Gute im Leben herbeiführen können, wenn sie die Missstände auf dem amerikanischen Kontinent nicht korrigieren.«
Diese Botschaft verbreitete Thomas überall, auf großen Veranstaltungen wie der, der diese Passagen entnommen sind, in Videos, bei Bürgerversammlungen und in den Häusern der Menschen der Schildkröteninsel. Viele Jahre lang versuchte er, die Vision und die Warnung der Hopi bei den Vereinten Nationen in Genf vorzutragen, und nachdem er es dreimal versucht hatte, nur um ignoriert zu werden, wurden ihm beim vierten Mal endlich zehn Minuten Redezeit gewährt, 1992, während einer Pause, vor vielen leeren weißen Stühlen. Oren Lyons von den Six Nations gab drei Rufe von sich und kündigte an, dass eine Botschaft von geistiger Bedeutung vorgetragen werden sollte, dann streute Thomas Maismehl und sprach. Die Botschaft wurde vorgetragen, und als Thomas geendet hatte, sagte der Vorsitzende auf dem Podium unter dem Beifall der wenigen Anwesenden: »Ich danke Herrn Thomas Banyacya. Ich bin sicher, dass Ihre Worte und Ihre Weisheit gebührend zur Kenntnis genommen wurden«, dann schlug er einmal mit dem Hammer auf den Tisch, und die Anwesenden verließen den großen Saal.
In den 1960er Jahren reiste auch Phillip Deere (Muskogee) überall hin, wo er nur konnte, und verkündete eine weitere klare Botschaft darüber, dass »die herrschenden Gesellschaften« sich in die falsche Richtung bewegten und dass das, was sie taten, schon bald »aus den Fugen geraten« würde. Wie Thomas ging auch er 1977 zu den Vereinten Nationen in Genf und verkündete dort seine konsequente Botschaft über das richtige Beziehungsverhältnis zwischen den Menschen und zwischen Mensch und nicht-Menschen und was bei deren Verletzung geschehen würde. In einer Rede von 1978 mit dem Titel »Ein verstandenes Gesetz (An Understood Law)« sagte er: »Ich sehe, dass sich diese Zivilisation in der Zukunft vielleicht dem Ende nähert. Aus diesem Grund haben wir die Anweisungen unserer Vorfahren befolgt.« Er verbrachte sein Leben damit, die jungen Indigenen Menschen zu ermutigen, von ihren Ältesten zu lernen und sich daran zu erinnern, dass »wir Teil der Natur sind« und dass das Leben der Indigenen Menschen der Natur nachempfunden sei, ganz gleich, wie sehr die Kolonialgesellschaften versuchten, »sie zu anderen zu machen«, die nach dem westlichen Vorbild gestaltet seien. Phillip erläuterte, dass in den 1960er und 1970er Jahren junge Indigene Personen auf der Straße protestierten und für ihre Rechte eintraten, weil die Verwüstung von Land, Wasser und Himmel ihnen das Herz brach. Sie kämpften nicht nur für ihre politischen Rechte innerhalb des kolonialen Systems, sondern auch für die Erde selbst. Sie kämpften für ihre kulturelle Vision, die deckungsgleich war und ist mit dem Kampf für die Erde.
Phillip sprach von den großen Unterschieden zwischen den Indigenen Gesellschaften und den Neuankömmlingen und forderte die Menschen auf, soziale Gerechtigkeit und Umweltbeziehungen als ein und dasselbe zu betrachten. »Die Gefängnisse in diesem Land sind nicht mehr als vierhundert Jahre alt. Vor der Ankunft von Kolumbus lebten hier mehr als vierhundert Stämme, die unterschiedliche Sprachen sprachen, unterschiedliche Sitten hatten und unterschiedliche Religionen lebten. Keiner dieser Stämme hatte Gefängnisse. Sie hatten keine Gefängnismauern. Sie hatten keine psychiatrischen Anstalten. Kein Land kann heute ohne sie existieren. Warum gab es bei uns keine Gefängnisse? Weil wir nach einem verständlichen Gesetz lebten. Wir haben verstanden, worum es im Leben geht. Bis zum heutigen Tage sind wir nicht verwirrt.«
Phillip definierte diese fehlende Verwirrung als das, was man heute als »Inklusivität« bezeichnet, aber er drückte es anders aus. Als er beschrieb, wie so viele verschiedene Gesellschaften das Zusammenleben hier meisterten, sagte er: »Wir sind uns nicht uneins über unsere Religion. Ich habe nie versucht, das Volk der Lakota zu Muskogee zu bekehren. Wir respektieren die Religion der anderen. Wir respektieren die Visionen der anderen. Das ist unsere einzige Möglichkeit, hier in diesem Land zu überleben – das ist unser Überleben. Das ist unsere Stärke.« Dann fügte er mit Nachdruck hinzu, was nicht vergessen werden darf: »Auch wenn wir zahlenmäßig weit unterlegen sind, werden unsere Ideen diese Zahlen überwinden!«
Phillip sprach davon, wie die Menschen den natürlichen Gesetzen des Respekts folgten und wies auf, dass die Behandlung der natürlichen Welt und der Menschen in dieser Welt ein und dasselbe ist und dass eine Gesellschaft oder Zivilisation ohne diesen Respekt nicht funktionieren kann, weder in Bezug auf sich selbst noch in Bezug auf ihre Mitglieder oder ihren Lebensraum. »Eine verwirrte Gesellschaft kann nicht ewig existieren. Die ersten Menschen, die hierherkamen, waren verloren. Sie sind immer noch verloren! Sie haben sich so weit von ihrer natürlichen Lebensweise entfernt, dass die Regierung die Indigene Sprache nicht versteht. Die Menschen in dieser Gesellschaft wurden vertrieben und so weit von der Realität entfernt, dass sie sich nicht mehr unter einen Baum setzen und mit uns reden können.«
Er sprach auch immer wieder davon, dass die Kolonialbevölkerung Amerikas mehr als alle anderen »diskriminiert« werde, weil sie der Kenntnis der wesentlichen Wahrheit beraubt worden sei, sowohl historisch als auch philosophisch. »Ich denke, der weiße Mann wird am meisten diskriminiert, weil er von seinesgleichen diskriminiert wird. Die Wahrheit! Wir glauben an die Wahrheit und nicht an die Fakten, denen diese Gesellschaft folgt.« Er behauptete, dass sie einer Beziehung zu ihrer eigentlichen Geschichte und zu ihrer eigenen Natur beraubt seien, und dass ihre Zivilisation sie beide Aspekte habe vergessen lassen.
1978 marschierten Hunderte Indigene Menschen der Amerikas von San Francisco nach Washington DC, um gegen die Verletzung der Land- und Wasserrechte ihrer Völker zu protestieren. Es war eine Zeit, in der sich ein Großteil Amerikas gegen Aktivist*innenbewegungen wehrte, welche die amerikanische Gesellschaft aufforderten, zu ihrem Wort in Verträgen und zwischenmenschlichen Beziehungen zu stehen und damit zu beginnen, die moralische Grundlage zu respektieren, die die Indigenen Völker in ganz Amerika in ihrer Beziehung zur Erde pflegten und immer noch pflegen. Unter Bezugnahme auf die Indigene Bewegung und den sogenannten Longest Walk von 1978 sprach Phillip Deere eine Warnung aus: »Wir werden weitergehen und weitergehen und weitergehen, bis wir die Freiheit für alle Indigenen Völker erlangt haben! Und ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie vielleicht kein Indigener Mensch sind, aber Sie sollten sich uns anschließen. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Ihr Überleben hängt davon ab.«
1990 wandte sich das Volk der Kogi im kolumbianischen Hochland an die BBC, um einen Dokumentarfilm zu produzieren, der international ausgestrahlt werden sollte: From the Heart of the World: The Elder Brothers' Warning (Aus dem Herzen der Welt: Die Warnung der Älteren Brüder). Die Kogi sind ein Volk, das sich vor vierhundert Jahren vor den Spaniern in die hohen Berge zurückgezogen hat und sich seit Generationen auf jede erdenkliche Weise gegen die Kolonialisierung wehrt. Obwohl sie in den Bergen leben, wandern sie zur Küste hinunter, um Muscheln für ihre täglichen Zeremonien zu sammeln, was ihnen einen umfassenden Blick auf die Ergebnisse westlicher Zivilisation ermöglicht. Dieser Einblick hat sie dazu veranlasst, die selbst auferlegte Isolation lange genug zu durchbrechen, um ihre Warnung auszusprechen, bevor sie sich wieder zurückzogen. Die Santa-Marta-Berge, in denen sie leben, sind das höchste Küstengebirge der Welt, sie erstrecken sich von der Meeresküste bis zur Bergspitze, vom tropischen Tiefland bis zu arktischen Berggipfeln, auf denen die Temperatur immer unter null liegt. Sie sind besorgt, weil sie beobachten, wie die Berge sterben, wie das Wasser und das Eis versiegen, die alles unter ihnen nähren. Da sie schon lange vor der Kolonialisierung in einem Mikrokosmos des Planeten lebten, wissen sie, was vor ihren Augen geschieht.
Die Kogi verbrachten vierzehn Monate damit, einen Mann, der sowohl von den Kogi als auch von anderen Indigenen Völkern abstammte, in ihren Bräuchen auszubilden, und zwar ausschließlich zu dem Zweck, ihr Wissen unter allen Gesichtspunkten darzustellen. »Die Große Mutter hat die Welt im Wasser erschaffen. Sie erschafft darin die Zukunft. So spricht sie zu uns. Wir kümmern uns um die Natur. Wir sind die Mamas [Seher*innen/Führer*innen der Gemeinschaft] und tun dies hier. Und wir Mamas sehen, dass ihr sie mit dem, was ihr tut, umbringt. Wir können die Welt nicht mehr reparieren. Ihr müsst es tun. Ihr entwurzelt die Erde. Und wir suchen nach göttlichen Möglichkeiten, herauszufinden, wie wir euch lehren können, damit aufzuhören.«
In diesem Film erinnern sie alle Menschen immer wieder daran, wirklich zu denken, über alles nachzudenken, den Verstand in seinem größtmöglichen Sinne zu nutzen. Sie ermahnen immer wieder: »Denke, denke, denke an die Große Mutter«, die sie den Geist in der Natur nennen. »Nachts, bevor ihr schlaft, denkt darüber nach, was ihr am nächsten Tag tun wollt. Welche Dinge getan werden müssen und wie ihr sie tun werdet. Überlegt es euch gut.«
Sie erklären, warum sie den Film gemacht haben. »Wir müssen diese Dinge erklären. Wir sollten nicht drohen oder beleidigen, aber es ist gut, dass wir sprechen. Wir müssen ihnen [den Jüngeren Brüdern] zeigen, wie wir arbeiten und wie wir der Großen Mutter unseren Tribut zollen, damit sie wissen, dass wir hier auch für den Jüngeren Bruder arbeiten ... nicht nur für die Kogis, sondern für alle Menschen auf der Welt.« Um der Welt zu zeigen, wie sehr sie sich um das gesamte Leben auf der Erde kümmern, nahmen sie den Filmemacher und den von ihnen ausgebildeten Übersetzer auf in ihre zeremoniellen Bräuche, ihre sozialen und landwirtschaftlichen Praktiken und in ihre Philosophie. Sie öffneten sich einer Welt, die alles, was sie für wertvoll und real halten, gefühllos missachtet. Dies ist ein mutiger Akt, der durch ihre Fürsorge allem Leben gegenüber und durch ein Verantwortungsgefühl motiviert ist, das sie in anderen zu wecken suchen.
Eine der Personen, die zu Wort kommen, drückt es mit Klarheit und Autorität aus: »Ich möchte, dass die ganze Welt auf die Warnung hört, die wir euch aussprechen. Sie hat gelehrt, die Große Mutter hat gelehrt, sie hat uns gelehrt, was richtig und was falsch ist, und noch haben wir nicht aufgegeben, so zu leben, wie sie es uns gelehrt hat. Wir erinnern uns an eine Lehre und leben nach ihr. Die Große Mutter lehrte und lehrte. Die Große Mutter gab uns das, was wir zum Leben brauchten, und ihre Lehre ist bis heute nicht vergessen worden. Wir alle leben immer noch nach ihr. Aber jetzt entfernen sie das Herz der Mutter, sie graben den Boden auf und schneiden ihre Leber und ihre Innereien heraus. Die Mutter wird in Stücke geschnitten und von allem beraubt. Seit ihrer ersten Landung haben sie das getan. Auch die Große Mutter hat einen Mund, Augen und Ohren. Sie schneiden ihr die Augen und Ohren heraus. Wenn wir ein Auge verlieren würden, wären wir traurig. Also ist auch die Mutter traurig, und sie wird aufhören zu existieren, und die Welt wird enden, wenn ihr nicht aufhört.«
Erneut bitten die Kogi die äußere Zivilisation, über all das nachzudenken und ehrlich zu sein. »Jüngerer Bruder, wir wissen, dass das Wasser unten zu versiegen begonnen hat. Denke nicht, dass wir dafür verantwortlich sind. Du bist es. Wir machen unsere Arbeit richtig, und weder du noch ich wissen, wann die Welt untergeht, nicht wahr? Hört auf, in der Erde zu graben. Wenn ihr weitermacht, wird die Welt untergehen. Ihr bringt die Welt zu einem Ende. Jetzt senden wir diese Botschaft und fragen: ›Könnten sie glauben, wenn sie uns zuhören, dass wir, die Älteren Brüder, alles zerstört haben?‹ Ich weiß, dass sie das nicht glauben werden.«
Um den Pragmatismus ihrer Philosophie zu verdeutlichen, zeigen sie dem Filmemacher, wie und warum sie auf eine Art und Weise anbauen und ernten, die die Erde nährt, ohne sie zu verletzen, wie sie das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen respektieren, wie wichtig es ist, Kinder und die Welt um sie herum zu lieben, wie sie auf die vorteilhafteste und respektvollste Art und Weise leben, um die Erde zu berühren. Nachdem sie gezeigt haben, was in ihrer Gesellschaft funktioniert, kehren sie zur Warnung zurück. »Wir wollen den Jüngeren einen Rat geben, ihnen die Wahrheit sagen, sodass sie sehen werden, was passiert, wenn sie so weitermachen und ihre Lebensweise nicht sofort ändern.«
Heute versuchen die Kogi immer noch, ihre Umgebung durch Bündnisse mit anderen und durch Indigene Organisationen aufzuklären, und sie kämpfen vor Gericht für den Schutz heiliger Stätten. Sie leben immer noch in kultureller Integrität und widersetzen sich der Zerstörung auf jede erdenkliche Weise. Sie haben eine uralte, pragmatische Vision zu teilen. Sie sehen die Welt um sich herum, sie hören dem Leben zu, und sie sprechen aus, was ihrer Meinung nach gesagt werden muss.
1982 gründete der Mohawk-Führer Jake Swamp-Tekaronianeken die Tree of Peace Society (Baum des Friedens Gesellschaft), ein Ergebnis seiner jahrzehntelangen Bemühungen, der Welt die Geschichte von Skennenrahawi, vor tausend Jahren Friedensstifter, zu erzählen. In dieser Geschichte wird der Friedensstifter in eine Zeit der Gewalt hineingeboren, die er, während er älter wird, durch die Gründung der Haudenosaunee-Konföderation zu heilen versucht. Bei dieser Heilung finden fünf Völker, die einst eins waren, aber auseinandergebrochen waren, wieder zusammen. Skennenrahawi wollte ein Symbol für dieses Zusammenkommen, das Bestand haben sollte, und so wählte er die weiße Kiefer, die heute das Symbol des Volkes der Haudenosaunee ist. Im Geiste des Erinnerns und des Friedens pflanzte Jake Swamp im Laufe seines Lebens überall auf der Schildkröteninsel und in vielen anderen Ländern der Welt Bäume.
Wie auch bei Friedensstiftern lange vor ihm war Jake Swamps Botschaft eine Heilung, und er sprach oft über den Kummer, den fast alle Menschen der Nations hier und weltweit in sich tragen; ein Kummer, der durch all die Zerstörung entstanden ist, die Menschen voneinander und von der natürlichen Welt entfernt hat. Seine durchgängige Botschaft, verpackt in Geschichten und Ermahnungen, forderte dazu auf, in das richtige Beziehungsverhältnis zurückzukehren und sich an die ursprünglichen Anweisungen zu erinnern. In der Geschichte, die er erzählte, sagte er, die Menschen hätten es vergessen und könnten nicht zu Frieden und Einigkeit kommen, weil sie keine Klarheit hätten, um die Zukunft zu sehen. Er sagte, die Menschen hätten ihre Klarheit verloren, weil die Tränen der Trauer über den Verlust, über all das, was geschehen war, sie blendeten. Dieser Schmerz verursache Tränen, die sie blind für die Zukunft machten. Und er sagte, die Menschen hätten die Fähigkeit verloren, zuzuhören, weil sie den Schmerz über das, was geschehen war, nicht ertragen könnten. Er sagte, die Menschen hätten vor lauter Trauer und Schmerz ihre Stimme verloren, sodass sie sich nicht einigen könnten. Die Fähigkeit, zu sehen, zuzuhören und zu sprechen, ist die Grundlage für die Kommunikation und damit für die Suche nach einer gemeinsamen Zukunft.
Er sagte, die Menschen müssten die Betroffenen an die Hand nehmen und ihnen helfen, »ihre Augen zur Schöpfung zu erheben« und »die reinste Wolke zu finden, um die Tränen wegzuwischen«, damit sie wieder sehen könnten. Dann sollten sie wieder zur Schöpfung blicken und »die weichste Feder finden, um die Ohren zu öffnen«, damit sie »den Wind, die Vögel und alles, was auf der Welt Geräusche macht«, hören könnten. Dann sollten sie noch einmal in Richtung Schöpfung greifen und »das reinste Wasser finden, um den Kloß im Hals wegzuspülen«, um wieder sprechen zu können. Zu sehen, zu hören und klar zu sprechen, seien die Grundvoraussetzungen, die seinem Volk vor tausend Jahren Einigkeit gebracht hätten, und das bräuchten wir jetzt wieder. Dies war seine Botschaft.
Um das zu erreichen, was er für notwendig hielt, stellte er sich allen zur Verfügung, großen und kleinen Gruppen, durch Pflanzungszeremonien oder Gesprächskreise oder Diskussionen oder Konferenzen, was auch immer nötig war. Er war überall als freundlicher Mann bekannt, der jeden einbezog. Der Mohawk-Künstler Billy Myers sagte über Jake: »Er hat niemandem die Tür verschlossen, weder Indigenen Menschen noch nicht-Indigenen.« Der Mohawk-Älteste Leonard Four Hawks sagte: »Er war in der Lage, jede Kultur, jede Nationalität zu überwinden, indem er Bäume pflanzte. Noch wichtiger ist, dass er der ältesten Tradition folgte, die wir haben. Was immer wir heute tun, wird sich auf die nächsten sieben Generationen auswirken, also auf die nächsten 140 Jahre. Wir Menschen leben nicht lange, und die meisten Tiere auch nicht, aber Bäume schon.« Als Billy Myers ein Jahr nach Jakes Tod sechs Weißkiefern zu seinen Ehren pflanzte, hängte er »Geisterbänder auf – schwarz, weiß, gelb und rot, um die unterschiedlichen Menschen der Welt zu repräsentieren.« Er folgte damit Jakes Beispiel, denn Jake Swamp schloss alle ein.
Auf diese Weise repräsentierte Jake die Grundlagen Indigenen Denkens, von dem wir hoffen, dass es die Leser*innen auf diesen Seiten spüren und erkennen können. Er war eine Stimme unter vielen, eine, die viele Menschen auf der ganzen Welt erreichte, doch er beschränkte sich nicht nur auf ein breites Publikum, sondern war in seiner Botschaft in jeder Situation konsequent. Sein Kinderbuch Giving Thanks. A Native American Good Morning Message (Danke sagen: Eine Native American Guten Morgen Botschaft) war ein Geschenk für jedes einzelne Kind, das sein grundlegendes Gebet lernte, das jedem einzelnen die Kraft gab, ein gutes Leben in Dankbarkeit zu gestalten. Das Eingangsgebet lautet: »Es ist eine Ehre, ein Mensch zu sein, und wir danken für alle Gaben des Lebens.« Im Einklang mit allen Redner*innen in dieser Sammlung, ob aus der Vergangenheit oder der Gegenwart, muss man sich an diese Worte erinnern.
DIE INTERVIEWS: ANMERKUNG DER REDAKTION
von Dahr Jamail / Stan Rushworth
Die Gespräche in dieser Sammlung folgen einer chronologischen Reihenfolge. Wir haben sie nicht nach Themen geordnet, da sich viele der von den Menschen angesprochenen Themen überschneiden, was auch notwendig ist, wenn man den allumfassenden Wandel betrachtet, mit dem sie sich befassen, sowie die Besitzverhältnisse der Menschen in diesem Land. Obwohl wir grundsätzliche Fragen haben, die sich den Lesenden erschließen werden, hielten wir es für essenziell, den Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen der einzelnen Personen zu folgen und sie in den Vordergrund zu rücken. Diese Art der Herangehensweise hat es uns ermöglicht, von jedem autonomen Individuum und von den vielen Traditionen zu lernen, aus denen sie erwachsen und mit denen sie leben. Jede der Personen hat uns Werkzeuge des Verstehens, des Denkens und der größeren Verbundenheit zur Hand gegeben, und wir bieten diese Perspektiven in der Hoffnung an, dass sie Ihnen das Gleiche bieten mögen.
Um eine klare Darstellung der sehr unterschiedlichen Stimmen, Erfahrungen, Gedanken und Gefühle zu gewährleisten, hatte jede interviewte Person die Möglichkeit, ihren eigenen Teil der Sammlung zu lesen und zu bearbeiten. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Prozess eine möglichst integre Darstellung jedes und jeder einzelnen Beteiligten ergibt. Wir danken allen, die zu diesem Angebot beigetragen haben, und hoffen, dass die hier zusammengetragenen Ansichten für alle, die sie lesen, hilfreich sein mögen. Wir danken Ihnen für die Lektüre.
1 |Präsidentin Fawn Sharp (Quinault)*STÄRKE
Verfasst von Dahr Jamail
Letztlich liegt die Lösung der Krise in unseren Werten, und das haben wir allein damit bewiesen, dass wir heute existieren, ungeachtet dessen, dass das mächtigste Land der Welt versucht hat, uns zu zerstören, uns zu vernichten und zu assimilieren. Wir haben unter großem Schmerz und Leid gelebt. Sie haben gemordet und Genozide begangen und versucht, uns vollständig zu vernichten, aber sie konnten nie den Trommelschlag in unserem Herzen aufhalten. Man kann sich entweder wie Papier zersetzen oder wie Stahl immer stärker werden. Wenn das mächtigste Land der letzten vierhundert Jahre einen nicht aufhalten kann, dann weiß man, dass es an unseren Ressourcen, unseren Gebeten und unserem Segen liegt und an allem, was dieses Land seit Anbeginn der Zeit durchzogen hat. Und wir haben nicht nur überlebt, sondern wir gehen jetzt noch stärker daraus hervor.
– Präsidentin Fawn Sharp
»Dies sind die Häuser unserer Ältesten«, sagte Pierre, als er am Strand von Taholah, Washington, stand und auf die graue, verwitterte Holzverkleidung eines kleinen Hauses zeigte, das kaum fünfzig Meter von der Brandung, die in der Nähe tobte, entfernt lag, ganz in der Nähe von ein paar anderen Häusern. Aus Respekt überlassen die Quinault ihren Ältesten die besten Standorte zum Wohnen.
Das Einzige, was diese klapprigen Bauten von der Küstenlinie trennt, die durch den Anstieg des Meeresspiegels und immer stärkere Stürme stetig weiter vorrückt, ist eine kleine Barriere aus Sanddünen und Felsbrocken, die als Wellenbrecher angelegt wurden. Aber selbst die ist längst zur Hälfte vom Sand begraben.
Pierre Augare ist der Spezialassistent der Präsidentin der Quinault Indian Nation (QIN), Fawn Sharp. Er führte mich durch das Reservat, während ich auf meinen Termin mit der Präsidentin wartete.
»Natürlich werden wir diese Häuser bergauf verlegen, wir haben bereits einen Platz für die Umsiedlung des Dorfes gerodet«, fuhr er fort und wies auf die nahe gelegenen Hügel, auf denen Rotzeder, Douglasie, Hemlocktanne, Kiefer und Sitka-Fichte wuchsen und teilweise fast dreihundert Meter in die Höhe ragten.
Die Quinault gehören zu den wenigen amerikanischen Indigenen Völkern, die auf demselben Land leben und jagen und auf denselben Gewässern paddeln wie ihre Vorfahren vor vielen Jahrhunderten. Die Stämme der Quinault und der Queets bilden zusammen mit den Nachkommen fünf anderer Küstenstämme – den Quileute, Hoh, Chehalis, Chinook und Cowlitz – die Quinault Indian Nation (QIN).
Die Vorfahren der modernen Quinault teilten ihre Lebensweisen mit den Kulturen der nördlich und südlich von ihnen lebenden Menschen. Sie ernährten sich von Meeressäugern und riesigen Lachsschwärmen, jagten Wildtiere und ernteten aus den reichhaltigen Wäldern mehr als genug für die körperlichen und geistigen Bedürfnisse ihrer Vorfahren. Die westliche Rotzeder ist ihr »Baum des Lebens«, denn diese Zeder lieferte Baumstämme für ihre Hochseekanus, Rinde für ihre Kleidung und Bretter für ihre Langhäuser.
Die Quinault sind das Volk der Kanus und das Volk des Zedernbaums. »Wir erinnern uns an unsere Vergangenheit und setzen gleichzeitig moderne Prinzipien in einer Verbindung ein, die unserem Volk jetzt und in der Zukunft Hoffnung und Verheißung bringen wird«, heißt es auf der Website des Stammes.
Präsidentin Sharp, die von ihren Ältesten aufgefordert worden war, als Präsidentin zu kandidieren, gehorchte, gewann und ist seit 2006 im Amt. Und ohne, dass man ihr sagen musste, wie töricht es wäre, zu versuchen, sich gegen den größten, tiefsten und wildesten Ozean der Erde zu stemmen, begann sie innerhalb weniger Tage damit, ihre Pläne in die Tat umzusetzen und die beiden Dörfer der QIN an einen Ort zu verlegen, der dreißig Meter über dem Meeresspiegel liegt.
Pierre setzte unseren Rundgang fort und zeigte mir die kleine Turnhalle des Stammes, das Gemeindezentrum, einen kleinen Lebensmittelladen und mehrere andere Gebäude und Wohnhäuser, die alle auf eine Umsiedlung in höher gelegene Gebiete warteten.
Dabei musste ich unweigerlich an meine Heimatstadt Port Townsend denken, die auf der anderen Seite der Olympic Peninsula in Washington liegt. Mit ihrem kleinen Stadtzentrum, das auf einer Höhe von rund zwei Metern direkt über dem Wasser liegt, befindet sie sich in der gleichen Situation wie die Dörfer der Quinault und Dutzende anderer großer Küstenstädte auf der ganzen Welt, die entweder komplett umgesiedelt werden müssen oder vom Meer verschluckt werden. Viele Einwohner*innen von Port Townsend sind stolz darauf, politisch fortschrittlich zu denken, und die große Mehrheit der Bewohner*innen ist sich der drohenden Klimakrise bewusst. Dennoch war das Beste, was der Stadt als Reaktion darauf einfiel, Millionen von Steuergeldern in das Aufreißen der Hauptstraße im Stadtzentrum zu stecken, die treffend Water Street genannt wird, um die darunter liegende Elektro- und Abwasserinfrastruktur zu verbessern. Das Projekt wurde 2018 fertiggestellt. Pierre brachte mich zu dem bergauf gelegenen Standort des Dorfes. Das Krankenhaus der QIN befindet sich bereits dort, ebenso wie die Hauptstraße, die durch das Gebiet führen wird. Einige Bäume wurden gerodet, um Platz für das zu schaffen, was kommen soll. Pierre erzählte mir, dass buchstäblich alles, was wir unten an der kristallblauen Brandung gesehen hatten, nach oben verlegt werden sollte.
Fawn Sharp wurde 1970 geboren und machte mit neunzehn Jahren ihren College-Abschluss. Fünf Jahre später war sie Absolventin der University of Washington School of Law und kehrte dann zu den QIN zurück, wo sie über ein Jahrzehnt lang als Richterin am Gericht der QIN tätig war. Zu dieser Zeit bereitete sich der vorherige Präsident auf seinen Rücktritt vor. Sharps Älteste baten sie, für sein Amt zu kandidieren, aber sie zögerte. Da sie gelernt hatte, nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Fairness zu streben, sah sie die Rolle als politisch an und hatte keinerlei Interesse daran, sich in der Politik zu engagieren. »Der Gedanke, Politikerin zu sein, passte nicht zu meiner persönlichen Vorstellung davon, wie ich mein Leben gestalten wollte«, sagte sie mir in ihrem Büro im Stammeshauptquartier, wo wir uns nach meiner Tour durch das Reservat unterhielten.
Wir saßen uns in ihrem Büro an einem Holztisch gegenüber, während draußen die Sommersonne schien. Fotos von geliebten Menschen säumten ihre Fensterbank, und Reihen von Gesetzesbüchern füllten ein Bücherregal an der Wand. Das Stammeswappen der Quinault, eine Holzschnitzerei in Form einer großen Adlerfeder, und ein geschnitztes Kanupaddel hingen an der Wand hinter ihr.
Aus »Pflichtgefühl gegenüber den Ältesten«, wie sie es nannte, unternahm Präsidentin Sharp weitere Schritte in Richtung Präsidentschaft und kündigte an, dass sie sich um das Amt bewerben würde. Aber sie zögerte und war dem überdrüssig, was sie als möglichen politischen Morast ansah. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie von einem Ältesten beiseitegenommen, und sie erklärte ihm ihre Abneigung gegenüber der Politik. »Er sagte: ›Sieh mal, du kandidierst nicht, um Politikerin zu werden, sondern um eine Führungspersönlichkeit zu werden, und eine Führungspersönlichkeit bringt diese Tugenden in ihr Amt ein‹«, gab Präsidentin Sharp wieder. »Das ist der Unterschied.« Daher habe sie ihre erste Lektion im öffentlichen Dienst gelernt, bevor sie überhaupt gewählt wurde: »Es ist von entscheidender Bedeutung, während des gesamten Dienstes sicherzustellen, dass man das Amt und die Verantwortung hoch schätzt.« Sie betrachtet ihre Rolle als Präsidentin der QIN als eine »sehr heilige Rolle«. Sie brachte Indigene Traditionen in ihre Machtposition ein und begann nach ihrer Wahl sofort mit dem Prozess der Dezentralisierung der Macht aus dem Präsidentenamt und mit der Umsetzung einer gemeinschaftsorientierten Agenda. Nach ihrer Wahl im März 2006 machte sich Präsidentin Sharp auch sofort an die Arbeit, die rückläufigen Bestände des Rotlachses wiederherzustellen.
Der Rotlachs oder auch Blaurückenlachs gilt als der wertvollste aller Lachse, da sein hoher Ölgehalt ihn zu einem weitaus schmackhafteren Fisch macht. Das niederländische Wort für den Rotlachs bedeutet übersetzt »Vorzüglichkeit«. In den 1950er Jahren fingen die Quinault noch Millionen von Rotlachsen, doch seither ist ihr Bestand stark zurückgegangen. In den darauffolgenden Jahrzehnten sanken die Bestände von Millionen auf Hunderttausende, dann auf fünfzigtausend und in den letzten Jahren, so Präsidentin Sharp, »war es nur noch eine Hand voll«. Im Jahr 2018 haben die QIN siebenundzwanzig Rotlachse gefangen, erklärte sie. »Deshalb haben wir die Rotlachs-Fischerei beendet«, sagte sie, nachdem sie erklärte, dass es nur noch siebenundzwanzig gab, weil ich sie gebeten hatte, genaue Zahlen zu nennen.
Das war ihre zweite Begegnung mit den dramatischen Auswirkungen der Klimakatastrophe, denn sie wusste, dass die dadurch verursachte Erwärmung des Pazifischen Ozeans der Hauptfaktor für den Rückgang der Lachsfarmen war. Die Wissenschaftler*innen des Stammes zeigten ihr, wie sich Ozeantemperaturdiagramme mit dem Rückgang der Lachsbestände überlagerten, und die Temperaturen spiegelten den Rückgang der Lachsbestände nahezu perfekt wider. Sie sprachen mit ihr über die Versauerung der Ozeane. Dann sprachen sie mit ihr über das Schmelzen der Gletscher, was zu ihrer ersten direkten physischen Erfahrung mit den Auswirkungen von Klimaveränderungen führte: Dies machte sie buchstäblich krank.
Präsidentin Sharp wurde zu einem Hubschrauberflug über den Anderson-Gletscher im nahe gelegenen Olympic National Park mitgenommen. »Wir hatten gehofft, den Gletscher zu sehen, und in diesem Moment stellten wir fest, dass er völlig verschwunden war«, sagte sie mit verdüsterter Miene. Sie beugte sich über den Tisch zu mir und fuhr leise, aber bestimmt fort: »Er war verschwunden. Das war ein schlimmer Moment für mich. Das war ein Moment, der mich zutiefst getroffen hat.«
Im Oktober 2018 unternahm sie einen weiteren Flug, um zu sehen, ob der Gletscher zurückgekehrt war. Doch das war er nicht. Außerdem stellte Präsidentin Sharp fest, wie stark der nahe gelegene Eel-Gletscher seit ihrem letzten Flug zurückgegangen war. Mit einem Rückzug von zehn Metern pro Jahr und einer sich beschleunigenden Rate ist der Eel-Gletscher um rund dreihundert Meter geschrumpft.
»Nach einem Jahrzehnt des Ringens und Kämpfens stand ich nun also vor dieser Situation«, sagte Präsidentin Sharp mit angespannter Stimme, die fast brach. »Das hat mich emotional sehr mitgenommen. Einige aus unserem Team haben gesehen, wie ich aus dem Hubschrauber gestiegen bin. Sie sagten, ich hätte ausgesehen, als müsste ich mich gleich übergeben.«
Doch die Dinge sollten sich für sie noch weiter zuspitzen, ganz so als würde sie von demselben Feuer angefacht werden, das auch die Erde bedroht. Nicht lange nach dieser Erfahrung musste Präsidentin Sharp einen weiteren schweren Schlag einstecken. Abstimmung 1631, ein Versuch, eine Kohlenstoffsteuer im Bundesstaat Washington zu verabschieden, für den sie sich unermüdlich eingesetzt hatte, scheiterte, weil die Industrie 33 Millionen Dollar für fossile Brennstoffe ausgab, um sie zu verhindern.
Präsidentin Sharp nahm die Niederlage so stark mit, dass sie für drei Tage nach Mexiko reiste, um sich zu erholen. Nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten blickte sie aus dem Flugzeug auf die rekordverdächtigen Waldbrände in Kalifornien. Es war die Zeit, in der die Stadt Paradise niederbrannte.
»Ich hatte schon immer von den psychologischen Auswirkungen der Klimakrise gehört«, sagte sie mir mit ernster Stimme, »aber ich glaube nicht, dass ich sie wirklich gespürt habe, bis zu diesem letzten Jahr, nach all diesen Ereignissen.«
Auf dem Höhepunkt des Projekts zur Erholung der Rotlachsbestände, ihrer Bemühungen, ihre Dörfer in höher gelegene Gebiete zu verlegen, und zahlreicher anderer Projekte im Zusammenhang mit der Klimakrise, die durch diese Reihe schockierender Ereignisse verstärkt wurden, verstand Präsidentin Sharp die wichtige Rolle, die Indigene Völker bei der Bewältigung der Klimakrise spielen. Sie hatte in ihrer Arbeit einen weiten Weg zurückgelegt, da sie sich in ihrer ersten Amtszeit mit der Krise befasste, während sie innerhalb des Stammes viel Kritik von Leuten einstecken musste, die der Meinung waren, dass es andere, dringendere Themen zu behandeln gäbe.
»Es hat also eine Weile gedauert«, fuhr sie fort, »Und es hat viel Anstrengung gekostet, die Klimakrise mit den Herausforderungen vor Ort in Verbindung zu bringen, aber im Laufe des letzten Jahrzehnts haben unsere Leute begriffen, was passiert. Und jetzt sind wir hier und der Bundesstaat Washington hat gerade eine weitere Dürre ausgerufen.«
Sie war eine junge Präsidentin ohne politische Erfahrung und fand sofort heraus, dass sich für ihre Gemeinschaft der höchste Handlungsbedarf im Verlust einer ikonischen Lachsart begründete, die nicht nur die Nahrung darstellt, auf die sie seit Jahrhunderten angewiesen ist, sondern auch Teil ihrer Identität und ein Aspekt all ihrer Aktivitäten ist, von Geburten über Hochzeiten bis hin zu Beerdigungen. Obwohl sie Führungspositionen innehatte, wie zum Beispiel als Treuhänderin der Washington State Bar Association – Indian Law Section und als Vizepräsidentin und Gründungsmitglied der National Intertribal Tax Alliance, und einen Abschluss in internationalem Menschenrecht an der Oxford University erworben hatte, lag vor Präsidentin Sharp noch viel Arbeit (und das bis heute).
Als sie das Klimathema in den letzten beiden Jahren der Bush-Regierung auf Völker-, Landes- und Bundesebene zur Sprache brachte, war es für sie eine große Herausforderung, auch nur eine einzige Person für den Dialog zum Thema Klima zu gewinnen. Daher nahm sie 2008 am Klimagipfel COP 14 in Polen teil, nachdem sie bereits zweieinhalb Jahre Zeit gehabt hatte, ihre Agenda zur Klimakrise zusammenzustellen. »Das Ziel war es, siebenundfünfzig Stämme in unserer Fünf-Staaten-Region zusammen mit den kanadischen First Nations zu einer Landbasis zusammenzuführen, die insgesamt größer als die Europäische Union ist«, sagte sie. Zwar gehörten die Vereinigten Staaten nicht zu den Unterzeichnern des Kyoto-Protokolls, ein Indigener Stamm war aber durchaus dazu in der Lage. Deshalb war es ihr Ziel, alle Stämme in ihrer Region (und in Kanada) zusammenzubringen, um in Polen eine Diskussion über den Emissionshandelsmarkt zu eröffnen. Doch noch bevor sie ankam, hatten die Länder bereits damit begonnen, sich von der Idee des Emissionshandels zu verabschieden, was für Sharp eine weitere Niederlage bedeutete, die es zu überwinden galt.
Dieser Trend setzte sich in der Obama-Regierung fort, während der Präsidentin Sharp beobachtete, wie der damalige Regierungsgesandte am Klimagipfel in Bonn teilnahm und dann zu dem Schluss kam, dass den Vereinigten Staaten der politische Wille fehle, eine stärkere Position in der Krise einzunehmen. Unbeirrt davon veranstaltete Präsidentin Sharp zusammen mit anderen Stammesführer*innen ein UN-Treffen im National Museum of the American Indian, bei dem sich andere Länder fanden, die dem Dialog und der Interessensvertretung Indigenen Völkern gegenüber sehr aufgeschlossen waren. Sie war überzeugt davon, dass die von den Quinault aufgestellte Agenda es wert war, auf die internationale Bühne gebracht zu werden, trotz der mangelnden Überzeugung der US-Regierung und obwohl sie bereits zu Beginn ihrer ersten Amtszeit den Notstand ausrufen musste, als im Dezember 2007 ein Sturm, der beinahe die Stärke eines Hurrikans hatte, die Quinault heimsuchte. Das war ein Weckruf, denn acht Tage lang fiel der Strom aus, und es gab kein Wasser, was sie als »ein episches Ereignis« bezeichnete. Bislang musste sie vier nationale Notstände ausrufen, und das ohne einen fertig ausgearbeiteten Klimaschutzplan.
Präsidentin Sharp hatte gehofft, dass sie durch die Zusammenarbeit mit der Gouverneurin des Bundesstaates Washington, Christine Gregoire, und dann mit Gouverneur Jay Inslee (mit dem sie als Teil seiner Arbeitsgruppe zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zusammenarbeitete) die Klimapolitik des Bundesstaates voranbringen könnte. Da diese Bemühungen jedoch nur wenig Wirkung zeigten, »wurde mir klar, dass wir in ernsthaften Schwierigkeiten steckten, wenn wir nicht einmal in einem Staat wie Washington mit Führungspersönlichkeiten wie Inslee und Gregoire eine Klimapolitik erreichen könnten«.
So begann sie vor vier Jahren mit der Idee, die Klimapolitik direkt an die Bürger*innen heranzutragen, weil sie glaubte, der Durchschnitt der Bevölkerung würde verstehen, dass die Klimakrise real ist: »Sie [die Bürger*innen] verstehen, dass die Industrie für fossile Brennstoffe zur Rechenschaft gezogen werden muss. Deshalb dachte ich, dass es im Zuge der Gegenbewegung zu Trump eine Art politische Welle geben könnte und dass wir bei den Wahlen 2018 im Bundesstaat Washington der erste Staat werden könnten, der einen Preis für Kohlenstoff einführt«, fügte sie hinzu. Sie unterschätzte jedoch, in welchem Ausmaß die Industrie bereit war, mehr Geld auszugeben, um Maßnahme 1631 zu vereiteln. Es war mehr Geld, als jemals zuvor für eine Wahlrechtsmaßnahme im Bundesstaat Washington ausgegeben wurde, denn die Gesamtkosten für die Kampagnen beider Seiten beliefen sich auf mehr als 50 Millionen Dollar.
»Ich habe auf unserer letzten Ratssitzung gesagt, dass wir vielleicht die letzte Generation sind, die weiß, was ein Rotlachs ist«, fuhr sie fort, wobei ihr Tonfall immer entschlossener wurde. »Nach meiner Rückkehr aus Mexiko habe ich lange und gründlich nachgedacht und beschlossen, dass das nächste Kapitel unserer Klima-Agenda noch aggressiver sein sollte.«
Nun ist das offizielle politische Ziel der QIN, die Industrie für fossile Brennstoffe dazu zu bringen, dass sie sich wünschten, die Volksabstimmung 1631 wäre angenommen worden, denn, so Präsidentin Sharp: »Der Preis von 15 Dollar pro Tonne Kohlenstoff, den sie hätten zahlen müssen, war noch günstig. Unsere Sechs-Punkte-Klima-Agenda, die ich vor ein paar Wochen vorgestellt habe, werden wir jetzt noch energischer angehen. Ich habe eine Pflicht und weiß, dass es eine Krise gibt, und zwar nicht nur eine Krise, die die Quinault betrifft, sondern Menschen auf der ganzen Welt. Uns bleibt keine andere Wahl, als jetzt noch härter gegen die fossile Brennstoffindustrie vorzugehen.«
Die QIN sind ein souveränes Volk, das das Recht hat, sich selbst zu regieren und mit anderen Stämmen und Nationen auf einer Regierungsbasis zu verhandeln. Auf der Website des Stammes heißt es: »Nach 150 Jahren der Misswirtschaft durch die Bundesregierung war es offensichtlich, dass die Stämme ihre eigenen Angelegenheiten besser regeln und ihre eigenen Entscheidungen ohne Einmischung von außen treffen konnten. Dies ist die grundlegende Philosophie der Selbstverwaltung.«
Daher trat 1988 der Selbstverwaltungsakt der QIN als Pilotprojekt im Bureau of Indian Affiairs (BIA) in Kraft. Im Jahr 1990 führten die QIN zusammen mit sechs anderen Stämmen die Selbstverwaltung in Indigenen Angelegenheiten ein. Heute umfasst die Tätigkeit der Stämme unter anderem die Bereiche natürliche Ressourcen, Gesundheits- und Sozialdienste, das Quinault Beach Resort und Gemeindedienste, die alle darauf ausgerichtet sind, das Wachstum und die Entwicklung ihres Reservats zu fördern.
»Es mag ein weiteres Jahrhundert dauern, um die vielen Probleme zu beheben, die von den ›Indigenen Vertreter*innen‹ verursacht wurden, auf die wir uns einst verließen«, heißt es auf der QIN-Website. »Aber wir blicken jetzt in die Zukunft und lernen aus der Vergangenheit.«
Präsidentin Sharp betonte deutlich, dass trotz aller Herausforderungen, mit denen der Stamm im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte konfrontiert war, »wir nie unsere spirituelle Verbindung zum Land und zum Meer aufgegeben haben, die viel stärker ist als ein Stück Papier, das von Besitz spricht«.
Ihr rund 85000-Hektar-Reservat liegt in der abgelegenen südwestlichen Ecke der Olympic Peninsula und umfasst üppige Wälder im pazifischen Nordwesten, stark fließende Flüsse, smaragdblaue Seen und fast 38 Kilometer rauer, weitgehend unberührter Pazifikküste. Das Volk der QIN teilt sein Zuhause unter anderem mit Pumas, Weißkopfseeadlern, Schwarzbären, Elchen und Rehen, und dem fast 1600 Hektar großen Lake Quinault, der nicht weit von der Küste entfernt ist.
Präsidentin Sharp erzählte mir von ihrem vierzehnjährigen Sohn, dem elf Lieder von dem See geschenkt wurden, die, wie sie sagte, »seit über hundert Jahren nicht mehr gehört wurden. Er sagte mir, dass der Quinault-See wiedererwacht, um sich selbst zu heilen.«
Ihr Sohn hatte sie gedrängt, mehr über ihre Kultur und Traditionen zu lernen. »Er sagte mir, wenn ich Präsidentin sei, müsse ich die gesamte Geschichte und all unsere Legenden kennen«, sagte sie und lachte. »Er sagte: ›Du solltest wissen, wer du bist.‹ Ich habe ihm geantwortet, dass meine Generation eine Ausbildung machen und es in dieser Welt zu etwas bringen muss, damit ich nach Hause kommen und seine Generation unterstützen kann. Aber dass es seine Generation ist, die jetzt unsere Sprache lernen kann, während sie noch Kinder sind.«
Präsidentin Sharp sagte, die Generation ihres Sohnes sei die siebte Generation seit dem ersten Kontakt in ihrem Gebiet, wofür sie sehr dankbar sei, denn das bedeute, dass die Quinault nicht sieben Generationen hätten verstreichen lassen, ohne ihre Sprache und Traditionen weiterzugeben; andernfalls wären sie verloren gegangen.
Eine Bewegung zur Wiederbelebung der Kultur im pazifischen Nordwesten, die in den 1970er Jahren begann, hat mit der Zeit weiteren Schwung bekommen. Einen großen Anteil daran hat die jährliche Kanufahrt, die jeden Sommer stattfindet. Stämme rund um die Salish Sea schicken Delegationen in Einbäumen von ihren Stammesgemeinschaften zu einem bestimmten Ort, in der Regel ein Gastland der Coastal Salish, wo sie alle zusammenkommen. Die Veranstaltung umfasst inzwischen mehr als hundert traditionelle Hochseekanus von Indigenen Völkern aus dem Süden von Oregon und dem Norden von Alaska. Die Reise kann zwei bis drei Wochen dauern und ist inzwischen jedes Jahr ein großes Ereignis für Präsidentin Sharp und die QIN.
»Wir haben keine sieben Generationen verstreichen lassen, ohne wieder auf den Kanus zu sitzen«, fügte sie hinzu. »Der Druck, den mir mein Sohn gemacht hat, hat mir sehr geholfen. Letztes Jahr war ich bei der Kanufahrt dabei und wurde gebeten, aufzustehen und um Erlaubnis zu bitten, an Land zu gehen. Ich fühlte mich wie ein Baby, das all das lernen musste; es war, als würde ich krabbeln. Es war meine erste Stammesreise, und ich lernte gerade erst unsere Sitten.«
Als sie das erkannte, sagte sie zu ihrem Sohn: »Ihr seid die Anführer*innen. Ich bin hier, um euch zu unterstützen.«
Präsidentin Sharp weiß um die Kraft und Bedeutung der Segnungen und Zeremonien, die seit Jahrhunderten auf dem Land ihres Volkes stattfinden.
»Alles, was in den letzten vierhundert Jahren passiert ist, verblasst im Vergleich zur verbindenden Kraft der Lieder auf diesem Land«, erklärte sie. »Ich erkläre den Leuten, dass sie überall in den Stammesgemeinden eine Trommel hören werden. Sie ist der Herzschlag der amerikanischen Indigenen Völker. Und meiner Meinung nach hat sie weder einen Anfang noch ein Ende. Es ist einfach eines dieser Dinge, die geschaffen werden. Ganz gleich, welche staatlichen Maßnahmen im Laufe der Jahre gegen uns ergriffen wurden, nichts konnte unseren Geist brechen. Nichts konnte den Trommelschlag stoppen. Nichts konnte die Verbindung unterbrechen, die wir auf kleinster, zellulärer Ebene fühlen, da unser ganzes Wesen mit der natürlichen Welt und der Umwelt verbunden ist.«
Präsidentin Sharp sprach über Umweltaktivist*innen und wie sie die meisten von ihnen in einem, wie sie es nannte, »sehr geistigen Kampf« wahrnimmt, und sagte dann: »Aber für uns ist es schlicht, wer wir sind und was wir tun. Ich kann mir nicht vorstellen, mich unter diesen Umständen nicht für die Natur einzusetzen. Das ist einfach Teil unserer Lehre und deren Fortführung.«
Sie hatte diese Verbindung gespürt, als sie im Jahr vor unserem Gespräch auf der Kanufahrt war. Damals hatte sie es wirklich aus erster Hand erfahren. Sie hatte ihren Körper nicht für die beschwerliche Reise in ihrem Einbaum trainiert, aber als es von der nahe gelegenen Honshu-Spitze aus in die vier Meter hohen Wellen ging und sie das Begleitboot kaum sehen konnte, war die Zeit gekommen, die alten Traditionen zu leben, ob sie bereit war oder nicht.
»Ich weiß noch, wie ich dachte: ›Das schaffe ich nie und nimmer‹«, erzählte sie mir leise. »Zwanzig Minuten nach Beginn des Paddelns waren wir kaum an den Felsen vorbeigekommen, und ich war bereits körperlich erschöpft. Aber unser Skipper fing an, eines der alten Lieder zu singen, und während er sang, war es, als würde das Meer zum Leben erwachen, und wir tanzten mit dem Meer durch das Lied. Ich spürte diese unglaubliche, fast übermenschliche Kraft.«
Sie hatte ihren jungen Leuten bereits gesagt, dass wenn sie die Landschaft in Augenschein nahmen, dies »[…] dieselbe Landschaft ist, die unsere Vorfahren seit Jahrhunderten gesehen haben. Es gibt keine Bebauung, keine Hotels, sie ist einfach unberührt und für die Öffentlichkeit gesperrt.« Daran erinnerte sie sich beim Kanufahren, als die Kraft durch das Meer, besungen vom Lied, in ihren Körper zurückgesungen wurde.
»Diese Erfahrung hat mir auf spiritueller Ebene bestätigt, was ich auf intellektueller Ebene wusste«, fuhr sie fort. »In meinem ersten Jahr als Präsidentin wurde ich in einem Fernsehinterview aufgefordert, einen Mythos und eine Wahrheit zu nennen. Einer, der mir durch das Gebet in den Sinn kam, war der Mythos, dass die Europäer*innen beim ersten Kontakt glaubten, wir seien primitiv und Wilde. Doch die Wahrheit ist, dass, wenn man sich Gelehrte und Wissenschaftler*innen und Leute wie Abraham Maslow und die Hierarchie der Reife ansieht, die egoistischen Menschen ganz unten stehen, dann, auf zweiter Ebene der Hierarchie, die unabhängigen Menschen und schließlich ganz oben die voneinander abhängigen Menschen.«
Präsidentin Sharp wies dann darauf hin, dass jemand, der selbstbewusst ist, unabhängig werde, aber erst dann, wenn er sich um andere Menschen kümmere, sei er an dem Punkt angelangt, an dem er als reifes Individuum gälte. Diese Wahrheit stellte sie dem Mythos gegenüber.
»Ich beziehe mich darauf, dass wir als Volk [der Native Americans] nicht nur von unseren Mitmenschen abhängig sind, sondern auch von der natürlichen Welt, den Tieren, den Bäumen, unserem Schöpfer und dem Großen Geist, der in allem lebt«, erklärte sie. »Das ist es, worauf Stammesoberhaupt Seattle sich bezog, dass alle Dinge miteinander verbunden sind. Was wir der Erde antun, tun wir uns selbst an. Wir sind nur ein Faden in diesem kompliziert gewebten Stoff.«
Das war es, was während der Kanufahrt in sie eindrang, inmitten der gewaltigen Wellen, als das Lied gesungen wurde und der Ozean tanzte und die Kraft in und durch all das floss. Sie erlebte es und »wusste« es daher zugleich.





























