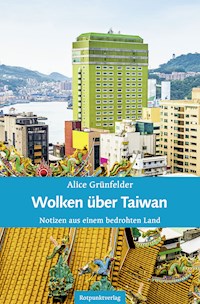Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie konnte es einer Handvoll Friedensbewegten in Mutlangen über Jahre hinweg und gegen sämtliche Anfeindungen gelingen, den Abzug der Pershing-II-Raketen zu erzwingen? Warum engagieren sich die einen, warum schauen andere weg? In welchem Spannungsfeld entsteht Zivilcourage, und was kann Mutlangen noch heute bedeuten als Symbol des zivilen Ungehorsams? "Alice Grünfelder erzählt von einer Zeit im Umbruch, in der sich eine starke Gegenbewegung für den Frieden in Deutschland bildete. Mutlangen steht nicht nur im Zentrum ihres zwischen Reportage, essayistischer Betrachtung und persönlicher Erinnerung changierenden Textes. Es stand 1983 einen Sommer lang auch im Zentrum der europäischen Friedenspolitik, als dort von einer kleinen Gruppe gewaltfreie Protestmärsche und Sit-ins gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen organisiert wurden." Andrea Zederbauer, Wespennest
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Sorglos
Pazifismus ist eine Bedrohung
Aufrüstung vor Ort
Friedensbewegung ist Staatsgefährdung
Größte Atomdichte der Welt
Friedensinitiative in Schwäbisch Gmünd
Unfälle
Wer Bunker baut, wirft Bomben
Bedrohungsszenarien
Heißer Herbst 1983
Endzeitstimmung
Atomkrieg vor der Haustür
Wie viel Gandhi verträgt Mutlangen?
Wie viel Gewalt darf sein?
Spinner und Chaoten?
Riskante Blockaden
Verwerfliche Nötigung
Wie entsteht Zivilcourage?
Ende gut, alles gut?
Freie Sicht aufs Mittelmeer
Endnoten
Dank
Über die Autorin
Sorglos
Kaum vorstellbar. Auch heute noch, nach knapp vierzig Jahren. Ein Jugendlicher streunt durch die Wälder und über die Heide, er nimmt alles mit, was dort so herumliegt, leere Patronenhülsen, verbeulte Schilder, abgewetzte Taschen, und schleppt es in den Keller der Eltern, die deswegen schon anfangen zu murren. Eines Tages findet er in einer Plastiktüte Namenslisten von Offizieren, die Zugang zu »nuclear positions« haben, und Dienstanweisungen für den Transport atomarer Raketenköpfe. Wo die Nuklear spreng köpfe der Pershing I und später Pershing II gelagert werden, scheint mit diesem Fund bestätigt: auf der Mutlanger Heide bei Schwäbisch Gmünd. Am Rand der Schwäbischen Alb. Ende der 1970er-Jahre.
Die Pershing I, eine mit Atomsprengköpfen bestückte Rakete, wurde 1958 entwickelt. Namensgeber war General John Pershing, der am letzten Tag des Ersten Weltkriegs trotz Kapitulation der deutschen Reichswehr eine deutsche Stellung angriff, »Krieg spielte«, was allerdings lediglich von einer Kommission geprüft und wieder fallen gelassen wurde. Die Rakete erhielt dennoch seinen Namen. Und weil in Schwäbisch Gmünd amerikanische Truppen stationiert und die heimischen Wälder geradezu ideal dafür waren, ganze Raketeneinheiten zu verstecken, kam die Pershing I in den 60er-Jahren nach Gmünd – mit einer Sprengkraft dreimal stärker als die der Hiroshima-Bombe. Das Hauptquartier des Pershing-Kommandos wurde im Keller der Bismarck-Kaserne untergebracht.
Und hier befanden sich später in den 80er-Jahren die »roten Knöpfe« für den Start und die Zielvorgaben der insgesamt 108 Pershing-II-Raketen, hier stand man in ständigem Kontakt mit dem NATO-Hauptquartier und dem Pentagon, hier hätte man per Knopfdruck binnen Minuten ganz Osteuropa in Schutt und Asche legen können. Schwäbisch Gmünd lag also seit Jahrzehnten in der Schusslinie der russischen Mittelstreckenraketen. Hochstimmung herrschte in der Behelfskonstruktion im Keller aber nicht erst mit der Ankunft der Pershings, sondern schon beim Einmarsch der UdSSR in die Tschechoslowakei. Bei jeder internationalen Krise stieg die Spannung im Bunker.
Die deutschen und US-Behörden haben seit Ende der 1960er- Jahre die Bevölkerung im Ungewissen gelassen, wo die Nuklearsprengköpfe tatsächlich lagerten. Als über den Fund in der Plastiktüte später in der Lokalzeitung berichtet wurde, interessierte sich nur eine kleine Minderheit dafür.
Mutlangen war nicht das kleine gallische Dorf, das sich gegen eine übermächtige Armee wehrt, hier und auch unten im Tal, in der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd, hatte man sich all die Jahre gut mit der US-amerikanischen Besatzung arrangiert. Die amerikanischen GIs gehörten zum Stadtbild, die Gmünder waren fast ein wenig stolz auf ihre Amerikaner, vor allem als Repräsentanten eines Landes, das unbegrenzte Möglichkeiten verhieß. Ich erinnere mich, dass man immer dann von einem »Onkel aus Amerika« sprach, wenn jemand über Nacht reich wurde – oder was man damals Anfang und Mitte der 70er-Jahre eben als Zeichen von Luxus wahrnahm: Transistorradios, von den GIs in einer bestimmen Ecke des Freibads laut aufgedreht, amerikanische Straßenkreuzer vor dem damals legendären Café Margrit, in dem jeder verkehrte, der etwas auf sich hielt. Und stolz waren damals die Mädchen und Jungen, die wegen irgendwelcher Beziehungen in den amerikanischen Supermärkten einkaufen durften und gleich die ganze Verwandtschaft versorgten mit Schokolade, Erdnussbutter, Whisky und besonders reißfesten Nylonstrumpfhosen.
Wenn die Mutlanger Heide und oben auf dem Hardt auf der anderen Seite des Tals die Kasernen und Zäune ihre Tore öffneten, durften Kinder per Knopfdruck schon mal eine Rakete gen Himmel richten, wurden von amerikanischen Soldaten huckepack genommen, ein Lachen und Jauchzen aus Kinderkehlen. Die Szenen findet man noch heute in Familienalben. Zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli gabs ein funkellichterlohes Feuerwerk für die bis zu 5000 Amerikaner, an dem sich auch die Gmünder nicht sattsehen konnten. Und an Weihnachten luden Hunderte Familien schon mal einen oder zwei GIs ein, um die deutsch-amerikanische Freundschaft unterm Tannenbaum zu feiern, die sich auch monetär auszahlte: Tausende Soldaten waren Mieter, die amerikanische Armee vergab lukrative Aufträge und war ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, amerikanische Soldaten waren als Kunden aus den Gmünder Geschäften nicht mehr wegzudenken. Als 1980 ein McDonald’s ins Herz der schwäbischen Altstadt zog, war der American Way of Life endgültig angekommen. Aus der einstigen Besatzungsmacht war in den Augen vieler ein bewunderungswürdiger großer Bruder geworden.
Hinter vorgehaltener Hand aber wurden die amerikanischen Kinder geschmäht, gezeugt von Soldaten, die bald wieder zurückgehen würden. Die einheimischen schwangeren Frauen hatten sie sitzengelassen.
Auch wenn man beispielsweise in meiner Familie den Amerikanern keineswegs wohlgesonnen war, gab es doch keinen Protest gegen die Stationierung der Raketen. Warum kann ich mich nicht an Demonstrationen, Menschenketten und Schweigekreise erinnern, an erste Blockaden und Ostermärsche, kann keine Antworten geben, wenn ich neuerdings immer wieder gefragt werde, wie es damals im Friedenscamp und auf der Mutlanger Heide war, wie man dort überhaupt leben konnte? Warum habe ich das alles ausgeblendet, vergessen, nicht wahrgenommen? War ich mit 18, 19 Jahren zu jung dafür? Heute frage ich mich, ob in der Friedensbewegung von damals Antworten für die Lösungen weltweiter Konflikte zu finden sein könnten. Versuche, eventuell Übersehenes sichtbar zu machen. Für mich. Für andere.
Pazifismus ist eine Bedrohung
Die Friedensbewegung in Mutlangen hat eine Vorgeschichte, auch wenn die fernab in Schwäbisch Gmünd wohl kaum wahrgenommen wurde. Widerstand gegen Militarisierung und Krieg gab es bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1850 wurde der erste Friedensverein in Königsberg gegründet, weitere Vereine existierten nicht lange; zu ungünstig war die Zeit, zumal Deutschland den deutsch-französischen Krieg 1870/1871 gewann und den Krieg damit als strategisch legitimes Mittel bestätigte.
Die Chronik der deutschen Friedensbewegung liest sich wie eine Geschichte von Demütigung und Verachtung: Rudolf Virchow war nicht nur Arzt, sondern engagierter Pazifist und wurde als solcher von den bürgerlichen Parteien angegriffen; dem Schriftsteller Walter Mehring machte man immer wieder den Prozess, später verbrannte man seine Bücher, um nur zwei Beispiele zu nennen. Als am 1. Mai 1916 vor dem Brandenburger Tor skandiert wurde: »Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung«, verurteilte man Walter Liebknecht und Rosa Luxemburg wegen Landesverrats, Ungehorsams und Widerstands gegen die Staatsgewalt.
Auch die Dolchstoßlegende, wonach Linke und Sozialdemokraten während des Ersten Weltkriegs das Heer von hinten erdolchten und dadurch die Kapitulation Deutschlands herbeiführten, gehört zur Verschwörungstheorie des Militärs und zieht sich ansatzweise bis in die 1980er-Jahre, als man der Friedensbewegung vorwarf, sie zersetze die Wehrfähigkeit der deutschen Bundeswehr.
Zeitschriften, die sich für Pazifismus und Antimilitarismus einsetzten, wurden während der Weimarer Republik mit Strafverfahren eingedeckt. In der August-Ausgabe 1931 der Weltbühne sorgte Kurt Tucholsky mit einer Glosse für Aufregung. Unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel schrieb er u. a.: »Da gab es vier Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich: Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder.«1 Für den Prozess im Juli 1932 wurde der verantwortliche Redakteur der Weltbühne, Carl von Ossietzky, aus der Haftanstalt vorgeführt, weil er dort wegen eines anderen Prozesses noch seine Strafe absaß. Tucholsky blieb in Schweden, denn Freunde hatten ihn vor den Nazi-Kommandos gewarnt. Allerdings hatte er genügend Material nach Berlin geschickt, um sich zu entlasten. »Als [Tucholskys Verteidiger] Olden die Fülle der Zitate von Laotse, Erasmus, Voltaire, Kant, Goethe, Klopstock, Herder, Raabe und vielen anderen vortrug, in denen Soldaten Mörder, Henker und Schlächter genannt wurden, verschlug es dem Staatsanwalt die Stimme.«2 Keine dieser Äußerungen war je zuvor von einem Richter geahndet worden. Carl von Ossietzky wurde freigesprochen. Wegen seiner pazifistischen Überzeugung wurde er jedoch 1933 abermals verhaftet und erhielt 1935 in Abwesenheit – weil er im Gefängnis saß – den Friedensnobelpreis.
Wegen Tucholskys Zitat sollten in den 1980er-Jahren wieder Pazifisten vor Gericht stehen, so als habe es das Berliner Urteil nie gegeben. Und wieder empörte man sich, als das Frankfurter Landgericht einen Arzt freisprach, der sich auf Tucholsky berief und Soldaten Mörder nannte. Tatsächlich waren T-Shirts und Aufkleber mit diesem Zitat populär, wie man auf Fotos der damaligen Zeit sieht. Die Strafgerichte fällten Urteile im Sinne der CDU-Empörung, bis 1995 das Bundesverfassungsgericht klar Position bezog: Unter dem Zitat stand eindeutig in Faksimile die Unterschrift Kurt Tucholskys, die sogenannten »Soldatenurteile« seien nichtig. Im selben Jahr hob das Bundesverfassungsgericht auch all jene Urteile auf, die gegen Mutlanger Friedensaktivisten gefällt worden waren.
Warum dieser Exkurs, all diese historischen Fakten? Ist es nicht verwunderlich, dass die Kriminalisierung der Friedensbewegung immer nach demselben Muster abläuft, die Argumente gegen Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, auch vor Ort in Mutlangen und später bei den unzähligen Prozessen vor Gmünder Richtern gebetsmühlenartig wiederholt werden? Der schlimmste Gegner oder zumindest die zweitschlimmsten waren offensichtlich noch immer die in der eigenen Bevölkerung. Als Pazifisten getarnt, versuchten sie, dem Feind in die Hände zu spielen und die eigene Wehrfähigkeit auszuhöhlen. Dass vielmehr die Kriegsaktivisten diejenigen waren und sind, die dem eigenen Volk Schaden zufügen, wird nach wie vor von staatlicher Seite gedeckt.
Dass in Strafurteilen und Diffamierung der Friedensaktivisten die ökonomischen Verflechtungen von Politik und Rüstungsindustrie stets außen vor gelassen werden, überrascht bei den herrschenden politischen Verhältnissen nicht weiter. Dass bei den jüngsten UNO-Verhandlungen im März und Juni/Juli 2017 zum Verbot der Atomwaffen ausgerechnet Deutschland und die meisten NATO-Staaten gegen die Resolution gestimmt haben, erstaunt nicht angesichts der Kriegsrhetorik der letzten hundert Jahre.
Und wieder argumentieren Kriegsgegner vergebens, dass Atomwaffen mit dem humanitären Völkerrecht nicht vereinbar seien und es im Falle des Falles keine angemessenen Krisenreaktionsmechanismen gebe.3 Und wieder ist es eine Handvoll Unermüdlicher, Vertreter der Mutlanger Friedenswerkstatt Wolfgang Schlupp-Hauck und der »Mayors for Peace« (Bürgermeister für den Frieden), die beispielsweise im Ostalbkreis auf diese UNO-Verhandlungen aufmerksam machen.
Aufrüstung vor Ort
Weil US-amerikanische Truppen während des Koreakriegs (1950–53) empfindliche Verluste auf der koreanischen Halbinsel hinnehmen mussten, rüsteten sie sich am anderen Ende der Welt präventiv. Diese Zusammenhänge wurden mir allerdings erst bei einem Spaziergang mit Freunden vor ein paar Jahren klar. Im Wald oberhalb des Lindenfelds in Bettringen (heute ein Stadtteil von Schwäbisch Gmünd) kamen wir an etlichen Bunkern vorüber: verlassene Hallen, zubetonierte Betonbunker, Schauplätze für einen überdrehten Kriegsfilm? Berüchtigte Partys wurden hier einst gefeiert, die Dorfjugend versammelte sich zum Kiffen und überhaupt … Heute fühlen sich offensichtlich nur noch Fledermäuse wohl und haben ein schützenswertes Zuhause gefunden, wie auf Schildern zu lesen ist.
Später ging ich erneut an einem verregneten Tag zwischen Weihnachten und Neujahr den Waldweg zur »Kriegsebene« hinauf, wie diese Gegend genannt wird. Wegen der Bunker oder vorher schon? Knapp die Hälfte der 28 Bunker ist heute noch begehbar. Vor dem Betreten wird gewarnt, die meisten Bunker sehen baufällig aus, auf manchen wachsen Bäume. Eingänge sind halb verschüttet oder versteckt hinter Büschen. Die Schritte hallen gedämpft wider. An den Wänden Graffitis und Herzchen, in mancher Ecke Spuren von Lagerfeuern.
In einer Sonderausstellung zum Bunkerwald, die das Heimatmuseum Waldstetten 2011 organisierte,4 ist zu lesen, dass die US-amerikanische Besatzungsmacht in Schwäbisch Gmünd und Umgebung ein zügiges Tempo an den Tag legte, um die militärischen Stützpunkte auszubauen. Zwischen 1952 bis 1954 wurden die Bunker angelegt, bis zu 60 Arbeiter seien damit beschäftigt gewesen. Um auch in Schwäbisch Gmünd gegen »den Russ« gewappnet zu sein, wurde bei Tag und Nacht gebaut. Einheimische boten in einer eigens eingerichteten Kantine auf dem Bauplatz Vesper und Mittagessen an, ein Bauer sorgte fürs Abendessen, untergekommen waren die Bauleute in Privatquartieren. Damit die Bunker für feindliche Flieger nicht einsehbar waren, wurden abschließend Bäume und Gestrüpp gepflanzt – Bauerntöchter aus dem Ort übernahmen für 30 Pfennig pro Stunde diese Arbeiten. Was in den Bunkern gelagert wurde, blieb geheim. Immer wenn Einheiten aus der Nachbarstadt Göppingen mit ihren Panzerkonvois durch Waldstetten hoch zum Bunkerwald rasselten, wackelte das Rathaus. Nächtliche Schießübungen raubten den Menschen den Schlaf. Der gesamte Höhenrücken zwischen Weiler, Bettringen und Waldstetten war fortan offiziell Verbotszone, kilometerweit zog sich ein Zaun mit Stacheldraht quer durch den Wald.
Während der Stationierung der Pershing-II-Raketen tauchte immer wieder das Gerücht auf, in den Bunkern wären atomare Sprengköpfe gelagert, was Historiker verneinen. Das mag und kann man sich heute kaum vorstellen, so baufällig sind diese Bunker. Und 1987 rutschte denn auch der ganze Hang ab. Hatten die amerikanischen Bauherren womöglich nicht nur Bunker gebaut, sondern den ganzen Hügel ausgehöhlt?
Erst vier Jahre nach Unterzeichnung des Abrüstungsvertrags, der zum Abzug der Pershings führte, wurden auch die Bunker geräumt und die Zäune abgebaut. Doch der aufmerksame Spaziergänger sieht die Absperrungen noch heute, die Betonpfeiler entlang der »Hauptstraße«, auf der damals die schweren Fahrzeuge ihr Material nächtens aus- und wieder zurückfuhren. Und die leeren Hallen wirken heute nur noch gespenstisch.
Wie lange die Bunker wirklich genutzt wurden und was tatsächlich gelagert wurde, bleibt bis heute unklar. Klar ist jedenfalls, dass die amerikanische Armee die Zeit für sich nutzte und sich als Besatzungsmacht einnistete. Ausgerechnet Mutlangen sollte aufgerüstet werden, das von allen Gemeinden im Kreis Schwäbisch Gmünd im Zweiten Weltkrieg am meisten unter der amerikanischen Invasion gelitten hatte. Denn auf der Mutlanger Heide gab es schon seit dem 19. Jahrhundert einen Flughafen, der während des Dritten Reichs zum Stützpunkt ausgebaut worden war. Zudem hatte in Mutlangen kurz vor Ende des Kriegs der Volkssturm zwischen Gmünd und Spraitbach Straßensperren angelegt. Der Bürgermeister machte den zuständigen Offizier vergeblich darauf aufmerksam, dass diese Aktivitäten den Untergang des Dorfes herbeiführen könnten. Kurzerhand packten die Mutlanger ihre Siebensachen und flohen vor den Amerikanern ins Haselbachtal. Durch dieses Tal zog viele Jahrzehnte später ein Fastenmarsch, dieses Mal aber, um der amerikanischen Militärmacht die Stirn zu bieten. Nach dem Krieg wurden in einer Holzbaracke auf dem Flugfeld die ausgebombten Mutlanger Familien und Flüchtlinge aus dem Osten Europas untergebracht. Und wegen der allgemeinen Lebensmittelknappheit baute man Gemüse an. Im Jahr 1951 übernahmen die US-Militärstreitkräfte die Mutlanger Heide, in anderen Gemeinden (Weiler, Bettringen und Waldstetten) kam es zu zahlreichen Enteignungen. Als Landrat Burkhardt sich bei einer Sitzung über diese erheblichen Anforderungen an Grund und Boden beschwerte und darauf hinwies, dass bäuerliche Existenzen davon betroffen sein könnten, erwiderte die amerikanische Seite trocken: Es handle sich nicht um Enteignung, sondern Beschlagnahmung.5
Man muckte also auf, ließ sich aber vieles gefallen – wohl oder übel, würden im Nachhinein deutsche Behördenvertreter sagen. Doch beinahe wäre es in Mutlangen schon Mitte der 1950er-Jahre zum Eklat gekommen. Schwere Fahrzeuge walzten auf der Straße Richtung Fluggelände Gehsteige und Kanäle zusammen. Die Anwohner setzten 1954 ein Protestschreiben gegen die »Dreck- und Seengasse« auf und drohten mit einer Blockade, die dann die erste in Mutlangen gewesen wäre. Der damalige Bürgermeister Hartmann beschwerte sich beim Amt für Besatzungsleistungen in Stuttgart mit markigen Worten. »Meine Bürger, die mit ihren Häusern an die fragliche Straße angrenzen, bezahlen so lange keine Steuern mehr, bis dieser unmögliche Zustand behoben ist.«6 Die Verweigerung von Steuerzahlungen als Protestform hat indes der amerikanische Bürgerrechtler H. D. Thoreau vor mehr als hundert Jahren gefordert. Wusste der Bürgermeister, in wessen Fußstapfen er trat und dass Thoreau den Mutlanger Friedensaktivisten als Vorbild des zivilen Ungehorsams gelten sollte?
Da er nie eine Antwort erhielt, schrieb er direkt an US-Senator Leon H. Gavin. Das Schreiben wirkte Wunder, die Straße wurde ausgebessert, die Mutlanger waren zufrieden. Nicht aber der Bürgermeister. Denn 1956 wurde der Bau von zwei »Lagerschuppen« auf der Mutlanger Heide angekündigt, doch Hartmann war misstrauisch. Bei der Besichtigung mit Vertretern des Sonderbauamts Stuttgart, die verschiedene Messungen auf der Heide vornahmen, fiel dem Bürgermeister auf, dass die Schuppen nur neunzig Meter auseinanderliegen sollten. Dies hat ihn in seinem Verdacht bestärkt, dass hier keine Lagerschuppen, sondern Munitionsdepots gebaut werden sollten. »Ich habe dem Herrn vom Sonderbauamt erklärt, dass ich mich noch für dumm halten lasse, aber nicht für saudumm.«7 Hartmann schimpfte, schließlich sei es nicht egal, ob in Mutlangen ein Lagerschuppen oder ein Munitionsdepot gebaut werden solle. Er drohte auch damit, die Presse zu informieren. Doch der Protest wurde ignoriert, das Munitionsdepot heimlich gebaut. Die zwei Betonkästen sind bis heute erhalten und mit Graffitis besprayt.
Friedensbewegung ist Staatsgefährdung
Wie viel Leid Krieg brachte und wie verächtlich Pazifisten während der Weimarer Republik behandelt wurden, hatte man kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schon wieder verdrängt. Pragmatisch forderte Konrad Adenauer die Wiederbewaffnung der BRD, woraufhin das westdeutsche Friedenskomitee als Teil der Weltfriedensbewegung 1949 gegründet wurde. Da bezichtigten Adenauer und die CDU diese Vereinigung als kommunistische UNO – und die Instrumentalisierung durch den Kommunismus war fortan ein gängiges Mittel, um die Friedensbewegung als fünfte Kolonne Moskaus zu verunglimpfen. Gegen die sechs Vorstandsmitglieder des Komitees wurde wegen Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung Anklage erhoben, denn die Staatsanwaltschaft wertete jede Kritik an Adenauer als Staatsgefährdung. Unter der Maske der Gewaltlosigkeit wurden Staatsfeinde vermutet, was für eine Verurteilung ausreichte.8 Als 1950 der Koreakrieg ausbrach und damit auch die Eiszeit des Kalten Krieges begann, schien die Wiederbewaffnung unausweichlich und die konservativen Parteien erhielten Rückenwind, sodass 1952 – damals noch gegen den Widerstand der SPD – die Aufrüstung beschlossen wurde.
Die Diffamierung und Kommunistenverdächtigung funktionierte in Gmünd und den Dörfern ringsum ebenso. Sybille Oker aus dem Nachbardorf erzählt mir, wie ihr Vater in den 1950er-Jahren als Kommunist verdächtigt wurde, wie er sich zunehmend verfolgt fühlte und später sogar in der Psychiatrie landete. Über ihr schwebte von Kindheit an die stille Drohung: »Sag nix, sonst landest du in der Klapse.« Den Kommunistenvorwurf mussten sich später in den 1980er-Jahren in Gmünd auch die Friedensaktivisten wieder gefallen lassen. »Gang doch nüber zu dene«, war wohl einer der meistgehörten Sprüche.
Schon wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es dem deutschen Militär – die Bundeswehr musste für die Wiederbewaffnung größtenteils auf ehemalige Offiziere und Unteroffiziere der Wehrmacht zurückgreifen – auf Endzeitstimmung zu machen und apokalyptische Szenarien heraufzubeschwören. Medien und CDU-Politiker schürten zudem die Angst vor den Friedensbewegten – der Feind saß auch in den eigenen Reihen – und machten doch selbst jahrelang Politik mit der Angst »vor dem Russ«.
Gleichwohl war es die Wiederbewaffnung, die den Grundstein für die Friedensbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg legte. Der Theologe und NS-Widerstandskämpfer Martin Niemöller, der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann, der Arzt Albert Schweitzer und der Philosoph Karl Jaspers – um nur einige Namen zu nennen – traten öffentlich gegen die Wiederbewaffnung ein und für den »Kampf dem Atomtod!«. Aufsehen erregte 1957 das Göttinger Manifest: Darin warnten 18 Naturwissenschaftler davor, die Bundeswehr mit Atomwaffen auszustatten. Evangelische Synoden und kirchliche Jugendverbände, unterstützt von den Gewerkschaften, formulierten ihren Widerstand gegen Aufrüstung und Wehrpflicht. Die ersten Massendemonstrationen der Friedensbewegung wurden organisiert, die Ostermarschbewegung fasste 1960 auch in Deutschland Fuß.
In der aufstrebenden Bundesrepublik gab es allerdings nur wenig aktiven Widerstand, vielmehr arrangierte man sich, gründete Familien und lebte seinen Alltag neben den Massenvernichtungsmitteln, gleichwohl marschierte man mit bei den Demos und Ostermärschen. Es wurde weiter aufgerüstet und immer effizientere Raketen wurden stationiert. »Wir haben alle etwas getan, aber es hat nicht gereicht, noch nicht gereicht.«9
Während des Vietnamkriegs galten Kriegsdienstverweigerer als Geier, Parasiten, von denen sich die Gesellschaft trennen muss, genau wie beim Aussortieren fauler Äpfel.10 Oder wie es der General in Schwäbisch Gmünd sagte: Man müsse eben auch die mehr oder minder Geistesgestörten verteidigen.11
Und in Schwäbisch Gmünd? Mit den Amis hatte man sich arrangiert, die amerikanischen Volksfeste waren jedes Jahr eine Gaudi und die Flugtage auf der Mutlanger Heide ein Höhepunkt. Zehntausende Menschen sahen sich diese Flugschau Jahr für Jahr an, sehr zum Leidwesen eines Pfarrers der Wallfahrtskirche Hohenrechberg, der gegen das amerikanische Teufelswerk predigte, weil so ein Großflugtag mehr Zuschauer anzog als die Kirche, vermutet der Lokalredakteur Heino Schütte.12 Ende der 1960er-Jahre wurden die Flugshows eingestellt. Nicht etwa aus antimilitaristischen Gründen, sondern weil mittlerweile in Mutlangen ein großes Krankenhaus am anderen Ende des Dorfes gebaut worden war und man sich gegen die Lärmbelästigung wehrte.