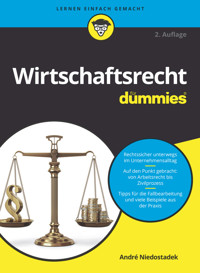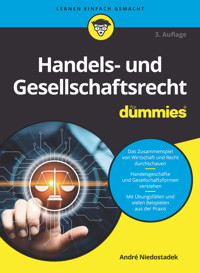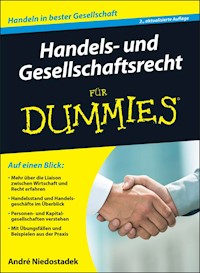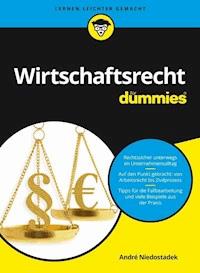
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Das Wirtschaftsrecht ist ein weites Feld. André Niedostadek behandelt in seinem Buch die wirtschaftsrelevanten Kerngebiete des Bürgerlichen Rechts und des Handels- und Gesellschaftsrechts ebenso wie beispielsweise auch das Arbeitsrecht, den Gewerblichen Rechtschutz oder das Wettbewerbs- und Kartellrecht. Viele Beispiele aus dem Alltag machen die gesamte Rechtsmaterie anschaulich. So sind Sie in der Jura-Klausur und in der Unternehmenspraxis immer rechtsicher unterwegs!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2016
© 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © iStock.com / Ulrich Knaupe
Korrektur: Frauke Wilkens, München
Satz: inmedialo Digital- und Printmedien UG, Plankstadt
Print ISBN: 978-3-527-71134-5
ePub ISBN: 978-3-527-69113-5
mobi ISBN: 978-3-527-69112-8
Über den Autor
»Jura kann jeder lernen!« – mit diesem Credo hat André Niedostadek bereits zahlreiche Studierende mit den Grundlagen des Handels- und Gesellschaftsrechts vertraut gemacht. Nach dem eigenen Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Münster und Aberystwyth in Wales sowie einem Forschungsaufenthalt an der Universität Cambridge sammelte er selbst zunächst mehrere Jahre lang vielfältige Berufserfahrungen als Consultant, Rechtsanwalt und Referent in unterschiedlichen Unternehmen, bevor er schließlich 2008 als Hochschullehrer an die Hochschule Harz wechselte. Dort gibt er sein Wissen und seine Erfahrung heute als Professor für Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht weiter. Als Dozent, Berater und Gutachter hält er darüber hinaus weiterhin den Bezug zur Praxis. Er ist Verfasser und Herausgeber mehrerer Bücher sowie Autor von Studienbriefen und Fachbeiträgen zu verschiedenen rechtlichen Themen. Leserinnen und Lesern der ». . . für Dummies«-Reihe ist er bereits als Autor von BGB für Dummies, Handels- und Gesellschaftsrecht für Dummies sowie des Prüfungstrainers dazu bekannt.
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Einführung
Über dieses Buch
Was dieses Buch nicht will
Begriffe, die in diesem Buch verwendet werden
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Teil I – Ihr Einstieg in das Wirtschaftsrecht
Teil II – Im Fokus: Das Wirtschaftsprivatrecht
Teil III – Meilensteine des Bürgerlichen Rechts
Teil IV – Kernfragen des Handels- und Gesellschaftsrechts
Teil V – Grundzüge des Arbeitsrechts
Teil VI – Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Kartellrecht
Teil VII – Außergerichtliche Konfliktlösung, Prozess- und Insolvenzrecht
Teil VIII – Der Top-Ten-Teil
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I Ihr Einstieg in das Wirtschaftsrecht
1 Das Wirtschaftsrecht – ein Rechtsgebiet mit vielen Facetten
Den roten Faden finden: Ein schneller Überblick
Richtungsweisend: Das Wirtschaftsverfassungsrecht
Gestaltend: Das Wirtschaftsprivatrecht
Dazwischentretend: Das Wirtschaftsverwaltungsrecht
Sanktionierend: Das Wirtschaftsstrafrecht
Wo wirtschaftsrechtliches Know-how gefragt ist
Die »klassischen« juristischen Berufe
Die Kombination von Wirtschaft und Recht
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
2 Wie (angehende) Wirtschaftsjuristen denken und arbeiten
Bestens ausgestattet: Der wirtschaftsrechtliche Werkzeugkasten
Unverzichtbar: Die einschlägigen Gesetze
Bedarfsweise: Weitere Hilfsmittel
Bestens vorbereitet: Das wird von Ihnen erwartet
Gesetze verstehen in fünf Minuten
Fälle lösen ist wie Flirten
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
Teil II Im Fokus: Das Wirtschaftsprivatrecht
3 Bühne frei: Darsteller und Gegenstände
Die Darsteller als natürliche und juristische Personen
Die Rechtsfähigkeit natürlicher Personen
Die Rechtsfähigkeit juristischer Personen
Die Rechtsfähigkeit sonstiger Personenzusammenschlüsse
Die Darsteller als Unternehmer und Verbraucher
Gewerblich oder selbstständig: Der Unternehmer
Rein privat unterwegs: Der Verbraucher
Die Gegenstände des Rechtsverkehrs
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
4 Wirtschaftsrechtliche Beziehungen – das Konzept im Überblick
Grundlegend: Die Rechtsgeschäftslehre
Ein Allroundtalent: Das Rechtsgeschäft
Im Mittelpunkt: Die Willenserklärung
Verbindend: Das Schuldverhältnis
Wie Schuldverhältnisse entstehen
Welchen Inhalt Schuldverhältnisse haben
Wie Schuldverhältnisse enden
Was Sie sonst noch wissen sollten
Das besondere Schuldverhältnis: Der Vertrag
Konsequenzen für die Fallprüfung
Schritt 1: Ist der Anspruch entstanden?
Schritt 2: Ist der Anspruch untergegangen?
Schritt 3: Ist der Anspruch durchsetzbar?
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
Teil III Meilensteine des Bürgerlichen Rechts
5 Einfacher geht’s nicht: So schließen Sie einen Vertrag
Recht vielseitig: Der Vertrag
Ohne Zahlenspielerei: Die Vertragsformel
Der Antrag
Die Annahme
Was denn nun: Einig oder nicht?
Fallstricke beim Vertragsschluss
Aspekte der Geschäftsfähigkeit
Formerfordernisse
Gesetzliches Verbot
Sittenwidrigkeit und Wucher
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
6 So kommen Sie aus einem Vertrag heraus
Die Anfechtung eines Vertrags
Rechtsfolgen der Anfechtung
Voraussetzungen der Anfechtung
Weitere Konsequenzen der Anfechtung
Der Rücktritt vom Vertrag
Rechtsfolgen des Rücktritts
Voraussetzungen des Rücktritts
Weitere Konsequenzen des Rücktritts
Der Widerruf eines Vertrags
Rechtsfolgen des Widerrufs
Voraussetzungen des Widerrufs
Weitere Konsequenzen des Widerrufs
Die Kündigung eines Vertrags
Rechtsfolgen der Kündigung
Voraussetzungen der Kündigung
Weitere Konsequenzen der Kündigung
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
7 Vertragstypen, die Sie kennen sollten
Für viele Fälle passend: Die Vertragstypen des BGB
Beschaffung und Absatz: Der Kauf
Zweckmäßig: Miete und Pacht
Servicebezogen: Der Dienstvertrag
Erfolgsverwöhnt: Der Werkvertrag
Kein Ende: Noch mehr Verträge …
Für die besonderen Bedürfnisse: Einige spezielle Vertragstypen
Für die Praxis entwickelt: Die nicht gesetzlich geregelten Vertragstypen
Der Leasingvertrag
Der Franchisevertrag
Der Lizenzvertrag
Der Know-how-Vertrag
Der Factoringvertrag
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
8 Probleme im Vertragsrecht lösen
Leistungsstörungsrecht: Ein erster Überblick
Im Mittelpunkt: Die Pflichtverletzung
Die Konsequenzen: Worauf Sie achten sollten
Gewusst wo: Die passenden Regelungen finden
Allgemeine Regelungen zu den Leistungsstörungen
Mehr schlecht als recht: Die Schlechtleistung
Nichts ist unmöglich – oder doch? Die Unmöglichkeit
Wer zu spät kommt: Der Schuldnerverzug
Augen auf: Der Gläubigerverzug
Besondere Regelungen für einzelne Vertragstypen
Regelungen beim Kaufvertrag
Regelungen beim Mietvertrag
Regelungen beim Werkvertrag
Regelungen beim Reisevertrag
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
9 Rechtsbeziehungen ohne Vertrag: Gesetzliche Schuldverhältnisse
Für einen anderen handeln: Die Geschäftsführung ohne Auftrag
Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag
Weitere Fälle der Geschäftsführung ohne Auftrag
Zu viel ist zu viel: Die ungerechtfertigte Bereicherung
Die Leistungskondiktion
Die Nichtleistungskondiktion
Weitere Fälle des Bereicherungsrechts
Obacht! Haftung wegen unerlaubter Handlung und anderer Anlässe
Verletzung eines absoluten Rechtsguts
Weitere Fälle der unerlaubten Handlung
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
10 Das Sachenrecht in den Griff bekommen
Ein erster Überblick zum Sachenrecht
Sachen selbst und Rechte daran
Bewegliche und unbewegliche Sachen
Beschränkte und unbeschränkte Rechte
Recht griffig: Der Besitz
Unmittelbarer und mittelbarer Besitz
Erwerb und Verlust des Besitzes
Rechte und Ansprüche zum Besitzschutz
Meins oder deins? Das Eigentum
Ein umfassendes Herrschaftsrecht
Erwerb und Verlust des Eigentums
Rechte und Ansprüche zum Eigentum
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
11 Hauptsache liquide: Die Unternehmensfinanzierung
Die Unternehmensfinanzierung: Ein erster Überblick
Ausgewählte Finanzierungsinstrumente
Die Kreditfinanzierung
Weitere Finanzierungsformen
Sicher ist sicher: Die (Kredit-)Sicherheiten
Ausgewählte Personalsicherheiten
Ausgewählte Realsicherheiten
Rechtliche Aspekte des Zahlungsverkehrs
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
Teil IV Kernfragen des Handels- und Gesellschaftsrechts
12 Kernfragen des Handelsrechts (1): Der Handelsstand
Ihr Einstieg in das Handelsrecht
Wo das Handelsrecht geregelt ist
Das Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten
Wann das Handelsrecht relevant wird
Gestatten: Kaufmann
Der Istkaufmann
Der Kannkaufmann
Der Fiktivkaufmann
Der Formkaufmann
Der Scheinkaufmann
Prüfungsrelevant: Das Registerrecht
Die Bedeutung des Handelsregisters
Der Inhalt des Handelsregisters
Das Eintragungsverfahren
Die rechtliche Bedeutung des Handelsregisters
Sag mir, wie du heißt: Die Firma
Die verschiedenen Facetten der Firma
Die rechtliche Bedeutung der Firma
Gut vertreten: Prokura und Handlungsvollmacht
Die Prokura
Die Handlungsvollmacht
Der Ladenangestellte
Vertriebsorientiert: Die kaufmännischen Hilfspersonen
Handelsvertreter und Handelsmakler
Sonstige Hilfspersonen
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
13 Kernfragen des Handelsrechts (2): Die Handelsgeschäfte
Die allgemeinen Regeln für alle Handelsgeschäfte
Im Fokus: Das Handelsgeschäft
Wie Handelsgeschäfte zustande kommen
Diese Regelungen sollten Sie kennen
Die speziellen Regeln für besondere Handelsgeschäfte
Geschäftig: Der Handelskauf
Dazwischengeschaltet: Das Kommissionsgeschäft
Logistisch: Das Fracht-, Speditions- und Lagergeschäft
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
14 Die Personengesellschaften
Das Gesellschaftsrecht: Ein erster Überblick
Einfach umgesetzt: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Die Gründung einer GbR
Das Innenverhältnis der GbR
Das Außenverhältnis der GbR
Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern
Das Ende der GbR
Noch eine Schippe drauf: Die offene Handelsgesellschaft
Die Gründung einer OHG
Das Innenverhältnis der OHG
Das Außenverhältnis der OHG
Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern
Das Ende der OHG
Der feine Unterschied: Die Kommanditgesellschaft
Die Gründung einer KG
Das Innenverhältnis der KG
Das Außenverhältnis der KG
Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern
Das Ende der KG
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
15 Die Kapitalgesellschaften
Kalkulierbar: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Die Gründung einer GmbH
Das Innenverhältnis einer GmbH
Das Außenverhältnis der GmbH
Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern
Das Ende der GmbH
Die Aktiengesellschaft
Die Gründung der AG
Das Innenverhältnis einer AG
Das Außenverhältnis einer AG
Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern
Das Ende der AG
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
Teil V Grundzüge des Arbeitsrechts
16 Das Individualarbeitsrecht
Arbeitsrecht: Ein erster Überblick
Zwei Seiten einer Medaille: Das Individual- und das Kollektivarbeitsrecht
Viele Puzzleteile: Die Rechtsgrundlagen des Arbeitsrechts
Die Begründung des Arbeitsverhältnisses
Erst mal beschnuppern: Rechtsfragen im Bewerbungsverfahren
Unter Dach und Fach: Der Arbeitsvertrag
Die Durchführung des Arbeitsverhältnisses
Grundlegend: Rechte und Pflichten der Beteiligten
Probleme gibt’s überall: Störungen im Arbeitsverhältnis
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Beendigungsgründe
Die ordentliche Kündigung
Die außerordentliche Kündigung
Beendigungsfolgen
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
17 Das Kollektivarbeitsrecht
Das Koalitionsrecht
Grundlage des Koalitionsrechts
Koalitionen – Anforderungen und Formen
Umfang des Koalitionsrechts
Bedeutung von Koalitionen
Das Tarifvertragsrecht
Parteien von Tarifverträgen
Inhalt von Tarifverträgen
Bedeutung von Tarifverträgen
Das Arbeitskampfrecht
Arbeitskampfmaßnamen im Überblick
Rechtmäßigkeit eines Arbeitskampfs
Rechtsfolgen von Arbeitskämpfen
Das Betriebsverfassungsrecht
Grundzüge der betrieblichen Mitbestimmung
Aufgaben und Rechte des Betriebsrats
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
Teil VI Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Kartellrecht
18 Geistiges Eigentum, Patent- und Gebrauchsmusterrecht
Geistiges Eigentum: Ein erster Überblick
Erfinderisch: Das Patentrecht
Wofür Sie ein Patent bekommen
Wie Sie ein Patent erhalten
Welche Rechte Sie durch ein Patent haben
Wie Sie ein Patent wieder verlieren
Was bei Patentverletzungen gilt
Welche Optionen ein Patent bietet
Schnell umgesetzt: Das Gebrauchsmusterrecht
Wofür Sie ein Gebrauchsmuster bekommen
Wie Sie ein Gebrauchsmuster erhalten
Welche Rechte Sie durch ein Gebrauchsmuster haben
Wie Sie ein Gebrauchsmuster wieder verlieren
Was bei Gebrauchsmusterverletzungen gilt
Welche Optionen ein Gebrauchsmuster bietet
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
19 Das Marken-, Design- und Urheberrecht
Unverwechselbar: Das Markenrecht
Wofür Sie eine Marke bekommen
Wie Sie eine Marke erhalten
Welche Rechte Sie durch eine Marke haben
Wie Sie eine Marke wieder verlieren
Was bei Markenverletzungen gilt
Welche Optionen eine Marke bietet
Gestalterisch: Das Designrecht
Wofür Sie ein Design bekommen
Wie Sie ein Design erhalten
Welche Rechte Sie durch ein Design haben
Wie Sie ein Design wieder verlieren
Was bei Designverletzungen gilt
Welche Optionen ein Design bietet
Einfallsreich: Das Urheberrecht
Wofür Sie ein Urheberrecht bekommen
Wie ein Urheberrecht entsteht
Welche Rechte Sie durch ein Urheberrecht haben
Wie Sie ein Urheberrecht wieder verlieren
Was bei Urheberrechtsverletzungen gilt
Welche Optionen ein Urheberrecht bietet
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
20 Das Wettbewerbs- und Kartellrecht
Das Wettbewerbsrecht
Ein erster Überblick zum Wettbewerbsrecht
Ein Eigentor: Die Wettbewerbsverstöße
(K)Ein Einsehen: Was bei Wettbewerbsverstößen droht
Das Kartellrecht
Ein erster Überblick zum Kartellrecht
Im Visier: Die kartellrechtlichen Schwerpunkte
(K)Ein Einsehen: Was bei Kartellrechtsverstößen droht
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
Teil VII Außergerichtliche Konfliktlösung, Prozess- und Insolvenzrecht
21 Außergerichtliche Konfliktlösung und gerichtliches Verfahren
Die außergerichtliche Konfliktlösung
Das Mediationsverfahren
Das Schlichtungsverfahren
Das Schiedsverfahren
Das gerichtliche Verfahren und die Vollstreckung
Zivilprozess und Zwangsvollstreckung
Besonderheiten für einzelne Verfahren
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
22 Das Insolvenzrecht
Ein erster Überblick über das Insolvenzrecht
Zulässigkeit eines Insolvenzverfahrens
Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens
Eröffnungsantrag und Eröffnungsgrund
Anordnung vorläufiger Maßnahmen
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Anmeldung der Forderungen
Berichts- und Prüfungstermin
Verwertung und Verteilung
Aufhebung des Insolvenzverfahrens
Wohlverhaltensperiode und Restschuldbefreiung
Besonderheiten eines Verbraucherinsolvenzverfahrens
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
Teil VIII Der Top-Ten-Teil
23 Zehn Fallen, in die Sie tunlichst nicht tappen sollten
Gesetzesstruktur verkennen!
Grundsätze und Prinzipien missachten!
Kenn ich schon!
Vom Ergebnis her denken!
Handwerkszeug vernachlässigen!
Rechtsnormen überfliegen!
Fallfrage ignorieren!
Signale nicht erkennen!
Zu viel lernen!
»App«lenken lassen!
24 Zehn Tipps, die Ihnen das Studium des Wirtschaftsrechts erleichtern
Setzen Sie sich Ziele!
Lieben Sie Tomaten!
Drehen Sie noch eine Schleife!
Nutzen Sie kreative Lerntechniken!
Setzen Sie Anker!
Optimieren Sie Ihr Lernen!
Suchen Sie sich Sparringspartner!
Holen Sie sich Feedback!
Machen Sie es doch wie Manager!
Halten Sie Augen und Ohren offen!
Stichwortverzeichnis
Einführung
Herzlich willkommen zu Wirtschaftsrecht für Dummies. Lassen Sie mich raten: Sie studieren an einer Universität, (Fach-)Hochschule oder Berufsakademie und das Wirtschaftsrecht ist Teil Ihres Studiums, nicht wahr? Und sicher liege ich nicht falsch, wenn Sie sich von diesem Buch nützliche Informationen erhoffen. Oder kommen Sie aus der Praxis und hätten gern etwas Orientierung? Nun, was immer Sie antreibt, dieses Buch möchte Ihnen für das eine wie das andere einen Einstieg bieten: kompakt, fundiert, anschaulich und hoffentlich ein bisschen kurzweilig.
Falls Sie ein eher klassisches Fach- und Lehrbuch erwarten, sogleich ein Hinweis in eigener Sache: Es gibt tatsächlich ganze Bibliotheken einschlägiger Fach- und Lehrbücher. Vieles von dem, was darin steht, bietet Ihnen dieses Buch ebenfalls (in mancher Hinsicht sogar etwas mehr als in einigen anderen Büchern). Warum dann noch ein Wirtschaftsrecht für Dummies? Ganz einfach: Vielen ist diese Materie fremd, vor allem dann, wenn man ansonsten wenig mit Rechtsthemen zu tun hat. Hier bekommen Sie das Ganze daher auf eine etwas andere Art und Weise präsentiert, nämlich möglichst verständlich und einprägsam. Neugierig geworden?
Okay, Sie haben das Buch nicht nach den ersten Zeilen gleich wieder zugeklappt und ins Regal verbannt. Dann lassen Sie uns loslegen. Zeit ist ja bekanntlich Geld, wie es bereits Benjamin Franklin (Erfinder des Blitzableiters und einer der Gründerväter der USA) vor über 250 Jahren formulierte. Er schrieb das übrigens den Lesern seiner »Ratschläge für junge Kaufleute« ins Stammbuch. Damit Sie dieses Buch bestimmungsgemäß nutzen können, finden Sie in dieser Einleitung eine Art Gebrauchsanweisung.
Über dieses Buch
Inhaltlich orientiert sich Wirtschaftsrecht für Dummies an dem, was Unterrichtsgegenstand vieler Studiengänge ist. Dabei geht es – etwas salopp formuliert – um die wichtigsten rechtlichen Spielregeln des Wirtschaftsalltags. Solche wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen berühren uns alle auf die eine oder andere Weise: Egal ob privat als Verbraucher oder beruflich als Angestellter, ob als selbstständiger Unternehmer in einem Einmannbetrieb oder Chef eines global agierenden Konzerns. Wirtschaft ohne Recht – das gibt’s nicht.
Dieses Buch möchte zweierlei, nämlich
Sie dabei unterstützen, sich wichtige Teilgebiete des Wirtschaftsrechts zu erschließen (was erfahrungsgemäß nicht allzu schwer ist und sich mit etwas Fleiß und Beharrlichkeit gut bewerkstelligen lässt).
Sie mit der juristischen Denk- und Arbeitsweise vertraut machen. Oftmals wird von Studierenden erwartet, erworbenes Wissen zum Beispiel im Rahmen von Fallbearbeitungen anzuwenden (das ist vor allem eine Sache der Übung, wozu Sie hier ebenfalls Gelegenheit haben werden).
Dieses Buch eignet sich aber nicht nur zum Einstieg. Sie können es ebenso gut dafür nutzen, einige Eckpunkte gezielt zu wiederholen (beispielsweise vor Prüfungen). Apropos: Das eine oder andere in diesem Buch wird Ihnen womöglich sogar schon bekannt vorkommen. Umso besser, denn Wiederholungen schaden keinesfalls. Sie profitieren von der Lektüre insbesondere,
wenn Sie sich als angehende Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftspsychologen, als Sozial- oder Verwaltungswissenschaftler (oder im Rahmen irgendeines anderen Studiums) dank Ihres ausgeklügelten Vorlesungsplans mit dem Wirtschaftsrecht befassen dürfen.
wenn Sie sich als Jurastudierende (vor allem in den ersten Semestern) einen schnellen Überblick verschaffen wollen.
wenn Sie sich als Vertreter der Praxis mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Wirtschaft vertraut machen möchten.
Was dieses Buch nicht will
Zwar ist dieses Buch thematisch breit angelegt – das Wirtschaftsrecht ist ein ziemlich verästeltes Rechtsgebiet –, es nimmt aber nicht für sich in Anspruch, eine Gesamtdarstellung zu bieten. Das würde den zur Verfügung stehenden Rahmen gleich mehrfach sprengen. Die Darstellung diskutabler Details darf daher draußen bleiben, wie auch manche Meinungsstreitigkeit. Fußnoten mit weiterführenden Hinweisen zur Vertiefung werden Sie daher vergeblich suchen. Auch als individuelle Rechtsberatung bei konkreten Problemen stößt dieses Buch an Grenzen. Sollte es darum gehen, so gilt: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Anwältin oder Ihren Anwalt.
Begriffe, die in diesem Buch verwendet werden
Die Bücher der … für Dummies-Reihe wollen das jeweilige Thema verständlich darstellen. Das ist auch hier die Leitlinie. Ganz ohne Fachbegriffe werden Sie dabei zwar nicht auskommen. Aber keine Sorge: Wichtige Begriffe sind besonders hervorgehoben und entweder im Text kursiv gedruckt oder sogar eigens durch ein Symbol gekennzeichnet und erklärt. Obendrein finden Sie unter www.downloads.fuer-dummies.de ein Glossar mit wichtigen Fachbegriffen, die Ihnen im Laufe der Lektüre verschiedentlich begegnen werden.
Konventionen in diesem Buch
Auch wenn Ihnen dieses Buch anbietet, das Wirtschaftsrecht verständlich darzustellen, wenn Sie dazu kein bestimmtes Vorwissen benötigen, wenn es auf Wissenschaftlichkeit verzichtet und sich eher als ein Lernbuch denn als ein Lehrbuch versteht, ganz ohne Ihr Mitwirken geht es nicht: Dazu zählt in erster Linie die Arbeit mit dem juristischen Handwerkszeug. Das sind die jeweils einschlägigen Gesetze. Entsprechende Textsammlungen gibt es bereits für wenige Euro zu kaufen. Ein paar Hinweise dazu finden Sie gleich im ersten Kapitel.
Was Sie nicht lesen müssen
Dieses Wirtschaftsrecht für Dummies konzentriert sich auf das grundlegende Know-how, die wesentlichen Leitlinien. Wer es noch schlanker haben möchte und eine noch ökonomischere Arbeitsweise bevorzugt – Sie finden über die einzelnen Kapitel verstreut immer wieder graue Kästen. Die Inhalte können Sie sich beim ersten Durchlesen gern schenken und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal vorknöpfen (aber Sie können die natürlich auch gleich lesen; schaden wird es kaum).
Törichte Annahmen über den Leser
Es wäre gewiss töricht anzunehmen, Leserinnen und Leser dieses Wirtschaftsrecht für Dummies seien denkfaul oder sie würden dieses Buch nur zur Hand nehmen, weil
sie alles verschlingen, was ihnen in die Hände fällt, um für den Fall der Fälle als potenzielle Kandidatin oder potenzieller Kandidat bei einem TV-Quiz bestens gerüstet zu sein (man weiß ja nie, was kommt).
gelb ihre Lieblingsfarbe ist und sie alles sammeln, was auch nur im Entferntesten danach schimmert (und diese Ausgabe daher gleich dreimal gekauft haben – da hat man noch zwei Tauschobjekte),
von einer Schänke zur nächsten ziehen, stets auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage: »Moment … wie … Wirt schafft’s Recht? Welcher Wirt schafft’s Recht?«
Im Gegenteil haben Sie sich vermutlich bewusst für dieses Buch entschieden, weil Sie – wenn man das mal so sagen darf – mit Ihrem Einsatz (der Lektüre dieses Buches) eine Art Rendite (Erkenntnisgewinn), quasi einen Return on Investment, erzielen wollen. Das klingt nicht nur plausibel, sondern es ist obendrein selbst durchaus wirtschaftlich gedacht.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Buch umfasst acht Teile bestehend aus insgesamt 24 Kapiteln, zuzüglich des schon erwähnten Glossars und eines Stichwortverzeichnisses. Die beiden letzten Teile helfen Ihnen dabei, sich die Inhalte dieses Buches gezielter zu erschließen. Die einzelnen Kapitel sind jeweils in sich abgeschlossen. Sollte an einer Stelle auf ein anderes Kapitel Bezug genommen werden, gibt es entsprechende Querverweise. Weil auch dieses Buch dem innovativen Prinzip folgt, die einzelnen Kapitel fortlaufend zu nummerieren, lässt sich alles leicht auffinden. Und darum geht’s:
Teil I – Ihr Einstieg in das Wirtschaftsrecht
In den beiden ersten Kapiteln lernen Sie, wie Sie sich im Wirtschaftsrecht zurechtfinden und wie die Rechtsanwendung funktioniert.
Teil II – Im Fokus: Das Wirtschaftsprivatrecht
In zwei weiteren Kapiteln erfahren Sie, was es mit Unternehmen, Kaufleuten und Verbrauchern als Akteure des Wirtschaftsrechts auf sich hat. Zudem lernen Sie das Konzept des Wirtschaftsprivatrechts kennen, das oftmals den Schwerpunkt des Wirtschaftsrechts ausmacht.
Teil III – Meilensteine des Bürgerlichen Rechts
In den Kapiteln 5 bis 11 geht es dann ans Eingemachte: Erfahren Sie alles Wissenswerte zum Vertragsrecht und dazu, wie man Probleme löst, wenn es einmal nicht rund läuft. Nach der Lektüre wissen Sie zudem, dass Rechtsbeziehungen sogar ohne Vertrag entstehen können. Einige Erläuterungen zum Sachenrecht und zur Unternehmensfinanzierung runden die Ausführungen ab.
Teil IV – Kernfragen des Handels- und Gesellschaftsrechts
Die Kapitel 12 bis 15 machen Sie mit einer ersten Spezialmaterie des Wirtschaftsrechts vertraut, dem Handelsrecht und dem Recht der Personen- und Kapitalgesellschaften.
Teil V – Grundzüge des Arbeitsrechts
Zwei weitere Kapitel geben Ihnen Gelegenheit, sich die Grundzüge des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts zu erschließen.
Teil VI – Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Kartellrecht
In den Kapiteln 18 bis 20 geht es dann um den Schutz geistigen Eigentums in Form der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts. Mit dem Wettbewerbs- und dem Kartellrecht lernen Sie zudem zwei weitere wirtschaftsrechtlich bedeutsame Rechtsbereiche kennen.
Teil VII – Außergerichtliche Konfliktlösung, Prozess- und Insolvenzrecht
Abschließend erfahren Sie in den Kapiteln 21 und 22 noch, wie man sich außergerichtlich einigen kann, wie man seine Rechte gegebenenfalls aber auch durchsetzt und woran bei einer (drohenden) Insolvenz zu denken ist.
Teil VIII – Der Top-Ten-Teil
Wenn Sie mit der … für Dummies-Reihe schon vertraut sind, ist Ihnen der charakteristische Top-Ten-Teil nicht fremd. Darin gibt es kurz, knapp und knackig weitere Informationen.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Das Buch ist zusätzlich gespickt mit den typischen Symbolen der … für Dummies-Bücher. Sie machen Sie aufmerksam auf »Merk«würdigkeiten, Beispiele und Begriffe, Tipps, die Sie nutzen, oder Tücken, vor denen Sie gefeit sein sollten. Und das sind sie:
Dieses Symbol enthüllt wichtige oder interessante Facetten und betont noch einmal bestimmte Punkte des vorherigen Abschnitts.
Die abstrakten gesetzlichen Regelungen lassen sich anhand von Beispielen besser veranschaulichen. Mit diesem Symbol sind jeweils kleinere (Fall-)Beispiele gekennzeichnet.
Wichtige Begriffe im Text sind mit diesem Symbol hervorgehoben. Kennen Sie diese, führt Sie niemand mehr durch sein Fachchinesisch aufs Glatteis.
Das Wirtschaftsrecht ist nicht frei vor manchen Fallstricken. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Textpassagen bewahren Sie vor Schlimmerem.
Speziell dieses Symbol macht Sie mit praktischen Bezügen des Wirtschaftsrechts vertraut.
Wie es weitergeht
An diese Einleitung schließt sich – das wird Sie kaum verwundern – der erste Teil an. Darin geht es um den Einstieg in das Wirtschaftsrecht. Verschaffen Sie sich zunächst einmal einen Überblick. Oder interessieren Sie sich für bestimmte Details? Auch kein Problem, dann steuern Sie einfach schnurstracks auf das jeweilige Kapitel zu, gehen Sie nicht über Los und denken Sie daran: Wer rastet, der rostet.
Teil I
Ihr Einstieg in das Wirtschaftsrecht
In diesem Teil . . .
Erhalten Sie im ersten Kapitel zunächst einen Überblick zum Wirtschaftsrecht. Machen Sie sich gleich zu Beginn mit einigen Grundzügen vertraut: Was kennzeichnet diese Rechtsmaterie eigentlich und wie ist sie in unserer Rechtsordnung verankert? Werfen Sie zudem einen Blick in die Praxis und lernen Sie einzelne Arbeitsfelder mit wirtschaftsrechtlichem Bezug kennen. Erfahren Sie in einem zweiten Kapitel sodann mehr dazu, wie (angehende) Wirtschaftsjuristen denken und arbeiten, welchen Werkzeugkasten Sie benötigen, um sich routiniert durch das Wirtschaftsrecht bewegen zu können, und was es mit der Falllösungstechnik auf sich hat.
1
Das Wirtschaftsrecht – ein Rechtsgebiet mit vielen Facetten
In diesem Kapitel
Berührungspunkte zwischen Wirtschaft und Recht erkennen
Wirtschaftsrecht innerhalb des Rechtssystems einordnen
Wirtschaftsrechtliche Arbeitsfelder benennen
Das Wirtschaftsrecht ist ein weites Feld. Wer es als Einsteiger beackern will, dem erscheint es auf den ersten Blick bisweilen sogar etwas arg großflächig. Grund genug, gleich hier im ersten Kapitel ein paar Pflöcke einzuschlagen und die Grenzen abzustecken, um so etwas Orientierung zu schaffen. Machen Sie sich in diesem Kapitel deshalb zunächst im Überblick damit vertraut, welche Teilbereiche des Wirtschaftsrechts es gibt und wie es in unserer Rechtsordnung verankert ist. Erfahren Sie zudem etwas dazu, wo in der Praxis wirtschaftsrechtliches Know-how gefragt ist. Am Ende dieses Kapitels wissen Sie dann, was das Wirtschaftsrecht ausmacht. Erschließen Sie sich die Themen ausgehend von folgender Fallstudie:
Dienstag 8:30 Uhr. Liu Chen (21 Jahre) und Sebastian Schnee (23 Jahre), beide Studierende der Wirtschaftswissenschaften, treffen sich mit ihrer Bekannten, der Webdesignerin Katja Witt (22 Jahre). Die drei verfolgen seit geraumer Zeit die Idee, gemeinsam ein Start-up-Unternehmen aufzubauen. Dabei möchten sie eine Erfindung vertreiben, die Sebastians Vater entwickelt hat. Es geht um duftende Büroklammern. Da sich Liu und Sebastian aktuell ohnehin noch auf eine Prüfung im Wirtschaftsrecht vorbereiten müssen, alle drei aber zugleich für ihre ersten unternehmerischen Schritte gut gerüstet sein wollen, haben sie sich mit der Rechtsanwältin Dr. Beate Bisnet (38) verabredet. Ebenfalls mit dabei ist der Referendar Aruj Ura (27 Jahre), der momentan eine Ausbildungsstation in der Kanzlei von Dr. Bisnet absolviert und bald als Wirtschaftsanwalt starten möchte.
Eine Frage, die die drei Existenzgründer sicher beschäftigen wird: Was ist eigentlich das Wirtschaftsrecht? Die Frage mag simpel klingen, eine Antwort darauf ist es nicht.
Den roten Faden finden: Ein schneller Überblick
Nach einer verbindlichen Definition zum Wirtschaftsrecht werden Sie vergeblich suchen. Das Wirtschaftsrecht ist nämlich keine in sich abgeschlossene Materie: Es handelt sich vielmehr – so viel sei vorausgeschickt – eher um einen Oberbegriff, unter dem sich ein Sammelsurium unterschiedlicher Teilrechtsgebiete einordnen lässt. Man könnte ebenso gut von einer Querschnittsmaterie sprechen. Gemeinsam ist den jeweiligen Teilgebieten der Bezug zum Wirtschaftsleben, was in der Verbindung der beiden Begriffe »Wirtschaft« und »Recht« ja schon zum Ausdruck kommt.
Wirtschaftliche Aktivitäten wollen in erster Linie menschliche Bedürfnisse befriedigen, und zwar nicht nur solche nach Essen, Kleidung, Wohnraum etc. Die bereitstehenden Ressourcen sind jedoch oft knapp. Wie kann man sie also mit Bedacht einsetzen? Und wie kann man in den unterschiedlichsten Bereichen ökonomisch sinnvoll handeln? Denken Sie nur an die ganze Palette wirtschaftlicher Betätigungen, angefangen von Handel und Produktion über Organisation, Finanzierung, Marketing, Vertrieb und Logistik bis hin zu Arbeitswelt. Hinzu kommt: Das Ganze vollzieht sich in einem Wettbewerb. Letztlich sind Belange unterschiedlichster Beteiligter berührt (zum Beispiel Verbraucher, Beschäftigte, Wettbewerber aber auch weitere Institutionen und Einrichtungen wie zum Beispiel Behörden).
Anstatt sich dem Thema vonseiten der Wirtschaft zu nähern, ist es einfacher, am Recht anzuknüpfen. Vielleicht wissen Sie schon, dass man hierzulande typischerweise drei große Rechtsbereiche unterscheidet, nämlich
das Privatrecht (auch Bürgerliches Recht oder Zivilrecht genannt). Es lässt sich wiederum aufteilen in
• Allgemeines Privatrecht. Hierbei geht es um Regelungen, mit denen wir als gleichgestellte (Privat-)Personen unser Miteinander regeln (etwa durch den Abschluss von Verträgen). Die wichtigste rechtliche Grundlage ist das Bürgerliche Gesetzbuch (kurz: BGB).
• Sonderprivatrecht. Es umfasst Teilbereiche des Privatrechts, die für bestimmte Adressaten gelten, wie etwa das Handelsrecht für Kaufleute (geregelt im Handelsgesetzbuch, kurz: HGB), das Arbeitsrecht als Schutzrecht für Beschäftigte (teils im BGB, teils in diversen anderen Gesetzen geregelt) oder das Verbraucherrecht als Schutzrecht für – klar – Verbraucher (ebenfalls teils im BGB, teils in diversen anderen Gesetzen geregelt).
Das Sonderprivatrecht steht nicht separat neben dem allgemeinen Privatrecht, sondern es ergänzt oder modifiziert zumeist die allgemeinen Regelungen (was gerade bei der Rechtsanwendung bedeutsam werden kann; das wird Ihnen in diesem … für Dummies verschiedentlich begegnen).
das Öffentliche Recht, das sich wiederum aufteilt in das
• Verfassungsrecht. Dabei geht es erstens um die Grundrechte der Bürger und zweitens um Regelungen zu den Aufgaben und zum Aufbau staatlicher Institutionen (Staatsorganisationsrecht). Wichtige Rechtsquelle ist hier das Grundgesetz (kurz: GG; für die Bundesländer gibt es jeweils Landesverfassungen).
• Verwaltungsrecht. Dabei geht es um die rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Rechtsbeziehungen gegenüber öffentlichen Stellen – vereinfacht ausgedrückt in einer Art hierarchischem Über- und Unterordnungsverhältnis. Ausprägungen dessen sind etwa das Beamtenrecht, das Kommunalrecht, das Öffentliche Baurecht, das Polizei- und Ordnungsrecht sowie diverse Verfahrens- und Prozessrechte (zum Beispiel um Rechte gerichtlich durchsetzen zu können: Zivilprozessordnung, Arbeitsgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung etc.).
das Strafrecht. Dabei geht es darum, wann eine Straftat vorliegt und welche Konsequenzen jemand zu tragen hat, der eine Straftat begeht. Manchmal droht eine Geldstrafe, manchmal sogar eine Freiheitsstrafe.
Nun fragen Sie sich vielleicht: »Gut und schön. Aber wo finde ich bei alledem das Wirtschaftsrecht?« Ganz einfach: Teile dieser drei Rechtsbereiche haben jeweils einen spezifischen wirtschaftsrechtlichen Bezug. Dann spricht man vom:
Wirtschaftsprivatrecht
Öffentlichen Wirtschaftsrecht bestehend aus
• Wirtschaftsverfassungsrecht
• Wirtschaftsverwaltungsrecht
Wirtschaftsstrafrecht
Alles zusammen kann man dann als Wirtschaftsrecht bezeichnen. Die Terminologie ist aber nicht immer einheitlich: Oft steht dieser Begriff synonym für das Wirtschaftsprivatrecht. Tatsächlich liegt in vielen Studiengängen gerade dort ein Schwerpunkt, weshalb es zugleich im Mittelpunkt dieses Buches steht. Wo es angebracht ist, wird es aber um einige (kurz gehaltene) Ausführungen zum Öffentlichen Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsstrafrecht ergänzt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das Wirtschaftsrecht umfasst sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen basierend auf gesetzlichen Vorschriften und sonstigen rechtlichen Vorgaben sowie Ansichten der Rechtsprechung mit Bezug zur Wirtschaft. Es gilt als das »Korsett der Märkte« – ein durchaus treffender Vergleich, wenn Sie dabei berücksichtigen, dass dieses Korsett manchmal straffer und manchmal lockerer geschnürt sein kann.
Ausgehend vom Aufbau unserer Rechtsordnung (das ist die Gesamtheit aller gültigen geschriebenen und ungeschriebenen Rechtsgrundsätze) finden Sie in Abbildung 1.1 eine erste zusammenfassende Übersicht zum Wirtschaftsrecht.
Abbildung 1.1: Die Rechtsordnung (und die wirtschaftsrechtlichen Bezüge)
Auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein hat: Nicht immer lassen sich die einzelnen Bereiche ganz trennscharf voneinander abgrenzen. Damit Sie ein besseres Gespür bekommen, sehen Sie sich die einzelnen Teilbereiche nun etwas genauer an.
Richtungsweisend: Das Wirtschaftsverfassungsrecht
Es klingt so einfach: Eine lohnende Idee und ein Quäntchen Glück und dem sprichwörtlichen Erfolg vom Tellerwäscher zum Millionär steht nichts entgegen. Was dabei leicht übersehen wird: Die wirtschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen müssen ebenfalls stimmen. Die sehen in einer Wirtschaftsordnung, die einer staatlich geregelten Planwirtschaft folgt, naturgemäß anders aus als in einer Marktwirtschaft, die auf Angebot und Nachfrage baut. Hierzulande setzt man darauf, dass Markt und Wettbewerb es schon richten werden, ergänzt um eine soziale Komponente als soziale Marktwirtschaft.
Man braucht sich aber nicht nur solche Extreme wie im Tellerwäscher-Millionär-Beispiel anzuschauen. Ausgewogene rechtliche Regelungen müssen vor allem im Alltag helfen. Dabei ist oft ein Spagat erforderlich, um verschiedene Interessen der Beteiligten auszugleichen. Hier obliegt dem Staat eine ordnende Aufgabe: Regelungen dürfen nicht zu eng gefasst sein, sie dürfen aber auch nicht ausufern. Und schließlich soll bei alledem weitgehende Rechtssicherheit herrschen. Das ist ein bisschen die Kunst, die der Gesetzgeber zu realisieren versucht. Grundlegende Weichen stellt dabei das Öffentliche Recht, vor allem mit dem Grundgesetz. Darin findet sich zwar keine explizite Weichenstellung für oder gegen ein bestimmtes Wirtschaftsmodell; insofern gilt das Grundgesetz als »wirtschaftspolitisch neutral«. Dennoch enthält es ein paar Aspekte, die als Wirtschaftsverfassungsrecht einen Rahmen abstecken.
Relevant ist bereits der Grundrechtskatalog ab Art. 1 GG. Die dort normierten Grundrechte sind in erster Linie Freiheitsrechte des Einzelnen und Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Wirtschaftsrechtlich von Interesse sind vor allem folgende Rechte:
Handlungsfreiheit: Art. 2 Abs. 1 GG garantiert die Handlungsfreiheit. Damit können die Akteure des Wirtschaftslebens (insbesondere Anbieter und Nachfrager) ihre Handlungen und Entscheidungen im Wesentlichen frei treffen. Gerade die so wichtige Freiheit, Verträge schließen zu können (Vertragsfreiheit), ist Ausdruck eben dieser grundgesetzlich gewährleisteten Handlungsfreiheit.
Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit: Art. 9 GG gewährleistet das Recht, Gesellschaften zu gründen (Abs. 1). Zudem ist für jedermann und für alle Berufe das Recht gewährleistet, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden (Abs. 3). Diese spezielle Koalitionsfreiheit ist beispielsweise eine Grundlage für Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Verbraucherverbände und andere Wirtschaftsverbände können sich auf Abs. 1 stützen.
Berufsfreiheit: Art. 12 Abs. 1 GG gewährt die Freiheit, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen, was ebenso die Freiheit unternehmerischer Aktivität mit einschließt. Die Berufsausübung kann nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden (Abs. 1 Satz 2 GG).
Eigentumsgarantie: Marktwirtschaftliche Mechanismen funktionieren letztlich nur, wenn das Privateigentum gewährleistet ist. Genau das garantiert Art. 14 GG.
Die genannten Grundrechte sind vor allem deshalb bedeutsam, weil sie zu starken staatlichen Reglementierungen einen Riegel vorschieben.
Das Grundgesetz kennt darüber hinaus weitere Regelungen mit wirtschaftsrechtlichem Bezug:
Sozialstaatsprinzip: Nach Art 20 Abs. 1 GG ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Zudem muss die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern den Grundsätzen des sozialen Rechtsstaates im Sinne des Grundgesetzes entsprechen (Art. 28 Abs. 1 GG). Der Staat trägt damit bei der Gestaltung des Wirtschaftslebens eine soziale Verantwortung.
Gesetzgebungskompetenz: Zudem sieht Art. 74 Nr. 11 GG eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für bestimmte Wirtschaftsbereiche vor (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen); andere Bereiche sind ausgenommen (zum Beispiel das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten etc.). Im Übrigen liegt die Gesetzgebungskompetenz bei den einzelnen Bundesländern.
Zwar werden Sie das Wirtschaftsverfassungsrecht nicht unbedingt in einer Fallbearbeitung benötigen. Für das Verständnis unserer Rechtsordnung ist es aber grundlegend.
Wenn sich Liu, Katja und Sebastian beruflich wirtschaftlich betätigen wollen, steht ihnen das frei. Das garantiert ihnen das Grundgesetz. Eventuell sind aber ein paar gesetzliche Anforderungen zu beachten, wenn es um die Berufsausübung geht. Wollen sie beispielsweise ein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) betreiben, müssen sie deren Anforderungen beachten. Wenn Aruj als Anwalt starten möchte, regelt die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) nicht zuletzt die Zulassung zu diesem Beruf.
Nachdem Sie jetzt das Wirtschaftsverfassungsrecht genauer einordnen können, lohnt es sich, sich auf eine Art »Arbeitsebene« zu begeben. Denn dort spielt die eigentliche Musik, vor allem beim Wirtschaftsprivatrecht. Aber selbst beim Wirtschaftsverwaltungs- und beim Wirtschaftsstrafrecht lohnt es sich, kurz hinzuschauen.
Gestaltend: Das Wirtschaftsprivatrecht
So wie das Privatrecht die Rechtsbeziehungen zwischen gleichgestellten Rechtssubjekten regelt (was Rechtssubjekte sind, dazu mehr in Kapitel 3), so regelt das Wirtschaftsprivatrecht solche Beziehungen, nur eben mit einem speziellen wirtschaftlichen Bezug. Um diesen Regelungsbereich etwas genauer zu erfassen, kann man sich drei Fragen stellen: »Wer?, »Wie?« und »Was?« (diese Fragen weisen schon ein bisschen auf die Inhalte der noch folgenden Kapitel hin).
Wer = Welche Akteure begegnen uns im Wirtschaftsprivatrecht? Das kommt drauf an, aus welcher Richtung man sich dem nähert: Aus der Richtung des allgemeinen Privatrechts können das natürliche oder juristische Personen sein. Aus der Richtung des Sonderprivatrechts kommt man an Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts nicht vorbei. (Einen ersten Einblick zu einzelnen Akteuren erhalten Sie vertiefend in Kapitel 3.)
Wie = Auf welche Weise werden Rechtsbeziehungen im Wirtschaftsleben gestaltet? Kennzeichnendes Merkmal des (Wirtschafts-)Privatrechts ist die Privatautonomie. Sie gibt jedem die Möglichkeit, seine Lebensverhältnisse und seine rechtlichen Beziehungen eigenverantwortlich (autonom) zu gestalten, vor allem durch Verträge. Das sichern auch die schon erwähnte grundgesetzlich geschützte Handlungsfreiheit und daraus folgend die Vertragsfreiheit. Sie können bei der Vertragsfreiheit noch etwas genauer unterscheiden:
• Abschlussfreiheit: Sie bezieht sich darauf, ob jemand überhaupt und gegebenenfalls mit wem einen Vertrag abschließen möchte.
• Inhaltsfreiheit: Sie bezieht sich darauf, welchen Inhalt ein Vertrag haben soll. Das kann man weitgehend frei aushandeln.
Ganz unbeschränkt gilt die Vertragsfreiheit nicht; sie ist an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden. So kann die Abschlussfreiheit etwa eingeschränkt sein, wenn es darum geht, elementare Grundbedürfnisse sicherzustellen: Anbieter im Bereich der Daseinsvorsorge sind beispielsweise verpflichtet, ihre Kunden mit Strom, Gas oder Wasser zu bedienen und entsprechende Verträge abzuschließen (Kontrahierungszwang). Auch die Inhaltsfreiheit kann beschränkt sein, etwa wenn der Inhalt eines Vertrags nach § 138 BGB als sittenwidrig einzustufen ist, was als Rechtsfolge (!) zur Nichtigkeit eines Vertrags führt (mehr dazu lesen Sie übrigens in Kapitel 5).
Weil das Vertragsrecht im Wirtschaftsleben einen sehr breiten Raum einnimmt, finden Sie Ausführungen dazu in diesem Buch auf die Kapitel 5 bis 8 verteilt. Fehlt es an vertraglichen Absprachen, findet sich für bestimmte Fälle immer noch ein gesetzlicher Rahmen (siehe Kapitel 9).
Was = Welche speziellen Rechtsbereiche sind im Wirtschaftsrecht betroffen? Hier geht es um spezielle Themen und damit zusammenhängende Fragestellungen. Das reicht angefangen von »A« wie Arbeitsrecht über »G« wie gewerblicher Rechtsschutz bis hin zu »Z« wie Zivilprozess (wenn es zum Beispiel darum geht, Rechte aus Verträgen durchzusetzen). Sie fragen sich, welche Kapitel dieses Buches sich damit befassen? Mehr oder weniger kommt dazu in allen Kapiteln etwas vor. Vor allem aber finden Sie dazu etwas ab Kapitel 12.
Schon mit dieser Kurzdarstellung haben Sie einen Überblick dazu bekommen, was Sie im Folgenden erwartet, wobei es vom Allgemeinen (etwa die erste Hälfte des Buches, Kapitel 1 bis 11) hin zum Speziellen und damit verbunden einzelnen Rechtsbereichen geht (etwa die zweite Hälfte des Buches, Kapitel 12 bis 22). Wenn Sie wollen, können Sie – wie in der Einleitung erwähnt – die einzelnen Kapitel aber durchaus unabhängig voneinander durchstöbern.
Das Wirtschaftsprivatrecht ist Teil des Wirtschaftsrechts. Es umfasst die privatrechtlichen Regelungen, die die rechtlichen Beziehungen der am Wirtschaftsleben beteiligten Akteure betreffen.
Falls Ihnen das noch etwas zu abstrakt ist, seien im Folgenden einzelne Teilgebiete samt den einschlägigen Rechtsquellen kurz vorgestellt. Lernen Sie in diesem Wirtschaftsrecht für Dummies unter anderem mehr zu folgenden Rechtsbereichen kennen:
Das Bürgerliche Recht
Das Bürgerliche Recht des BGB ist das allgemeine Privatrecht und regelt die rechtlichen Beziehungen von Privatpersonen untereinander. Zugleich ist es so etwas wie die Basis des Wirtschaftsprivatrechts. Es ist zudem ein recht umfangreiches Regelwerk, das seinerseits wiederum aus fünf »Büchern« besteht. An dieser Stelle ein paar kurze Hinweise zum Aufbau dieses wichtigen Gesetzes, damit Sie sich besser darin orientieren können. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis des BGB hilft bereits weiter (siehe auch Abbildung 1.2):
Allgemeiner Teil (§ 1 bis § 240 BGB): Er enthält einige allgemeine Bestimmungen, die für die weiteren Bücher des BGB gelten.
Schuldrecht (§ 241 bis § 853 BGB): Dort sind einzelne typische und immer wiederkehrende Vertragstypen geregelt (vertragliche Schuldverhältnisse); ergänzend dazu finden Sie dort etwas zu gesetzlichen Schuldverhältnissen, bei denen es keine vertraglichen Absprachen gibt.
• Allgemeines Schuldrecht: Das in den § 241 bis § 432 BGB geregelte Allgemeine Schuldrecht enthält – wenig überraschend – allgemeine Regelungen, die für alle Schuldverhältnisse relevant werden. Es beantwortet Ihnen beispielsweise, was ein Schuldverhältnis ist und welche Pflichten ganz allgemein aus einem Schuldverhältnis resultieren (§ 241 BGB), das Schadensersatz zu leisten sein kann, wenn solche Pflichten verletzt werden (§ 280 BGB), und viele weitere Dinge mehr.
• Besonderes Schuldrecht: Das in den § 433 bis § 853 BGB geregelte Besondere Schuldrecht enthält konkrete Regelungen bezüglich einzelner Schuldverhältnisse, angefangen vom Kauf (§§ 433 ff. BGB) über Miete (§§ 535 ff. BGB) und Bürgschaft (§§ 765 ff. BGB) bis hin zur unerlaubten Handlung (§§ 823 ff. BGB). Das ist nur eine kleine Auswahl (blättern Sie doch dort einfach mal herum).
Sachenrecht (§ 854 bis § 1296 BGB): Es betrifft die Rechtsbeziehungen einer Person zu einer Sache.
Familienrecht (§ 1297 bis § 1921 BGB): Hier geht es um die rechtlichen Aspekte der Familie.
Erbrecht (§ 1922 bis § 2385 BGB): Hier geht es um die rechtlichen Folgen, wenn jemand verstirbt.
Abbildung 1.2: Aufbau des BGB
In diesem Buch werden Sie sich vorwiegend mit den ersten drei Büchern beschäftigen. Nur vereinzelt werden Regelungen aus dem Familien- beziehungsweise Erbrecht eine Rolle spielen.
Das Handelsrecht
Das Handelsrecht gilt als das sogenannte Sonderprivatrecht der Kaufleute. Wichtigste Rechtsgrundlage ist das HGB. Es ergänzt beziehungsweise modifiziert in vielerlei Hinsicht das BGB. Wenn es in einem Fall um Kaufleute geht, sollte bei Ihnen immer ein »HGB-Lämpchen« angehen. Ausführungen zum Handelsrecht gibt es in diesem Buch gleich an mehreren Stellen:
1. Einmal finden Sie immer dort, wo sich HGB und BGB konkret begegnen, explizite Hinweise.
2. Darüber hinaus behandeln zwei separate Kapitel die Kernfragen des Handelsrechts (siehe Kapitel 12 und 13).
Das Gesellschaftsrecht
Hier geht es zuvorderst um den Zusammenschluss mehrerer Personen, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Wichtige rechtliche Regelungen finden Sie verteilt im BGB (zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts), im HGB (zum Beispiel zu den Handelsgesellschaften, wie der offenen Handelsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft) sowie in speziellen Gesetzen, etwa für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), für die Aktiengesellschaft im Aktiengesetz (AktG) oder für die Genossenschaft im Genossenschaftsgesetz (GenG). Ähnlich wie das Handelsrecht begegnet Ihnen das Gesellschaftsrecht an verschiedenen Stellen. Speziell mit den Kernfragen des Gesellschaftsrechts befassen sich die Kapitel 14 und 15.
Das Arbeitsrecht
Das Arbeitsrecht hat sich inzwischen als eine Spezialmaterie herauskristallisiert (um das Arbeitsrecht geht es in den Kapiteln 16 und 17). Es ist zweigeteilt:
Das Individualarbeitsrecht betrifft Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung und Beendigung einzelner Arbeitsverhältnisse.
Das Kollektivarbeitsrecht regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf Zusammenschlüsse von Arbeitgebern beziehungsweise Arbeitnehmern sowie die bedeutsame Mitbestimmung im Unternehmen.
Der gewerbliche Rechtsschutz und das Urheberrecht
Immaterielle (also »unkörperliche«, »nicht gegenständliche«) Vermögenswerte wie geistiges Eigentum in Form von Patenten, Marken, Designs, Urheberrechten etc. sind gerade in den letzten Jahren zunehmend bedeutsamer geworden. Nicht nur für Existenzgründer sind solche immateriellen Vermögenswerte oftmals bares Geld wert. Grund genug, sich das geistige Eigentum, wenn möglich, schützen zu lassen und etwaige Rechtspositionen zu verteidigen. Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums finden Sie vor allem im Patentgesetz (PatG), im Markengesetz (MarkenG), im Designgesetz (DesignG), im Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) und im Urhebergesetz (UrhG). Mehr zu alledem können Sie in den Kapiteln 18 und 19 lesen.
Das Wettbewerbsrecht
Das Wettbewerbsrecht dient dem Schutz vor unfairen Wettbewerbsmethoden. Geschützt sind Mitbewerber, Verbraucher sowie die Allgemeinheit in Bezug auf einen unverfälschten Wettbewerb. Der Wettbewerb selbst ist damit schützenswerter Teil unserer Wirtschaftsordnung. Eine rechtliche Grundlage finden Sie im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Es gewährt anderen Akteuren beispielsweise die Möglichkeit, gegen unlautere Wettbewerbsmethoden vorzugehen. Verwaltungsbehörden sind dagegen nicht vorgesehen, weshalb man es eher dem Wirtschaftsprivatrecht zuordnet. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 20.
Abbildung 1.3 verdeutlicht Ihnen nochmals im Überblick das Wirtschaftsprivatrecht, wobei das grau unterlegte Bürgerliche Recht und Handels- und Gesellschaftsrecht oft so etwas wie den Kernbestand bilden, das durch weitere Facetten ergänzt wird.
Abbildung 1.3: Das Wirtschaftsprivatrecht im Überblick
Wenn Liu, Katja und Sebastian ihr Start-up-Unternehmen auf den Weg bringen, werden sie sich zwangsläufig mit wirtschaftsrechtlichen Fragen konfrontiert sehen: Ganz sicher werden sie Verträge schließen (Bürgerliches Recht) und vielleicht sogar als Kaufmann auftreten (Handelsrecht). Wenn sie sich zusammenschließen, gründen sie eine Gesellschaft (Gesellschaftsrecht). Vielleicht stellen sie Mitarbeiter ein (Arbeitsrecht) und müssen sich dem Wettbewerb stellen (Wettbewerbsrecht). Liegt die Geschäftsidee darin, eine Erfindung zu vertreiben, sind Rechtsfragen des geistigen Eigentums betroffen (gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht).
IPR, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht
Wirtschaft vollzieht sich global. Dabei können Rechtsordnungen miteinander kollidieren. Welche Rechtsordnung dann anzuwenden ist, ist eine Frage des Internationalen Privatrechts (IPR), auch Kollisionsrecht genannt. Anders als es der Begriff vielleicht vermuten lässt, ist das IPR keineswegs internationales, sondern nationales innerstaatliches Recht (Regelungen finden Sie im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, kurz: EGBGB).
Aber es gibt auch vielfältige europäische und internationale Entwicklungen, die zu berücksichtigen sind und die mal mehr, mal weniger direkt das Recht hierzulande beeinflussen. Der wichtige Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) enthält beispielsweise die grundlegenden Freiheiten des Waren- und Dienstleistungsverkehrs (siehe Art. 34, 56 AEUV). Ein anderes Beispiel betrifft Vorgaben zum Verbraucherschutz. Impulse aus Brüssel führen oft zu einer europaweiten Annäherung einzelner Rechtsbereiche, sei es, weil entsprechende Rechtsakte unmittelbar gelten (EU-Verordnungen), sei es, weil sie in nationales Recht umzusetzen sind (EU-Richtlinien). Was auf europäischer Ebene verabschiedet wird, findet sich später durchaus hier wieder. Auch mit dem Internationalen Wirtschaftsrecht muss sich die Praxis beschäftigen, etwa mit internationalen Abkommen, wie zum Beispiel dem UN-Kaufrecht oder den Incoterms (International Commercial Terms); sie können bei grenzüberschreitenden Sachverhalten zu berücksichtigen sein. International bedeutsam ist darüber hinaus das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, kurz: GATT) als Vereinbarung zum Welthandel. Dass solche Abmachungen durchaus Kontroversen entfachen können, zeigte sich zuletzt etwa beim angedachten Transatlantischen Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz: TTIP) zwischen der Europäischen Union und den USA.
Dazwischentretend: Das Wirtschaftsverwaltungsrecht
Sofern das Verwaltungsrecht wirtschaftsrechtliche Bezüge aufweist, spricht man vom Wirtschaftsverwaltungsrecht. Als Teil des besonderen Verwaltungsrechts prägt es das Wirtschaftsleben in vielfältiger Weise, indem zum Beispiel wirtschaftliches Handeln von staatlicher Seite fördernd, lenkend oder womöglich beschränkend beeinflusst wird. Legitim sind etwaige Aktivitäten freilich nur, wenn es dazu jeweils eine konkrete rechtliche Grundlage gibt (Prinzip des Gesetzesvorbehalts). Im Wesentlichen können Sie sich auf zwei Formen von Verwaltungsaktivität beschränken:
Eingriffsverwaltung: Hier setzt staatliches Handeln gewisse Schranken.
Solche Schranken finden sich beispielsweise im Gewerbe- und Gaststättenrecht, im Kartellrecht und dort speziell im Rahmen der Fusionskontrolle (dort geht es um die Monopolkontrolle und eine etwaige Begrenzung der Marktmacht einzelner Unternehmen). Manche Wirtschaftsbereiche sind zudem in besonderer Weise reguliert (dazu zählen zum Beispiel Energie, Banken und Finanzen, Verkehr als für das Gemeinwesen bedeutsame Einrichtungen, sogenannte »kritische Infrastrukturen«). In Kapitel 20 lesen Sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsrecht auch etwas zum Kartellrecht. Das Gewerberecht spielt hier nur am Rande eine Rolle.
Leistungsverwaltung: Hier fördert der Staat bestimmte Entwicklungen.
Denken Sie beispielsweise an das Gewähren unterschiedlicher Arten von Vorteilen, insbesondere von Subventionen (Subventionsrecht) oder sonstiges (finanzielles, beratendes, vermittelndes) Handeln, wie etwa im Rahmen kommunaler Wirtschaftsförderung, um günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen.
Liu, Katja und Sebastian werden sich Gedanken machen, ob sie sich an zuständige staatliche Stellen wenden müssen, wenn es zum Beispiel um die Voraussetzungen für das Betreiben eines Gewerbes geht. Als Start-up wird das Kartellrecht für sie dagegen sicher nicht relevant werden (Eingriffsverwaltung). Aber womöglich gibt es staatlicherseits Unterstützung (Leistungsverwaltung)?
Materielles und formelles Recht
Recht lässt sich noch in anderer Weise unterteilen, nämlich in das Begriffspaar materielles und formelles Recht. Ersteres umfasst die rechtlichen Vorschriften, die Rechtsverhältnisse inhaltlich betreffen und sie gestalten. Materielles Recht finden Sie in fast allen vorstehend genannten Gesetzen zum BGB, HGB etc. Formelles Recht bezieht sich dagegen auf die Verfahren zur Durchsetzung materiellen Rechts, es sind Verfahrensvorschriften (daher spricht man auch von Prozessrecht, speziell dazu mehr in Kapitel 21). Darunter fallen beispielsweise das Zivilprozessrecht sowie das Zwangsvollstreckungsrecht und das Insolvenzrecht.
Wenn Liu, Katja und Sebastian beispielsweise ein Produkt verkaufen, haben sie materiell-rechtlich einen Anspruch auf Bezahlung des Kaufpreises. Zahlt der Käufer nicht, gibt das formelle Recht vor, wie sie ihren Anspruch geltend machen (im Rahmen eines Gerichtsverfahrens) und durchsetzen (Vollstreckung durch einen Gerichtsvollzieher) können. Mehr dazu finden Sie in Kapitel 21.
Sanktionierend: Das Wirtschaftsstrafrecht
Streng genommen gehört das Strafrecht als ein drittes großes Rechtsgebiet zum öffentlichen Recht. Denn aufgrund des Strafmonopols kann nur der Staat – und können demzufolge nur die Gerichte – Strafen verhängen. Es gibt keine Selbstjustiz. Typischerweise wird das Strafrecht aber als eigenständiges Rechtsgebiet neben das Privatrecht und das öffentliche Recht gestellt. Wichtigste Rechtsgrundlage ist das Strafgesetzbuch (StGB). Darüber hinaus sind weitere Straftatbestände in anderen Gesetzen geregelt (sogenanntes Nebenstrafrecht). Sofern es um strafrechtliches Verhalten im Wirtschaftsleben geht, hat sich mit dem Wirtschaftsstrafrecht sogar ein eigener Teilbereich herauskristallisiert. Relevant ist dabei stets die strafrechtliche Verantwortlichkeit einzelner Personen. Aber auch ein Unternehmensstrafrecht wird diskutiert.
So kann man sich zum Beispiel wegen Bankrotts (§ 283 StGB) oder Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) strafbar machen. Darüber hinaus gibt es Verbindungen zu anderen Rechtsgebieten, wie dem Gesellschaftsrecht: Ein Geschäftsführer einer GmbH macht sich wegen Insolvenzverschleppung (§ 15a Abs. 4, 5 Insolvenzordnung) strafbar, wenn er einen Insolvenzantrag vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder fehlerhaft stellt. Strafrechtliche Vorschriften finden Sie zudem im Urheberrecht. Hoffentlich werden Liu, Katja oder Sebastian nicht einmal mit dem Strafrecht in Konflikt geraten. Aber wer weiß?
Compliance und Corporate Governance
Rechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist jedoch keineswegs immer der Fall, wie diverse publik gewordene Rechtsverstöße von Unternehmen belegen. Verfehlungen schädigen nicht nur das Image, sondern können zudem finanzielle Einbußen zur Folge haben. Unter dem Stichwort Compliance hat sich dabei ein Tätigkeitsfeld zum Umgang mit rechtlichen Risiken entwickelt. Es ist gleichermaßen für Groß- und Mittelstandsunternehmen bedeutsam. Speziell für börsennotierte Wirtschaftsunternehmen regelt der Deutsche Corporate Governance Kodex (kurz: DCGK) das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien und deren Beachtung durch die Konzernunternehmen. In diversen weiteren Bestimmungen (§ 43 GmbHG, §§ 91, 93 AktG) ist zudem für Geschäftsführer und Vorstände explizit die Pflicht normiert, wirtschaftliche Schäden vom Unternehmen abzuwenden – etwa durch wirksame Compliance-Maßnahmen.
Nun haben Sie einen ersten Überblick. Vielleicht werden Sie ja zustimmen, dass der erste Satz diese Kapitels durchaus berechtigt war: Das Wirtschaftsrecht ist ein weites Feld. Wie geht die Praxis damit um und was wird von Ihnen im Studium erwartet?
Wo wirtschaftsrechtliches Know-how gefragt ist
Für wen ist es wichtig, etwas zum Wirtschaftsrecht zu wissen? Das kommt ganz darauf an, denn die Einsatzgebiete und Tätigkeitsfelder variieren stark voneinander – ist man eher »klassisch« unterwegs oder genügt ein Grundverständnis?
Die »klassischen« juristischen Berufe
Die »klassische« juristische Tätigkeit in der Praxis ist breit gefächert. Erforderlich ist in aller Regel ein rechtswissenschaftliches Studium sowie ein sich anschließendes Referendariat mit jeweils zwei erfolgreich abgeschlossenen Staatsexamen (Volljurist). Das eröffnet verschiedene Berufswege:
Anwaltschaft: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterstützen ihre Mandanten in allen rechtlichen Belangen, etwa wenn es darum geht, wirtschaftliche Aktivitäten auf rechtliche Risiken abzuklopfen und Lösungswege aufzuzeigen, insbesondere Verträge zu erstellen (streitvermeidende Tätigkeit). Darüber hinaus bereiten sie solche Prozesse vor und vertreten ihre Mandanten im Gerichtsverfahren (streitbegleitende Tätigkeit).
Unternehmen: Unternehmensjuristen sind nicht freiberuflich für mehrere Mandanten tätig. Sie sind innerhalb eines Unternehmens mit rechtlichen Belangen ihres Arbeitgebers befasst (manchmal als Syndicus oder Syndici beziehungsweise Syndicusanwälte bezeichnet).
Verwaltung: Als Verwaltungsjuristen sind Absolventen in Behörden tätig.
Notariat: Noch etwas andere Aufgaben übernehmen speziell geschulte Juristen, die Notare: Ihnen obliegen sogar öffentliche Aufgaben, etwa wenn sie Gesellschaftsverträge beurkunden. Manche Anwälte sind zugleich Notare.
Justiz: Und wenn es hart auf hart kommt? Dann urteilen Richterinnen und Richter beispielsweise, wie in einem Streitfall zu entscheiden ist (streitentscheidende Tätigkeit).
Hätten Sie es gedacht? Hierzulande gibt es mehr als 160.000 zugelassene Anwältinnen und Anwälte. Auch wenn davon nicht alle klassisch tätig sind, ist das doch eine beeindruckende Zahl, die zugleich die Bedeutung rechtlicher Themen erahnen lässt. Nicht wenige von ihnen sind zusätzlich spezialisiert. Ausgewiesene Experten (Fachanwaltschaften) gibt es gerade mit wirtschaftsrechtlichem Bezug, etwa für Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Internationales Wirtschaftsrecht, gewerblichen Rechtsschutz, Handels- und Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Transport- und Speditionsrecht sowie Urheber- und Medienrecht, um hier nur einige zu nennen.
Juristischer Sachverstand ist nicht nur bei Volljuristen gefragt. Beschäftigte ohne eine klassische juristische Ausbildung brauchen ebenfalls wirtschaftsrechtliches Know-how, vor allem an den Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Recht.
Die Kombination von Wirtschaft und Recht
Wirtschaftsrechtliche Kenntnisse benötigen nicht nur diejenigen, die in verantwortlichen Positionen in einem Unternehmen tätig sind, wie Manager, Führungskräfte und sonstige Mitarbeitern in leitenden Funktionen. Letztlich bedarf es für viele Tätigkeiten eines soliden rechtlichen Hintergrundwissens, um auftretende (rechtliche) Risiken einschätzen und damit angemessen umgehen zu können: Wer Haftungsrisiken aus vertraglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnissen nicht kennt, wer seine Haftung als Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft, einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft nicht einschätzen kann, wer nicht weiß, was er als Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstand einer AG zu tun hat, oder wem letztlich als Arbeitnehmer die eigenen Rechte und Pflichten unbekannt sind, balanciert manchmal auf einem Drahtseil. Denken Sie zudem an einzelne Bereiche, wie etwa an das Beschaffungs-, Finanz-, Personal- oder Vertriebswesen (und das alles branchenübergreifend). Oder werfen Sie einen Blick in die Insolvenzverwaltung, Steuerberatung (gerade für Unternehmen wichtige Ansprechpartner!) sowie die Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Wirtschaftsrechtliche Aspekte wirken überall hinein.
Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf
Sie haben in diesem Kapitel nun einen ersten Überblick zum Wirtschaftsrecht erhalten. Im Mittelpunkt steht das Wirtschaftsprivatrecht mit seinen unterschiedlichen Teilgebieten. Aber auch das Wirtschaftsverwaltungs- und das Wirtschaftsstrafrecht lassen sich dem Wirtschaftsrecht zuordnen. Letztere bleiben hier jedoch weitgehend ausgeklammert und werden nur punktuell behandelt. Sie haben darüber hinaus eine Vorstellung davon erhalten, welche Berufsgruppen sich in der Praxis mit dem Wirtschaftsrecht befassen. Und wie funktioniert die Arbeit in der Praxis? Konkret etwas dazu, wie angehende Wirtschaftsjuristen denken und arbeiten, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
2
Wie (angehende) Wirtschaftsjuristen denken und arbeiten
In diesem Kapitel
Wichtige Hilfsmittel kennen
Mit Gesetzen umgehen können
Subsumtionstechnik und Gutachtenstil beherrschen
In diesem Kapitel haben Sie nun Gelegenheit, in die juristische Arbeitsweise einzutauchen und sich mit dem einschlägigen Handwerkszeug vertraut zu machen. Eignen Sie sich dazu die Denk- und Arbeitsweise (angehender) Wirtschaftsjuristen an und schlagen Sie dann eine Brücke zum Studium. Erfahren Sie mehr dazu, was von Ihnen regelmäßig verlangt wird, wenn es um (wirtschafts-)rechtliche Themen geht. Dabei lernen Sie nicht nur den Umgang mit Gesetzestexten kennen, sondern qualifizieren sich obendrein dafür, wie man Fälle löst. Am Ende dieses Kapitels haben Sie dann bereits eine konkrete Vorstellung davon, wie Sie mit alledem umgehen können. So ausgestattet sind Sie dann für die weiteren Kapitel bestens gerüstet.
Selbst wenn Sie in Ihrer beruflichen Praxis nicht unbedingt in die Situation kommen werden, tatsächlich juristisch zu arbeiten (wofür gibt es schließlich Spezialisten?), wird es Ihnen aber helfen, sich das Wirtschaftsrecht zu erschließen, wenn Sie sich mit der juristischen Arbeitsweise vertraut machen.
Bestens ausgestattet: Der wirtschaftsrechtliche Werkzeugkasten
Um wirtschaftsrechtlich arbeiten zu können – egal in welchem Metier –, brauchen Sie das nötige Arbeitsmaterial. Einiges davon ist unerlässlich, auf anderes können Sie bei Bedarf zurückgreifen.
Unverzichtbar: Die einschlägigen Gesetze
Was Sie in jedem Falle zwingend benötigen, sind die einschlägigen Gesetzestexte. Die können Sie beispielsweise im Internet finden.
Hilfreich ist das Portal des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz unter www.gesetze-im-internet.de.
Da Ihnen das Internet in Prüfungen kaum zur Verfügung steht, können Sie die einschlägigen Gesetze einzeln erwerben oder – was sich oftmals empfiehlt – auf entsprechende Textsammlungen zurückgreifen. Dabei gilt ein bisschen: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Viele Fachverlage haben entsprechende Titel in ihrem Sortiment, zum Beispiel Wichtige Gesetze des Wirtschaftsprivatrechts, Wichtige Wirtschaftsgesetze, Wichtige Wirtschaftsgesetze für Bachelor/Master oder Aktuelle Wirtschaftsgesetze. Darin sind jeweils die relevanten Gesetze zusammengestellt, allerdings nicht immer vollständig, sondern nur auszugsweise. Entsprechende Bände sind über den Buchhandel leicht zu beziehen. Erkundigen Sie sich einfach, welche Gesetze in Ihrer Prüfung zugelassen sind. Wenn Sie es noch persönlicher möchten: Man kann sich heute Gesetzesbücher sogar kurzfristig nach seinen jeweiligen Bedürfnissen eigens zusammenstellen (etwa über www.gesetzbuch24.de). Auf eines sollten Sie jedoch unbedingt achten, nämlich Ihre Gesetze auf dem aktuellen Stand zu halten.
Gesetze, Gerichte, Gewohnheiten und die »herrschende Meinung«
Der »Aufhänger« für die juristische Arbeit sind zunächst immer die einschlägigen Gesetze. An den Gerichten liegt es dann, diese Gesetze anzuwenden. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass der Gesetzgeber bestimmte Fallkonstellationen nicht bedacht hat und die Gerichte (vor allem die höchstrichterliche Rechtsprechung) das Recht weiterentwickeln, gegebenenfalls sogar neues Recht schaffen (Richterrecht). Wenn sich eine bestimmte rechtliche Überzeugung im Laufe der Jahre mehr und mehr verfestigt, spricht man von Gewohnheitsrecht. So existieren im Wirtschaftsrecht teilweise Rechtsinstitute, die gesetzlich gar nicht ausdrücklich geregelt, die aber gleichwohl gewohnheitsrechtlich anerkannt sind. Im Handelsrecht spielen besondere »Gewohnheiten und Gebräuche« unter Kaufleuten – Handelsbräuche genannt (§ 346 HGB) – sogar explizit eine Rolle. In diesem Buch finden Sie gegebenenfalls an entsprechender Stelle einen Hinweis, sollte es darauf ankommen. Gewicht hat zudem die Rechtswissenschaft. In Fachaufsätzen und Fachbüchern werden beispielsweise unterschiedliche Ansichten zu rechtlichen Problemen aufgegriffen und diskutiert. Bildet sich eine Meinung heraus, die auf breite Zustimmung stößt, spricht man von »herrschender Meinung« (kurz: »h. M.«). Manchmal werden in der höchstrichterlichen Rechtsprechung und der herrschenden Meinung in der Literatur durchaus unterschiedliche Auffassungen vertreten. Solche Details werden in diesem Buch aber nicht vertieft.
Bedarfsweise: Weitere Hilfsmittel
Daneben gibt es noch weitere Arbeits- und Hilfsmittel, die Sie nicht gleich anzuschaffen brauchen (bei Bedarf schauen Sie einfach in einer gut sortierten Bibliothek vorbei). Die weiteren Hilfsmittel können Ihnen aber helfen, einzelne Aspekte zu vertiefen oder spezielle Fragen zu beantworten.
Kommentare: Die gibt es zu vielen Gesetzen. Darin finden Sie Erläuterungen und Analysen einzelner Vorschriften mit weiteren Hinweisen (etwa zu Literatur und Rechtsprechung). Ein bekannter Kommentar zum BGB ist beispielsweise der sogenannte Palandt.
Fachbücher: Fachbücher gibt es zu den unterschiedlichsten wirtschaftsrechtlichen Themen, und zwar als wissenschaftliche Darstellungen wie auch als praxisorientierte Handreichung.
Fachzeitschriften: Viele wirtschaftsrechtliche Probleme werden in Beiträgen in allgemeinjuristischen oder wirtschaftsrechtlichen Fachzeitschriften dargestellt und diskutiert. Bekannte Fachzeitschriften sind – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – neben der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW) vor allem mit wirtschaftsrechtlichem Bezug und interdisziplinärem Ansatz der Betriebs-Berater sowie Der Betrieb. Darüber hinaus gibt es für einzelne Rechtsbereiche Spezialliteratur.
Gerichtsentscheidungen: Sie haben für das Verständnis unseres Rechts eine große Bedeutung – allen voran die Entscheidungen der höchsten Gerichte (Bundesgerichtshof, Bundesarbeitsgericht, Bundespatentgericht etc.). Wenn Sie kein rechtswissenschaftliches Studium absolvieren, brauchen Sie sich mit Details aber nicht zu belasten.
Bestens vorbereitet: Das wird von Ihnen erwartet
Erwartet wird von Ihnen, dass Sie mit Ihrem Werkzeugkasten (allen voran den einschlägigen Gesetzen) umgehen können. Das ist das Handwerkszeug aller Juristen – egal ob als Anwalt oder Unternehmensjurist, ob in der Verwaltung oder Justiz. Lernen Sie hier, wie Sie Gesetze handhaben.
Den Code knacken – wie Sie Gesetze »zitieren«
Ein Gesetz kann ein ganzes Gesetzbuch sein (etwa das BGB, HGB etc.) oder ein einzelner Paragraf (oft als Vorschrift, Norm, Regelung oder Bestimmung bezeichnet – beim Grundgesetz spricht man übrigens von Artikeln). Wenn Sie mit einzelnen Paragrafen beziehungsweise Artikeln arbeiten, sollten Sie wissen, wie man sie konkret bezeichnet, wenn man sich darauf bezieht (zum Beispiel wenn Sie einen Fall lösen). Dazu gibt es in der Juristerei ein gemeinsames Verständnis und eine Art »Zeichencode«, den Sie natürlich nutzen sollten. Damit jeder weiß, worum es geht, müssen Sie genau angeben, auf welchen Paragrafen, gegebenenfalls welchen Absatz, Satz oder weitere Details Sie sich beziehen. Das geht so: § = Paragraf, Art. = Artikel, Abs. = Absatz (es gehen auch römische Zahlen für einen Absatz, also I, II, III …), »S.« beziehungsweise 1, 2, 3, 4 und so weiter = Satz, »Halbs.« = Halbsatz, »Nr.« = Nummer. Sollte es innerhalb eines Tatbestands zwei Tatbestandsmerkmale geben, die alternativ vorliegen können, spricht man von Alternative (»Alt.«), bei mehr als zwei Optionen von Varianten (»Var.«). Wenn Sie auf weitere, sich anschließende Paragrafen Bezug nehmen, können Sie ein »f.« (für eine folgende Norm) oder ein »ff.« (für mehrere Normen) verwenden. Dann stellt man üblicherweise ein doppeltes Paragrafenzeichen (»§§«) voran.
Finden Sie § 812 Abs. 1, 1. Alt. BGB? Was steht in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UrhG? Und welche Vorschriften sind mit §§ 349 f. HGB gemeint?
Erst einmal muss man die Regelungen finden. Hier gilt das geflügelte Wort »Man muss nicht viel wissen, man muss nur wissen, wo es steht«. Das können Sie sich zunutze machen: Versuchen Sie erst gar nicht, sich irgendwelche Vorschriften zu merken oder womöglich auswendig zu lernen. Das wird nicht erwartet und wäre obendrein verlorene Liebesmüh. Schließlich kann es immer wieder vorkommen, dass der Gesetzgeber einzelne Vorschriften mehr oder weniger umfangreich ändert.
Bürden Sie sich nicht unnötigen Ballast auf. Bemühen Sie sich stattdessen lieber, eine Gesetzesvorschrift einfach aufmerksam zu lesen, und versuchen Sie, den Inhalt zu verstehen. Schließlich gilt: Was Sie verstanden haben, brauchen Sie nicht zu lernen.
Gesetze verstehen in fünf Minuten
Wer seine Finger auf einem Klavier virtuos über die Tasten hasten lassen möchte, wird sich an ein Instrument setzen und immer wieder üben. Auf die Wegstrecke eines Marathons wird man sich kaum unvorbereitet einlassen. Das gilt in etwa auch für das Wirtschaftsrecht. Lernen Sie das Gesetz als Ihr Handwerkszeug kennen. Das ist zwar zugegebenermaßen nicht eben eine erbauliche Lektüre. Aber wenn Sie wissen, dass die ungezählten Vorschriften, die es so gibt, fast alle nach demselben Prinzip aufgebaut sind, sollte es Ihnen sogar möglich sein, selbst unbekannte Vorschriften zu verstehen. Man unterscheidet bei einer Vorschrift zwischen
dem Tatbestand und
der Rechtsfolge.
Beides lässt sich leicht behalten, wenn Sie sich eine Wenn-dann-Verknüpfung denken: Wenn die einschlägigen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, dann tritt eine vorgesehene Rechtsfolge ein. Knöpfen Sie sich zum Beispiel § 433 Abs. 1 BGB vor. Dort heißt es in Satz 1:
»Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen.«
Wie ist diese Vorschrift zu verstehen? Zäumen Sie das Pferd einmal von hinten auf und sehen Sie sich zunächst die Rechtsfolge an.
Rechtliche Konsequenzen: Die Rechtsfolge
Die Rechtsfolge ist häufig das Interessante an einer Norm, gewissermaßen das Salz in der Suppe. Denn sie verrät Ihnen, was die rechtlichen Konsequenzen sind.
Der Rechtsfolge sollten Sie stets eine besondere Aufmerksamkeit schenken.
Liest man den § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB mit dem »Wenn-dann-Schema« im Hinterkopf, dann wird jemand verpflichtet, einem anderen die Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen. Damit haben Sie die Rechtsfolge: Übergabe und Eigentumsverschaffung. Das tritt aber nur ein, wenn der Tatbestand erfüllt ist.
Rechtliche Voraussetzungen: Der Tatbestand
Der Tatbestand einer Vorschrift enthält mindestens eine (oftmals sogar mehrere) Voraussetzung(en). Man nennt das Tatbestandsmerkmal (beziehungsweise bei mehreren Voraussetzungen: Tatbestandsmerkmale). Die Rechtsfolge tritt nur ein, wenn die Voraussetzung(en) erfüllt ist/sind.
Sind in einem Tatbestand tatsächlich einmal mehrere Voraussetzungen genannt, kann es sein, dass alle erfüllt sein müssen. Manchmal können Sie direkt dem Wortlaut entnehmen, ob entweder das eine »oder« das andere gegeben sein muss.
So etwas finden Sie beispielhaft in § 823 Abs. 1 BGB (die »oder« sind fett hervorgehoben):
»Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.«
Zurück zu § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB. Was sind die Tatbestandsmerkmale? »Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache […]«. Mit dem »Wenn-dann-Schema« lassen sich darin schon die nötigen Tatbestandsmerkmale identifizieren: zum einen der »Kaufvertrag« (wenn es den gibt, gibt es automatisch einen »Verkäufer« und einen »Käufer«), zum anderen eine »Sache«. Sind beide Tatbestandsmerkmale im konkreten Fall gegeben, folgt als rechtliche Konsequenz automatisch die Verpflichtung zur Übergabe und Eigentumsverschaffung.
Wenn es einen Kaufvertrag (Tatbestandsmerkmal 1) betreffend einer Sache (Tatbestandsmerkmal 2) gibt, dann besteht eine Verpflichtung des Verkäufers zur Übergabe und Eigentumsverschaffung (Rechtsfolge).
Können Sie sich mit dem Wissen im Hinterkopf selbst § 433 Abs. 2 BGB erarbeiten? Kein Problem mehr, oder?
Achten Sie bei jeder Norm, die Ihnen unterkommt, immer darauf, was die Rechtsfolge ist und welche Tatbestandsmerkmale erfüllt sein müssen, damit die Rechtsfolge eintritt. Das wird Ihnen zunächst vielleicht etwas ungewohnt vorkommen. Wie beim Klavierspielen oder beim Marathon wird das zunehmend besser klappen.
In Abbildung 2.1 finden Sie noch einmal als Übersicht die Konzeption einer gesetzlichen Vorschrift.
Abbildung 2.1: Aufbau einer Gesetzesvorschrift
Gesetze auslegen: Inhalte erfassen
Nicht immer erschließt sich einem sofort die tiefere Bedeutung einer Norm. Dann muss man ein Gesetz interpretieren. Man spricht dann davon, ein Gesetz auszulegen. Gängige Auslegungsmethoden orientieren sich am Wortsinn eines Gesetzesbegriffs (wörtliche Auslegung), an der Stellung einer Norm innerhalb des Regelungszusammenhangs (systematische Auslegung), an der Entstehungsgeschichte einer Regelung (historische Auslegung) oder an deren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung