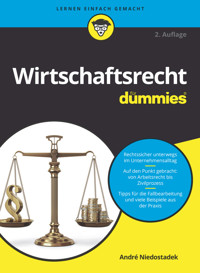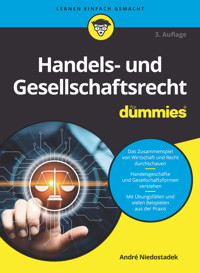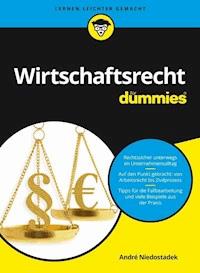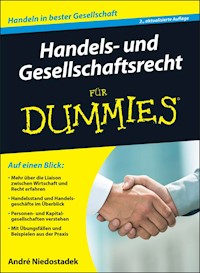
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Handels- und Gesellschaftsrecht
Von BGB bis HGB alles okay
Mit übungsfällen und Lösungen
Das Handels- und Gesellschaftsrecht ist für jeden wichtig, der sich mit Wirtschaft beschäftigt. Aber gerade Nicht-Juristen tun sich mit diesem Stoff schwer. Deshalb hat André Niedostadek dieses Buch speziell für Jura-Einsteiger geschrieben, die sich in ihrem Studium mit dem Handels- und Gesellschaftsrecht befassen müssen. Im Handelsrecht erklärt er Ihnen Wissenswertes zum Handelsstand und zu den Handelsgeschäften, im Gesellschaftsrecht geht er auf Personen- und Kapitalgesellschaften ein. Ergänzend finden Sie eine Einführung in die Falllösung und eine Reihe von übungsfällen inklusive Beispiellösungen. So sind Sie für die Prüfung bestens gewappnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2., aktualisierte und überarbeitete Auflage 2016
© 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
This E-Book published under license with the original publisher John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses E-Book wird mit Genehmigung des Original-Verlages John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: DragonImages-Fotolia.com
Korrektur: Geesche Kieckbusch
Satz: inmedialo Digital- und Printmedien UG, Plankstadt
Print ISBN: 978-3-527-71282-3ePub ISBN: 978-3-527-80242-5mobi ISBN: 978-3-527-80243-2
Über den Autor
»Jura kann jeder lernen!« – mit diesem Credo hat André Niedostadek bereits zahlreiche Studierende mit den Grundlagen des Handels- und Gesellschaftsrechts vertraut gemacht. Nach dem eigenen Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Münster und Aberystwyth in Wales sowie einem Forschungsaufenthalt an der Universität Cambridge sammelte er selbst zunächst mehrere Jahre lang vielfältige Berufserfahrungen als Consultant, Rechtsanwalt und Referent in unterschiedlichen Unternehmen, bevor er schließlich 2008 als Hochschullehrer an die Hochschule Harz wechselte. Dort gibt er sein Wissen und seine Erfahrung heute als Professor für Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht weiter. Als Dozent, Berater und Gutachter hält er darüber hinaus weiterhin den Bezug zur Praxis. Er ist Verfasser und Herausgeber mehrerer Bücher sowie Autor von Studienbriefen und Fachbeiträgen zu verschiedenen rechtlichen Themen. Leserinnen und Lesern der »… für Dummies«-Reihe ist er bereits als Autor des Prüfungstrainers zum Handels- und Gesellschaftsrechts sowie von »BGB für Dummies« bekannt. In Kürze erscheint sein Buch »Wirtschaftsrecht für Dummies«.
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Einführung
Über dieses Buch
Begriffe, die in diesem Buch verwendet werden
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Teil I: Neue Rechtsgebiete entdecken: Die Tour beginnt …
Teil II: Handelsrecht: Der Handelsstand
Teil III: Handelsrecht: Die Handelsgeschäfte
Teil IV: Gesellschaftsrecht: Die Personengesellschaften
Teil V: Gesellschaftsrecht: Die Kapitalgesellschaften
Teil VI: Recht praktisch: Vorsicht Fälle!
Teil VII: Recht hilfreich: Der Top-Ten-Teil
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I Neue Rechtsgebiete entdecken: Die Tour beginnt …
1 Reisevorbereitungen treffen …
Ein Hinweis vorweg: Kein Grund zur Panik
Zwei Seiten einer Medaille: Wirtschaft und Recht
Drei Grundpfeiler unserer Rechtsordnung
Das Privatrecht
Das öffentliche Recht
Das Strafrecht
Vier Schritte, um wirklich jedes Gesetz in den Griff zu bekommen
Schritt 1: Gesetze lesen: Das A und O
Schritt 2: Gesetze unterscheiden: Verschiede Typen von Normen
Schritt 3: Gesetze verstehen: Tatbestand und Rechtsfolge
Schritt 4: Gesetze auslegen: Inhalte erfassen
2 Im Landeanflug: Ein erster Überblick
Ihr Starterpaket fürs Handelsrecht
Für wen gilt das Handelsrecht?
Was bezweckt das Handelsrecht?
Welche Rechtsgrundlagen sind zu beachten?
Ihr Starterpaket fürs Gesellschaftsrecht
Was ist eine Gesellschaft?
Welche verschiedenen Gesellschaftsformen gibt es?
Welche Fragen stellen sich typischerweise im Gesellschaftsrecht?
Teil II Handelsrecht: Der Handelsstand
3 Eine Frage des Typs: Von Kaufleuten und solchen, die es gern wären
Für’s »Big Business«: Der Istkaufmann
Der Grundsatz – oder: Was ist ein Handelsgewerbe?
Die Ausnahme – oder: Wann liegt doch kein Handelsgewerbe vor?
Wann »betreibt« jemand ein Handelsgewerbe?
Eine Nummer kleiner: Der Kannkaufmann
Bodenständig: Der land- und forstwirtschaftliche Kaufmann
Kein Entkommen: Der Fiktivkaufmann
In guter Gesellschaft: Der Formkaufmann
Zu hoch gepokert: Der Scheinkaufmann
4 Schwarz auf weiß: Das Registerrecht
Das Handelsregister
Was ist das Handelsregister?
Wozu dient das Handelsregister?
Was steht im Handelsregister?
Das formelle Registerrecht
Die Zuständigkeit
Das Eintragungsverfahren
Das materielle Registerrecht
Die negative Publizität gemäß § 15 Abs. 1 HGB
Die positive Publizität gemäß § 15 Abs. 2 HGB
Die positive Publizität gemäß § 15 Abs. 3 HGB
5 Keineswegs nur Schall und Rauch: Die Firma
Begriffliches
Die Firma = ein Name
Der Name eines Kaufmanns
Der Name für den Geschäftsverkehr
Rechtliche Bedeutung
Woraus eine Firma besteht
Der Firmenkern
Der Rechtsformzusatz
Wichtige Firmengrundsätze
Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit
Grundsatz der Firmenwahrheit
Grundsatz der Firmeneinheit
Grundsatz der Firmenöffentlichkeit
Grundsatz der Firmenbeständigkeit
Schutz der Firma
Haftung bei Firmenfortführung
Haftung des Erwerbers bei Firmenfortführung
Haftung des Erben bei Firmenfortführung
Haftung bei Eintritt in das Geschäft eines Einzelkaufmanns
6 Durchaus vertretbar: Prokura und Handlungsvollmacht
Wie war das noch mit der Stellvertretung?
Die Prokura
Wie bekommt jemand Prokura?
Wie erlischt eine Prokura?
Wozu berechtigt die Prokura?
Die Handlungsvollmacht
Wie bekommt jemand Handlungsvollmacht?
Wie erlischt die Handlungsvollmacht?
Wozu berechtigt die Handlungsvollmacht?
Was gilt bei Ladenangestellten?
7 Mit Unterstützung klappt’s besser: Einige Hilfspersonen
Der Handlungsgehilfe
Der Handelsvertreter
Was ist eigentlich ein Handelsvertreter?
Was regelt der Handelsvertretervertrag
Welche Rechte und Pflichten haben die Beteiligten?
Der Handelsmakler
Was ist eigentlich ein Handelsmakler?
Was regelt der Handelsmaklervertrag?
Welche Rechte und Pflichten haben die Beteiligten?
Der Kommissionsagent
Der Vertragshändler
Der Franchisenehmer
Teil III Handelsrecht: Die Handelsgeschäfte
8 Allgemeine Regelungen zu den Handelsgeschäften
Die Handelsgeschäfte
Einseitiges Handelsgeschäft
Beidseitiges Handelsgeschäft
Die Handelsbräuche
Das Zustandekommen von Handelsgeschäften
Schweigen auf ein Angebot zur Geschäftsbesorgung
Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben
Der kaufmännische Sorgfaltsmaßstab
Das kaufmännische Vertragsstrafeversprechen
Die kaufmännische Bürgschaft
Die handelsrechtlichen Zinsregelungen
Die kaufmännische Vergütung
Die Wirksamkeit von Abtretungen
Das handelsrechtliche Kontokorrent
Das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht
Die ordnungsgemäße Leistung bei Handelsgeschäften
Der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten
9 Besondere Formen von Handelsgeschäften
Der Handelskauf
Was ist ein Handelskauf?
Besonderheiten beim Annahmeverzug
Besonderheiten beim Bestimmungskauf
Besonderheiten beim Fixhandelskauf
Besonderheiten bei der Sachmängelhaftung
Das Kommissionsgeschäft
Weitere Handelsgeschäfte
Teil IV Gesellschaftsrecht: Die Personengesellschaften
10 Alltagstauglich: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Rechtliche Grundlagen & praktische Bedeutung
So gründen Sie eine GbR
Anforderungen an die GbR-Gründung
Konsequenzen der GbR-Gründung
Was im Innenverhältnis zu beachten ist
Die Geschäftsführung
Die Rechte und Pflichten
Das Gesellschaftsvermögen
Was im Außenverhältnis zu beachten ist
Die Rechtsfähigkeit
Die Vertretung
Die Haftung
Was beim Gesellschafterwechsel zu beachten ist
Eintritt eines neuen Gesellschafters
Ausscheiden eines bisherigen Gesellschafters
Das Ende der GbR
11 Grundlegend: Die offene Handelsgesellschaft
Rechtliche Grundlagen & praktische Bedeutung
So gründen Sie eine OHG
Anforderungen an die OHG-Gründung
Konsequenzen der OHG-Gründung
Was im Innenverhältnis zu beachten ist
Die Geschäftsführung
Die Rechte und Pflichten
Das Gesellschaftsvermögen
Was im Außenverhältnis zu beachten ist
Die Rechtsfähigkeit
Die Vertretung
Die Haftung
Was beim Gesellschafterwechsel zu beachten ist
Eintritt eines Gesellschafters
Ausscheiden eines Gesellschafters
Das Ende der OHG
12 Mit zweierlei Maß: Die Kommanditgesellschaft
Rechtliche Grundlagen & praktische Bedeutung
So gründen Sie eine KG
Anforderungen an die KG-Gründung
Konsequenzen der KG-Gründung
Was im Innenverhältnis zu beachten ist
Die Geschäftsführung
Die Rechte und Pflichten
Das Gesellschaftsvermögen
Was im Außenverhältnis zu beachten ist
Die Rechtsfähigkeit
Die Vertretung
Die Haftung
Was beim Gesellschafterwechsel zu beachten ist
Eintritt eines Gesellschafters
Ausscheiden eines Gesellschafters
Das Ende einer KG
13 Und sonst? Weitere Personengesellschaften
Die stille Gesellschaft
Rechtliche Grundlagen & praktische Bedeutung
So gründen Sie eine stille Gesellschaft
Was im Innenverhältnis zu beachten ist
Was im Außenverhältnis zu beachten ist
Die Partnerschaftsgesellschaft (mit beschränkter Berufshaftung)
Rechtliche Grundlagen & praktische Bedeutung
So gründen Sie eine Partnerschaftsgesellschaft
Was im Innenverhältnis zu beachten ist
Was im Außenverhältnis zu beachten ist
Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung
Rechtliche Grundlagen & praktische Bedeutung
So gründen Sie eine Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung
Was im Innenverhältnis zu beachten ist
Was im Außenverhältnis zu beachten ist
Teil V Gesellschaftsrecht: Die Kapitalgesellschaften
14 Überschaubares Risiko: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtliche Grundlagen & praktische Bedeutung
So gründen Sie eine GmbH
Anforderungen an die GmbH-Gründung
Konsequenzen der GmbH-Gründung
Was im Innenverhältnis zu beachten ist
Die Aufgaben und Rechtsstellung der Organe
Die Rechte und Pflichten der Gesellschafter
Das Gesellschaftsvermögen
Was im Außenverhältnis zu beachten ist
Die Rechtsfähigkeit
Die Vertretung
Die Haftung
Was beim Gesellschafterwechsel zu beachten ist
Das Ende einer GmbH
15 Nicht nur fürs Börsenparkett: Die Aktiengesellschaft
Rechtliche Grundlagen & praktische Bedeutung
So gründen Sie eine AG
Anforderungen an die AG-Gründung
Konsequenzen der AG-Gründung
Was im Innenverhältnis zu beachten ist
Die Organe der AG
Das Gesellschaftsvermögen
Was im Außenverhältnis zu beachten ist
Die Rechtsfähigkeit
Die Vertretung
Die Haftung
Was beim Gesellschafterwechsel zu beachten ist
Das Ende einer AG
Exkurs: Konzern und Holding
Teil VI Recht praktisch: Vorsicht Fälle!
16 Die Falllösung im Handels- und Gesellschaftsrecht
Methodik der Rechtsanwendung
Aller Anfang ist leicht
Lesen Sie den Sachverhalt!
Beachten Sie die Fallfrage!
Finden Sie die richtige(n) Anspruchsgrundlage(n)!
Ordnen Sie die Ansprüche!
Der Anspruchsaufbau Schritt für Schritt
Erstellen Sie eine Lösungsskizze!
Formulieren Sie das Gutachten!
Ein bisschen Technik …
… und achten Sie auf guten Stil
Lösungsvorschlag zum Beispielfall
17 Übung macht den Meister: Fälle und Lösungen
Übungsfall 1: »Prahlerei mit Konsequenzen«
Sachverhalt
Lösung
Übungsfall 2: »Wie du mir, so ich dir«
Sachverhalt
Lösung
Übungsfall 3: »Wahrlich kein Schmaus«
Sachverhalt
Lösung
Übungsfall 4: »Teures Vergnügen«
Sachverhalt
Lösung
Übungsfall 5: »Fragen bei der GmbH-Gründung«
Sachverhalt
Lösung
Übungsfall 6: »Der sorglose Aufsichtsrat«
Sachverhalt
Lösung
Teil VII Der Top-Ten-Teil
18 Auf einen Blick: Zehn Übersichten zum Handelsrecht
Einmal direkt gegenübergestellt: Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Einfach so tun, als ob: Einige handelsrechtliche Fiktionen
Selten aber nützlich: Einige handelsrechtliche Anspruchsgrundlagen
Die »Lehre vom Scheinkaufmann«
Die Publizitätswirkungen des Handelsregisters (§ 15 HGB)
Schutz Dritter bei Nichteintragung oder Nichtbekanntmachungeintragungspflichtiger Tatsachen (§ 15 Abs. 1 HGB)
Schutz Dritter bei Eintragung und Bekanntmachung eintragungspflichtiger Tatsachen (§ 15 Abs. 2 HGB)
Schutz Dritter bei falscher Bekanntmachung einer eintragungspflichtigen Tatsachen (§ 15 Abs. 3 HGB)
Die eintragungspflichtigen und eintragungsfähigen Tatsachen im Überblick
Eintragungspflichtige Tatsachen
Eintragungsfähige Tatsachen
Die Haftung bei Firmenfortführung
Haftung des Erwerbers bei Firmenfortführung (§ 25 Abs. 1 HGB)
Haftung des Erben bei Firmenfortführung (§ 27 HGB)
Haftung bei Eintritt in das Geschäft eines Einzelkaufmanns (§ 28 HGB)
Die »Lehre vom kaufmännischen Bestätigungsschreiben«
Der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten (§ 366 HGB)
Die Haftung für Sachmängel (§ 377 HGB)
19 Auf einen Blick: 10 Übersichten zum Gesellschaftsrecht
Einige Unterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften
Einige Überlegungen zur Wahl der »richtigen« Rechtsform
Beachtenswertes bei der GbR
Beachtenswertes bei der OHG
Beachtenswertes bei der KG
Beachtenswertes bei weiteren Personengesellschaften
Beachtenswertes bei der GmbH
Beachtenswertes bei der AG
Checkliste zur GmbH-Gründung
Checkliste zur AG-Gründung
20 Glossar
Stichwortverzeichnis
Einführung
Herzlich willkommen zum Handels- und Gesellschaftsrecht für Dummies. Sie haben vermutlich zu diesem Buch gegriffen, um sich in ein neues Rechtsgebiet vorzuwagen, nicht wahr? Eine gute Entscheidung, denn mit dem Handels- und Gesellschaftsrecht präsentieren sich Ihnen zwei überaus praxisrelevante Rechtsgebiete, die wirklich eine Menge zu bieten haben. In der Praxis begegnen sie uns sogar im Grunde genommen auf Schritt und Tritt, auch wenn wir uns dessen meist gar nicht bewusst sind. Nur ein Beispiel: Ist Ihnen, als Sie dieses Buch aus der »… für Dummies«-Reihe beim Buchhändler Ihres Vertrauens erworben haben, in den Sinn gekommen, dass Sie selbst bei diesem Erwerb direkt mit dem Handels- und Gesellschaftsrecht auf Tuchfühlung gegangen sind? Wohl kaum. Doch höchstwahrscheinlich haben Sie nicht bloß einen 08/15-Kaufvertrag abschlossen, sondern es dürfte sogar ein Handelskauf im Sinne des Handelsgesetzbuches vorliegen – jedenfalls dann, wenn Ihr Buchhändler Kaufmann ist. Gut möglich auch, dass Sie den Vertrag gar nicht mit dem Buchhändler selbst, sondern mit einer dahinterstehenden Gesellschaft abgeschlossen haben (die z. B. als »Offene Handelsgesellschaft«, »Kommanditgesellschaft« oder als »Gesellschaft mit beschränkter Haftung« etc. »konstruiert« ist). Sie ahnen vielleicht schon: Das Handels- und Gesellschaftsrecht ist nicht bloß irgendeine abstrakte und abseitige Rechtsmaterie, sondern man kann ihr im Alltag in vielerlei Hinsicht begegnen.
Dennoch fällt gerade vielen Studierenden der Zugang zu alldem nicht immer leicht. Dieses »… für Dummies«-Buch möchte Abhilfe schaffen. Nehmen Sie es einfach als eine Art Reiseführer, der Sie auf Ihrer Route durch die vielfältigen »Regionen« des Handels- und Gesellschaftsrechts begleitet. Lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen, schnappen Sie etwas »Fachchinesisch« auf, um mitreden zu können, und versuchen Sie vor allem, mit den verschiedenen Gesetzen umzugehen und sie zu verstehen. Sie bieten Ihnen so etwas wie »Landkarten«, um sich in den einzelnen Rechtsgebieten zurechtzufinden. Sie sollten nach der Lektüre dieses Buches in der Lage sein, zielsicherer durch den (bloß auf den ersten Blick) undurchdringlichen Paragrafenwirrwarr hindurchzunavigieren. Und wer weiß, vielleicht stellen Sie bei alldem ja sogar fest, dass Recht zu Recht recht reizvoll sein kann.
Und das Schöne bei alledem: Für Ihre Entdeckungstour benötigen Sie weder ein Visum noch sind irgendwelche Impfungen vorzunehmen oder Einreiseformalitäten abzuwickeln. Überhaupt können Sie getrost auf umfangreiche Reisevorbereitungen verzichten (ein bisschen Vorbereitung finden Sie in Kapitel 1) und eigentlich sofort loslegen. Sie profitieren von der Lektüre insbesondere dann,
wenn Sie sich an einer Universität für das Fach Rechtswissenschaften eingeschrieben haben und sich noch in den ersten Semestern befinden,
wenn Sie an einer (Fach-)Hochschule oder Berufsakademie studieren und das Handels- und Gesellschaftsrecht – wie in vielen Studiengängen üblich – einen Teil des Studiums darstellt,
wenn Sie als Praktiker mit Bezug zu diesen Rechtsgebieten einen verständlichen Einstieg in die zentralen Eckpunkte bekommen möchten oder
wenn Sie sich als Laie ganz allgemein für rechtliche Themen interessieren und einen fundierten Blick hinter die Kulissen werfen möchten, anstatt sich nur auf ein (mitunter trügerisches) Rechtsgefühl zu verlassen.
Was immer Ihr persönliches Motiv ist, sich mit dem Handels- und Gesellschaftsrecht zu befassen, dieses »… für Dummies«-Buch bietet Ihnen das nötige Rüstzeug.
Über dieses Buch
Wie schon erwähnt versteht sich dieses Buch als eine Art Reiseführer. Was dürfen Sie also erwarten? Zunächst einmal, dass es
Ihnen Wissenswertes vermittelt und Sie auf die »Sehenswürdigkeiten« hinweist, die es zu entdecken gibt,
praktische Tipps bereit hält, damit Sie sich »vor Ort« orientieren können und
Sie gegebenenfalls mit Eigenheiten vertraut macht, die man kennen und beachten sollte.
Dazu bieten Ihnen die einzelnen Kapitel so etwas wie »Tourenvorschläge«, die Sie nach und nach absolvieren können, um sich so die Grundlagen des Handels- und Gesellschaftsrechts zu erschließen. Doch es soll nicht allein darum gehen, Ihnen ein bestimmtes Wissen zu vermitteln. Das Buch möchte Sie vielmehr dabei unterstützen, …
… einen Einblick in die Rechtsanwendung zu bekommen. Gerade im Jurastudium steht sie im Fokus. Hier helfen einerseits die vielfach eingestreuten Hinweise und Beispiele (samt Lösungsvorschlägen) sowie andererseits speziell Teil VI mit einigen Übungsfällen.
… ein Gespür für rechtliche Fragestellungen zu entwickeln. Gerade von künftigen Absolventen der Wirtschafts-, Sozial- oder Verwaltungswissenschaften (sowie weiterer Studiengänge), die das Handels- und Gesellschaftsrecht vielleicht »nur« im Nebenfach studieren, wird immerhin eine gewisse Sensibilität für rechtliche Fragestellungen erwartet. Auch wenn man selbst also vielleicht keine kniffligen juristischen Probleme zu meistern hat (und dies regelmäßig den juristischen Spezialisten überlassen kann), so muss man doch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der eigenen Tätigkeit vertraut sein und beispielsweise ein Gespür für Haftungsrisiken entwickeln. Gerade in der beruflichen Praxis geht es immer wieder darum, Sachverhalte unter Berücksichtigung juristischer Gesichtspunkte einzuschätzen und darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen.
… sich wichtige Schlüsselkompetenzen anzueignen. Wenn Sie sich mit rechtlichen Fragestellungen befassen, wie sie in diesem Buch behandelt werden, können Sie zugleich wichtige Schlüsselkompetenzen trainieren. Dazu gehört es beispielsweise, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und zu analysieren (also Wichtiges von Unwichtigem zu trennen), Probleme zu strukturieren und zu lösen, sich argumentativ mit Sachverhalten auseinanderzusetzen, die eigenen Ansichten zu begründen und sich im Rahmen einer stringenten Gedankenführung in Wort und Schrift auszudrücken.
Das Handels- und Gesellschaftsrecht ist wirklich ein weites Feld. Erwarten Sie daher keine umfassende Abhandlung sämtlicher Einzelheiten und Probleme. Dieses Buch bietet Ihnen vielmehr einen Einstieg und eine knappe, aber doch verständliche Information über die wesentlichen Aspekte. Im Fokus stehen Kerngedanken und Zusammenhänge, die für das Verständnis des Handels- und Gesellschaftsrechts prägend sind. Dazu kann ein Blick in die Praxis manchmal mehr beitragen als die detaillierte Darstellung von Meinungsstreitigkeiten.
Last but not least: Natürlich kann es gerade im Rahmen eines Studiums (und in der Praxis) vorkommen, dass man auf Fragestellungen stößt oder mit Problemen konfrontiert wird, von denen man vielleicht bis dato noch nichts gehört oder zu denen man noch nichts gelesen hat und die in diesem Buch letztlich aus Platzgründen ausgeklammert bleiben (müssen). Wenn Sie alle Kapitel durchgearbeitet haben, sollten Sie jedoch so fit sein, um sich unbekannte Themenfelder (gegebenenfalls mithilfe weiterführender Literatur) eigenständig zu erschließen. Sie sehen: Mit diesem Handels- und Gesellschaftsrecht für Dummies können Sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Begriffe, die in diesem Buch verwendet werden
Charakteristisch der »… für Dummies«-Reihe ist es, das jeweilige Thema verständlich darzustellen. Das dürfen Sie von diesem Buch natürlich ebenfalls erwarten. Ganz ohne Fachbegriffe geht es dennoch nicht. Das hat einen einfachen Grund: Unser Recht ist randvoll mit Begriffen, die häufig nicht nur sehr abstrakt sind (weshalb nicht immer gleich klar ist, was eigentlich konkret gemeint ist), sondern die sogar einen anderen Inhalt haben können als unsere Alltagssprache. Die »Firma« ist so ein Fall. Vielleicht verbinden Sie damit typischerweise eine Art Unternehmen oder Betrieb? Handelsrechtlich steht die »Firma« dagegen für etwas ganz anderes (was genau, sei allerdings noch nicht verraten). Dennoch brauchen Sie für die Arbeit mit diesem Buch natürlich nicht noch einen eigenen Kurs zur Rechtssprache zu absolvieren. Wenn es darauf ankommt, sind zentrale Begriffe entweder kursiv hervorgehoben oder sie werden sogar durch ein separates Symbol gekennzeichnet und an entsprechender Stelle sofort erklärt. Damit ist dieses Buch nicht nur ein Reisebegleiter, sondern obendrein noch eine Art Sprachführer – damit die Fachterminologie für Sie kein Kauderwelsch bleibt.
Konventionen in diesem Buch
Sie kennen nun den Ansatz und die Zielsetzung dieses Buches und wissen, dass Sie keine wissenschaftliche Einführung in das Handels- und Gesellschaftsrecht in der Hand halten. Sie werden daher weder einen umfangreichen Fußnotenapparat finden, noch sollen seitenlange »wissenschaftliche« Ausführungen zu rechtlichen Problemen Sie langweilen. Dieses Buch versteht sich mehr als Lern- anstatt als Lehrbuch. Sie können die einzelnen Kapitel dieses Buches – und damit auch die Tourenvorschläge – nacheinander bearbeiten oder aber sich gezielt einzelne Punkte als Etappen herausgreifen. Auf eines dürfen Sie bei alledem keinesfalls verzichten: Halten Sie stets einen Gesetzestext parat und lesen Sie die genannten Vorschriften alle (!) am besten gleich nach, damit Sie nicht vom Kurs abkommen.
Was Sie nicht lesen müssen
Neben den grundlegenden »Basics« zum Handels- und Gesellschaftsrecht enthält dieses Buch ergänzende Informationen, die Sie nicht unbedingt gleich beim ersten Durcharbeiten lesen müssen. Solche Passagen sind optisch durch die grau unterlegten Kästen zu erkennen. Inhaltlich werden dort nochmals einzelne Aspekte vertieft, durch ergänzende Beispiele veranschaulicht oder weitere Brücken in die Praxis geschlagen.
Kommt es Ihnen lediglich darauf an, bestimmte grundlegende Kenntnisse zu erhalten und sich wesentliche Zusammenhänge zu erschließen, dann können Sie zudem die speziellen Ausführungen zur Rechtsanwendung, wie Sie sie in Teil VI zu den Fällen und Lösungen finden, ebenfalls getrost erst einmal links liegen lassen.
Törichte Annahmen über den Leser
Sicher wäre es töricht anzunehmen, Leserinnen und Leser dieses Handels- und Gesellschaftsrechts für Dummies seien naiv oder sie würden dieses Buch nur zur Hand nehmen, weil
der eigene dreijährige Nachwuchs gern mit einem Kaufmannsladen spielt und seine Eltern unerwartet damit konfrontiert, ihnen Prokura erteilen zu wollen,
man zu Sylvester den Vorsatz gefasst hat, alle Bücher der »… für Dummies«-Reihe zu verschlingen,
man recht gern etwas Gesellschaft hat.
Ganz im Gegenteil werden Sie sicher gute Gründe dafür haben, gerade dieses Buch ausgewählt zu haben. Vermutlich geht es Ihnen darum, eine komplexe Materie in den Griff zu bekommen und sich ganz im Sinne einer nüchternen Zeit-Nutzen-Abschätzung zunächst einmal auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das klingt überaus vernünftig. Gerade wenn man sich in ein bislang unbekanntes Rechtsgebiet einarbeiten will, besteht ohnehin schnell die Gefahr, sich zu verzetteln und womöglich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Buch besteht aus sieben Teilen mit insgesamt 19 Kapiteln, einem ergänzenden Glossar sowie einem Stichwortverzeichnis. Letztere helfen Ihnen, sich die Inhalte dieses Buches gezielt zu erschließen. Sämtliche Kapitel sind übrigens so verfasst, dass sie von sich aus verständlich sind und Sie eigentlich keine speziellen Vorkenntnisse aus den anderen Abschnitten benötigen. Sollten bestimmte Themen an anderer Stelle im Buch eingehender behandelt werden, finden sich gegebenenfalls entsprechende Querverweise auf andere Kapitel. Die lassen sich leicht aufstöbern, denn originellerweise folgen die jeweiligen Teile und Kapitel einer fortlaufenden Nummerierung. Und auch inhaltlich gibt es einen roten Faden:
Teil I: Neue Rechtsgebiete entdecken: Die Tour beginnt …
Legen Sie mit diesem Teil und den beiden ersten Kapiteln die Grundlagen für Ihre weitere Tour. Erfahren Sie zunächst mehr zur Liaison zwischen Wirtschaft und Recht und machen Sie sich zugleich mit dem Aufbau unserer Rechtsordnung und der Rolle des Handels- und Gesellschaftsrechts vertraut. Auch die grundlegende Arbeit mit dem Gesetz soll nicht zu kurz kommen. Wenden Sie sich dann dem Handels- und Gesellschaftsrecht selbst zu und schnüren Sie sich jeweils ein erstes Starterpaket.
Teil II: Handelsrecht: Der Handelsstand
Die Kapitel 3 bis 7 präsentieren Ihnen die wichtigsten Eckpunkte aus dem ersten Buch des Handelsgesetzbuches (HGB). Lernen Sie die verschiedenen Typen von Kaufleuten kennen, erfahren Sie, weshalb das Registerrecht eine wichtige Stellung einnimmt und warum die Firma oder der Prokurist gar nicht das sind, was man im Alltag oftmals darunter versteht. Erfahren Sie schließlich noch, welche Möglichkeiten die Praxis kennt, wenn es darum geht, sich einiger Hilfspersonen zu bedienen.
Teil III: Handelsrecht: Die Handelsgeschäfte
In den Kapiteln 8 und 9 werden Ihnen dann die allgemeinen Regeln zu den Handelsgeschäften sowie einige besondere Handelsgeschäfte selbst vorgestellt. Gerade dort gibt es vielfältige Berührungspunkte zwischen dem Bürgerlichen Recht einerseits und dem Handelsrecht andererseits zu entdecken.
Teil IV: Gesellschaftsrecht: Die Personengesellschaften
Die Kapitel 10 bis 13 geben Ihnen sodann Gelegenheit, sich mit den Personengesellschaften zu befassen. Neben der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) werden Sie die offene Handelsgesellschaft (OHG) und die Kommanditgesellschaft (KG) kennenlernen. Ein kurzer Blick auf die stille Gesellschaft, auf die Partnerschaftsgesellschaft und die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) beschließt diesen Teil.
Teil V: Gesellschaftsrecht: Die Kapitalgesellschaften
In den Kapiteln 14 und 15 geht es dann um die Kapitalgesellschaften. Im Mittelpunkt stehen dort die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie die Aktiengesellschaft (AG).
Teil VI: Recht praktisch: Vorsicht Fälle!
Wer das erworbene Wissen selbst anwenden möchte, bekommt dazu in diesem Teil und den Kapiteln 16 und 17 Gelegenheit. Zunächst wird verraten wie man Fälle löst, wobei Sie natürlich nicht auf spezifische Besonderheiten im Hinblick auf das Handels- und Gesellschaftsrecht zu verzichten brauchen. Daran anschließend können Sie dann anhand von mehreren Beispielfällen Ihre Kenntnisse unter Beweis stellen.
Teil VII: Recht hilfreich: Der Top-Ten-Teil
Erfahrenen »… für Dummies«-Leserinnen und -Lesern ist der Top-Ten-Teil schon bekannt. Dort finden Sie in den Kapiteln 18 und 19 quasi als »Best of« noch einmal in der gebotenen Kürze Wichtiges aus dem Handels- und Gesellschaftsrecht quasi auf dem Silbertablett präsentiert.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Im ganzen Buch werden Sie auf Textpassagen stoßen, die mit den typischen Symbolen der »… für Dummies«-Reihe gekennzeichnet sind. Sie verweisen auf »Merk«-würdiges, anschauliche Beispiele, bedeutsame Begriffe, hilfreiche Tipps oder ganz einfach auf die eine oder andere Klippe, die es zu umschiffen gilt. Hier eine Übersicht:
Dieses Symbol macht Sie auf wichtige oder interessante Facetten aufmerksam und betont noch einmal bestimmte Punkte des vorherigen Abschnitts.
Mit diesem Symbol sind jeweils kleinere einführende Fallbeispiele und deren Lösungen gekennzeichnet.
Die abstrakten Regelungen der unterschiedlichen Gesetze lassen sich anhand von Beispielen oftmals viel besser veranschaulichen. Sie finden daher überall im Buch verstreut zahlreiche weitere Beispiele.
Wichtige Begriffe im Text sind mit diesem Symbol hervorgehoben. Kennen Sie diese, führt Sie niemand mehr durch sein Fachchinesisch aufs Glatteis.
Speziell dieses Symbol macht Sie mit praktischen Bezügen des Handels- und Gesellschaftsrechts vertraut.
Hier finden Sie spezielle Hinweise für die Rechtsanwendung und Fallbearbeitung sowie weitere Tipps und Tricks.
Das Handels- und Gesellschaftsrecht ist nicht frei von Fallstricken. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Textpassagen bewahren Sie vor Schlimmerem.
Wie es weitergeht
Nun sind Sie gefragt: Beginnen Sie zum Beispiel gleich mit dem ersten Kapitel oder wenden Sie sich speziell den Abschnitten zu, die Sie vor allem interessieren. Egal, ob Sie sich die einzelnen Teile nach und nach erschließen oder zwischen den Kapiteln hin- und herspringen – im Laufe der Zeit werden Sie ein immer besseres Bild vom Handels- und Gesellschaftsrecht bekommen. Und das ist es ja, was Sie eigentlich wollen.
Der Jurist und Satiriker Karl Julius Weber (1767 – 1832) bemerkte einmal: »Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung«. Dazu braucht man gar nicht immer in die Ferne zu schweifen. Manchmal genügt es schon Naheliegendes zu erkunden. Nehmen Sie dieses Handels- und Gesellschaftsrecht für Dummies mit auf Ihre Entdeckungstour. Sie werden garantiert das eine oder andere später in einem ganz anderen Licht sehen. Und einmal mehr gilt: Ein bisschen Neugier und Interesse, ja vielleicht sogar etwas »Abenteuerlust« sind hilfreich. Es gibt manches zu entdecken – versprochen! In diesem Sinne einmal mehr: Bon voyage!, Have a good trip! Oder ganz einfach: Gute Reise!
Teil I
Neue Rechtsgebiete entdecken:Die Tour beginnt …
In diesem Teil . . .
Treffen Sie mit dem ersten Kapitel dieses Teils Ihrer Tour in das Handels- und Gesellschaftsrecht zunächst ein paar Reisevorbereitungen: Wie ist unsere Rechtsordnung aufgebaut? Welche Rolle spielt das Wirtschaftsprivatrecht? Wie fügen sich das Handels- und Gesellschaftsrecht dort ein? Und welche Tipps und Tricks gibt es, um mit Gesetzen umzugehen? Anschließend haben Sie dann noch Gelegenheit, tiefer in das eigentliche Handels- und Gesellschaftsrecht einzusteigen. Lernen Sie grundlegende Prinzipien und zentrale Zielsetzungen kennen.
1
Reisevorbereitungen treffen …
In diesem Kapitel
Berührungspunkte zwischen Wirtschaft und Recht erkennen
System und Aufbau der Rechtsordnung erfassen
Mit Gesetzen umgehen können
Im Mittelpunkt dieses Dummies stehen – der Buchtitel verrät es unverkennbar – das Handels- und Gesellschaftsrecht. Das sind jedoch nur zwei Rechtsgebiete eines viel umfangreicheren Regel- und Ordnungsrahmens. Weil beide zugleich zahlreiche Bezüge zu anderen Rechtsbereichen aufweisen und speziell für das Wirtschaftsleben unabkömmlich sind (denken Sie nur an die unzähligen Geschäfte, die tagtäglich nach den gleichen rechtlichen Regeln abgewickelt werden), gibt Ihnen dieses Kapitel erst einmal einen Einblick, weshalb es überhaupt rechtlicher Regelungen bedarf. Es zeigt Ihnen zudem, wie unsere Rechtsordnung aufgebaut ist und welchen Platz dabei das Handels- und Gesellschaftsrecht einnehmen. Schließlich werden Sie in der Lage sein, mit dem wichtigsten »Handwerkszeug« der Juristen umzugehen: dem Gesetz.
Ein Hinweis vorweg: Kein Grund zur Panik
Wer eine Reise unternimmt, freut sich normalerweise darauf. Bei einer Entdeckungstour in das Handels- und Gesellschaftsrecht (oder in andere Rechtsgebiete) ist die Freude allerdings nicht ganz ungeteilt: Während manche Jura hoch spannend und reizvoll finden, halten es andere für staubtrocken und öde. Wenn Sie sich selbst zur ersten Gruppe zählen, haben Sie es einfacher. Mit einer positiven Einstellung gelingt es viel leichter, den Horizont zu erweitern und den Wissensdurst zu stillen, als wenn man etwas total uninteressant findet.
Dieses »… für Dummies«-Buch möchte Ihnen das Handels- und Gesellschaftsrecht schmackhaft machen. Probieren müssen Sie davon schon selbst. Falls Sie sich also eher für andere Dinge begeistern als für Jura (sich aber aus irgendwelchen Gründen dazu »verdonnert« fühlen, da durch zu müssen) oder womöglich glauben, da eh nicht durchzublicken, lässt sich die eigene Motivation mit einem kleinen und doch effektiven Kniff steigern, damit die Tour nicht zur Tortur wird. Da negative Einstellungen nämlich wie Barrieren wirken (und obendrein echte Motivationskiller sind!), überlisten Sie Ihr Gehirn einfach mit einem Trick. Anstatt sich einzureden, etwas sei schwierig oder gehe aus diesem und jenem Grund nicht und überhaupt sei alles sterbenslangweilig, machen Sie es genau umgekehrt:
Stellen Sie sich so intensiv wie möglich vor, Sie hätten bereits gute Kenntnisse und Erfahrungen im Handels- und Gesellschaftsrecht!
Unser Gehirn ist faszinierend und die Kraft der eigenen Vorstellung phänomenal: Was passiert nämlich? Da es den grauen Zellen schnuppe ist, ob man sich bloß etwas einbildet oder wirklich erlebt hat, verändert sich die eigene Einstellung, je intensiver Sie sich etwas vorstellen. Nur eine (von vielen) guten Möglichkeiten, sich selbst zu motivieren. Probieren Sie es aus! (Falls es nicht klappt, haben Sie es sich nicht intensiv genug vorgestellt.) Selbstverständlich können Sie auf diesen Trick immer wieder zurückkommen, wenn Sie einmal Ihren »inneren Schweinehund« überwinden möchten. Nun aber ans Eingemachte …
Zwei Seiten einer Medaille: Wirtschaft und Recht
Das Handels- und Gesellschaftsrecht sind zwei Teilbereiche des viel umfangreicheren Wirtschaftsrechts. Schon die begriffliche Verbindung von »Wirtschaft« und »Recht« macht deutlich: Hier gehört zweierlei zusammen. Wirtschaftliches Handeln zielt darauf ab, menschliche Bedürfnisse (insbesondere nach Nahrung, Kleidung, Wohnraum und vieles, vieles mehr) zu decken. Da die zur Verfügung stehenden Ressourcen mitunter knapp sind, geht es nicht zuletzt darum, wie man sie klug einsetzt, um höhere Lebensstandards zu erreichen. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, die jeweils verschiedenen Leitideen folgen und die sich auf zwei Grundformen zurückführen lassen:
Zum einen kann eine zentrale staatliche Stelle die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen festlegen und lenken. Häufig spricht man daher von planwirtschaftlicher – oder besser: zentralverwaltungswirtschaftlicher – Wirtschaftsordnung.
Zum anderen können Angebot und Nachfrage die Eckpunkte der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen darstellen. Dann spricht man von einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung.
Bei einem marktwirtschaftlich orientierten System, wie es hierzulande ausgeprägt ist (ergänzt um eine Facette der sozialen Marktwirtschaft), können Güter und Dienstleistungen je nach Angebot und Nachfrage frei gehandelt werden. Man setzt also eher auf die selbstregulierenden Kräfte des Marktes, wenn es um die Produktion und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen geht. Die handelnden Akteure, das heißt die Anbieter und die Nachfrager, sind in ihren Handlungen und Entscheidungen im Wesentlichen frei.
Nun soll es an dieser Stelle keineswegs um die verschiedenen Wirtschaftsordnungen gehen. Aber man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen davon berührt werden können und je nach Ausrichtung anders ausfallen.
Das zeigt sich klassischerweise schon beim wichtigen Rechtsinstitut »Eigentum«: Während in zentralverwaltungswirtschaftlich geprägten Wirtschaftsordnungen die Produktionsmittel verstaatlicht sind, setzt das Funktionieren marktwirtschaftlicher Mechanismen auf das Privateigentum.
Dort, wo sich die Kräfte des Marktes begegnen, stoßen durchaus unterschiedliche Interessen aufeinander. Natürlich kann man einerseits alles dem freien Spiel des Marktes überlassen. Allerdings wird man dann nachteilige Konsequenzen in Kauf nehmen müssen – denken Sie etwa an einseitige wirtschaftliche Machtpositionen oder unsoziale Auswirkungen. Will man einerseits die positiven Effekte fördern (und Gestaltungsspielräume schaffen), andererseits die negativen Folgen eindämmen, dann bedarf es eines Ordnungsrahmens. Sofern der Ordnungsrahmen rechtlicher Natur ist, geht es darum, vonseiten des Gesetzgebers entsprechende Regeln aufzustellen und für deren Einhaltung zu sorgen.
Neben rechtlichen Spielregeln gibt es weitere Mechanismen, die einen Ordnungsrahmen prägen: Dazu zählen etwa bestimmte Moralvorstellungen, Sitten, Bräuche oder religiöse Überzeugungen. Rechtliche Wirkungen kommen ihnen allerdings nur ausnahmsweise zu (siehe etwa § 134 BGB, Verstoß gegen die guten Sitten oder § 346 HGB zur Berücksichtigung von Handelsbräuchen).
Sehen Sie sich nun im Folgenden genauer an, wie unsere Rechtsordnung aufgebaut ist und bekommen Sie dadurch ein besseres Verständnis davon, welchen Part das Handels- und Gesellschaftsrecht dabei übernehmen.
Drei Grundpfeiler unserer Rechtsordnung
Ganz im Sinne der »… für Dummies«-Tradition soll Ihnen das Thema dieses Buchs selbst ohne ein bestimmtes Vorverständnis einleuchten. Wenn Sie sich mit dem Recht im Allgemeinen und dem Handels- und Gesellschaftsrecht im Speziellen befassen, dann lohnt es sich der besseren Orientierung wegen, einen kurzen Überblick über unsere Rechtsordnung zu verschaffen, jedenfalls sofern Sie davon noch nichts gehört oder gelesen haben. Im Fokus stehen drei Fragen:
Wie ist die Rechtsordnung hierzulande eigentlich aufgebaut?
Wie passen das Handels- und Gesellschaftsrecht dort hinein?
Welche Rechtsquellen gibt es?
Die Antworten darauf schaffen zugleich eine Grundlage für die weitere Arbeit, wenn es nämlich darum geht, sich nicht bloß zurechtzufinden, sondern mit den entsprechenden rechtlichen Regelungen umgehen zu können, das heißt, sie zu verstehen und anzuwenden. Fangen Sie bei »Null« an und fragen Sie sich: Was heißt eigentlich Rechtsordnung?
Rechtsordnung umfasst die Gesamtheit aller gültigen geschriebenen und ungeschriebenen Rechtsgrundsätze (objektives Recht).
Der Begriff Rechts»ordnung« lässt vermuten, dass das Recht irgendwie systematisiert ist. Und das ist tatsächlich der Fall. Typischerweise wird zwischen dem Privatrecht, dem öffentlichen Recht und dem Strafrecht unterschieden, wobei diese so etwas wie die tragenden Säulen unserer Rechtsordnung sind (siehe Abbildung 1.1). Übrigens können wirtschaftsrechtliche Gesichtspunkte in allen drei Bereichen eine Rolle spielen.
Abbildung 1.1: Die Rechtsordnung und die wirtschaftsrechtlichen Bezüge im Überblick
Das Privatrecht
Das Privatrecht (auch Bürgerliches Recht oder Zivilrecht genannt) regelt kurz gesagt die Rechtsbeziehungen zwischen gleichgestellten (Privat-)Personen, die sich quasi auf Augenhöhe begegnen. Lassen Sie sich von dem Begriff »Personen« nicht irritieren. Darunter fallen natürlich zunächst einmal alle natürlichen Personen. Es gibt zudem sogenannte juristische Personen. Insofern handelt es sich um – na, sagen wir – fiktive Gebilde, die aber ebenso wie »du und ich« am Rechtsleben teilnehmen können.
Hier gibt es übrigens schon gleich einen Berührungspunkt zum Gesellschaftsrecht, denn wie Sie noch sehen werden, sind manche Gesellschaften als juristische Personen konstruiert; dazu zählen insbesondere die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie die Aktiengesellschaft (AG). Übrigens kann sogar der Staat selbst privatrechtlich handeln, nämlich dann, wenn er nicht hoheitliche Befugnisse ausübt, sondern so quasi wie Otto Normalverbraucher am Rechtsverkehr teilnimmt.
Im Privatrecht gestalten die Beteiligten ihre Rechtsverhältnisse frei und selbstbestimmt. Der dort geltende Grundsatz der Privatautonomie und damit verbunden die sogenannte Vertragsfreiheit ermöglichen es allen, ohne staatliche Bevormundung und im Rahmen der geltenden Gesetze, die eigenen Rechtsangelegenheiten zu regeln und zum Beispiel Verträge abzuschließen.
Es ist im Grunde genommen also egal, ob Lieschen Müller sich ein neues Cabrio zulegt, ob eine GmbH einen neuen Firmenwagen anschafft oder ein Bundesland neue Fahrzeuge für den Fuhrpark der Polizei erwirbt – in jedem Fall sind privatrechtliche Regelungen einschlägig (§ 433 BGB zum Kaufvertrag).
Das Privatrecht ist wirklich sehr umfangreich. Zudem lässt es sich noch weiter unterteilen, und zwar in das allgemeine Privatrecht und das Sonderprivatrecht.
Das allgemeine Privatrecht. Es gilt für jeden und enthält Regelungen zu den Grundlagen aller privatrechtlichen Verhältnisse (also etwa zu Schuldverhältnissen in Form von Verträgen). Wichtigstes Gesetz ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).
Das Sonderprivatrecht. Es gilt für bestimmte Adressaten. Zum Sonderprivatrecht zählen beispielsweise die speziellen handelsrechtlichen Regelungen für Kaufleute, wie sie im Handelsgesetzbuch (HGB) geregelt sind. Andere Sonderprivatrechte sind z. B. das Arbeitsrecht (als Schutzrecht für Arbeitnehmer) oder das Verbraucherrecht (als Schutzrecht für Verbraucher).
Das Sonderprivatrecht steht nicht isoliert neben dem allgemeinen Privatrecht, sondern es ergänzt oder modifiziert zumeist die allgemeinen Regelungen.
Ein ziemlicher Schmöker: Das Bürgerliche Gesetzbuch
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist ein sehr umfassendes Regelwerk. Es besteht aus insgesamt fünf »Büchern«. Schon das Inhaltsverzeichnis gibt Ihnen einen guten Einblick: Den Auftakt macht der sogenannte »Allgemeine Teil« (§§ 1 bis 240 BGB). Dort sind – wenig überraschend – einige allgemeine Bestimmungen enthalten, die für die weiteren Bücher des BGB gelten. Im zweiten Buch ist das sogenannte »Schuldrecht« geregelt (§§ 241 bis 853 BGB). Dort finden Sie insbesondere ausgewählte Vertragstypen sowie weitere Arten von Schuldverhältnissen, um die Rechtsbeziehungen zwischen den jeweiligen Rechtssubjekten zu gestalten. Das dritte Buch zum »Sachenrecht« (§§ 854 bis 1296 BGB) betrifft die Rechtsbeziehungen einer Person zu einer Sache. Das vierte Buch regelt mit dem »Familienrecht« unter anderem die verwandtschaftlichen Beziehungen (§§ 1297 bis 1921 BGB) und das fünfte Buch schließlich das »Erbrecht« (§§ 1922 bis 2385 BGB). Sie werden im weiteren Verlauf Vorschriften aus allen Büchern kennenlernen und benötigen deshalb unter anderem ein BGB.
Vom Privatrecht ist es nur ein Katzensprung zum Wirtschaftsprivatrecht. Zwar ist dieser Begriff selbst gesetzlich nirgends fixiert, jedoch wird er inzwischen häufig genutzt. Inhaltlich sind davon teils Aspekte des allgemeinen, teils des Sonderprivatrechts mit umfasst. Falls Sie sich fragen, was das Wirtschaftsprivatrecht im Kern ausmacht: Es bringt jene Inhalte des Privatrechts zusammen, die in wirtschaftlicher Hinsicht relevant sind. Selbstredend geht es wieder darum, die Rechtsbeziehungen zwischen gleichgeordneten Rechtssubjekten zu gestalten und zwar konkret im Hinblick auf wirtschaftlich relevante Güter und Dienstleistungen.
Das Wirtschaftsprivatrecht umfasst als Teil des Wirtschaftsrechts alle privatrechtlichen Rechtsgrundlagen, die das Wirtschaftsleben betreffen und vornehmlich die rechtlichen Beziehungen der beteiligten Akteure regeln.
Als Akteure kommen einerseits die Anbieter von Gütern und Dienstleistungen in Betracht, wie Hersteller, Produzenten, Verkäufer, Händler (unter anderem als Unternehmen), sowie andererseits die Abnehmer entsprechender Güter und Dienstleistungen, also die Kunden (wobei nicht nur an Verbraucher, sondern ebenso an Unternehmen zu denken ist).
Die maßgeblichen Rechtsquellen des Wirtschaftsprivatrechts sind neben dem schon genannten BGB zudem das Handelsgesetzbuch (HGB) sowie verschiedene gesellschaftsrechtliche Gesetze, etwa das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), das Aktiengesetz (AktG) oder das Genossenschaftsgesetz (GenG). Darüber hinaus gehören zum Wirtschaftsprivatrecht Vorschriften, die den Schutz geistigen Eigentums betreffen und die insbesondere im Patentgesetz (PatG), im Markengesetz (MarkenG), im Designgesetz (DesignG), im Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) und im Urhebergesetz (UrhG) geregelt sind. Zu nennen sind schließlich weitere Rechtsbereiche, etwa das im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) normierte Wettbewerbsrecht.
Kurzum: Das Handels- und Gesellschaftsrecht sind Teile des Wirtschaftsprivatrechts.
Abbildung 1.2 vermittelt Ihnen einen Überblick zum Wirtschaftsprivatrecht, wobei es im Weiteren vornehmlich um das Handels- und Gesellschaftsrecht sowie die damit verbundenen Berührungspunkte zum Bürgerlichen Recht geht.
Abbildung 1.2: Das Wirtschaftsprivatrecht im Überblick
Einflüsse auf das Wirtschaftsprivatrecht
Wirtschaftliches Handeln ist beileibe keine rein nationale Angelegenheit. Wie auch? Die Europäisierung und Globalisierung bieten bei aller Kontroverse vielfältigste Optionen für wirtschaftliches Handeln. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. So ist gerade im Wirtschaftsprivatrecht der Einfluss des Europarechts immer spürbarer. Zahlreiche europäische Rechtsakte (insbesondere EU-Verordnungen und EU-Richtlinien) bewirken eine europaweite Annäherung einzelner Rechtsbereiche. Ähnliches gilt für das internationale Wirtschaftsrecht. Vor allem internationale Abkommen, wie beispielsweise das UN-Kaufrecht oder die sogenannten Incoterms (International Commercial Terms (siehe dazu den Kasten auf Seite 146) müssen unter Umständen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten einkalkuliert werden.
Das öffentliche Recht
Vom Privatrecht unterscheidet sich das öffentliche Recht in vielerlei Hinsicht. So geht es dort nicht um die Rechtsbeziehungen auf einer gleichgeordneten Ebene. Charakteristisch für dieses Rechtsgebiet ist vielmehr etwas ganz anderes: nämlich regelmäßig (umgangssprachlich »in der Regel«) ein hierarchisches Über- bzw. Unterordnungsverhältnis. Das öffentliche Recht befasst sich mit den rechtlichen Beziehungen des einzelnen Bürgers zu den öffentlichen Hoheitsträgern (das heißt dem Staat und seinen Institutionen). Daneben regelt das öffentliche Recht die staatlichen Institutionen selbst, also deren Aufbau und Aufgaben. Rechtsquellen des öffentlichen Rechts sind das im Grundgesetz (GG) und den Landesverfassungen der Bundesländer geregelte Staats- und Verfassungsrecht. Und es kommt schließlich noch etwas Weiteres hinzu, und zwar das allgemeine und besondere Verwaltungsrecht (etwa das Bau-, Polizei- oder Steuerrecht).
Das öffentliche Recht berechtigt beziehungsweise verpflichtet regelmäßig ausschließlich einen Träger der öffentlichen Gewalt (Bund, Länder, Kommunen).
Die Verwaltung der Stadt Berlin erlässt gegenüber dem Bauherrn Bodo eine Baugenehmigung (Verwaltungsakt). Bodo hat als Adressat die darin getroffenen Anordnungen zu befolgen. Hier ist öffentliches Recht einschlägig.
In wirtschaftsrechtlicher Hinsicht ist das öffentliche Recht ebenfalls bedeutsam. Zwar finden Sie im Grundgesetz explizit keine Entscheidung für (oder gegen) ein bestimmtes Wirtschaftsmodell. Ganz im Gegenteil gilt das Grundgesetz in dieser Hinsicht vielmehr als »wirtschaftspolitisch neutral«. Ein paar Punkte sind verfassungsrechtlich aber doch geregelt (sogenanntes Wirtschaftsverfassungsrecht). So sind beispielsweise mit dem grundgesetzlich verbürgten Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 GG in Verbindung mit (kurz: i. V. m.) Art. 1 GG), der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) oder der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) bestimmte Weichen gestellt, die eine Wirtschaftsordnung nicht unbeeinflusst lassen. Zudem sieht Art. 74 Nr. 11 GG eine explizite Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Recht der Wirtschaft vor. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann finden Sie dort sogar etwas zum »Handel« – na, das erinnert doch schon sehr stark an das Handelsrecht.
Die Wirtschaft ist von staatlicher Seite zudem in anderer Hinsicht beeinflusst. So kann wirtschaftliches Handeln im Zuge des sogenannten Wirtschaftsverwaltungsrechts beispielsweise
gefördert werden (Leistungsverwaltung). Man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an das Gewähren von Subventionen (Subventionsrecht).
begrenzt werden (Eingriffsverwaltung). Man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an die Beschränkung von Monopolen, etwa durch das sogenannte Kartellrecht (wobei hierzulande das Bundeskartellamt bzw. die Landeskartellbehörden tätig werden).
Legitim sind etwaige Aktivitäten freilich nur, wenn es dazu jeweils eine konkrete rechtliche Grundlage gibt.
Das Strafrecht
Ein dritter großer Rechtsbereich betrifft das Strafrecht. Es enthält Regelungen, die bestimmen, was eine Straftat ist und welche Konsequenzen jemand zu tragen hat, der eine Straftat begeht. Manchmal droht eine Geldstrafe, manchmal womöglich eine Freiheitsstrafe. Im Grunde genommen handelt es sich beim Strafrecht um ein Rechtsgebiet, das eigentlich dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist. Denn aufgrund des sogenannten Strafmonopols kann nur der Staat – und demzufolge ein Gericht – Strafen verhängen. Es gibt also keine Selbstjustiz. Typischerweise wird das Strafrecht als eigenständiges Rechtsgebiet und dritter Pfeiler neben dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht genannt. Wichtigste Rechtsgrundlage ist das Strafgesetzbuch (StGB). Darüber hinaus sind weitere Straftatbestände in anderen Gesetzen geregelt (sogenanntes Nebenstrafrecht). Sofern es um strafrechtliches Verhalten im Wirtschaftsleben geht, hat sich mit dem sogenannten Wirtschaftsstrafrecht sogar ein eigener Teilbereich herauskristallisiert.
So kann man sich z. B. wegen Bankrotts (§ 283 StGB) oder Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) strafbar machen. Darüber hinaus gibt es zugleich direkte Verbindungen etwa zum Gesellschaftsrecht. Beispielsweise macht sich ein Geschäftsführer einer GmbH wegen Insolvenzverschleppung (§ 15a Abs. 4 und 5 Insolvenzordnung) strafbar, wenn er einen Insolvenzantrag vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder fehlerhaft stellt.
Gesetzesrecht, Richterrecht und »herrschende Meinung«
Die vielen Gesetzbücher und die darin enthaltenen Regeln bilden einen Paragrafendschungel, den man manchmal nur schwer durchschauen kann. Dennoch bieten sie für den Alltag eine gute Grundlage, um viele Rechtsfragen zu beantworten und Streitigkeiten zu entscheiden. Letztlich lässt sich aber doch nicht jegliche Fallkonstellation abbilden. Mit dem Gesetzesrecht bietet der Gesetzgeber einerseits zwar einen Rahmen, jedoch verbleiben durchaus Interpretationsspielräume. Was das betrifft sind vorzugsweise die Gerichte gefragt, das Recht anzuwenden und solche Spielräume gegebenenfalls zu klären. Speziell der Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofs (BGH), als einem der höchsten Gerichte, kommt bei alledem eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Neben der Auslegung von Gesetzen kann durch die Rechtsprechung sogar neues Recht (weiter)entwickelt werden (Rechtsschöpfung, Richterrecht).
So sind beispielsweise die »Lehre vom Scheinkaufmann« (siehe Kapitel 3) oder die Anerkennung der Rechtsfähigkeit der »Gesellschaft bürgerlichen Rechts« in Form der Außen-GbR (siehe Kapitel 10) maßgeblich richterrechtlich geprägt. Im Gesetz werden Sie dazu also nichts finden.
Ebenfalls bedeutsam ist bei alledem die Rechtswissenschaft. Die jeweiligen Rechtsmeinungen werden beispielsweise in Fachaufsätzen und -büchern diskutiert. Unterschiedliche Ansichten zu einzelnen Punkten sind durchaus gang und gäbe, gerade zwischen Wissenschaft und Praxis (nicht ohne Grund heißt es: »Zwei Juristen, drei Meinungen«). Sofern sich eine Meinung herauskristallisiert, die von vielen geteilt wird, wird sie meist als »herrschende Meinung« (kurz: h. M.) bezeichnet. In diesem Handels- und Gesellschaftsrecht für Dummies lernen Sie die überwiegend vertretenen Ansichten kennen und werden gegebenenfalls auf Streitpunkte hingewiesen.
Vier Schritte, um wirklich jedes Gesetz in den Griff zu bekommen
Inzwischen sollte eines deutlich geworden sein: Es gibt ein weit verzweigtes Rechtssystem und eine wahre Flut an Gesetzen, die man gar nicht alle kennen kann. Es wäre eine Sisyphusarbeit, sich durch Tausende von Gesetzen und Verordnungen mit vielen Zehntausenden Einzelvorschriften hindurcharbeiten zu wollen. Der Dichter und Jurist Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) bemerkte einmal lapidar: »Wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten«.
Versuchen Sie also gar nicht erst, irgendwelche Gesetze auswendig lernen zu wollen. Machen Sie sich vielmehr ein »geflügeltes Wort« aus der juristischen Ausbildung zunutze: »Man muss nicht viel wissen, man muss nur wissen wo es steht«. In diesem Buch lernen Sie, wo Sie suchen müssen, um etwas zu finden (damit befassen sich vornehmlich die nächsten Kapitel). Nicht weniger wichtig ist es, Gesetze zu verstehen und mit dem Handwerkszeug der Juristen umgehen zu können.
Sie werden es im Weiteren mit unterschiedlichen Paragrafen (auch Vorschriften, Bestimmungen, Regelungen, Normen oder Gesetze etc. genannt) zu tun bekommen. Sie sollten daher gleich am Anfang lernen, ein paar »Werkzeuge« zu gebrauchen, um mit diesem eigentlichen »Arbeitsmittel« der Juristen umgehen zu können.
Wenn im Folgenden von Gesetzen die Rede ist, kann – wie gesagt – damit ein einzelner Paragraf angesprochen sein oder ein komplettes Gesetzbuch (zum Beispiel das BGB, das HGB oder das AktG etc.). Sie werden damit aber keine Probleme haben, denn aus dem Kontext wird sich immer leicht erschließen, was gemeint ist.
Schritt 1: Gesetze lesen: Das A und O
Wenn Sie sich das Handels- und Gesellschaftsrecht erobern wollen, kommen Sie um eines nicht umhin: Sie müssen sich mit den einschlägigen Regelungen vertraut machen. Das erfordert zunächst einmal, die genannten Vorschriften aufmerksam durchzulesen und nicht bloß zu überfliegen. Klingt banal? Mag sein, dennoch wird das überraschenderweise immer wieder missachtet.
Werfen Sie die Flinte nicht gleich ins Korn, nur weil Sie vielleicht den einen oder anderen Paragrafen nicht sofort auf Anhieb verstehen. Erfahrungsgemäß muss man die verschiedenen Regeln immer wieder aufs Neue lesen. Erst allmählich wird sich so nach und nach dann das eine oder andere Aha-Erlebnis einstellen.
Die Lektüre eines Gesetzes kann also durchaus anspruchsvoll sein, aber mit diesem Buch haben Sie ja einen Begleiter zur Hand, der Ihnen den Einstieg leicht macht.
Ganz einfach: Mit Gesetzen arbeiten
In der Rechtswissenschaft hat sich ein bestimmter Konsens herauskristallisiert, wenn es darum geht, mit Gesetzen zu arbeiten. Jeder weiß, ein Gesetz(buch) beinhaltet regelmäßig viele Paragrafen. Eine Ausnahme bildet unter anderem das Grundgesetz (sowie das Einführungsgesetz zum HGB). Dort spricht man nicht von Paragrafen, sondern von Artikeln. Wenn sich Juristen auf einen bestimmten Paragrafen oder Artikel beziehen, benennen sie ihn einfach und das möglichst genau. Gerade für die Fallbearbeitung ist das wichtig, damit jeder gleich weiß, welche Vorschrift gemeint ist. Dazu nutzt man einfach das entsprechende Zeichen (§) oder die entsprechende Kurzform (»Art.« für Artikel). Hat eine Vorschrift mehrere Absätze und besteht ein Absatz aus mehreren Sätzen, können Sie weitere Abkürzungen verwenden, wie z. B. Absatz: »Abs.« oder römische Zahlen (I, II, III, IV …) für einen Absatz, »S.« oder nur die arabische Zahl (1, 2, 3, 4 …) für einen bestimmten Satz und »Halbs.« für einen Halbsatz und damit einen Satzteil. Sollte ein Tatbestand zwei Merkmale enthalten, die wahlweise erfüllt sein können, spricht man von Alternative (oder kurz »Alt.«). Will man auf weitere Paragrafen verweisen, die sich anschließen, fügt man ein »f.« für folgende an (wenn man sich auf eine weitere Norm bezieht) bzw. ein »ff.« (wenn es um mehrere Vorschriften geht). Dann stellt man üblicherweise ein doppeltes Paragrafenzeichen (»§§«) voran. Vielleicht probieren Sie es einmal aus?
Ob Sie nun »§ 28 Abs. 1 S. 1 HGB« oder »§ 28 I 1 HGB« bevorzugen, ist letztlich egal. Und wenn Sie z. B. »§§ 38 f. AktG« schreiben, weiß ebenfalls jeder sogleich, was gemeint ist, nämlich dass Sie sich auf § 38 AktG und § 39 AktG beziehen (die behandeln übrigens die Eintragung einer AG im Handelsregister). So einfach ist das.
Schritt 2: Gesetze unterscheiden: Verschiede Typen von Normen
Wenn Sie mit dem Gesetz arbeiten, dann sollten Sie sich über unterschiedliche Typen von Vorschriften im Klaren sein. Das ist mit Blick auf die Rechtsanwendung wichtig, bei der es regelmäßig darauf ankommt, einen vorgegebenen Sachverhalt rechtlich zu würdigen. Im Laufe einer solchen Prüfung können die unterschiedlichsten Normen heranzuziehen sein. Insoweit ist es ganz hilfreich, wenn Sie die verschiedenen Typen von Normen auseinanderhalten können. Unterscheiden Sie daher Folgendes:
Anspruchsgrundlagen. Sofern Sie sich im Privatrecht (und damit im Wirtschaftsprivatrecht) tummeln, geht es meist darum, dass irgendwer von irgendwem etwas will. Es wird ein sogenannter Anspruch geltend gemacht. Damit der greift, bedarf es einer entsprechenden rechtlichen Grundlage, der sogenannten Anspruchsgrundlage. Sie zählen mit zu den wichtigsten rechtlichen Normen!
Ein Anspruch ist das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194 BGB).
Möchte jemand beispielsweise als Käufer die Übereignung der Kaufsache vom Verkäufer, so kann er einen solchen Anspruch auf § 433 Abs. 1 BGB stützen. Will umgekehrt der Verkäufer vom Käufer den Kaufpreis, dann sieht § 433 Abs. 2 BGB einen entsprechenden Anspruch vor. Macht jemand Schadensersatz wegen Beschädigung des Eigentums geltend, so lässt sich das auf § 823 BGB stützen. Die Herausgabe einer Sache kann man beispielsweise nach § 985 BGB verlangen.
Sollten Sie sich bereits mit dem BGB beschäftigt haben, dann werden Ihnen viele Anspruchsgrundlagen bereits bekannt sein. Im Handels- und Gesellschaftsrecht gibt es nur wenige zusätzliche Anspruchsgrundlagen, und wenn es sie gibt, dann lernen Sie sie an den entsprechenden Stellen kennen. Oder Sie schauen im Top-Ten-Teil nach.
Einwendungen. Wer in Anspruch genommen wird, der wird sich nach Möglichkeit »verteidigen« wollen. Es ist daher nicht allein wichtig, die Anspruchsgrundlagen zu kennen, sondern ebenso etwaige Verteidigungsmöglichkeiten, die einen Anspruch gegebenenfalls wieder zu Fall bringen können. Das sind die sogenannten Einwendungen (siehe zu den verschiedenen Arten von Einwendungen zudem den Kasten auf Seite 42).
Einwendungen sind Verteidigungsmittel des Anspruchsgegners bzw. Schuldners. Im Gesellschaftsrecht gewährt z. B. § 129 HGB einem OHG-Gesellschafter ausdrücklich die Möglichkeit, Einwendungen geltend zu machen.
Hilfsnormen. Zwar gibt es im gesamten Privat- und Wirtschaftsrecht eine Fülle an Anspruchsgrundlagen und Einwendungen. Die meisten Vorschriften, gerade im Handels- und Gesellschaftsrecht, lassen sich indes eher als Hilfsnormen verstehen.
Hilfsnormen sind Gesetzesbestimmungen, deren Funktion darin besteht, andere Gesetzesbestimmungen zu ergänzen und zu erläutern (z. B. indem sie Definitionen oder weitere Bestimmungen enthalten).
Die §§ 1 ff. HGB sind weder Anspruchsgrundlagen noch Einwendungen, sondern »nur« Hilfsnormen, wenn es z. B. darum geht, ob ein Handelsgeschäft im Sinne des § 343 HGB gegeben ist. Diese Norm ist ihrerseits wiederum nur eine Hilfsnorm, z. B. wenn es darum geht, ob eine Bürgschaft ausnahmsweise nicht der Schriftform bedarf (§ 350 HGB). Im Gesellschaftsrecht ist § 13 Abs. 3 GmbHG beispielsweise eine Hilfsnorm, wenn es um ein Handelsgeschäft und die Eigenschaft als Formkaufmann nach § 6 Abs. 1 HGB geht.
Ein besonderer Typ von Hilfsnormen sind die sogenannten Legaldefinitionen. Sie sind leicht erkennbar, denn die definierten Begriffe sind in Klammern gesetzt – wie z. B. der in § 194 BGB erwähnte Anspruch.
Das Vertrackte an Anspruchsgrundlagen, Einwendungen und Hilfsnormen ist das Zusammenspiel dieser verschiedenen gesetzlichen Regelungen. Aber keine Sorge: Sie werden in diesem Buch an den relevanten Stellen entsprechende Hinweise zum Umgang mit alledem finden.
Das Zusammenspiel von Anspruchsgrundlagen und Einwendungen hat vor allem Konsequenzen für die Fallprüfung: Mehr dazu finden Sie in Teil VI zu den Fällen und Lösungen.
Auf den Zahn gefühlt: Einwendungen und Einreden
Einwendungen gibt es nicht nur viele, sondern auch vielfältige. Zu unterscheiden sind insbesondere:
Rechtshindernde Einwendungen. Sie lassen einen Anspruch gar nicht erst entstehen. Beispiele aus dem BGB sind etwa die Geschäftsunfähigkeit (§§ 104 f. BGB), der Verstoß gegen ein Verbotsgesetz (§ 134 BGB), die Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) oder das Schriftformerfordernis bei der Bürgschaft (§ 766 BGB), von dem das Handelsrecht allerdings eine Ausnahme macht (§ 350 HGB); hier hebelt das Handelsrecht also eine rechtshindernde Einwendung kurzerhand wieder aus.
Rechtsvernichtende Einwendungen. Sie führen zum Erlöschen eines ursprünglich entstandenen Anspruchs. Solche Einwendungen sind überaus zahlreich (im BGB beispielsweise der Rücktritt oder Widerruf gemäß § 346 Abs. 1 BGB, die Unmöglichkeit gemäß § 275 Abs. 1 BGB oder die Erfüllung gemäß § 362 BGB). Speziell im Handelsrecht liegt beispielsweise in § 373 HGB (Hinterlegung/Selbsthilfeverkauf) eine rechtsvernichtende Einwendung.
Rechtshemmende Einwendungen. Sie führen dazu, dass ein ursprünglich entstandener und nicht erloschener Anspruch sich gerichtlich nicht mehr durchsetzen lässt. Sie gewähren dem Schuldner ein Recht, die Leistung zu verweigern. Im Handels- und Gesellschaftsrecht ist das beispielsweise relevant im Rahmen von § 369 HGB beim »kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht«.
Während rechtshindernde und rechtsvernichtende Einwendungen von einem Gericht in der Praxis automatisch zu berücksichtigen sind, muss sich der Anspruchsgegner auf rechtshemmende Einwendungen ausdrücklich berufen. Daher nennt man speziell diese Art der Einwendungen Einreden.
Schritt 3: Gesetze verstehen: Tatbestand und Rechtsfolge
Gesetze zielen darauf ab, für eine Vielzahl unterschiedlicher Sachverhalte zu gelten. Dennoch kann in einem Gesetz nicht jede noch so erdenkliche Fallkonstellation konkret abgebildet werden. Um dieses Dilemma etwas aufzulösen, sind Gesetze abstrakt formuliert. Das macht es zwar nicht immer ganz einfach, bestimmte rechtliche Regelungen zu verstehen (zumindest auf den ersten Blick). Auf den zweiten Blick ist es allerdings wiederum gar nicht so schwer. Sie müssen sich dafür einfach nur klarmachen, dass eine gesetzliche Vorschrift meist nach dem gleichen Schema aufgebaut ist. Es gibt regelmäßig
eine Rechtsfolge. Das ist gewissermaßen die Konsequenz, die sich aus einer bestimmten Vorschrift oder Norm ergibt.
einen Tatbestand. Der formuliert die Voraussetzungen (die sogenannten Tatbestandsmerkmale), die erfüllt sein müssen, damit die entsprechende Rechtsfolge eintritt. Manchmal enthält ein Tatbestand nur ein, oft aber gleich mehrere Tatbestandsmerkmal(e). Die wichtigste Aufgabe für Rechtsanwender ist es, zunächst die Tatbestandsmerkmale zu erkennen.
Versuchen Sie sich das ganze Prinzip als »Wenn … dann«-Verbindung vorzustellen: Wenn diese(s) und jene(s) Merkmal(e) erfüllt ist (sind), dann soll als Konsequenz diese oder jede Rechtsfolge eintreten. Die greift aber nur, wenn tatsächlich alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Ausnahmsweise kann eine Vorschrift einmal Alternativen oder Varianten vorsehen. Sie können sie leicht an dem Wörtchen »oder« erkennen. In diesem Fall reicht es natürlich aus, wenn das eine bzw. das andere Tatbestandsmerkmal gegeben ist.
Nehmen Sie sich dazu gleich mal eine Vorschrift aus dem HGB vor, zum Beispiel § 1 Abs. 1 HGB. Dort steht: »Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt«. Wenn also jemand (1.) ein Handelsgewerbe (2.) betreibt (das sind die Tatbestandsmerkmale), dann ist er Kaufmann (das ist die Rechtsfolge).
Ein anderes Beispiel, diesmal aus dem Gesellschaftsrecht: So heißt es in § 13 GmbHG: »Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern derselben nur das Gesellschaftsvermögen«. Übersetzt heißt das gewissermaßen: Wenn (1.) eine Verbindlichkeit (2) einer GmbH besteht (das ist der Tatbestand), dann haftet dafür den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen (das ist die Rechtsfolge). Sie sehen schon, man muss manchmal genau lesen, um die Tatbestandsmerkmale zu erfassen. Die folgenden Ausführungen helfen Ihnen dabei.
Schritt 4: Gesetze auslegen: Inhalte erfassen
Wenn Sie die drei ersten Schritte beherzigen, dann haben Sie schon geschätzt 95 Prozent der Rechtsanwendung in der Tasche. Bleibt noch ein vierter Schritt, wenn es darum geht, einen Paragrafen in den Griff zu bekommen. Wie Sie bereits erfahren haben, besteht eine gesetzliche Regelung aus den unterschiedlichsten Tatbestandsmerkmalen. Nun kann es vorkommen, dass man mit Begriffen konfrontiert wird, von denen man nicht immer sofort weiß, was damit gemeint sein soll. Manchmal muss man ein Gesetz interpretieren, um den Bedeutungsgehalt zu erschließen. Juristen sprechen in diesem Zusammenhang davon, ein Gesetz auszulegen.
Die Auslegungsmethoden gehören zwar zum Kernbestand juristischer Tätigkeit und sie können in Prüfungsarbeiten durchaus mal relevant werden, allerdings wohl nur ausnahmsweise. In Fallbearbeitungen zum Handels- und Gesellschaftsrecht dürften Sie kaum jemals damit konfrontiert werden. Das ist doch beruhigend, nicht wahr? Sie sollten von den Auslegungsmethoden aber zumindest schon einmal gehört haben.
Die wichtigsten Auslegungsmethoden sind folgende:
Die wörtliche Auslegung: Sie knüpft am möglichen Wortsinn eines Gesetzesbegriffs an.
Die systematische Auslegung. Sie knüpft an die systematische Stellung einer auszulegenden Vorschrift innerhalb des Regelungsrahmens an. Dadurch lässt sich beispielsweise ermitteln, ob es sich um eine Regel oder eine Ausnahme handelt.
Die historische Auslegung. Sie knüpft an die Entstehungsgeschichte einer gesetzlichen Regelung an. So lässt sich beispielsweise anhand von Gesetzesbegründungen herausfinden, wie der ursprüngliche Gesetzgeber eine Bestimmung verstanden hat.
Die teleologische Auslegung. Sie knüpft am Sinn und Zweck einer gesetzlichen Regelung an.
Sie haben nun schon das erste Kapitel hinter sich gebracht und können sich eigentlich gleich im nächsten Kapitel Ihre Starterpakete zum Handels- und Gesellschaftsrecht schnüren.
2
Im Landeanflug: Ein erster Überblick
In diesem Kapitel
Grundbegriffe und Ziele des Handelsrechts kennen
Handelsrecht als Sonderprivatrecht der Kaufleute erfassen
Zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften differenzieren
Verschiedene Gesellschaftsformen unterscheiden
Das erste Kapitel bot Ihnen Gelegenheit, sich erst einmal einige allgemeine Grundlagen unserer Rechtsordnung anzueignen. Sie haben dort bereits erfahren, welchen Platz dem Handels- und Gesellschaftsrecht als Teil des Wirtschaftsprivatrechts zukommt. Jetzt befinden Sie sich quasi im Landeanflug – also »Fasten your seatbelt!«. Bevor Sie tatsächlich aufsetzen, sollten Sie ruhig die Gelegenheit wahrnehmen, kurz beizudrehen und sich in einer Art »Rundflug« einen etwas genaueren ersten inhaltlichen Überblick zum Handels- und Gesellschaftsrecht zu verschaffen. Gerade wenn Sie noch keinen blassen Schimmer haben, ist es sicher lohnend, das Terrain etwas genauer kennenzulernen, in dem Sie sich im Weiteren tummeln werden. Wie Sie noch mehrfach sehen (oder sollte man besser schreiben: »lesen«?) werden, bieten das Handels- und das Gesellschaftsrecht nicht nur Bezüge zu anderen Rechtsgebieten (wie etwa dem Bürgerlichen Recht), sondern sie sind zugleich selbst in vielfältiger Weise miteinander verbunden:
Wenn Sie sich etwa gleich im nächsten Kapitel eingehender mit dem »Kaufmann« befassen, sollten Sie bereits eine Ahnung davon haben, welche Arten von Gesellschaften es gibt, um den in § 6 HGB geregelten »Formkaufmann« überhaupt verstehen zu können.
Sparen Sie sich die Feinheiten zum Handels- und Gesellschaftsrecht also getrost für die nächsten Kapitel auf, schieben Sie aber die Grundlagen dazu nicht auf die lange Bank. Machen Sie in diesem Kapitel vielmehr gleich Nägel mit Köpfen und knöpfen Sie sich einige Aspekte vor, von denen Sie bei Ihrer weiteren Expedition durch das Handels- und Gesellschaftsrecht sicher profitieren können.
Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, werden Sie unter anderem verstehen, warum das Handelsrecht als »Sonderprivatrecht der Kaufleute« gilt. Zugleich werden Sie mit den grundsätzlichen Regelungszielen des Handelsrechts vertraut sein und ganz nebenbei etwas zu den Besonderheiten der Handelsgerichtsbarkeit erfahren. Vergegenwärtigen Sie sich im Anschluss daran, wann eine Gesellschaft im Rechtssinne vorliegt, welche Gesellschaftsformen es überhaupt gibt und welche Grundsätze bei der Wahl der »richtigen« Rechtsform zu beachten sind. Schließlich geht es noch um typische Fragen, die sich im Gesellschaftsrecht stellen. Doch zunächst zum Handelsrecht.
Ihr Starterpaket fürs Handelsrecht
Ihr Starterpaket für das Handelsrecht konzentriert sich auf drei Fragen:
Für wen gilt das Handelsrecht?
Was bezweckt das Handelsrecht?
Welche Rechtsgrundlagen sind zu beachten?
Für wen gilt das Handelsrecht?
Das Handelsrecht gilt als das »Sonderprivatrecht der Kaufleute«. Dem lässt sich dreierlei entnehmen:
Es ist Sonderrecht.
Als Sonderrecht enthält es eigens Regelungen für eine bestimmte Zielgruppe. Sonderregelungen sind nichts Außergewöhnliches, sondern finden sich auch in anderen Bereichen, etwa in Form des Arbeitsrechts als dem Schutzrecht für Arbeitnehmer oder beim Verbraucherrecht als dem Schutzrecht für Verbraucher.
Die Sonderregelungen des HGB ergänzen oder modifizieren die allgemeinen Regelungen des BGB. Beide Gesetze stehen daher nicht losgelöst nebeneinander. Vielmehr gilt ergänzend zum HGB weiterhin das BGB – jedenfalls so lange, wie das Handelsrecht selbst nicht speziellere Regelungen vorsieht. So steht’s übrigens auch in Art. 2 Abs. 1 des sogenannten Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB).
Es ist Privatrecht.
Das Handelsrecht ist in erster Linie privatrechtlicher Natur und betrifft insoweit die Rechtsbeziehungen zwischen gleichgeordneten Rechtssubjekten. Sicher ist Ihnen das Privatrecht (ebenso wie die Abgrenzung zum öffentlichen Recht und zum Strafrecht) noch aus dem vorherigen Kapitel bekannt (falls nicht, blättern Sie einfach noch einmal zurück).
Allerdings haben nicht alle Regelungen im HGB privatrechtlichen Charakter. So sind die Vorschriften zum Handelsregister (§§ 8 ff. HGB) eher dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Dort wird beispielsweise jemand verpflichtet, bestimmte Eintragungen im Handelsregister vornehmen zu lassen (kommt er dem nicht nach, droht ein Zwangsgeld, § 14 HGB).
Es ist Kaufmannsrecht.
Das Handelsrecht ist regelmäßig nur einschlägig, wenn Kaufleute beteiligt sind. Oft reicht es sogar schon, wenn bloß ein Beteiligter Kaufmann ist (§ 345 HGB). In Ausnahmefällen werden einzelne Regelungen sogar selbst dann angewendet, wenn überhaupt kein Kaufmann beteiligt ist, jedoch jemand in größerem Umfang wirtschaftlich am Geschäftsleben teilnimmt. (Details dazu, wann das ausnahmsweise der Fall ist, erfahren Sie an den entsprechenden Stellen in den weiteren Kapiteln.)
Die Kaufmannseigenschaft wird damit für die Anwendung des Handelsrechts zum Dreh- und Angelpunkt. Sie sollten sich daher im nächsten Kapitel unbedingt mit den verschiedenen Formen des Kaufmanns bekannt machen.
Vielleicht fragen Sie sich ja nach den vorstehenden Ausführungen: »Moment! Es geht doch ums Handelsrecht. Vom ›Handel‹ war bislang jedenfalls explizit keine Rede. Und überhaupt ›Kaufleute‹: Gelten die Regelungen nicht für alle Unternehmen?«. Diese Fragen sind absolut berechtigt und geben Gelegenheit, dem eigentlichen Ansatz des HGB noch etwas auf den Grund zu gehen.
Selbst wenn bislang in erster Linie vom »Handels«-Recht und »Kauf«-mann die Rede war, sollte man nicht glauben, dieses Rechtsgebiet würde nur für den An- und Verkauf von Waren gelten. Der Begriff des Kaufmanns umfasst vielmehr Unternehmer und Unternehmen aus allen möglichen Branchen. So fällt insbesondere der »Handel« mit Dienstleistungen darunter. (Dem werden hierzulande übrigens oftmals beachtliche Wachstums- und Beschäftigungspotenziale attestiert; immerhin sollen über 80 Prozent der heutigen Unternehmensgründungen den sehr vielfältigen Dienstleistungssektor betreffen.)
Anders als es die Bezeichnungen »Handels«- und »Kaufmanns«-Recht also nahelegen, ist dieses Rechtsgebiet keineswegs allein auf den An- und Verkauf von Waren beschränkt. Anwendung findet es vielmehr auf die unterschiedlichsten Arten wirtschaftlicher Betätigung (Handel, Dienstleistung, Industrie, Handwerk etc.).