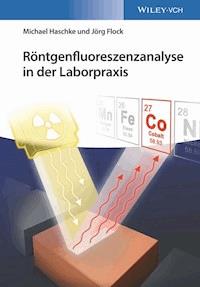5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Für viele Ostdeutsche bedeutete die politische Wende einen Bruch ihrer Biographie, der sich vor allem im beruflichen Leben widerspiegelte, aber natürlich auch Auswirkungen auf das persönliche Leben hatte. Anhand von einzelnen Episoden, die sich vorwiegend um die Entwicklung, die Fertigung und den Vertrieb von wissenschaftlichen Geräten drehen, sich aber ähnlich auch in anderen Wirtschaftszweigen abgespielt haben könnten, werden Erfahrungen der Arbeit und des Lebens in zwei unterschiedlichen Wirtschaftsordnungen dargestellt. Dabei werden die meist sehr ähnlichen Arbeitsweisen, aber auch deren Unterschiede in den beiden Wirtschaftssystemen - und das nicht nur im beruflichen, sondern auch im persönlichen Leben - dargestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen
Das erste Leben
Erste Erfahrungen mit der Röntgenspektroskopie
Erste Schritte im Berufsleben
Bereichsleiter in einer Außenstelle
Das neue Aufgabenspektrum
Die Aufgaben eines Bereichsleiters
Nationale Zusammenarbeit
Kontakte mit den Organen der Staatsmacht
Zusammenarbeit mit dem DESY
Das private Leben
Wendezeiten
Persönliches Erleben der politischen Veränderungen
Wissenschaftlerabwicklung
Vorbereitung auf eine berufliche Neuorientierung
Der Beginn einer neuen Tätigkeit
Das zweite Leben
Start mit polarisiert angeregter Röntgenfluoreszenz
Einführung der RFA in die Schmuckanalytik
Mikro-RFA
Erfahrungen in unterschiedlichen Firmen
Allgemeine Aktivitäten
Weltanschauung und Reisen
Meine Chefs
Vorbemerkungen
Ich hatte die Möglichkeit, aber auch das Glück, in zwei unterschiedlichen Gesellschaftsformationen zu leben. Der Übergang zwischen beiden Systemen stellte eine Zäsur im Privaten und im Arbeitsleben dar, er teilte das berufliche Leben für mich in zwei etwa gleichlange Hälften. Dieser Wechsel gab mir auch die Möglichkeit, die ‚Kultur‘ in den unterschiedlichen Firmen kennen zu lernen und zu vergleichen.
Dabei hatte ich das Glück, fast immer in der Verantwortung für die Entwicklung einiger jeweils neuer Geräteklassen in der Röntgenanalytik zu stehen. Im ersten Leben war das die Nachentwicklung von Si(Li)-Detektoren als analytische Option für die Elektronenmikroskopie. Daneben gab es damals aber noch einige andere Aufgaben, z.B. in der Meteorologie und der Bildbearbeitung. Dann im zweiten Leben waren es die Röntgenfluoreszenz durch Anregung mit polarisierter Strahlung, der Einsatz von Kleingeräten für die Schmuckanalytik und die ortsaufgelöste Analytik mit fokussierter anregender Strahlung. Da ich mein Arbeitsgebiet immer zwischen Geräteentwicklung, Applikation und Verkaufsunterstützung sah, hatte ich die Chance, durch Erfahrungen bei den Applikationen neue Geräteentwicklungen bzw. -erweiterungen entsprechend den Kundenwünschen zu steuern. Es war aber auch erforderlich, die verschiedensten Analysenverfahren in ihren Leistungen zu vergleichen, um die Möglichkeiten der ‚eigenen‘ Methode richtig einordnen zu können. Das erweiterte den Blick, erforderte aber auch die ‚eigene‘ Methode immer kritisch zu sehen und natürlich zu verbessern.
Durch die Wende ergab sich auch bei mir, wie bei vielen anderen, ein Bruch in der Biographie. Allerdings hatte ich viel Glück. Ich fand schnell eine Anstellung unter den neuen Bedingungen, wechselte dann aber auch gelegentlich die Firma. Die Gründe dafür waren immer vielfältig. Einerseits Unstimmigkeiten in der alten Firma, andererseits aber auch interessante Angebote der neuen Firmen. Ich war als Mitglied der Geschäftsleitung jeweils in Personal- und Produktverantwortung und hatte dadurch Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten für diese Bereiche. Dabei war es günstig, sich zwar immer mit der gleichen Analysenmethode zu beschäftigen, aber durch die Entwicklung anderer Produkte auch nie im Wettbewerb mit den bisherigen Geräten zu stehen. Dadurch kam auch kein Wettbewerbsgedanke zu den alten Kollegen auf und zu den meisten erhielt sich ein freundschaftliches Verhältnis.
Der generell begrenzte Markt für röntgenspektrometrische Geräte erfordert einen weltweiten Vertrieb, um eine ausreichende Effektivität durch entsprechende Gerätestückzahlen zu erzielen. Oft war ich der Erste, der ein neuentwickeltes Gerät und dessen Applikationen am besten kannte. Das verlangte, diese Kenntnisse bei den ersten Verkäufen weltweit einzusetzen und auch die Vertriebsmitarbeiter und Servicetechniker vor Ort anzulernen und zu überzeugen, dass sie ein neues verkaufsfähiges und erfolgsversprechendes Produkt haben. Das führte aber auch dazu, dass es viele Begegnungen mit Analytikern aus den verschiedensten Ländern gab; in der Regel gut ausgebildete und auch interessante Gesprächspartner zur Analytik, aber viel interessanter auch zum Leben in ihren Ländern. Aus einigen dieser Begegnungen entwickelten sich sogar längerfristige Freundschaften.
Diese vielen Reisen hatten aber auch den Vorteil, dass ich mir die Welt anschauen konnte. Das bewirkte, dass ich mir nach den Einschränkungen im ersten Leben nun eine eigene „Weltanschauung“ aneignen konnte. Und das in vielen Fällen nicht nur allein, sondern auch in Begleitung meiner Frau. Wir hatten das Glück, in einer höchst spannenden Zeit Geschichte direkt mitzuerleben und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen mitzugestalten. Das kann nicht jede Generation von sich behaupten!
Das Leben hat es also ganz gut mit mir gemeint! Das ist erfreulich, unter den gegebenen Bedingungen hätte es viel schlimmer kommen können.
Das erste Leben
Erste Erfahrungen mit der Röntgenspektroskopie
Nach dem zweijährigen Grundstudium an der TU Dresden erfolgte die Verteilung der Studenten auf die einzelnen Physikalischen Institute. Ich interessierte mich für Festkörperphysik und ging daher in das Institut für Metall- und Röntgenphysik. Dort beschäftigte man sich mit röntgenanalytischen Methoden, um die Struktur von Festkörpern zu untersuchen und zu verstehen. Für spektroskopische Untersuchungen waren ein wellenlängendispersives Gerät von ARL sowie zwei Mikrosonden von JEOL im Haus. Zum Ende meines Studiums gab es dann auch eines der ersten wellenlängendispersiven Geräte vom CZ Jena (VRA-30. Für Strukturuntersuchungen an Festkörpern waren verschiedene Diffraktometer von der Präzisionsmechanik Freiberg vorhanden. Die gehörten auch zum Kombinat CZ Jena und übernahmen später auch die Fertigung der Fluoreszenz-Spektrometer.
Meine erste selbstständige Arbeit war eine Literaturrecherche zu energiedispersiven Detektoren, insbesondere zu Si(Li)-Detektoren. Das war im Jahr 1969. Zu dieser Zeit befanden sich diese Detektoren gerade in Entwicklung. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Auflösung der aus der γ-Spektroskopie bekannten Festkörperdetektoren, insbesondere der Reduzierung des elektronischen Rauschbeitrages, wurde nun auch ein Einsatz bei geringeren Strahlungsenergien möglich, d.h. auch im Röntgenbereich. Das Institut interessierte sich für diese Entwicklungen und wollte Informationen über den Entwicklungsstand haben. Zu dieser Zeit steckte die Si(Li)-Technologie noch in den Kinderschuhen. Die besten Energieauflösungen lagen im Bereich von 220 eV und die Publikationen beschäftigten sich vorrangig mit den Schritten zur Herstellung der Detektoren, also mit Fragen wie: Welche geometrischen Formen reduzieren den Dunkelstrom am besten, wie ist der Li-Driftprozess in Abhängigkeit von der Qualität des Ausgangsmaterials optimal zu führen, welche Passivierungsoberflächen sind besonders geeignet? Ein anderer wichtiger Themenkreis betraf die verschiedenen Konzepte für rauscharme ladungsempfindliche Vorverstärker und deren Auswirkungen auf das Auflösungsvermögen sowie die Impulsverträglichkeit der Detektoren. Spektroskopische Fragestellungen, etwa das Auftreten von Detektorartefakten oder mögliche Algorithmen zur Spektrenentfaltung waren dagegen noch völlig uninteressant.
Das gerade das meine erste eigenständige ‚wissenschaftliche‘ Arbeit war, ist angesichts der späteren, mehr als 35-jährigen Beschäftigung mit der energiedispersiven Röntgenspektroskopie schon als schöner Zufall zu betrachten.
Aber in der Zeit meines Studiums war die wellenlängendispersive Röntgenspektroskopie noch die einzig genutzte Spektroskopiemethode. Neben applikativen Arbeiten an den beiden Mikrosonden, die mit wellenlängendispersiven Spektrometern ausgestattet waren, sowie dem wellenlängendispersiven RFA-Gerät von ARL, damals noch Bausch&Lomb, wurden im Institut im Auftrag des VEB Carl Zeiss Jena grundlegende Untersuchungen zum Aufbau von WD-Geräten sowie zur Spektrenaufbereitung und –auswertung durchgeführt. Vielleicht wurden schon hier Grundlagen für mein späteres Interesse am Gerätebau gelegt?
Ein weiterer Schritt in diese Richtung war die Beschäftigung mit ESCA – Electron Spectrocopy for Chemical Analysis, wie es damals noch genannt wurde (heute XPS). Das war eine zu dieser Zeit gerade neu eingeführte, von Kai Siegbahn entwickelte Methode für die Elementanalytik. Es bestand die Absicht, ein Gerät in die DDR zu importieren. Für den Aufbau dieses Gerätes kamen ein Institut an der Uni in Halle und unseres in Dresden in Frage. Zur Vorbereitung wurde eine umfangreiche Studie angefertigt, in der neben dem instrumentellen Aufbau von Elektronenspektrometern auch die Applikationsmöglichkeiten dieser Methode untersucht wurden. Leider wurden die Mittel für den Import dann nicht für uns, sondern für die Hallenser freigegeben. Damit war ein Jahr Arbeit umsonst, obwohl wir dabei vieles lernen konnten.
Danach begann dann für mich ein direkter und sehr intensiver Kontakt mit der wellenlängendispersiven Spektroskopie. Im Rahmen der Vorbereitung meiner Dissertation wurden hochaufgelöste L-Spektren von Übergangsmetallen in Aluminiumlegierungen gemessen. Ziel war, aus der Spektrenform die Besetzungsdichten der äußeren Elektronenbänder zu bestimmen und daraus Rückschlüsse auf einige makroskopische Eigenschaften zu ziehen. Dazu mussten die L-Spektren sehr genau gemessen werden. Das war ein aufwendiger Prozess. Nachdem die Proben auf Hochglanz poliert waren, wurden sie in den evakuierbaren Rezipienten einer Elektronenstrahl-Mikrosonde eingeschleust. Die Einstellung des Bragg-Winkels erfolgte manuell über ein Getriebe, dann wurde die Messung gestartet. Die Messzeiten für jeweils einen Winkel lagen im Bereich von einigen Minuten. Das war erforderlich, um bei den intensitätsschwachen L-Linien eine ausreichend gute Statistik zu erreichen. Die Spektren wurden mit einer guten Auflösung gemessen, um die Spektrenform genau nachbilden zu können. Das bedeutete, die Schrittweiten des Spektrometers waren sehr klein und damit die Anzahl der Schritte sehr groß. Die sich dadurch ergebenden Gesamtmesszeiten für ein Spektrum lagen in Abhängigkeit von der Breite des zu erfassenden Energiebereichs bei einigen Stunden. Außerdem war es notwendig, die Probe etwa alle Stunden zu polieren, da es bei den damals verfügbaren Öldiffusionspumpen zu einer Rückdiffusion des Pumpenöls in den Rezipienten kam und die Ölmoleküle im anregenden Elektronenstrahl gecrackt wurden. Die dadurch entstehende Kontamination der Probenoberfläche mit Kohlenstoff hatte eine Absorption der niederenergetischen L-Strahlung und damit eine Verfälschung der gemessenen Spektren zur Folge. Um besonders stabile Messbedingungen zu erhalten, wurden die Messungen oft über Nacht ausgeführt. Das waren dann lange und oft auch einsame Nächte, die nach Abschluss der eigentlichen Messungen noch verlängert wurden, weil die Diffusionspumpen abkühlen mussten. Die gemessenen Intensitäten wurden von Dekadenzählern abgelesen und notiert. Nach dem Übertragen der Daten auf Lochbänder wurden die Spektren dann bearbeitet. Der wichtigste Schritt war die Entfaltung mit der Form des Niveaus der inneren beteiligten Elektronenschale. Die Entfaltung erfolgte im Jobbetrieb auf einem ‚Großrechner‘. Die waren aus heutiger Sicht aber nur groß bezüglich ihres Volumens, es handelte sich um raumfüllende Maschinen mit einer Peripherie, die weitere Räume einnahm. Allerdings bezog sich die Größe nicht auf ihre Leistungsfähigkeit oder gar Bedienfreundlichkeit. Für die Spektrenentfaltung musste der Job, d.h. die Spektrendaten und auch das Entfaltungsprogramm auf Lochbändern, am Abend im Rechenzentrum abgegeben werden. Am nächsten Morgen konnte dann das Ergebnis abgeholt werden - aber das nur, wenn alle Daten richtig vorbereitet waren. Es standen zwei Großrechner zur Verfügung, eine PDP11 an einem nicht zur Universität gehörenden Institut in Dresden und eine BESM 6, die von allen Instituten der TU genutzt wurde. Der Andrang war entsprechend groß, die Erfassung der Messdaten aber auch ein langwieriger Prozess, so dass beide Teilschritte aneinander angepasst waren. Die Interpretation der Spektren danach war der eigentlich kreative Anteil der Arbeit. Dazu waren Literaturarbeit, Modellentwicklung und –verifizierung und viele Diskussionen mit den Kollegen erforderlich.
Erste Schritte im Berufsleben
Nach dem Studium fand ich eine Anstellung im Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau (ZWG) der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW). Die Aufgabe des Instituts bestand in der Versorgung von Akademieeinrichtungen, Universitätsinstituten und der Industrie mit wissenschaftlichen Geräten, die die Industrie nicht bereitstellen konnte. Auch die Prioritäten bei der Verteilung der Geräte entsprachen dieser Reihenfolge. Zuerst arbeitete ich in der Abteilung für Halbleitertechnologien. Dort wurden Anlagen zur Kristallzüchtung entwickelt und auch gefertigt sowie die erforderlichen Züchtungstechnologien entwickelt. Die Motivation dafür war die Bereitstellung von Anlagen zur Herstellung von hochreinen Silizium-Einkristallen für leistungselektronische Bauelemente. Dazu wurden Zonen-Floating-Anlagen genutzt, bei denen eine durch Hochfrequenz aufgeheizte flüssige Metallzone durch den Silizium-Kristall gezogen wurde. Die Kristalle hatten damals Durchmesser von 50 mm. Die HF-Spule, ein Kupferröhrchen, wurde mit Wasser gekühlt.
Bei Versuchen zum Lernen der Züchtungstechnologie zerriss mir einmal die HF-Spule und das Wasser flutete den evakuierten Probenraum. Der hatte eine Größe von ca. 0.5 m3. Da ich beim Reißen der Spule nicht anwesend war, lief recht viel Wasser in den Rezipienten. Das Vakuum wurde durch zwei riesige Diffusionspumpen erzeugt, die durch den Vakuumzusammenbruch nicht ordentlich abkühlen konnten. Dadurch verkohlten ihre Prallbleche völlig. Das kostete mich neben den Frotzeleien der Kollegen vor allem zwei volle Tage für die Reinigung der Pumpen und das manuelle Polieren der Prallbleche. Seitdem ist mir die Funktion von Diffusionspumpen allerdings immer gegenwärtig.
Nach etwa einem Jahr Beschäftigung mit der Si-Kristall-Züchtung wurde die Abteilung mit einer weiteren Aufgabe betraut. Es sollte eine Epitaxie-Anlage für die Abscheidung von GaAs-Schichten entwickelt und gebaut werden. Diese GaAs-Schichten dienten dann als Grundmaterialien für die ersten in der DDR hergestellten Halbleiter-Laser. Die Forderungen zur Homogenität des räumlichen Temperaturprofils sowie zur Führung des Temperaturverlaufs waren sehr hoch. Die Homogenitätsanforderungen konnten wir durch den in der DDR erstmaligen Einsatz von Wärmerohren, die mit Natrium gefüllt waren, erreichen. Bei Wärmerohren wird durch die Verdampfung eines Gases an den wärmeren Stellen des Rohres und dessen Kondensation an dessen kälteren Stellen die Wärme transportiert; durch den vernachlässigbaren Strömungswiderstand des Gases im Rohr ist die Wärmeleitfähigkeit etwa 200-mal besser als in Metallen mit guter Wärmeleitung. Der Rücktransport der Flüssigkeit erfolgt mit Hilfe der Kapillarkraft. Typisch für die DDR, musste der Aufbau der Wärmerohre von uns nicht nur entwickelt, sondern auch die Fertigungstechnologie dafür aufgebaut werden.
Erste Erfahrungen mit Personalführung konnte ich als Vertreter der Jugendlichen des ZWG im Leitungskollektiv des Instituts machen. Im ZWG wurden Lehrlinge zu Feinmechanikern, technische Zeichnerinnen und Physiklaboranten ausgebildet und es waren auch viele Absolventen beschäftigt. Deren Belange wurden durch mich in der Leitung des Instituts vertreten.
In dieser Zeit wurde mir auch die Leitung der Prüfungskommission für die Facharbeiterprüfung der Physiklaboranten von ganz Berlin übertragen. Die Lehrlinge bekamen im ZWG eine Grundausbildung und wurden nach 2 Jahren auf die verschiedenen Physikalischen Institute der Akademie und der Humboldt Uni aufgeteilt, die sie eingestellt hatten. Dort erhielten sie ihre Spezialausbildung und mussten dann auch ihre Abschlussarbeit anfertigen. Um die Zielstellungen der Ausbildung und auch die Inhalte der Abschlussarbeiten abzustimmen, besuchte ich die Institute mindestens zweimal während der Ausbildungsperiode. Es waren immer sehr interessante Gespräche mit den dortigen Betreuern. Ich erfuhr dadurch welche Arbeiten in den verschiedenen Einrichtungen im Fokus standen, oft ergaben sich auch Anknüpfungspunkte für spätere Kooperationen. Interessant war die Breite der Themen, in die sich die Physiklaboranten während dieser speziellen Ausbildung einzuarbeiten hatten und das auch auf Grundlage der Grundausbildung im ZWG gut meisterten.
Bereichsleiter in einer Außenstelle
Nach meinem Einsatz als Jugendvertreter in der Institutsleitung wurde mir 1978 die Leitung eines Bereiches des ZWG übertragen. Dieser Bereich beschäftigte sich zu dieser Zeit vorrangig mit der Entwicklung und Fertigung von meteorologischen Geräten. Es handelte sich um eine im Jahr 1972 verstaatlichte Firma mit etwa 60 Mitarbeitern, die ungefähr 5 km vom Akademiegelände in Adlershof entfernt ihren Standort hatte. In Zusammenarbeit mit dem Meteorologischen Dienst der DDR wurden dort Geräte für die Erfassung von Klimadaten, also z.B. Windrichtung und –geschwindigkeit, Regenmenge, Strahlungsdaten oder Eisablagerung entwickelt und gebaut. Ein Teil dieser Geräte wurde auch für den Einsatz über See konfiguriert, d.h. aus speziellen, gegenüber Seewasser resistenten Materialien hergestellt. Daneben befanden sich auch spezielle Sensoren für Parameter im Seewasser im Portfolio, etwa für Wassertemperatur, Wasserdruck, Salzgehalt oder Schallgeschwindigkeit. Das waren Entwicklungen, die gemeinsam mit dem Institut für Meereskunde der Akademie der Wissenschaften (AdW) in Warnemünde realisiert wurden.
Darüber hinaus wurde auch ein Staubprobennahmegerät entwickelt, mit dem an staubbelasteten Arbeitsplätzen die Staubsammlung verbunden mit einer Trennung in Grob- und Feinstaub erfolgen konnte. Der Grobstaub wurde in einem Zyklon abgeschieden, der Feinstaub in einem mit einer Hochspannung aktivierten Filzfilter. Die gesammelte Staubmenge konnte dann gravimetrisch bestimmt werden.
Ein weiteres Projekt betraf die Bildauswertung. Ein System, das für eine analoge Film-Densitometrie genutzt werden konnte, wurde von einem Leipziger Akademieinstitut zu uns in die Fertigung übernommen. Dabei wurden Filme im Durchlicht mit einer Kamera betrachtet, deren Grauwerte bestimmt und in Falschfarben dargestellt. Diese Geräte waren zunächst für die radiologische Untersuchung der Verteilung von radioaktiven Markern konzipiert. Aber durch das Fehlen adäquater Messtechnik wurden diese Geräte auch für andere Aufgaben eingesetzt. Eine interessante Applikation war die Auswertung von Aufnahmen der damals spektakulären Multispektral-Kamera, die von Carl Zeiss Jena entwickelt und mit einer russischen Trägerrakete ins All befördert wurde. Leider hatte man vergessen, neben der Kamera auch Auswertetechnik für diese Bilder zu entwickeln. Unser Densitron konnte diese Lücke zumindest teilweise schließen. Die zu untersuchenden Bilder konnten sowohl in Durchlicht als auch in Auflicht mit einer Kamera erfasst werden. Für die Verarbeitung wurde dann eine aufwendige Elektronik benötigt, in dieser Zeit noch alles analog, die viel Platz und auch einen erheblichen Kalibrieraufwand erforderte. Der ‚Elektronikturm‘ in Abb. 1 macht den Hardwareaufwand deutlich. Heute lässt sich sowas mit einem Laptop und viel mehr Komfort lösen.
Von einer besonderen Begebenheit mit dem Densitron wird noch später die Rede sein.
Abb. 1: Densitron
Insgesamt war das schon ein recht breites Gerätespektrum für 60 Mitarbeiter. Und es veränderte sich auch noch relativ schnell. Wenn der Bedarf an einem Gerät in dem kleinen Absatzbereich – Akademie und Hochschulwesen befriedigt war, wurden wieder neue Aufgaben übernommen. Das sorgte für Abwechslung bei der Arbeit, führte aber dazu, dass eine hohe Leistungsfähigkeit der Geräte infolge des Fehlens einer langjährigen Erfahrung mit der jeweiligen Gerätetechnik nur schwer erreichbar war.
Mit 29 Jahren durfte ich diesen Bereich übernehmen, eine ziemliche Verantwortung. Eine der ersten Sachen die ich lernen musste, war eine lesbare Unterschrift. Die Sekretärin des Bereiches, eine ältere Dame, meinte, meine Schrift sei zu klein und nicht leserlich. Also habe ich zwei Seiten mit Versuchen für eine Unterschrift bekritzelt, die habe ich dann aber auch beibehalten.
Ein Ereignis in den ersten Tagen, das mir in Erinnerung ist, war ein Disziplinarverfahren gegen einen Konstrukteur. Der hatte nach einer Feier im Konstruktionsbüro, bei dem offensichtlich zu viel Alkohol geflossen war, sich aus dem Fenster erleichtert. Dabei lief die ‚Erleichterung‘ am Fenster der unter dem Konstruktionsbüro liegenden Schlosserei entlang. Darüber hatte sich der Schlosser beim Direktor beklagt. Allerdings war dessen eigentliche Motivation für die Beschwerde, dass er nicht zur Feier miteingeladen war. Hier musste ein salomonisches Urteil gefunden werden, es gab auch eines. Aber welches, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Das neue Aufgabenspektrum
Es war nicht einfach, als ‚Jüngling‘ den Bereich zu übernehmen. Es erforderte anfangs eine Menge Arbeit, einerseits um sich in die neue wissenschaftliche Problematik einzuarbeiten, andererseits aber auch, um die betriebswirtschaftlichen Abläufe zu verstehen und richtige Personalentscheidungen zu treffen. Aber bald hatte ich mich eingearbeitet und auch eine ausreichende Autorität erworben. Ich betrachtete den Bereich als so etwas wie eine Familie. Aber ich musste auch lernen, dass Familienmitglieder diese auch verlassen können. Ich erinnere mich an zwei Kündigungen in den ersten Jahren: die erste bereits nach wenigen Monaten im Sommer von einer Buchhalterin. Die Kündigung ging mir nicht sehr nah, war aber beeindruckend. Die Dame war an ihrem letzten Arbeitstag mit einer extrem durchsichtigen Bluse bekleidet, die mehr zeigte als verbarg. Da sie immer über Erkältungen klagte, konnte ich ihr nur nahelegen, sich doch eine Jacke überzuziehen, was nicht nur einer Erkältung vorbeugen, sondern auch der allzu offenherzigen Präsentation ihres Oberkörpers entgegenwirken würde.
Ein weiteres Beispiel betrifft einen Kollegen, einen Physiker, der sein Abitur mit Berufsausbildung zum Betonfacharbeiter, so nannten wir damals die Maurer, gemacht hat. Dessen Traum war immer ein eigenes Haus zu bauen. Er hatte sich mit einem Betriebsleiter im Randgebiet von Berlin befreundet, der unterhielt wiederum Kontakte zu der ortsansässigen LPG. Mein Mitarbeiter kam irgendwann zu mir mit dem Wunsch, unsere Einrichtung zu verlassen, da er die Möglichkeit sah, dort im Randgebiet mit Unterstützung der dortigen Firma und vor allem der LPG bauen sein Haus zu bauen. Die LPG würde sowohl bei der Bereitstellung von Baumaschinen aber auch vorrangig bei der Beschaffung von Baumaterial behilflich sein. Seine Frau arbeitete dann auch im dortigen Baustoffhandel, um direkten Zugriff zu den in der Regel schwer beschaffbaren Baustoffen zu haben. Er wurde in der Firma als Technologe eingestellt, eine Arbeit, die er zwar ausüben konnte, ihn aber nicht ausfüllte. Was tut man nicht alles für seine Träume?
Als Außenstelle, die nicht allzu weit von Adlershof entfernt war und auf dem Weg von Adlershof in die Akademiezentrale in der Stadt lag, bekamen wir nur wenig Besuch aus Adlershof. Der Institutsdirektor fuhr in der Woche mindestens zweimal bei uns vorbei und dachte offensichtlich immer: ‚Beim nächsten Mal muss ich mal wieder diesen Bereich besuchen‘. Aber da er das jedes Mal dachte, hielt er nie an. Alle anderen Außenstellen waren dagegen relativ weit entfernt und erforderten für einen Besuch einen Eintrag in seinen Terminkalender. Somit erfolgten dort Besuche viel öfter. Allerdings konnten wir den Chef zu bestimmten Ereignissen einladen, und dann kam er auch. Aber wir hatten viele Freiheiten und konnten unsere Arbeit weitgehend nach unseren Vorstellungen organisieren.
Regelmäßige Kontakte gab es außerdem durch die Leitungssitzungen sowie durch Quartalsreporte. Die regelmäßigen Leitungssitzungen wurden genutzt, um die aktuellen Probleme des Institutes zu diskutieren, also Entscheidungen zu fachlichen Fragestellungen, zu wichtigen Personalentscheidungen oder auch zu Investitionsfragen.
Zu den Quartalsreports mussten alle Bereichsleiter separat antreten und über den Erfüllungsstand ihrer Aufgaben berichten. Erfolge wurden in der Berichterstattung bevorzugt. In der Regel lief das so ab, dass man mit einer Liste von Fragen und Entscheidungsvorschlägen antrat, und mit nur wenigen Antworten dazu, dafür aber mit einer Reihe neuer Aufgaben wieder von dannen ging. Am gravierendsten waren dabei für unseren Bereich die Entscheidungen, einem anderen Bereich durch die Überleitung von fertigen Produktentwicklungen unter die Arme greifen zu müssen. Das betraf das Staubprobennahmegerät und auch das Densitron.
Beide Geräte erforderten einen hohen Arbeitsaufwand in der Entwicklung, versprachen dann aber einen guten Absatz. Als diese Entwicklungen nach unseren Begriffen abgeschlossen waren, musste deren Überleitung in einen anderen Bereich erfolgen. Das bedeutete, der Nachschub für den eigenen Vertrieb entfiel. Diese Lücke galt es dann durch neue Entwicklungen wieder zu schließen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eine Überleitung in eigener Verantwortung relativ einfach ist. Bei Unklarheiten können die Entwickler im eigenen Haus direkt dazu befragt werden. Wenn aber die Überleitung in eine ca. 400 km entfernte Fertigung erfolgen soll, ergaben sich nicht nur viel mehr Fragen, die eigene Unfähigkeit ließ sich einfach durch die Behauptung einer unvollständigen Entwicklung überspielen, sondern es mussten die anstehenden Fragen auch über diese Entfernung beantwortet werden. Und das zu Zeiten, wo es nur das Telefon und die Post gab, also kein Internet oder gar Videokonferenzen. Das bedeutete für uns viele Fahrten von Berlin ins Eichsfeld. Die waren zu dieser Zeit auch nicht einfach. Mit dem Zug dauerte es etwa 6 Stunden mit zweimaligem Umsteigen. Mit dem Auto ging es nur mit dem Privatwagen, Firmenwagen oder Leihautos gab es in der DDR nicht. Und oft musste auch das Benzin aus der eigenen Tasche bezahlt werden, da es rationiert war. Strecken von dieser Länge mit einem Trabbi waren aber einigermaßen anstrengend. Der Lärm und der ständig gegenwärtige Benzingeruch beeinflussten das Wohlbefinden bei der langen Fahrt erheblich. Im Winter, wenn die Heizung vom Trabbi nicht ausreichte, fuhren wir auch mal mit einer dicken Decke über den Knien. Eine Klimaanlage für den Sommer existierte sowieso nicht, aber da konnte man immerhin die Fenster öffnen.
Die Aufgabenstellung zu diesem Zeitpunkt war also schon recht breit gefächert. Das resultierte aus der speziellen Aufgabenstellung des ZWG. Immer wenn sich in einem Akademieinstitut ein spezielles gerätetechnisches Problem ergab oder wenn in den Instituten eine Geräteentwicklung mit dem Potential eines breiteren Bedarfs initiiert wurde, war das ZWG gefragt. Das sicherte aber auch ständig wechselnde Aufgabenstellungen und eine interessante Arbeit.
Energiedispersive Röntgenspektroskopie - eine neue Aufgabenstellung
Übernahme einer Entwicklung
Eines Tages im Jahr 1981 wurde ich nach Adlershof zum Institutsdirektor gerufen. Er schickte mich nach Dresden an die Technische Universität (TU), um festzustellen, wie weit dort die Entwicklung eines energiedispersiven Röntgenspektrometers (EDS) gediehen sei, das als analytische Option für Elektronenmikroskope eingesetzt werden könnte. Ich bekam diesen Auftrag, weil mein Studienabschluss an der TU erst wenige Jahre zurücklag und ich mich während des Studiums mit Röntgenspektroskopie beschäftigt hatte. Ich erkundigte mich zuerst bei einigen ehemaligen Kollegen an der TU über diese Entwicklung und fuhr erst dann zu der Arbeitsgruppe in Pirna, die an dieser Entwicklung beteiligt war. Dort wurde an einem „RGW-Spektrometer“ gearbeitet. Der Hintergrund war, dass es im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), dem Pendant der EU für Osteuropa, zwei Hersteller von Elektronenmikroskopen gab, einen in Brno in der CSSR und einen in Sumy in der Ukraine. Schon zu dieser Zeit wurde eine Vielzahl der Rasterelektronenmikroskope (REM) mit energiedispersiven Röntgenspektrometern ausgerüstet. Es gab aber keinen Hersteller dafür im RGW, alle Geräte mussten importiert werden. Aus diesem Grund wurde die gemeinsame Entwicklung eines EDS-Systems im RGW vereinbart. Dabei wurde die Entwicklung des Detektors, eines Si(Li)-Kristalls vom Kernforschungszentrum der DDR in Rossendorf in den VEB Messelektronik in Dresden überführt. Der erforderliche Dewar zum Kühlen des Kristalls wurde im Kernforschungszentrum der CSSR in Rez entwickelt und gefertigt. Der Einbau des Detektorkristalls sollte dann bei Messelektronik in Dresden erfolgen. Die Auswerteelektronik schließlich, ein Vielkanalanalysator, wurde in Ungarn entwickelt. Die gesamte Entwicklung war abgeschlossen und es existierten schon drei Funktionsmuster. Aber die Serienfertigung wollte keine der beteiligten Einrichtungen übernehmen. Ein Grund war der überteuerte Preis für den Vielkanalanalysator, der in die Nähe eines kompletten Elektronenmikroskops kam. In der DDR war vor allem die Tatsache, dass Messelektronik von VEB Robotron übernommen wurde, um dort Prüftechnik für Leiterkarten für die Robotron-Rechner zu entwickeln und zu fertigen, maßgebend für diese Entscheidung.
Und nun gab es da ein Entwicklungsergebnis, das nach einer Fertigungsstätte suchte. Daher wurde die Bitte zur Weiterführung der Arbeiten an das ZWG herangetragen. An der TU Dresden wurde an einer rechnergestützten Steuerung des Gesamtsystems sowie an den Auswertealgorithmen für die Spektren gearbeitet. Nach den ersten Kontakten wurde die Machbarkeit einer Übernahme als erfolgsversprechend eingeschätzt und die Überleitung in meinen Bereich beschlossen. Das war nun mein zweiter Kontakt zur energiedispersiven Röntgenspektroskopie. Allerdings sollte der nun längerfristig sein und meine gesamte weitere fachliche Arbeit bestimmen. Wir hatten also eine neue Aufgabe, die aber nur mit einer Erweiterung der Personalkapazität möglich war. Das ging allerdings nur langsam, da neben den erforderlichen Planstellen auch die geeigneten Fachleute fehlten. Aber mit Hilfe der TU konnte auch diese Problematik gelöst werden. Während der Spezialausbildung in dem betroffenen Institut wurden Studenten ausgesucht, die nach dem Studienabschluss nach Berlin wollten und die sich durch gute Leistungen auszeichneten. Die wurden dann speziell für die Aufgabe in unserem Hause vorbereitet. Auf diese Weise kamen 6 gut ausgebildete Absolventen über einen Zeitraum von 4 Jahren zu uns, die bereits in ihren Diplomarbeiten uns interessierende Probleme bearbeiteten und so ohne Einarbeitungszeit nach ihrer Einstellung wirksam werden konnten.
Zunächst versuchten wir möglichst viele Informationen zu dem vorhandenen Stand der vorliegenden Entwicklung aber auch zum Stand der Technik zusammenzutragen. Der Stand der Technik wurde damals durch Firmen wie EDAX oder KEVEX repräsentiert. Das ging sogar soweit, dass der Methodenname mit dem Firmennamen von EDAX gleichgesetzt wurde, d.h. die Nutzer sagten oft, sie haben ein EDAX gekauft, von KEVEX.
Die an den verschiedenen Stellen durchgeführten Entwicklungen mussten von uns zusammengeführt werden. Die Kristalle kamen nach wie vor vom VEB Messelektronik. Auch, wenn dort eine Orientierung auf Rechnerprüftechnik vorgenommen wurde, wurden die Si(Li)s weiterproduziert, da sie in leicht geänderter Form auch für den Nachweis von Beta-Strahlung eingesetzt werden konnten. Auf dieses Produkt wurde seitens der Armee großer Wert gelegt und die Fortführung der Fertigung verlangt.
Der Vorverstärker war eine Entwicklung des Forschungszentrums Rossendorf. Die dortige Elektronikgruppe hatte einen sehr rauscharmen Verstärker mit Widerstandrückkopplung entwickelt.
Der Dewar war eine Entwicklung des tschechischen Kernforschungszentrums in Rez und wurde in einer kleinen Firma südlich von Prag produziert. Es war ein Alu-Dewar mit Superisolation, d.h. mit einer Isolation aus Al-beschichteter Kunststofffolie, die in vielen Schichten um das innere Gefäß gewickelt wurde. Die Betreuung übernahm das Institut für Gerätebau der tschechischen Akademie der Wissenschaften in Brno, das eine sehr enge Kooperation mit dem Teil von Tesla hatte, in dem die Elektronenmikroskope produziert wurden. Die Liefertreue für die Dewars bereitete ständig Probleme, die gelieferten Stückzahlen ließen keine wirkliche Serienfertigung zu. Daher wurden bald Überlegungen zum Aufbau eines neuen Dewars auf der Basis einer Entwicklung aus Brno aufgenommen.
Für die Konfigurierung des Kristalls in den Dewar lagen keine wirklichen Erfahrungen vor. Von einem Mitarbeiter der TU Dresden, der für etwa 9 Monate zum ZWG delegiert wurde, erlernten wir diesen technologischen Schritt. Der erste aufgebaute Detektor funktionierte gleich und ergab auch eine relativ gute Energieauflösung von etwa 180 eV. Wir dachten schon, wir beherrschen den Prozess – aber weit gefehlt! Die nächsten Detektoren hatten weitaus geringere Energieauflösungen, bis zu 250 eV und es stellten sich bei fast jedem aufgebauten Detektor neue Fehler heraus. Aber wir lernten, nicht immer schnell genug, aber kontinuierlich.
Für die Auswerteelektronik wurde erstmals ein Kleinrechner eingesetzt. Alle sich auf dem Markt befindenden Spektrometer arbeiteten damals mit Rechnern in der Größenklasse PDP11. Wir versuchten es mit einem modularen Aufbau und einem C8080-Prozessor. Damit konnten 64 kB Daten adressiert werden. Das musste ausreichen, um das Gerät zu steuern, die Daten zu erfassen und eine komplette qualitative und quantitative Analyse durchzuführen. Dazu wurde der Speicher geviertelt; ein Viertel war der residente Teil mit dem Betriebssystem, ein weiteres wurde für die notwendigen Berechnungen genutzt, ein Viertel für die Ablage der gemessenen und zu bearbeitenden Spektren und in das letzte Viertel wurden in Abhängigkeit von der jeweiligen Aufgabe die jeweils benötigten Programmteile von einem externen Speicher geladen, damals einem Magnetband. Diese Aufteilung ging nur, wenn das gesamte Programm in Maschinensprache vorlag, das zu dieser Zeit von einem Lochstreifen eingelesen wurde. Beeindruckt hat mich immer der verantwortliche Software-Ingenieur. Er war in der Lage, nur durch Ansehen des Lochstreifens Programmfehler zu finden und dort auch direkt durch Einfügen einer zusätzlichen Zeile oder dem Zukleben von Stanzlöchern diese zu korrigieren.
Zu Beginn der Arbeiten an den energiedispersiven Detektoren mussten wir viel lernen, alles war Neuland. Im Jahr 1982 zeigten wir es erstmals auf der Leipziger Messe, auf einen Sonderstand für Neuentwicklungen. Unser Gerät hatte schon ein bemerkenswertes Design. Die Elektronik war in einem Normgestell ähnlich einem Schreibtisch untergebracht. Auf der einen Seite der modulare Mikro-Rechner und die dazu erforderlichen, damals noch großen analogen Netzteile, auf der anderen Seite die Auswerteelektronik für den Detektor mit einem hochstabilisierten Netzteil. Unter dem Mittelteil des Schreibtisches befand sich eine Bildansteuereinheit und darauf als Monitor ein Heimfarbfernseher mit 25 Zoll Diagonalbreite, der hochkant gestellt wurde. Jede Zeile zeigte einen Spektrenkanal. Damit waren Umschaltungen des Spektrums sehr schnell möglich, es mussten nur zwei Informationen pro Kanal an den Fernseher gegeben werden. Für die Ausgabe war ein Plotter vorgesehen, mit dem sowohl Spektren als auch quantitative Ergebnisse gedruckt werden konnten. Gemessen an den aus dem westlichen Ausland angebotenen Geräten sah unseres recht rustikal aus, siehe Abb. 2.
In diesem Jahr stellten auf der genannten Messe keine anderen Firmen EDS-Systemen aus, da diese Systeme gerade auf der Comecon-Liste standen. Sie konnten nach Meinung der USA für den Bau von Waffen eingesetzt werden und durften daher nicht in den Ostblock geliefert werden. Die Firma EDAX war durch einen Holländer auf der Messe vertreten. Der schaute sich unser Gerät an und bemerkte etwas arrogant, dass er sich wundere, dass ein solches Gerät verkauft werden könne. Der hatte uns etwas unterschätzt, ein paar Jahre später gelang es uns wesentlich dazu beitragen, das Produktportfolio seiner Firma zu erweitern und ihre Quantifizierungsmodelle deutlich zu qualifizieren. Aber dazu später.
Abb. 2: EDR 176 - das erste EDS-System des ZWG
Die Firma Kevex war mit einem Stand präsent, aber ohne Geräte. Am Stand war eine Leinwand gespannt mit folgendem Text: ‚Leider können wir in diesem Jahr keine Geräte ausstellen, aber wir sind trotzdem hier, um unseren Kunden den gewohnten Service zu bieten‘. Der KEVEX-Vertreter in Deutschland lud mich auf seinen Stand ein und wir hatten ein nettes und langes Gespräch; über die Methode an sich, aber auch über die Lösung spezieller Probleme beim Aufbau der Geräte. Diese Gespräche wurden dann über mehrere Jahre immer auf der Leipziger Messe fortgesetzt. Ich konnte dabei sehr viel lernen und uns dadurch viele Umwege bei der Optimierung der Detektoren ersparen. Wir hatten dann in den 80-iger Jahren eine gute Koexistenz. Der KEVEX-Vertreter kannte die Wege, wie seine Geräte in die DDR eingeführt werden konnten, als einziger Anbieter aus dem westlichen Ausland. Damit war er Marktführer. Alle, die über Valuta verfügten kauften bei ihm EDS-Systeme, alle anderen bei uns.
Lizenzverhandlungen
Die Entwicklung der Si(Li)-Detektoren war erfolgreich. Wir erreichten respektable Energieauflösungen und fertigten pro Jahr etwa 10 – 15 Systeme, d.h. in den Jahren 1982 bis 1989 etwa 90 Systeme. Das war aber bei weitem nicht ausreichend für die jährlich verkauften Elektronenmikroskope. Daher und auch weil Lieferungen an die Industrie nicht zu den vorrangigen Aufgaben des ZWG gehörten waren die Hersteller von Elektronenmikroskopen also Tesla, Sumy und auch ein chinesischer Hersteller an unserer Detektortechnologie interessiert und wir nahmen mit allen Lizenzverhandlungen auf.
Mit Tesla waren die Verhandlungen am Weitesten vorangeschritten. Zur letzten Vertragsverhandlung musste ich nach Prag. Geplant war ein Flug von Berlin-Schönefeld, dem heutigen BER. Das Flugzeug war pünktlich, es startete normal, allerdings meldete sich nach wenigen Minuten die Stewardess über Bordfunk und teilte mit, dass wir doch bitte alle angeschnallt bleiben sollen, da wir aus technischen Gründen in Kürze wieder landen müssten. Die Gespräche im Flugzeug setzten augenblicklich aus, es herrschte absolute Stille. Nur wenige Monate vorher hatte sich in Schönefeld ein Flugzeugunglück ereignet. Nach der sicheren Landung stellte sich heraus, dass ein Vogelschwarm die Bugspitze mit den Navigationsinstrumenten beschädigt hatte. Mit einer Verzögerung von ca. zwei Stunden wurde der Flug erneut gestartet, diesmal störungsfrei. Zu den Verhandlungen kam ich zwar etwas verspätet, sie wurden aber abgeschlossen, allerdings durch die dann bald eintretenden politischen Veränderungen nicht mehr wirksam.
Mit der Firma in Sumy in der Ukraine wurden ebenfalls Verhandlungen geführt. Ein erster Besuch erfolgte von unserer Seite. Wir meldeten die Reise bei der Reisestelle an, damit die Flugtickets geordert werden konnten. Die wurden allerdings für einen Flug nach Tjumen und nicht nach Sumy bestellt. Tjumen liegt weit im Norden hinter dem Ural. Nachdem wir das rechtzeitig klären konnten, stellte sich heraus, dass Sumy zwar einen Flugplatz hatte, der war aber nicht für Ausländer zugelassen, da er auch militärisch genutzt wurde. Wir flogen also nach Kiew und fuhren von dort mit dem Zug über Nacht die knapp 400 km nach Sumy. Es war Winter und der Zug hoffnungslos überheizt, so dass an Schlaf nicht zu denken war. Wir stiegen in einem ganz neuen Hotel ab. Das war architektonisch interessant, die verwendeten Materialien erlesen, aber die Verarbeitung erschreckend. Die Türzargen der Hotelzimmer waren aus Ebenholz und mit drei Zoll langen Nägeln befestigt, die zudem an jeweils verschiedenen Stellen durch die Zargen geschlagen waren. Schade um das schöne Ebenholz!
Die Firma in Sumy stellte sich als riesiges Unternehmen heraus, in dem neben Elektronenmikroskopen auch Massenspektrometer, FT-IRSpektrometer sowie weitere komplexe wissenschaftliche Geräte hergestellt wurden. Uns wurde die Firma gezeigt, alles war sehr interessant. Bei den Verhandlungen kamen wir schnell mit den technischen Absprachen voran. Schließlich wurde über Kosten diskutiert. Hier mussten die Diskussionen aber abgebrochen werden, da beiden Seiten über keine endgültige Entscheidungsbefugnis verfügten. Zum Abschluss der Diskussionen holten wir unsere mitgebrachten Geschenke heraus, u.a. eine Flasche Weinbrand aus Armenien. Die Mitarbeiter des Werkes aus Sumy sahen sich alle betreten an und baten uns, für eine plötzlich erforderliche Pause den Raum zu verlassen. Als wir wieder den Raum betraten, standen nicht wie erwartet Gläser auf dem Tisch, um den Weinbrand zu trinken, sondern die Flasche war verschwunden. Hier stießen wir auf von uns unerwartete Auswirkungen des Gorbatschow‘schen Alkoholverbots. Wer konnte ahnen, dass es überhaupt und dann noch so tief in der Provinz so ernst genommen wurde.
Die Verhandlungen mit China hatten eine Vorgeschichte. Die gerätebauenden Einrichtungen der Akademien der Wissenschaften der sozialistischen Länder veranstalteten regelmäßig Ausstellungen mit ihren Produkten, die Naucpribor. Im September 1989 fand diese Veranstaltung in Berlin statt. Wir hatten natürlich unser energiedispersives Spektrometer dort auf dem Stand und wurden überraschend von einem chinesischen Professor einer Universität in Peking angesprochen – auf Deutsch. Er hatte in Tübingen studiert, war dann während der Postdoc-Zeit in den USA und hat dort die Lizenz zum Bau von Amray-Elektronenmikroskopen erworben. Das waren damals die ersten digitalisierten Mikroskope. Auch in China war man an unseren Detektoren interessiert. Nach ersten Gesprächen während der Ausstellung wurde ein Gegenbesuch in Peking vereinbart.
Die Reise des Professors sollte von Berlin weiter nach Tübingen, also in die BRD gehen. Allerdings hatte er damit Schwierigkeiten, da ihm in Polen, das er vor der DDR besucht hatte, sein gesamtes Gepäck und damit auch der Pass mit dem Visum gestohlen wurde. Ich begleitete ihn daher zur Ständigen Vertretung der BRD in der Hannoverschen Straße, damit ihm dort ein neues Visum ausgestellt werden konnte. Auf dem Weg dorthin wurden wir auf den letzten hundert Metern dreimal von Herren in Zivil angesprochen, die wissen wollten, wohin wir wollen. Bis zur Ständigen Vertretung schaffte es nur er, ich wurde schon vorher aufgehalten. Das war kurz nachdem den Ausreisesuchenden, die sich in die Ständige Vertretung geflüchtet hatten, die Ausreise gestattet wurde und eine erneute Besetzung vermieden werden sollte. Das Visumproblem konnte geklärt werden. Nach dem erfolgreichen Neuerwerb des Visums gingen wir zu mir nach Hause und es gab frisch gebackene Käsetorte.
Der Gegenbesuch erfolgte im Januar 1990. Wir fuhren zu zweit und wurden von dem Professor empfangen. Der Besuch war in verschiedener Richtung interessant. Die Universität befand sich am Rande der riesigen Stadt. Wir waren in einem Hotel untergebracht, das sonst nur chinesische Gäste beherbergte. Wir wurden dort auch vollständig verpflegt. Das war immer spannend. Wir hatten zwar schon viel über chinesische Küche gehört, gegessen aber noch nie, in der DDR gab es keine chinesischen Restaurants. Die einzelnen Gänge wurden immer gesondert serviert und der Ober sagte uns erst nach dem Essen, was wir gerade gegessen hatten. Diese Reihenfolge war vorteilhaft, da wir sonst sicher nicht alles mit solchem Appetit herunterbekommen hätten. Es gab auch eine Einladung zu dem Professor nach Hause. Er wohnte in einem Hochhaus in einer Zweizimmerwohnung, die einen offenen Wohnbereich hatte. Er hatte für uns gekocht. Es gab einen Eintopf mit Gemüse und Kalamari, d.h. vor allem die Fangarme, schön mit Saugnäpfen bedeckt. Wir kannten das nicht, Seafood in der DDR bestand aus Hering, Kabeljau und Makrele. Ich probierte die mir unbekannten Kalamari, und sie schmeckten nach Gummi. Aber zurückgeben ging nicht, also dachte ich mir, iss sie zuerst, dann kannst du den Rest genießen. Der Professor sah, dass ich die Kalamari zuerst gegessen hatte und dachte sie schmecken mir besonders gut und legte noch einmal ordentlich nach. Das war kontraproduktiv für mich und ich würgte dann weiter an den nachgelegten Fangarmen.
Die Verhandlungen zur Übernahme unserer Technologie wurden in dem Uni-Institut geführt. Es war Januar und daher recht kalt. Das Institut war aber nicht geheizt. Alle liefen dort in Mänteln rum und es war auch ständig schlecht beleuchtet. Nicht um die Bilder des Elektronenmikroskops besser zu sehen, sondern offensichtlich um Strom zu sparen. Wir diskutierten über die Einbindung unserer Software in die Steuerung des Mikroskops. Es wäre sicher eine Zusammenarbeit sehr sinnvoll gewesen, aber die Änderungen in den Einrichtungen der Akademie durch die politische Wende verhinderten eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit.
Die besuchte Universität lag am Rande der Stadt. Bei der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten wurden wir von unseren Gastgebern begleitet. So konnten wir den Platz des himmlischen Friedens, die verbotene Stadt und auch die Chinesische Mauer sowie die Minh-Gräber besuchen. Gern wären wir auch einmal allein unterwegs gewesen. Aber wir stellten fest, dass für unsere Gastgeber die Ausflüge sehr wichtig waren. Bei diesen Exkursionen wurde das Essen für uns auf Universitätskosten serviert, aber nicht nur für uns, sondern auch für unsere Begleiter. Für die war das wichtig, da sie dadurch selbst eine gute Mahlzeit bekamen und auch für ihre Familien noch die Reste mitnehmen konnten.