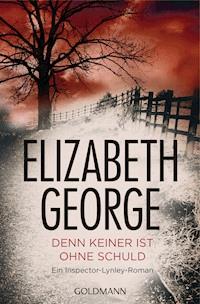9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
In London werden drei farbige Jugendliche ermordet, doch die Polizei reagiert verhalten. Aus Rassismus – glauben zumindest die Medien. Als man Thomas Lynley und Barbara Havers von New Scotland Yard den Fall überträgt, hat der brutale Serienmörder bereits sein viertes Opfer gefunden: Diesmal ist es weiß, und alles deutet auf einen Ritualmord hin. Während Havers eine erste heiße Spur verfolgt, trifft Lynley die schlimmste persönliche Tragödie seines Lebens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1219
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Elizabeth George
Wo kein Zeuge ist
Ein Inspector-Lynley-Roman
Deutsch von Ingrid Krane-Müschen und Michael J. Müschen
Buch
Auf einem Londoner Friedhof wird die Leiche eines Teenagers gefunden, grausam zugerichtet, kunstvoll auf einem Grabstein drapiert. Alles scheint auf einen Ritualmord hinzuweisen. Als man daraufhin Thomas Lynley und Barbara Havers von New Scotland Yard den Fall überträgt, bedeutet das Ergebnis ihrer Ermittlungen eine schallende Ohrfeige für die Londoner Polizei: Denn der 15-jährige Kimmo Thorne ist wahrscheinlich schon das vierte Opfer eines brutalen Serienmörders. In den vergangenen Monaten wurden bereits drei ähnlich zugerichtete Leichen von Jugendlichen in verschiedenen Stadtvierteln gefunden. Brisant ist, dass die ersten drei Opfer alle dunkler Hautfarbe waren. Warum reagiert die Polizei erst jetzt? Rassendiskriminierung, so lautet der Aufschrei der empörten Öffentlichkeit.
Alle Morde tragen dieselbe Handschrift. Aber welche Gemeinsamkeit verbindet die Opfer? Barbara Havers stößt auf eine erste heiße Spur. Doch der Tod eines fünften Jungen weicht vom Muster ab. Waren Lynley und Havers auf der falschen Fährte? Hat der Killer seinen Modus Operandi verändert? Oder hat ein Nachahmungstäter zugeschlagen? Trotz fieberhafter Ermittlungen kann die Polizei nicht verhindern, dass der Fall zu eskalieren droht. Und dann trifft Lynley die größte persönliche Tragödie seines Lebens …
Weitere Informationen zu Elizabeth George sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »With No One as Witness« bei HarperCollins Publishers, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Neuausgabe Dezember 2016 im Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Susan Elizabeth George
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2006 by Blanvalet Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Dave Curtis / Trevillion Images
Th · Herstellung: Str.
ISBN 978-3-641-26141-2V002
www.goldmann-verlag.de
Für Miss Audra Isadora, in Liebe.
Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. NIETZSCHE
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die Dietrich war Kimmo Thorne von allen die Liebste: das Haar, die Beine, die Zigarettenspitze, der Zylinder und der Frack. Sie war das, was er »das Komplettpaket« nannte, und seiner Ansicht nach konnte keine ihr das Wasser reichen. Ach, natürlich konnte er auch die Garland darstellen, wenn’s sein musste. Die Minnelli war einfach, und er wurde eindeutig immer besser bei der Streisand, aber wenn er die Wahl hatte – und die hatte er in der Regel, nicht wahr? –, dann entschied er sich für die Dietrich. Die kesse Marlene. Seine Nummer eins. Marlene konnte die Krümel aus dem Toaster singen, das war keine Frage.
Er hielt also die Pose am Ende des Lieds nicht deshalb, weil es für die Darbietung erforderlich war, sondern weil er sie so liebte. Das Ende von »Falling in Love Again« verklang, und er verharrte wie eine Marlene-Statue: der eine Fuß im hochhackigen Pumps auf dem Stuhl, die Zigarettenspitze zwischen den Fingern. Der letzte Ton verhallte, und er stand immer noch reglos da, zählte bis fünf – ergötzte sich an Marlene und an sich selbst, denn sie war gut, und er war gut, er war sogar verdammt gut, wenn man’s genau nahm –, ehe er sich rührte und das Karaokegerät abschaltete. Er lupfte den Zylinder, schlug die Frackschöße zurück und verneigte sich tief vor seinem zweiköpfigen Publikum. Tante Sal und seine Großmutter – seine treuesten Fans – reagierten genau, wie er erwartet hatte: »Großartig! Einfach großartig, Junge«, rief Tante Sally. Und Gran sagte: »Das ist unser Junge, wie wir ihn kennen. Durch und durch talentiert, unser Kimmo. Was werden deine Eltern nur sagen, wenn ich ihnen die Fotos schicke!«
Das würde sie bestimmt schnellstens hierher bringen, dachte Kimmo sarkastisch. Aber er stellte den Fuß noch einmal auf den Stuhl, denn er wusste, Gran meinte es gut, auch wenn sie nicht die Allerhellste war, was ihre Ansichten über seine Eltern betraf.
Gran wies Tante Sally an: »Weiter nach rechts, fang seine Schokoladenseite ein.« Nach wenigen Minuten war das Foto gemacht und die Show für den heutigen Abend vorüber.
»Wo soll’s denn hingehen heute Abend?«, fragte Tante Sally, als Kimmo in sein Zimmer ging. »Hast du eine neue Flamme, mein Junge?«
Hatte er nicht, aber das musste sie ja nicht wissen. »Ich geh zu Blinker«, erwiderte er munter.
»Nun, dann treibt keinen Unsinn, dein Freund und du.«
Er zwinkerte ihr zu. »Würden wir doch nie tun, Tantchen«, log er im Hinausgehen. Er zog die Tür hinter sich zu und schloss ab. Zuerst kümmerte er sich um das Marlene-Kostüm. Kimmo zog es aus und hängte es auf, ehe er sich an seine Frisierkommode setzte. Er betrachtete sein Gesicht im Spiegel und erwog einen Moment, das Make-up teilweise zu entfernen. Aber schließlich verwarf er den Gedanken mit einem Schulterzucken und durchwühlte seinen Schrank nach zweckdienlicher Kleidung. Er wählte ein Sweatshirt mit Kapuze, seine bevorzugten Leggings und die knöchelhohen Wildlederstiefel mit den flachen Sohlen. Die Zweideutigkeit seiner Erscheinung gefiel ihm. Mann oder Frau?, mochte ein Beobachter sich fragen. Aber nur wenn Kimmo sprach, war die Antwort eindeutig. Denn er war endlich in den Stimmbruch gekommen, und wenn er den Mund aufmachte, war das Spielchen vorbei.
Er zog sich die Kapuze des Sweatshirts über den Kopf und schlenderte die Treppe hinab. »Ich bin dann weg!«, rief er seiner Großmutter und Tante zu, während er seine Jacke vom Haken neben der Tür nahm.
»Wiedersehen, mein Liebling!«, antwortete Gran.
»Bleib anständig!«, fügte Tante Sally hinzu.
Er warf ihnen eine Kusshand zu. Sie erwiderten die Geste. »Hab dich lieb«, sagten alle gleichzeitig.
Draußen zog er den Reißverschluss seiner Jacke hoch und löste die Kette, mit der sein Fahrrad am Treppengeländer gesichert war. Er schob es zum Aufzug, drückte auf die Ruftaste, und während er wartete, überprüfte er, ob die Satteltaschen auch alles enthielten, was er brauchen würde. Er hatte eine geistige Checkliste, deren einzelne Punkte er nun abhakte: Nothammer, Handschuhe, Schraubenzieher, Brecheisen, Taschenlampe, Kopfkissenbezug, eine rote Rose. Letztere ließ er gern als Visitenkarte zurück. Man durfte schließlich nicht nehmen, ohne auch etwas zu geben.
Draußen auf der Straße schlug ihm die eisige Nachtluft entgegen, und Kimmo freute sich nicht gerade auf die lange Fahrt. Er hasste es, mit dem Rad fahren zu müssen, vor allem dann, wenn die Temperatur so nah dem Gefrierpunkt war. Da aber weder Gran noch Tante Sally ein Auto besaßen und er selbst keinen Führerschein hatte, den er einem Polizisten bei einer Kontrolle mit einem einnehmenden Lächeln hätte unter die Nase halten können, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu radeln. Den Bus zu nehmen stand mehr oder minder außer Frage.
Seine Route führte die Southwark Street entlang, dann durch den dichteren Verkehr der Blackfriars Road, bis er nach mehrmaligem Abbiegen Kennington Park erreichte. Von dort – Verkehr oder nicht – ging es praktisch schnurgerade nach Clapham Common und zu seinem Ziel: Ein frei stehendes, zweigeschossiges Wohnhaus aus rotem Backstein, das für seine Zwecke günstig gelegen war und das er in den vergangenen Monaten sorgfältig ausgekundschaftet hatte.
Inzwischen kannte er den Tagesablauf der Familienmitglieder so genau, als lebte er selbst dort. Er wusste, die Leute hatten zwei Kinder. Mum hielt sich fit, indem sie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr, Dad nahm den Zug von der Clapham Station. Sie hatten ein Aupair-Mädchen, das an zwei festgelegten Wochentagen seine freien Abende hatte, und an einem dieser Abende – immer am gleichen – verließen Mum, Dad und die Kinder das Haus gemeinsam und fuhren zu … Kimmo hatte keine Ahnung. Zum Abendessen bei der Großmutter, nahm Kimmo an, aber es konnte genauso gut ein langer Gottesdienst sein, eine Familientherapie oder Yogaunterricht. Entscheidend war, dass sie den Abend nicht zu Hause verbrachten und lange wegblieben. Wenn sie heimkamen, mussten die Eltern die Kleinen jedes Mal ins Haus tragen, weil sie im Auto eingeschlafen waren. Und das Aupair-Mädchen verbrachte den Abend mit zwei anderen Mädchen. Sie verließen zusammen das Haus und schnatterten auf Bulgarisch, oder was immer sie sprachen, und falls sie je vor Sonnenaufgang zurückkamen, so weit nach Mitternacht.
Die Vorzeichen schienen günstig bei diesem Haus. Die Familienkutsche war der größte Wagen aus der Range-Rover-Reihe, ein Mal in der Woche kam ein Gärtner. Sie benutzten auch einen Wäschereiservice, der ihre Laken und Kissenbezüge gewaschen und gebügelt zurückbrachte. Dieses Haus, hatte Kimmo gedacht, war reif und wartete förmlich auf ihn.
Das Sahnehäubchen war das Haus nebenan, vor dem ein einsames »Zu vermieten«-Schild an einem Pfosten im Wind schaukelte. Und um das Ganze perfekt zu machen, gab es auch noch einen einfachen Zugang von der Rückseite. Da erstreckte sich nämlich eine Ziegelmauer, die den Garten von einer unbebauten Wildnis trennte.
Dorthin radelte Kimmo, nachdem er die Vorderseite des Hauses passiert hatte, um sich zu vergewissern, dass die Familie sich auch an ihren strikten Tagesablauf hielt. Dann fuhr er durch die Wildnis und lehnte sein Rad gegen die Mauer. Er benutzte den Kissenbezug, um seine Ausrüstung und die Rose zu transportieren, stieg auf den Fahrradsattel und kletterte mühelos über die Mauer.
Der rückwärtige Garten war schwärzer als die Zunge des Teufels, aber Kimmo hatte früher schon einmal über die Mauer gespäht und wusste, was vor ihm lag. Gleich unterhalb der Mauer war ein Komposthaufen, dahinter stand eine Gruppe von Obstbäumen, die sich in dekorativer Unordnung über einen gepflegten Rasen verteilten. Breite Blumenbeete links und rechts davon bildeten die Rabatte. Eins der Beete zog sich um einen Pavillon, das andere zierte ein Gartenhäuschen. Vor dem Haus drüben gab es eine Terrasse mit ungleichmäßigen Pflastersteinen, auf welcher der Regen des letzten Gewitters Pfützen gebildet hatte, dann kam ein Vordach, an dem die Gartenbeleuchtung hing.
Sie schaltete sich automatisch ein, als Kimmo näher trat. Er nickte ihr dankbar zu. Bewegungsmelder, hatte er schon vor langer Zeit erkannt, mussten die geistreiche Erfindung eines Einbrechers sein, denn wann immer sie sich einschalteten, schienen alle anzunehmen, dass nur eine Katze durch den Garten lief. Er hatte jedenfalls noch nie gehört, dass ein Nachbar die Polizei alarmierte, weil irgendwo ein Licht anging. Andererseits hatte er von Einbrecherkollegen gehört, wie viel einfacher der Zugang zur Rückseite eines Hauses durch diese von Bewegungsmeldern gesteuerten Lichter war.
In diesem Fall waren die Lichter bedeutungslos. Die leeren Fenster und das »Zu vermieten«-Schild sagten ihm, dass niemand im Haus zur Rechten wohnte, und das linke Haus hatte weder Fenster zu dieser Seite noch einen Hund, der die eisige Nacht plötzlich mit wildem Gebell erfüllen würde. Soweit Kimmo es beurteilen konnte, war die Luft rein.
Glastüren führten auf die Terrasse, und Kimmo ging darauf zu. Ein kurzer Schlag mit dem Nothammer – eigentlich dafür vorgesehen, im Notfall eine Autoscheibe zu zertrümmern – reichte aus, um ihm Zugang zur Klinke zu verschaffen. Er öffnete die Tür und betrat das Haus. Die Alarmanlage heulte los wie eine Feuersirene.
Der Lärm war ohrenbetäubend, aber Kimmo ignorierte ihn. Er hatte fünf Minuten, vielleicht sogar länger, ehe die Sicherheitsfirma anrief, um hoffnungsvoll nachzufragen, ob der Alarm vielleicht nur versehentlich ausgelöst worden sei. Wenn niemand abhob, riefen sie die Kontaktnummern an, die man ihnen gegeben hatte. Führte auch das nicht dazu, das unablässige Geheul zum Verstummen zu bringen, riefen sie vielleicht die Polizei, die dann vielleicht vorbeischaute, um nach dem Rechten zu sehen, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall lag diese Eventualität mindestens zwanzig Minuten in der Zukunft, was wiederum zehn Minuten länger war, als Kimmo brauchen würde, um zu finden, wonach er in diesem Haus suchte.
Er war Spezialist auf diesem Gebiet. Die Computer, Laptops, CD- und DVD-Player, Fernseher, Schmuckstücke, Digitalkameras, Palm Pilots und Videorekorder überließ er anderen. Er suchte nach etwas Bestimmtem in den Häusern, in die er einstieg, und das Wunderbare daran war, dass die Gegenstände, die er suchte, immer offen sichtbar und meistens in den Räumen des Erdgeschosses standen. Kimmo ließ den Lichtstrahl seiner Taschenlampe herumwandern. Er befand sich im Esszimmer, und hier gab es nichts abzuräumen. Doch im Wohnzimmer sah er schon vier Stück auf einem Klavier funkeln. Er ging sie holen: Silberrahmen, die er von ihren Fotos befreite – man sollte schließlich rücksichtsvoll sein –, ehe er sie behutsam in seinem Kissenbezug verstaute. Ein weiterer Rahmen fand sich auf einem der Beistelltische. Er steckte ihn ein und begab sich auf die Vorderseite des Hauses, wo in der Diele auf einem Halbmondtisch unter einem Spiegel zwei weitere Silberrahmen aufgestellt waren, zusammen mit einer Porzellandose und einem Blumenarrangement, die er ließ, wo sie waren.
Die Erfahrung lehrte, dass er gute Chancen hatte, den Rest seiner Beute im Elternschlafzimmer zu finden, also lief er eilig die Treppe hinauf, während die Alarmsirene weiter in seinen Ohren gellte. Das Zimmer, das er suchte, war in der obersten Etage, nach hinten gelegen, mit Blick auf den Garten, und er hatte gerade die Taschenlampe eingeschaltet, um sich zu orientieren, als die Sirene abrupt verstummte und das Telefon zu klingeln begann.
Kimmo erstarrte, die eine Hand um die Taschenlampe gelegt, die andere halb nach einem Bilderrahmen ausgestreckt, der das Foto eines Paares in Hochzeitsstaat präsentierte, das sich unter blühenden Zweigen küsste. Nach einem Moment brach das Telefonklingeln ebenso abrupt ab wie der Alarm zuvor, unten ging das Licht an und jemand rief: »Hallo?«, und dann: »Nein. Wir kommen gerade erst nach Hause … Ja. Ja. Die Sirene heulte, aber ich hatte noch keine Gelegenheit … O mein Gott! Gail, lass die Finger von dem Glas!«
Dies reichte aus, um Kimmo klar zu machen, dass die Dinge eine unerwartete Wendung genommen hatten. Er hielt sich nicht damit auf, zu rätseln, was die Familie zu Hause zu suchen hatte, obwohl sie doch eigentlich bei Gran sein sollte oder in der Kirche, beim Yoga, in der Therapie oder wohin sie auch immer gehen mochten, wenn sie das Haus verließen. Stattdessen hastete er zum Fenster links neben dem Bett, während unten eine Frau schrie: »Ronald, es ist jemand im Haus!«
Kimmo brauchte nicht Ronalds polternde Schritte auf der Treppe zu hören oder Gails Rufe: »Nein! Warte!«, um zu begreifen, dass er sich schleunigst verdrücken sollte. Er kämpfte kurz mit dem Schloss des Fensters, schob es dann hoch und stieg mit dem Kissenbezug hindurch, als Ronald gerade in das Schlafzimmer stürmte, bewaffnet mit einem Gegenstand, der wie eine Grillgabel aussah.
Kimmo landete mit einem gewaltigen, dumpfen Aufprall und einem Stöhnen auf dem Vordach zweieinhalb Meter tiefer und verfluchte den Umstand, dass kein Blauregen die Fassade emporrankte, an dem er sich wie Tarzan hätte in die Freiheit schwingen können. Er hörte Gail rufen: »Hier ist er! Hier ist er!« und Ronald von oben am Fenster schreien. Ehe er den Garten zur rückwärtigen Mauer durchquerte, wandte er sich noch einmal zum Haus um und schenkte der Frau im Esszimmer ein Grinsen und einen frechen Salut. Sie hielt ein schlaftrunkenes Kind mit schreckgeweiteten Augen im Arm, ein zweites hatte die Hand in ihre Hose gekrallt.
Dann rannte er. Der Kissenbezug schlug ihm bei jedem Schritt gegen den Rücken, und Kimmo lachte in sich hinein. Er bedauerte nur, dass er nicht dazugekommen war, die Rose zu hinterlassen. Als er die Mauer erreichte, hörte er Ronald auf die Terrasse stürmen, aber noch bevor der arme Kerl im Schatten der Bäume ankam, war Kimmo die Mauer hochgeklettert und hinübergesprungen und flüchtete über das unbebaute Grundstück. Wenn die Bullen schließlich kamen – was in einer Stunde oder morgen Mittag sein konnte –, war er längst über alle Berge, nur noch eine verschwommene Erinnerung der Dame des Hauses: ein geschminktes Gesicht unter einer Sweatshirt-Kapuze.
Gott, das hier war das Leben! Das hier war das Beste! Wenn sich herausstellte, dass die Beute Sterlingsilber war, würde er am Freitagmorgen um ein paar hundert Pfund reicher sein. Konnte irgendetwas besser sein? Kimmo glaubte nicht. Was machte es schon, dass er gesagt hatte, er wolle für ein Weilchen ehrlich werden. Er konnte all die Zeit, die er bereits in diesen Job investiert hatte, nicht einfach so abschreiben. Da wär er doch blöd, und wenn es eines gab, was Kimmo Thorne nicht war, dann blöd. Kein bisschen. Keine Chance, meine Herren.
Er war vielleicht eine Meile weit geradelt, als er merkte, dass ihm jemand folgte. Es war allerhand Verkehr auf den Straßen – wann war in London kein Verkehr? –, und ein paar Autos hatten gehupt, als sie ihn überholten. Zuerst dachte er, sie hupten seinetwegen, so wie Autos es oft taten, wenn sie ein Fahrrad zur Seite drängen wollten, aber dann ging ihm auf, dass ihre Ungeduld einem langsam fahrenden Wagen hinter ihm galt, der keine Anstalten machte, ihn zu überholen.
Der Schreck fuhr ihm in die Glieder, denn er fragte sich, ob Ronald es irgendwie geschafft hatte, ihm zu folgen. Er bog in eine Seitenstraße, um sich zu vergewissern, dass es keine Einbildung war und er wirklich verfolgt wurde, und tatsächlich: Die Scheinwerfer in seinem Rücken bogen mit ab. Er war im Begriff, einen Spurt einzulegen, als er neben sich das Brummen eines Motors hörte und dann eine freundliche Stimme, die seinen Namen sagte.
»Kimmo? Bist du’s? Was treibst du in diesem Teil der Stadt?«
Kimmo ließ das Fahrrad ausrollen und bremste. Er wandte den Kopf, um festzustellen, wer ihn angesprochen hatte. Als er den Fahrer erkannte, lächelte er und sagte: »Wieso ich? Das Gleiche könnte ich dich fragen.«
Der andere erwiderte das Lächeln. »Sieht so aus, als wär ich auf der Suche nach dir. Soll ich dich ein Stück mitnehmen?«
Das käme gelegen, dachte Kimmo, falls Ronald ihn mit dem Fahrrad hatte flüchten sehen und die Bullen schneller als üblich reagiert hatten. Er wollte jetzt wirklich nicht unbedingt draußen auf der Straße sein. Er hatte außerdem immer noch zwei Meilen vor sich, und es war kalt wie in der Antarktis. Er antwortete: »Aber ich habe das Rad.«
Der andere lachte leise. »Das ist kein Problem, wenn du keins draus machst.«
1
Detective Constable Barbara Havers stellte fest, dass sie ein Glückspilz war: Die Einfahrt war leer. Sie hatte beschlossen, ihre Einkäufe mit dem Wagen und nicht zu Fuß zu erledigen, was immer mit gewissen Risiken verbunden war in dieser Gegend von London, wo ein jeder, der glücklich genug war, einen Parkplatz in der Nähe seines Wohnhauses zu finden, sich mit einer Hingabe daran klammerte wie eine geläuterte Seele an ihren Retter. Doch sie hatte allerhand einzukaufen gehabt, und die Vorstellung, die Sachen in der Kälte vom Lebensmittelladen bis nach Hause tragen zu müssen, hatte sie schaudern lassen. Also hatte sie sich fürs Auto entschieden und das Beste gehofft. Ohne Gewissensbisse belegte sie die Einfahrt des gelben, edwardianischen Wohnhauses, hinter dem ihr winziger Bungalow lag, mit Beschlag. Sie lauschte dem Husten und Röcheln ihres Minis, während sie den Motor abstellte, und nahm sich zum fünfzehnten Mal in diesem Monat vor, einen Mechaniker nach dem Wagen schauen zu lassen, der – so konnte man nur hoffen – nicht ihr letztes Hemd dafür verlangen würde, den Fehler zu reparieren, der dazu führte, dass ihr Auto rülpste wie ein magenkranker Rentner.
Sie stieg aus und klappte den Sitz nach vorn, um die erste ihrer Einkaufstüten vom Rücksitz zu holen. Sie trug vier Tüten auf dem Arm, als sie ihren Namen hörte.
Jemand sang: »Barbara! Barbara! Guck mal, was ich im Schrank gefunden habe!«
Barbara richtete sich auf und schaute in die Richtung, aus der die glockenhelle Stimme kam. Die kleine Tochter ihres Nachbarn saß auf der verwitterten Holzbank vor der Erdgeschosswohnung des altehrwürdigen, zum Mehrfamilienhaus umgewandelten Gebäudes. Sie hatte die Schuhe ausgezogen und versuchte, sich in ein Paar Inlineskates zu kämpfen. Sie sahen ein paar Nummern zu groß aus, fand Barbara. Hadiyyah war erst acht Jahre alt, und die Skates waren eindeutig für einen Erwachsenen gedacht.
»Die gehören Mummy«, klärte Hadiyyah sie auf, als habe sie Barbaras Gedanken gelesen. »Wie gesagt, ich hab sie im Schrank gefunden. Ich bin noch nie mit ihnen gefahren. Vermutlich sind sie mir zu groß, aber ich hab Küchenpapier reingestopft. Dad weiß nichts davon.«
»Von dem Küchenpapier?«
Hadiyyah kicherte. »Quatsch! Er weiß nicht, dass ich sie gefunden hab.«
»Vielleicht will er nicht, dass du sie benutzt.«
»Sie waren aber nicht versteckt. Nur weggeräumt. Bis Mummy wieder nach Hause kommt, nehme ich an. Sie ist in …«
»Kanada. Ich weiß.« Barbara nickte. »Also, sei schön vorsichtig mit den Dingern. Dein Dad wird nicht glücklich sein, wenn du fällst und dir den Kopf einschlägst. Hast du einen Helm oder so was?«
Hadiyyah sah auf ihre Füße hinab – einer mit dem Inlineskate, einer nur mit der Socke bekleidet – und dachte darüber nach. »Brauche ich das?«
»Vorsichtsmaßnahme«, erklärte Barbara. »Auch mit Rücksicht auf die Straßenkehrer. Es verhindert, dass das Gehirn der Inlineskater auf die Bürgersteige spritzt.«
Hadiyyah verdrehte die Augen. »Ich weiß, dass du nur Spaß machst.«
Barbara hob die Hand zum Schwur. »So wahr mir Gott helfe. Wo ist denn dein Dad überhaupt? Bist du heute allein?« Mit einem Fußtritt öffnete sie das Törchen zu dem gepflasterten Weg, der zum Haus führte, und überlegte, ob sie Taymullah Azhar noch einmal darauf ansprechen sollte, dass er seine Tochter öfter allein ließ. Auch wenn es stimmte, dass das nur selten vorkam, hatte sie ihm doch angeboten, dass sie gern bereit war, sich in ihrer Freizeit um Hadiyyah zu kümmern, wenn er an der Universität eine Sprechstunde abhalten oder die Arbeit im Labor überwachen musste. Hadiyyah war für eine Achtjährige erstaunlich selbstständig, aber letztlich war sie doch immer noch das: Eine Achtjährige, die naiver war als ihre Altersgenossinnen, zum Teil aufgrund einer Kultur, die sie von allem abschirmte, zum Teil aufgrund der Tatsache, dass ihre englische Mutter sie verlassen hatte und nun schon seit fast einem Jahr »in Kanada« war.
»Er ist losgezogen, um mir eine Überraschung zu kaufen«, berichtete Hadiyyah sachlich. »Er denkt, ich weiß das nicht. Er denkt, ich denke, dass er nur was zu erledigen hat, aber ich weiß, was er in Wirklichkeit macht. Es ist, weil er traurig ist, und er meint, ich bin traurig, was nicht stimmt, aber er will, dass ich wieder fröhlich bin. Also hat er gesagt: ›Ich muss etwas erledigen, Kushi‹, und ich soll glauben, es hat nichts mit mir zu tun. Hast du deine Einkäufe gemacht? Kann ich dir helfen, Barbara?«
»Es sind noch mehr Tüten im Auto. Wenn du sie holen willst …«, antwortete Barbara.
Hadiyyah glitt von der Bank und – einen Skate angezogen – humpelte zum Auto hinüber und holte die restlichen Tüten heraus. Barbara wartete an der Hausecke. Als Hadiyyah sich ihr hinkend anschloss, fragte sie: »Was ist denn der Anlass?«
Hadiyyah folgte ihr zum Ende des Grundstücks, wo Barbaras Bungalow stand. Er glich eher einem um Vornehmheit bemühten Gartenhäuschen, war halb von einer Falschen Akazie verborgen und ließ grüne Farbflocken auf ein Blumenbeet rieseln, das dringend bepflanzt werden musste. »Hm?«, machte Hadiyyah. Aus der Nähe erkannte Barbara, dass sie den Kopfhörer eines Discman um den Hals trug. Das Gerät war am Bund ihrer Blue Jeans befestigt. Undefinierbare Klänge drangen blechern aus den Ohrstöpseln. Nur eine weibliche Stimme war auszumachen. Hadiyyah schien sie gar nicht zu bemerken.
»Die Überraschung«, sagte Barbara und schloss ihre Haustür auf. »Du hast gesagt, dein Dad sei unterwegs, um eine Überraschung für dich zu besorgen.«
»Ach, das.« Hadiyyah humpelte hinein und stellte die Tüten auf den Esstisch, wo die Post von mehreren Tagen sich mit vier Ausgaben des Evening Standard, einem Korb voll schmutziger Wäsche und einem leeren Vanillepuddingkarton vermischte. Das alles ergab ein unschönes Durcheinander, und das gewohnheitsmäßig ordentliche kleine Mädchen betrachtete es mit einem vielsagenden Stirnrunzeln. »Du hältst deine Sachen nicht in Ordnung«, schalt sie.
»Sehr scharfsinnig erkannt«, murmelte Barbara. »Und die Überraschung? Ich weiß, dass du nicht Geburtstag hast.«
Hadiyyah klopfte mit dem Inlineskate auf den Boden und wirkte plötzlich verlegen, was ihr ganz und gar nicht ähnlich sah. Barbara stellte fest, dass sie sich das dunkle Haar heute selbst geflochten hatte, denn ihr Scheitel ergab ein Zickzackmuster, und die roten Schleifen am Ende der Zöpfe waren schief angebracht, die eine Schleife zwei Zentimeter höher als die andere. »Na ja«, begann sie, während Barbara den Inhalt der ersten Einkaufstüte auf der Arbeitsplatte ausbreitete. »Er hat es nicht direkt gesagt, aber ich nehme an, es hat damit zu tun, dass Mrs. Thompson ihn angerufen hat.«
Barbara erkannte den Namen von Hadiyyahs Lehrerin. Sie warf dem kleinen Mädchen über die Schulter einen Blick zu und zog fragend eine Augenbraue hoch.
»Weißt du, es gab eine Teeparty«, berichtete Hadiyyah. »Na ja, es war nicht wirklich eine Teeparty, aber so haben sie’s genannt, denn wenn sie gesagt hätten, was es wirklich war, wär es allen so peinlich gewesen, dass keiner hingegangen wäre. Und sie wollten, dass alle hingingen.«
»Warum? Was war es wirklich?«
Hadiyyah wandte sich ab und begann, die Tüten auszupacken, die sie aus dem Mini geholt hatte. Barbara erfuhr, dass es mehr ein Event als eine Teeparty gewesen war. Oder eigentlich mehr ein Meeting als ein Event. Mrs. Thompson hatte eine Dame eingeladen, die ihnen etwas über ihre Körper erzählen sollte, und alle Mädchen aus der Klasse und ihre Mütter waren gekommen, um sich das anzuhören, und dann konnten sie Fragen stellen, und danach gab es Limo und Kekse und Kuchen. Also, Mrs. Thompson hatte es eine Teeparty genannt, obwohl niemand wirklich Tee getrunken hatte. Da Hadiyyah keine Mutter hatte, die sie mitnehmen konnte, hatte sie sich vor der Teilnahme gedrückt. Darum hatte Mrs. Thompson ihren Vater angerufen, denn, wie sie schon zuvor gesagt hatte, alle sollten teilnehmen.
»Dad sagt, er wär mit mir hingegangen«, erzählte Hadiyyah. »Aber das wär grauenhaft gewesen. Außerdem hat Meagan Dobson mir sowieso erzählt, worum es ging. Mädchenkram. Babys. Jungen. Periode.« Sie verzog schaudernd das Gesicht. »Du weißt schon.«
»Ah. Verstehe.« Barbara konnte sich vorstellen, wie Azhar auf den Anruf der Lehrerin reagiert hatte. Sie hatte noch nie einen Menschen getroffen, der so stolz war wie der pakistanische Professor, ihr Nachbar. »Tja, Herzchen, wenn du wieder mal eine Freundin als Ersatz für deine Mum brauchst, stehe ich gern zur Verfügung«, erklärte sie.
»Das ist ja toll!«, rief Hadiyyah. Zuerst glaubte Barbara, dies beziehe sich auf ihr Angebot als Mutterersatz, aber dann sah sie, dass ihre kleine Freundin einen Karton aus einer der Lebensmitteltüten herausgezogen hatte: Choctastic Pop-Tarts – schokoladegefüllte Teigtaschen für den Toaster. »Isst du die zum Frühstück?«, fragte Hadiyyah seufzend.
»Die perfekte Schnellnahrung für die Karrierefrau in Eile«, erklärte Barbara ihr. »Sagen wir, es ist unser kleines Geheimnis, okay? Eines von vielen.«
»Und was ist das hier?«, fragte Hadiyyah, als habe sie Barbara gar nicht gehört. »Oh, herrlich! Sahneeisriegel! Wenn ich groß bin, werd ich genauso essen wie du.«
»Ich lege Wert darauf, alle wichtigen Nahrungsgruppen zu berücksichtigen«, erklärte Barbara. »Schokolade, Zucker, Fett und Tabak. Apropos, sind dir die Players zufällig schon begegnet?«
»Du darfst nicht rauchen«, entgegnete Hadiyyah, durchwühlte eine der Tüten und förderte eine Zigarettenschachtel zutage. »Dad versucht aufzuhören. Hab ich dir das schon erzählt? Mummy wird sich ja so freuen. Sie hat ihn andauernd gebeten, aufzuhören. ›Hari, deine Lungen werden ganz fies, wenn du das nicht sein lässt‹, hat sie immer zu ihm gesagt. Ich rauche nicht.«
»Das will ich auch hoffen«, antwortete Barbara.
»Manche von den Jungs rauchen. Sie stehen draußen auf der Straße vor der Schule. Die größeren Jungs. Und sie ziehen das Hemd aus der Hose, Barbara. Ich nehme an, sie meinen, damit sehen sie cool aus, aber ich finde, sie sehen …« Sie runzelte nachdenklich die Stirn. »… grässlich aus«, schloss sie. »Absolut grässlich.«
»Pfauen und ihre Schwanzfedern«, stimmte Barbara zu.
»Hm?«
»Männchen einer Spezies, die Weibchen anlocken wollen. Und ohne das Gehabe hätten sie keine Chance. Interessant, oder? Eigentlich sollten die Männer Make-up tragen.«
Hadiyyah kicherte und sagte: »Dad wär bestimmt ein toller Anblick mit Lippenstift, was?«
»Er könnte sich vor den Frauen wahrscheinlich gar nicht retten.«
»Das wäre Mummy aber bestimmt nicht recht«, merkte Hadiyyah an. Sie ergriff vier Dosen All Day Breakfast – Barbaras bevorzugtes Notfallabendessen nach einem ungewöhnlich langen Arbeitstag – und trug sie zum Schrank über der Spüle.
»Nein, sicher nicht«, stimmte Barbara zu. »Hadiyyah, was ist dieses fürchterliche Gekreisch da um deinen Hals eigentlich?« Sie nahm dem kleinen Mädchen die Dosen ab und wies auf die Kopfhörer, aus denen nach wie vor irgendwelche fragwürdige Popmusik quäkte.
»Nobanzi«, antwortete Hadiyyah geheimnisvoll.
»No – was?«
»Nobanzi. Die sind klasse. Schau.« Aus der Jackentasche beförderte sie die Plastikhülle der CD ans Licht. Das Cover zeigte drei Magersüchtige in den Zwanzigern mit winzigen bauchfreien Tops und Jeans, die so eng waren, dass das einzige Geheimnis, welches sie offen ließen, die Frage war, wie sie sich hineingezwängt haben mochten.
»Ah«, sagte Barbara. »Vorbilder für unsere Jugend. Also, gib her. Lass mich mal reinhören.«
Hadiyyah überreichte ihr die Kopfhörer, die Barbara sich aufsetzte. Zerstreut griff sie nach einer Schachtel Players und schüttelte trotz Hadiyyahs Protestlaut eine Zigarette heraus. Sie zündete sie an, während etwas, das der Refrain eines Liedes sein mochte – wenn man es Lied nennen wollte – in ihre Ohren drang. Nobanzi waren nicht gerade die Vandellas, mit oder ohne Martha, entschied Barbara. Der Text bestand aus unverständlichen Wortfetzen. Orgiastisches Stöhnen im Hintergrund ersetzte offenbar sowohl den Bass als auch das Schlagzeug.
Barbara nahm die Kopfhörer ab und gab sie zurück. Sie zog an ihrer Zigarette und sah Hadiyyah mit zur Seite geneigtem Kopf neugierig an.
»Sind sie nicht super?«, fragte Hadiyyah. Sie nahm Barbara die CD-Hülle ab und zeigte auf das Mädchen in der Mitte, die zweifarbige Dreadlocks trug und eine rauchende Pistole auf die rechte Brust tätowiert hatte. »Das ist Juno. Die find ich am tollsten. Sie hat ein Baby, das Nofretete heißt. Ist sie nicht süß?«
»Genau das Wort, das mir auch in den Sinn kam.« Barbara knüllte die leeren Plastiktüten zusammen und stopfte sie in den Schrank unter der Spüle. Sie öffnete die Besteckschublade und fand ganz hinten Haftnotizen, die sie normalerweise benutzte, um sich bevorstehende Großereignisse zu notieren wie etwa: »Gelegentlich mal wieder Augenbrauen zupfen« oder »Putz endlich dieses eklige Klo«. Dieses Mal jedoch schrieb sie vier Wörter auf und sagte zu ihrer kleinen Freundin: »Komm mit. Es wird Zeit, dass sich jemand um deine Bildung kümmert.«
Sie schnappte sich ihre Schultertasche und führte Hadiyyah wieder zur Frontseite des Haupthauses, wo die Schuhe des kleinen Mädchens am Eingang der Erdgeschosswohnung unter der Bank lagen. Barbara sagte ihr, sie solle die Schuhe anziehen, während sie selbst die Notiz an die Eingangstür heftete.
Als Hadiyyah fertig war, sagte Barbara: »Komm mit. Ich habe deinem Dad Bescheid gegeben.« Und damit machten sie sich auf den Weg Richtung Chalk Farm Road.
»Wohin gehen wir?«, fragte Hadiyyah. »Werden wir ein Abenteuer erleben?«
Barbara antwortete: »Lass mich dir eine Frage stellen. Nicke, wenn einer dieser Namen dir bekannt vorkommt. Buddy Holly. Nein? Richie Valens. Nein? The Big Bopper. Nein? Elvis. Na ja, natürlich. Wer hätte nicht schon mal von Elvis gehört, aber das zählt nicht. Was ist mit Chuck Berry? Little Richard? Jerry Lee Lewis? ›Great Balls of Fire‹. Kommt dir das bekannt vor? Nein? Verflucht noch mal, was lernt ihr eigentlich in der Schule?«
»Du sollst nicht fluchen«, sagte Hadiyyah.
Nachdem sie die Chalk Farm Road erreicht hatten, war es nicht mehr weit zu ihrem Ziel: Der Virgin Megastore auf der Camden High Street. Um dorthin zu gelangen, mussten sie allerdings die Einkaufsmeile passieren, die, soweit Barbara beurteilen konnte, mit keiner anderen in der Stadt vergleichbar war: Die Gehwege waren bevölkert von jungen Menschen jeder Hautfarbe, Religion und Körperkultvariation, aus allen Richtungen beschallt mit einer dröhnenden Kakophonie von Musik und durchsetzt mit unzähligen Duftnoten von Patschuli bis Fish and Chips. Hier hatten die Geschäfte Logos in Gestalt riesiger Katzen oder einer gigantischen unteren Torsohälfte in Blue Jeans und Riesenstiefeln oder eines Flugzeugs mit der Nase nach unten … Diese Firmenschilder hatten meistens nur einen marginalen Bezug zu den angebotenen Waren in den jeweiligen Läden, die hauptsächlich Dinge in Schwarz und aus Leder verkauften. Schwarzes Leder. Schwarzes Kunstleder. Schwarzer Webpelz auf schwarzem Kunstleder.
Hadiyyah nahm all dies mit dem Gesichtsausdruck einer Novizin in sich auf, was Barbara zum ersten Mal auf den Gedanken brachte, dass das kleine Mädchen nie zuvor auf der Camden High Street gewesen war, obwohl diese doch gar nicht weit von ihrem Haus entfernt lag. Hadiyyah folgte ihr, die Augen groß wie Radkappen, die Lippen geöffnet, das Gesicht verzückt. Barbara musste sie zwischen den Menschen hindurchführen und legte eine Hand auf ihre Schulter, um zu verhindern, dass sie beide im Gedränge getrennt wurden.
»Toll, toll!«, flüsterte Hadiyyah. »O Barbara, das ist viel besser als eine Überraschung.«
»Ich freu mich, dass es dir gefällt«, erwiderte Barbara.
»Gehen wir in die Läden?«
»Sobald ich deine Bildung aufgebessert habe.«
Sie brachte sie in die Abteilung »Classic Rock ’n’ Roll« des Megastores. »Das hier«, klärte Barbara sie auf, »ist Musik. Also … womit fängst du am besten an …? Ach, eigentlich ist das doch gar keine Frage. Denn letzten Endes gibt es nur einen Meister und dann den ganzen Rest. Also …«
Sie suchte die Abteilung »H« und dann innerhalb der Abteilung das einzige »H«, das zählte. Sie ging die CDs durch, schaute die Listen der Songs auf den Rückseiten an, während Hadiyyah neben ihr stand und die Fotos von Buddy Holly auf den Covern studierte.
»Sieht ein bisschen komisch aus«, bemerkte sie.
»Pass auf, was du sagst. Hier. Das ist das Richtige. Da ist ›Raining in My Heart‹ drauf, wovon du garantiert in Ohnmacht fällst, und wenn du ›Rave On‹ hörst, wirst du auf der Küchenanrichte tanzen wollen. Das, Herzchen, ist Rock ’n’ Roll. Noch in hundert Jahren werden die Menschen Buddy Holly hören, das schwör ich dir. Nobuki hingegen …«
»Nobanzi«, verbesserte Hadiyyah geduldig.
»… werden nächste Woche Schnee von gestern sein. Verschwunden und vergessen, während der Meister bis in alle Ewigkeit weiter rockt. Dies hier, mein Kind, ist Musik.«
Hadiyyahs Gesichtsausdruck verriet ihre Zweifel. »Aber er hat so eine merkwürdige Brille«, wandte sie ein.
»Na ja, schon. Aber so war damals eben die Mode. Er ist seit Ewigkeiten tot. Flugzeugabsturz. Schlechtes Wetter. Wollte unbedingt nach Hause zu seiner schwangeren Frau.« Zu jung, dachte Barbara. Zu sehr in Eile.
»Wie traurig.« Hadiyyah sah das Foto von Buddy Holly nun mit anderen Augen.
Barbara bezahlte die CD und riss die Plastikfolie ab, holte die CD aus der Hülle heraus und legte sie an Stelle von Nobanzi in den Discman ein. Dann sagte sie: »Tu deinen Ohren mal was Gutes«, und als die Musik einsetzte, führte sie Hadiyyah zurück auf die Straße.
Wie versprochen brachte Barbara sie in einige der Läden, wo die »Heute in, morgen out«-Mode auf überfüllten Ständern und an den Wänden hing. Dutzende Teenager warfen mit Geld um sich, als sei eben in den Nachrichten der Weltuntergang angekündigt worden, und sie alle wirkten so uniform, dass Barbara ihre kleine Begleiterin anschaute und betete, Hadiyyah möge sich ihre Arglosigkeit, die sie zu einem so liebenswerten Menschen machte, für immer bewahren. Barbara konnte sich einfach nicht vorstellen, dass sie sich je in einen Londoner Teenager verwandeln würde, der es nicht erwarten konnte, erwachsen zu werden, das Handy ans Ohr gepresst, angemalt mit Lippenstift und Lidschatten, ihr kleiner Arsch in enge Blue Jeans gezwängt, und hochhackige Stiefel, die ihre Füße ruinierten. Und ganz sicher konnte Barbara sich nicht vorstellen, dass der Vater des kleinen Mädchens seine Tochter in solch einer Montur je auf die Straße lassen würde.
Hier und heute nahm Hadiyyah alles mit der Hingabe eines Kindes in sich auf, das zum ersten Mal im Leben auf der Kirmes ist, während Buddy Holly in ihr Herz rieselte. Erst als sie schon wieder auf der Chalk Farm Road waren, wo die Menschen womöglich noch lauter und bunter waren, nahm Hadiyyah die Kopfhörer ab und sagte schließlich: »Von jetzt an will ich jede Woche hierher. Kommst du mit mir, Barbara? Ich könnte mein Taschengeld sparen, und wir könnten Mittagessen gehen und durch alle Geschäfte bummeln. Heute geht es leider nicht, denn ich sollte zu Hause sein, bevor Dad zurückkommt. Er wäre bestimmt sauer, wenn er erfährt, wo wir waren.«
»Wirklich? Warum?«
»Oh, weil er mir verboten hat, hierher zu gehen«, antwortete Hadiyyah treuherzig. »Dad hat gesagt, wenn er mich je auf der Camden High Street erwischt, würd er mich verhauen, bis ich nicht mehr sitzen kann. Du hast doch nicht auf den Zettel geschrieben, wohin wir gegangen sind, oder?«
Barbara fluchte innerlich. Sie hatte die möglichen Folgen dieses unschuldigen Ausflugs zum Plattengeschäft nicht bedacht. Für einen Moment hatte sie das Gefühl, als habe sie die Unschuld verdorben, doch dann war sie erleichtert, dass ihre Notiz an Taymullah Azhar nur aus den vier Wörtern »Hadiyyah ist bei mir« und ihrer Unterschrift bestanden hatte. Jetzt hing alles von Hadiyyahs Diskretion ab … Doch als sie die Begeisterung des kleinen Mädchens sah, musste Barbara sich eingestehen, die Chancen standen schlecht, dass Hadiyyah die Freude, die dieser Ausflug ihr gemacht hatte, vor ihrem Vater würde verbergen können – ganz gleich, wie fest sie im Moment entschlossen sein mochte, vor ihm geheim zu halten, wo sie während seines Einkaufs gewesen war.
»Ich habe nicht ausdrücklich geschrieben, wohin wir wollten«, räumte Barbara ein.
»Oh, das ist super«, erwiderte Hadiyyah. »Denn wenn er’s wüsste … Ich bin nicht versessen darauf, verhauen zu werden, du etwa, Barbara?«
»Meinst du, er würde wirklich …?«
»Oh, schau mal!«, rief Hadiyyah. »Wie heißt das hier? Und es riecht so himmlisch. Wird hier irgendwo gekocht? Können wir reingehen?«
»Das hier« war der Camden Lock Market, an dem ihr Heimweg sie vorbeiführte. Der Markt erstreckte sich entlang des Ufers des Grand Union Canal, und die Düfte der Fressbuden wehten bis zu ihnen herüber. Rap-Musik dröhnte aus einem der Läden, und die Rufe der Marktschreier, die alles – von gefüllten Folienkartoffeln bis Hähnchen Tikka Masala – feilboten, waren gerade noch auszumachen.
»Barbara, können wir da reingehen?«, wiederholte Hadiyyah. »So was hab ich ja noch nie gesehen! Und Dad muss es nie erfahren. Wir werden nicht verhauen. Ich verspreche es, Barbara.«
Barbara sah in ihr strahlendes Gesicht und wusste, sie konnte Hadiyyah das harmlose Vergnügen, einmal über den Markt zu schlendern, nicht versagen. Was konnte es denn schon schaden, wenn sie sich noch ein halbes Stündchen gönnten, um zwischen den Kerzen, den Räucherstäbchen, T-Shirts und Tüchern zu flanieren. Sie würde Hadiyyah von den Drogenzubehör- und Piercingständen ablenken, wenn sie daran vorbeikamen. Und was Camden Lock Market sonst zu bieten hatte, war größtenteils harmlos.
Barbara lächelte ihre kleine Freundin an. »Ach, was soll’s. Gehen wir.«
Sie waren jedoch erst zwei Schritte Richtung Markt gegangen, als Barbaras Handy klingelte. »Sekunde mal«, sagte Barbara zu Hadiyyah und las die Anrufernummer im Display. Als sie sie erkannte, wusste sie, dass es wahrscheinlich keine guten Neuigkeiten gab.
»Es gibt Arbeit«, sagte Thomas Lynley, zur Zeit Interim Superintendent. Ein Unterton von Anspannung lag in seiner Stimme, der sich mit seinem nächsten Satz erklärte: »Kommen Sie so schnell wie möglich in Hilliers Büro.«
»Hillier?« Barbara starrte ihr Handy an, als sei es ein Gegenstand aus einer fremden Galaxie, während Hadiyyah geduldig an ihrer Seite wartete, mit der Schuhspitze einen Riss im Pflaster nachzog und die Menschen betrachtete, die sich auf dem Weg zu einem der Märkte an ihnen vorbeidrängten. »AC Hillier kann nicht nach mir verlangt haben.«
»Sie haben eine Stunde«, eröffnete Lynley ihr.
»Aber Sir …«
»Er hat anfangs gesagt, dreißig Minuten, aber wir haben verhandelt. Wo sind Sie?«
»Camden Lock Market.«
»Schaffen Sie es, in einer Stunde hier zu sein?«
»Ich tu mein Bestes.« Barbara beendete die Verbindung und steckte das Telefon in ihre Umhängetasche. »Herzchen, das müssen wir verschieben«, sagte sie. »Ich muss zur Arbeit.«
»Ist was Schlimmes passiert?«, fragte Hadiyyah.
»Vielleicht ja, vielleicht nein.«
Barbara hoffte Letzteres. Sie hoffte, diese Einbestellung bedeutete, dass die Zeit ihrer Abstrafung vorüber war. Seit Monaten durchlitt sie jetzt schon die Demütigung der Degradierung, und wann immer Assistant Commissioner Sir David Hilliers Name fiel, konnte sie es nicht verhindern, zu hoffen, dass das Ende dessen, was sie als ihre berufliche Ächtung betrachtete, endlich gekommen war. Und jetzt wurde sie angefordert, sollte in AC Hilliers Büro kommen, zu Hillier selbst und zu Lynley, der, wie Barbara wusste, beinah seit dem Moment ihrer Degradierung taktiert und versucht hatte, ihr wieder zu ihrem alten Rang zu verhelfen.
Sie und Hadiyyah trabten im wahrsten Sinne des Wortes zurück nach Eton Villas. Sie trennten sich an der Gabelung des gepflasterten Weges an der Hausecke. Hadiyyah winkte ihr zu, ehe sie zur Erdgeschosswohnung hinüberhüpfte. Barbara sah, dass die Haftnotiz, die sie für den Vater des kleinen Mädchens an der Tür hinterlassen hatte, verschwunden war. Daraus schloss sie, dass Azhar mit der Überraschung für seine Tochter nach Hause gekommen war, und begab sich zu ihrem Bungalow, um sich in aller Eile umzuziehen.
Die erste Entscheidung, die es zu treffen galt – und zwar schnell, denn von der Stunde, die Lynley ihr gegeben hatte, waren nach der hastigen Heimkehr vom Markt an der Chalk Farm Road nur noch fünfundvierzig Minuten übrig –, war, was sie anziehen sollte. Ihre Garderobe musste Professionalität ausstrahlen, ohne den Eindruck zu erwecken, als buhle sie um Hilliers Gunst. Eine Hose mit passendem Jackett würde Ersteres bewerkstelligen, ohne Letzterem zu nahe zu kommen. Also: Eine Hose mit passendem Jackett musste her.
Sie fand sie, wo sie sie zurückgelassen hatte, nämlich zu einem Bündel zusammengeknüllt hinter dem Fernseher. Sie konnte sich nicht genau erinnern, wie sie dorthin gekommen waren, und schüttelte sie aus, um den Schaden zu begutachten. Ah, es geht doch nichts über Polyester, dachte sie. Man konnte von einer Büffelherde niedergetrampelt werden, ohne eine einzige Knitterfalte davonzutragen.
Sie machte sich daran, eine Art Ensemble zusammenzustellen. Dies bedeutete nicht den Ausdruck ihres Modebewusstseins, sondern lediglich, rasch in die Hose zu schlüpfen und nach einer Bluse ohne zu viele sichtbare Falten zu wühlen. Dann wählte sie die am wenigsten provozierenden Schuhe, die sie besaß – ein Paar derber, abgewetzter Halbschuhe, die sie statt der roten, knöchelhohen Turnschuhe anzog, die sie normalerweise bevorzugte –, und nach fünf Minuten war sie fertig, schnappte sich zwei Choctastic Pop-Tarts und stopfte sie auf dem Weg zur Tür in ihre Tasche.
Draußen galt es, die Frage des Transportmittels zu entscheiden. Auto, Bus oder U-Bahn? Alle drei bargen Risiken. Der Bus musste sich durch die verstopfte Arterie quälen, welche die Chalk Farm Road war. Das Auto würde eine kreative Schleichwegfahrt erfordern. Und was die U-Bahn betraf … Die U-BahnLinie, die am Bahnhof Chalk Farm hielt, war die für ihre Unzuverlässigkeit berüchtigte Northern Line. Selbst an guten Tagen betrug allein die Wartezeit oft zwanzig Minuten.
Barbara entschied sich für ihr Auto. Sie überlegte sich eine Route, die Dädalus vor Neid hätte erblassen lassen, und schaffte es mit nur elfeinhalb Minuten Verspätung nach Westminster. Dennoch wusste sie natürlich, dass nichts außer absoluter Pünktlichkeit Hillier zufrieden stellen konnte, darum bog sie mit qualmenden Reifen in die Tiefgarage an der Victoria Street, und nachdem sie das Auto abgestellt hatte, rannte sie zu den Aufzügen.
Sie hielt in dem Stockwerk, wo Lynley vorübergehend sein Büro hatte, in der Hoffnung, dass er Hillier die elfeinhalb Minuten hingehalten hatte. Das war jedoch nicht der Fall, oder zumindest legte sein leeres Büro diesen Schluss nahe. Dorothea Harriman, die Abteilungssekretärin, bestätigte Barbaras Verdacht.
»Er ist oben beim Assistant Commissioner, Detective Constable«, berichtete sie. »Er sagte, Sie sollen hinaufkommen und sich ihnen anschließen. Wissen Sie, dass der Saum Ihrer Hose gerissen ist?«
»Ehrlich? Verdammt.«
»Ich hätte eine Nadel, wenn Sie wollen.«
»Keine Zeit, Dee. Haben Sie zufällig auch eine Sicherheitsnadel?«
Dorothea ging an ihren Schreibtisch. Barbara wusste, wie unwahrscheinlich es war, dass die andere Frau eine Sicherheitsnadel besaß. Dees Erscheinung war immer so perfekt, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, wozu sie Nähzeug besitzen sollte. Sie sagte: »Ich fürchte, nein, Detective Constable. Tut mir Leid. Aber wie wär’s hiermit?« Sie hielt den Tacker hoch.
»Her damit«, antwortete Barbara. »Aber beeilen Sie sich. Ich bin spät dran.«
»Ich weiß. An Ihrer Manschette fehlt übrigens ein Knopf«, bemerkte Dorothea. »Und da ist … Detective Constable, Sie haben … Haben Sie sich mit Ihrer Hose in den Staub gesetzt?«
»Oh, verdammt. verdammt«, schimpfte Barbara. »Was soll’s. Er wird mich einfach so nehmen müssen, wie ich bin.«
Mit offenen Armen würde er sie wahrscheinlich so oder so nicht empfangen, dachte Barbara, während sie zum Tower Block hinüberlief und den Aufzug zu Hilliers Büro nahm. Seit mindestens vier Jahren wollte er sie feuern, und nur die Interventionen von dritter Seite hatten das bislang verhindern können.
Hilliers Sekretärin, die sich selbst immer Judi-mit-i Mac-Intosh nannte, sagte Barbara, sie solle gleich eintreten. Sir David warte schon auf sie. Warte zusammen mit Superintendent Lynley schon einige Minuten, fügte sie hinzu. Sie lächelte gezwungen und wies auf die Tür.
Drinnen fand Barbara Hillier und Lynley bei einer Telefonkonferenz mit jemandem, der über Hilliers Lautsprecher etwas von »Vorbereitung zu Schadensbegrenzungsmaßnahmen« sagte.
»Ich nehme an, das heißt, wir sollten eine Pressekonferenz geben«, bemerkte Hillier. »Und zwar bald, damit es nicht den Eindruck erweckt, wir täten es nur, um Fleet Street zu besänftigen. Bis wann können Sie das auf die Beine stellen?«
»Wir kümmern uns sofort darum. Wollen Sie persönlich in Erscheinung treten?«
»Allerdings. Und zwar mit einem pressewirksamen Mitarbeiter an meiner Seite.«
»In Ordnung. Ich melde mich, David.«
»David« und »Schadensbegrenzung«, dachte Barbara. Bei dem Anrufer handelte es sich offenbar um einen Pappkopf von der Pressestelle.
Hillier beendete das Gespräch. Er schaute Lynley an, sagte: »Also?«, und dann entdeckte er Barbara an der Tür. »Wo, zum Henker, waren Sie, Constable?«, schnauzte er.
So viel also zu meinen Chancen, etwas für meinen angeschlagenen Ruf zu tun, dachte Barbara. »Tut mir Leid, Sir«, antwortete sie, während Lynley sich in seinem Stuhl umdrehte. »Der Verkehr war mörderisch.«
»Das Leben ist mörderisch«, erwiderte Hillier. »Aber das hindert uns nicht, es zu leben.«
Der König der Unlogik, dachte Barbara. Sie schaute kurz zu Lynley hinüber, der unauffällig warnend einen Zeigefinger hob. »Ja, Sir«, antwortete sie nur und schloss sich den beiden Männern am Konferenztisch an, wo Lynley saß und wohin Hillier sich nach Beendigung seines Telefonats begeben hatte. Sie zog einen Stuhl zurück und glitt so diskret, wie sie konnte, darauf.
Sie sah vier Fotoserien auf dem Tisch liegen, die vier verschiedene Leichen zeigten. Soweit sie es von ihrem Platz aus beurteilen konnte, handelte es sich um halbwüchsige Jungen, die auf dem Rücken lagen, die Hände auf der Brust gefaltet wie bei den Reliefs auf Sarkophagen. Man hätte meinen können, sie schliefen, wäre ihre Gesichtsfarbe nicht bläulich verfärbt gewesen und hätten die Hälse nicht Strangulationsmale aufgewiesen.
Barbara schürzte die Lippen. »Verdammter Mist. Wann sind sie …«
»Im Laufe der letzten drei Monate«, erklärte Hillier.
»Drei Monate? Aber warum hat niemand …« Barbara sah von Hillier zu Lynley. Sie sah, dass Lynley tief besorgt schien. Hillier, der Meister des politischen Instinkts, wirkte beunruhigt. »Ich habe bisher nicht ein Sterbenswort über diese Sache gehört. Oder in der Zeitung gelesen. Oder Fernsehberichte gesehen. Vier Tote. Der gleiche Modus Operandi. Alle Opfer sind jung. Alle männlich.«
»Bitte versuchen Sie, nicht wie eine hysterische Nachrichtensprecherin im Privatfernsehen zu klingen«, warf Hillier ein.
Lynley bewegte sich auf seinem Stuhl. Er warf Barbara einen Blick zu. Die braunen Augen rieten ihr, sich zurückzuhalten und nicht zu sagen, was sie beide dachten, bis sie irgendwo allein waren.
Na schön, dachte Barbara. Ganz wie er wollte. Betont sachlich fragte sie: »Also, um wen handelt es sich bei den Opfern?«
»A, B, C und D. Wir haben noch keine Namen.«
»Niemand hat sie als vermisst gemeldet? In drei Monaten?«
»Das ist offenbar Teil des Problems«, sagte Lynley.
»Wie meinen Sie das? Wo wurden sie gefunden?«
Hillier zeigte auf eines der Fotos. »Der Erste … im Gunnersbury Park. Am zehnten September. Um acht Uhr fünfzehn von einem Jogger entdeckt, der pinkeln musste. Innerhalb des Parks liegt ein alter Garten, teilweise von einer Mauer umgeben, unweit der Gunnersbury Avenue. Von dort scheint der Täter gekommen zu sein. Von der Straße aus gibt es zwei Eingänge, wenn auch mit Brettern verschlossen.«
»Aber er ist nicht im Park gestorben«, bemerkte Barbara und wies auf das Foto, das den Jungen in Rückenlage auf einem Bett aus Unkraut zeigte, das im Winkel zweier zusammentreffender Mauern wuchs. Nichts deutete darauf hin, dass dort ein Kampf stattgefunden hatte. Außerdem gab es in dem ganzen Stapel von Fotos keine Aufnahme von Beweisstücken, die man normalerweise an Tatorten fand, wo ein Mord stattgefunden hatte.
»Nein, er ist nicht dort gestorben. Und der hier auch nicht.« Hillier ergriff einen zweiten Fotostapel. Die Bilder zeigten den Leichnam eines weiteren schlanken Jungen, der auf der Motorhaube eines Autos aufgebahrt worden war. Mit der gleichen Sorgfalt wie das Opfer aus dem Gunnersbury Park. »Dieser hier wurde auf einem öffentlichen Parkplatz am Queensway aufgefunden. Gut fünf Wochen später.«
»Und was sagt die Mordkommission dort drüben? Irgendwas von den Überwachungskameras?«
»Der Parkplatz hat keine Kameras«, antwortete Lynley. »Ein Schild dort besagt, dass ›Kameraüberwachung möglich‹ sei. Aber das ist alles. Das soll reichen, um die Sicherheit zu gewährleisten.«
»Und der hier lag in der Quaker Street«, fuhr Hillier fort und zeigte auf einen dritten Stoß Fotografien. »Ein verlassenes Lagerhaus unweit der Brick Lane. Fünfundzwanzigster November. Und dieser hier« – er nahm den vierten Stapel und reichte ihn Barbara –, »ist das jüngste Opfer. Aufgefunden in St. George’s Gardens. Heute.«
Barbara sah auf die letzten Bilder hinab. Sie zeigten den nackten Leichnam eines Teenagers auf einer flechtenbewachsenen Grabplatte. Das Grab selbst lag in einer Rasenfläche unweit eines gewundenen Pfades. Jenseits dieses Weges erhob sich eine Mauer, die jedoch keinen Friedhof begrenzte, wie man wegen des Grabes hätte annehmen können, sondern einen Garten. Und dahinter schienen Garagen und ein Mehrfamilienhaus zu liegen.
»St. George’s Gardens?«, fragte Barbara. »Wo ist das?«
»Unweit Russell Square.«
»Wer hat die Leiche gefunden?«
»Der Parkwächter, der morgens aufschließt. Der Mörder ist durch das Tor an der Handel Street hineingelangt. Es war ordnungsgemäß mit einer Kette verschlossen, die mit einem Bolzenschneider durchtrennt wurde. Er hat das Tor geöffnet, ist hineingefahren, hat das Opfer auf dem Grab abgelegt und ist wieder verschwunden. Er hat noch einmal angehalten, um die Kette wieder notdürftig um die Torpfosten zu schlingen, sodass Passanten nichts auffallen würde.«
»Reifenspuren im Garten?«
»Zwei brauchbare. Es werden gerade Gipsabdrücke genommen.«
»Zeugen?« Barbara zeigte auf die Wohnungen, die über die Garagen hinweg auf den Garten blickten.
»Constables der Theobald’s-Road-Wache gehen von Tür zu Tür.«
Barbara zog alle Fotos zu sich her und legte die vier Opfer vor sich in eine Reihe. Augenblicklich fielen ihr die gravierenden Unterschiede zwischen dem letzten Opfer und den drei vorherigen auf. Alle waren Teenager und auf identische Weise gestorben, aber im Gegensatz zu den ersten drei Jungen war das letzte Opfer nicht nur nackt, sondern auch stark geschminkt: Lippenstift, Lidschatten, Kajal und Wimperntusche waren über das Gesicht verschmiert. Außerdem hatte der Mörder den Jungen vom Brustbein bis zur Taille aufgeschlitzt und mit Blut ein eigentümliches rundes Symbol auf die Stirn gemalt. Das wichtigste, potenziell politische Detail jedoch hatte mit der Hautfarbe zu tun: Nur das jüngste Opfer war weiß. Eines der drei früheren war schwarz, die anderen beiden eindeutig gemischtrassig. Schwarz und asiatisch vielleicht. Schwarz und philippinisch. Schwarz und Gott allein wusste, was.
Nachdem Barbara dies erkannt hatte, begriff sie, warum die Morde keine Titelgeschichten in den Zeitungen nach sich gezogen hatten, keine Fernsehberichte und – das war das Schlimmste – kein Gemunkel bei New Scotland Yard. Sie hob den Kopf. »Institutioneller Rassismus. Das werden sie uns nachsagen, oder? Kein Polizist in London in keiner der zuständigen Wachen ist auf den Gedanken gekommen, dass hier ein Serienmörder am Werk ist. Niemand hat sich die Mühe gemacht, seinen Fall mit den Kollegen aus dem nächsten Revier abzuklären.« Sie nahm das Bild des schwarzen Jungen auf. »Dieser hier ist vielleicht in Peckham vermisst gemeldet worden. Oder in Kilburn. Oder Lewisham. Oder wo auch immer. Aber seine Leiche wurde nicht dort abgelegt, wo er wohnte und von wo er verschwunden ist, richtig? Und darum haben die Kollegen im Revier seines Wohnviertels ihn als Ausreißer zu den Akten gelegt und ihn nie mit einem Mordopfer in Zusammenhang gebracht, das anderswo entdeckt wurde. Ist es so gelaufen?«
»Jetzt verstehen Sie, warum sowohl behutsames Vorgehen als auch sofortiges Handeln angezeigt sind«, antwortete Hillier.
»Unbedeutende Morde, kaum der Ermittlung wert, und zwar aufgrund der Hautfarbe der Opfer. Das werden sie über die ersten drei Jungen sagen, sobald die Sache herauskommt. Die Boulevardblätter, die Fernseh- und Radionachrichten, das ganze verdammte Pack.«
»Wir beabsichtigen, dem zuvorzukommen. Genau betrachtet hätten die Boulevardblätter, die seriösen Zeitungen, Radio und Fernsehen selbst hinter diese Sache kommen und uns auf der Frontseite kreuzigen können, wären sie nicht immer so mit der Jagd nach Skandalen bei den Promis, den Politikern oder der verdammten Royal Family beschäftigt. So aber können sie uns schwerlich institutionellen Rassismus vorwerfen, nur weil wir nicht entdeckt haben, was sie selbst zu entdecken versäumt haben. Seien Sie versichert, als die Pressesprecher der jeweiligen Polizeiwachen die Mitteilung über den Fund der Opfer herausgegeben haben, hat die Presse sie als nicht nachrichtenfähig abgetan, und zwar wegen der Opfer: nur wieder irgendein toter schwarzer Junge. Wer will das schon wissen. Keine Schlagzeile wert.«
»Bei allem Respekt, Sir«, wandte Barbara ein. »Das wird die Medien nicht hindern, über uns herzufallen.«
»Das werden wir ja sehen. Ah.« Hillier lächelte überschwänglich, als seine Bürotür sich wieder öffnete. »Hier kommt der Gentleman, auf den wir gewartet haben. Ist der Papierkram erledigt, Winston? Dürfen wir Sie schon ganz offiziell Sergeant Nkata nennen?«
Die Frage traf Barbara unerwartet wie ein Schlag. Sie schaute zu Lynley, doch der hatte sich erhoben, um Winston Nkata zu begrüßen, der an der Tür stehen geblieben war. Im Gegensatz zu ihr hatte Nkata seiner Kleidung die übliche Sorgfalt angedeihen lassen. Alles an ihm wirkte geschniegelt und gebügelt. In seiner Gegenwart – in ihrer aller Gegenwart – fühlte Barbara sich wie Aschenputtel vor dem Besuch der Fee.
Sie stand auf. Sie war im Begriff, ihrer Karriere den Todesstoß zu versetzen, aber sie sah keinen anderen Ausweg … außer dem Weg hinaus, den sie nun einschlug. »Winnie«, sagte sie zu ihrem Kollegen. »Super. Glückwunsch. Ich hab’s gar nicht gewusst.« Und dann zu ihren beiden anderen Vorgesetzten: »Mir ist gerade eingefallen, dass ich einen wichtigen Anruf erledigen muss.«
Und damit ging sie hinaus.
Lynley verspürte einen beinah unbezähmbaren Drang, Havers zu folgen. Gleichzeitig erkannte er jedoch, dass es klüger war, zu bleiben. Vor allem wusste er, dass er ihr eher dadurch helfen würde, wenn es wenigstens einem von ihnen gelang, bei AC Hillier nicht vollends in Ungnade zu fallen.
Das war bedauerlicherweise nie einfach. Der Führungsstil des Assistant Commissioner war irgendwo zwischen machiavellistisch und despotisch angesiedelt, und rationale Menschen machten einen möglichst großen Bogen um Hillier. Lynleys direkter Vorgesetzter – Malcolm Webberly, der jetzt schon seit einiger Zeit krankgeschrieben war – hatte lange Zeit als Puffer fungiert und Lynley und Havers den Rücken freigehalten, seit er sie zum ersten Mal zusammen auf einen Fall angesetzt hatte. In Webberlys Abwesenheit von New Scotland Yard war es nun an Lynley, zu berücksichtigen, aus welcher Richtung der Wind wehte.
Die gegenwärtige Situation stellte Lynleys Vorsatz, im Umgang mit Hillier stets neutral zu bleiben, auf eine harte Probe. Vorhin hätte der AC reichlich Gelegenheit gehabt, ihn von Winston Nkatas Beförderung in Kenntnis zu setzen. Etwa als er sich geweigert hatte, Barbara Havers wieder in ihren alten Rang zu befördern.
Was Hillier indessen mit einem Minimum an Höflichkeit gesagt hatte, war: »Ich will, dass Sie diese Ermittlung leiten, Lynley. Interim Superintendent … Ich kann den Fall kaum jemand anderem übertragen. Malcolm hätte ohnehin gewollt, dass Sie das übernehmen, also stellen Sie das Team zusammen, das Sie brauchen.«
Lynley hatte fälschlicherweise angenommen, der brüske Ton des AC liege in dessen Betroffenheit begründet. Superintendent Malcolm Webberly war immerhin Hilliers Schwager und Opfer eines Mordanschlags geworden. Er war mit einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden, sodass sich Hillier zweifellos um seine Genesung sorgte. Also fragte Lynley: »Wie geht es dem Superintendent, Sir?«
»Jetzt ist nicht der geeignete Zeitpunkt, um über den Gesundheitszustand des Superintendent zu sprechen«, lautete Hilliers Antwort. »Übernehmen Sie diese Ermittlung, oder soll ich sie einem Ihrer Kollegen übertragen?«
»Ich hätte Barbara Havers gern wieder als Sergeant in meinem Team.«
»Ach wirklich. Nun, wir sind hier aber nicht auf dem Basar, und wir feilschen auch nicht. Sie haben die Wahl zwischen: Ja, Sir, ich mache mich sofort an die Arbeit, oder: Bedaure, ich nehme eine längere Zeit Urlaub.«
Lynley war nichts anderes übrig geblieben, als sich für das »Ja, ich mache mich sofort an die Arbeit« zu entscheiden, ohne dass er die Möglichkeit gehabt hätte, sich für Havers einzusetzen. Er nahm sich jedoch vor, seine Kollegin in diesem Fall mit den Aufgaben zu betrauen, die ihre Stärken besonders hervorheben würden. Im Laufe der kommenden Monate würde es ihm sicher gelingen, die Ungerechtigkeiten wieder gutzumachen, die Barbara seit dem vergangenen Juni widerfahren waren.
Jetzt hatte Hillier ihn jedoch erst einmal ausmanövriert. Winston Nkata hatte als frisch gebackener Sergeant die Bühne betreten – womit er Havers’ Beförderung vorläufig im Wege stand –, ohne zu ahnen, welche Rolle er in dem sich anbahnenden Drama spielen sollte.
All das erfüllte Lynley mit Zorn, aber seine Miene gab nichts preis. Er war neugierig, wie Hillier um den heißen Brei herumzutanzen gedachte, wenn er Nkata zu seiner rechten Hand ernannte. Denn Lynley zweifelte nicht daran, dass genau das Hilliers Absicht war. Mit einem Elternteil aus Jamaika, dem anderen von der Elfenbeinküste, war Nkata ganz entschieden schwarz, und das traf sich ausgesprochen gut: Denn sobald die Nachricht sich verbreitete, dass es eine Serie rassistisch motivierter Morde gab, die bislang nicht miteinander in Zusammenhang gebracht worden waren, obwohl dies längst hätte geschehen müssen, dann würde der nicht-weiße Teil der Bevölkerung auf die Barrikaden gehen. Der willkürliche, sinnlose Mord an Stephen Lawrence – einem schwarzen Jungen, der auf offener Straße von weißen Jugendlichen erstochen worden war – war in London unvergessen. Hier hatten sie es nun nicht mit einem Stephen Lawrence zu tun, sondern mit dreien. Und es gab keine Entschuldigung, nur die offensichtliche Erklärung, die Barbara Havers mit ihrer typischen, politisch unklugen Direktheit ausgesprochen hatte: Institutioneller Rassismus, der dazu führte, dass die Polizei die Ermordung schwarzer und gemischtrassiger Jugendlicher nicht mit großem Elan verfolgt hatte. Einfach so.
Derweil verströmte Hillier Jovialität: Er bot Nkata einen Platz an und setzte ihn ins Bild. Die ethnische Zugehörigkeit der ersten drei Opfer erwähnte er mit keinem Wort, aber Winston Nkata war kein Dummkopf.
»Das heißt, Sie haben ein Problem«, war sein kühles Resümee am Ende von Hilliers Ausführungen.
Dieser erwiderte mit einstudierter Gelassenheit: »So wie die Situation sich momentan darstellt, sind wir bemüht, Probleme zu vermeiden.«
»Und da komme ich ins Spiel, richtig?«
»Sozusagen.«
»Wie zu sagen?«, hakte Nkata nach. »Wie wollen Sie das unter den Teppich kehren? Nicht die Morde an sich, meine ich, sondern die Tatsache, dass nichts unternommen wurde?«
Lynley hatte Mühe, ein Lächeln zu unterdrücken. Ach, Winston, dachte er, du lässt dich von niemandem an der Nase herumführen.
»In allen zuständigen Polizeiwachen sind Ermittlungen durchgeführt worden«, lautete Hilliers Antwort. »Zugegeben, zwischen den einzelnen Mordfällen hätten Verbindungen hergestellt werden müssen, und das ist nicht geschehen. Aus diesem Grund übernehmen wir von Scotland Yard die Fälle. Ich habe Acting Superintendent Lynley instruiert, ein Team zusammenzustellen. Ich will, dass Sie in diesem Team eine herausragende Stellung einnehmen.«
»Sie meinen eine Vorzeigerolle«, sagte Nkata.
»Ich meine eine verantwortliche, entscheidende …«
»… sichtbare«, warf Nkata ein.
»… ja, meinetwegen, eine sichtbare Rolle.« Hilliers für gewöhnlich schon frische Gesichtsfarbe nahm einen tieferen Rotton an. Es war unschwer zu erkennen, dass dieses Treffen nicht in den von ihm vorgesehenen Bahnen verlief. Hätte Hillier vorher gefragt, hätte Lynley ihn gern darüber aufgeklärt, dass Winston Nkata als ehemaliger Chefstratege der Brixton Warriors – eine Vergangenheit, deren sichtbare Narben er noch heute trug – der letzte Mensch war, den man nicht ernst nehmen durfte, wenn man seine politischen Ränke schmiedete. So aber