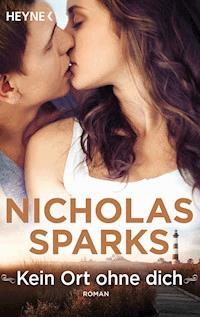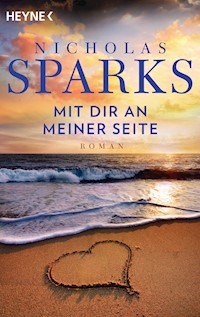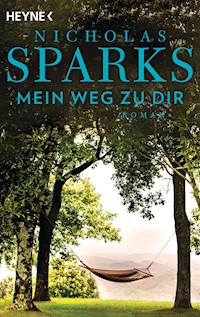9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 36-jährige Hope steckt in einer tiefen persönlichen Krise. Im idyllischen Strandhaus der Familie hofft sie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch dann trifft sie den sympathischen Abenteurer Tru, der alles durcheinanderwirbelt. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick, sie verbringen herrliche romantische Tage miteinander. Aber beide spüren auch den Druck familiärer Verpflichtungen, die ihrer Beziehung entgegenstehen. Und so drohen Hope und Tru sich zu verlieren, bevor sie sich überhaupt richtig gefunden haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Die 36-jährige Hope Anderson steht vor unangenehmen Entscheidungen. Sie ist bereits seit sechs Jahren mit ihrem Partner Josh zusammen, weiß aber nicht, ob er wirklich die Liebe ihres Lebens ist. Zusätzlich wurde bei ihrem Vater vor Kurzem eine tödliche Krankheit diagnostiziert, was schwierige Fragen für ihre eigene Zukunft aufwirft. Eine Woche im idyllischen Strandhaus der Familie will Hope dazu nutzen, wieder Klarheit in ihr Leben zu bringen.
Dort, in Sunset Beach, trifft sie den sympathischen Safari-Guide Tru Walls, und plötzlich ist alles anders. Beide verlieben sich Hals über Kopf ineinander, erkennen sich als wahre Seelenverwandte. Aber können sie den zahlreichen familiären Verpflichtungen standhalten, die an ihnen zerren? Sie haben nur wenige Tage des Glücks, bevor Tru nach Simbabwe zurückreisen wird. Und bevor Hope eine Entscheidung für ihr Leben treffen muss.
Zum Autor
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in über 50 Sprachen erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen.
Große Autorenwebsite auf: www.nicholas-sparks.de
NICHOLAS
SPARKS
WO WIR
UNS FINDEN
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Astrid Finke
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel EVERY BREATH bei Grand Central Publishing/Hachette Book Group USA, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Willow Holdings, Inc.
Copyright © 2018 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lüra – Klemt & Mues GbR
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, unter Verwendung eines Fotos von Tim Dahl / Alamy Stock Photo
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-22805-7V007
www.heyne.de
Für Victoria Vodar
Seelenverwandte
Es gibt Geschichten, die geheimnisvolle, unbekannte Ursprünge haben, und andere, die entdeckt werden, die ein Geschenk sind. Eine solche ist diese. An einem kühlen und böigen Tag gegen Ende des Frühlings 2016 fuhr ich nach Sunset Beach, North Carolina, einem Städtchen auf einer von vielen kleinen Inseln zwischen Wilmington und der Grenze zu South Carolina. Ich parkte meinen Pick-up in der Nähe des Piers und wanderte zum Strand hinunter zu einem unbewohnten Naturschutzgebiet, einem Teil von Bird Island. Einheimische hatten mir erzählt, es gebe dort etwas, das ich sehen müsse; vielleicht finde der Ort sogar Eingang in einen meiner Romane. Ich solle Ausschau nach einer amerikanischen Flagge halten. Als ich diese also in der Ferne ausmachte, wusste ich, dass es nicht mehr weit war.
Daraufhin sah ich mich aufmerksam um. Ich suchte nach einem Briefkasten mit der Aufschrift »Seelenverwandte« (Kindred Spirits). Den Briefkasten – montiert auf einen Pfosten aus verwittertem Treibholz nahe einer von Dünengras bewachsenen Düne – gibt es seit 1983, er gehört allen und niemandem. Jeder darf einen Brief oder eine Postkarte dort hinterlegen, und jeder darf lesen, was er in dem Kasten findet. Tausende tun das auch jedes Jahr. Im Laufe der Zeit wurde »Seelenverwandte« zu einem Hort der Hoffnungen und Träume in schriftlicher Form … und immer sind dort Liebesgeschichten zu finden.
Der Strand war leer. Als ich mich dem Briefkasten näherte, entdeckte ich daneben eine Holzbank. Es war der perfekte Rastplatz, ein Ort der Besinnung.
In dem Briefkasten fand ich zwei Postkarten, etliche bereits geöffnete Briefe, ein Rezept für einen Brunswick-Eintopf, ein offenbar auf Deutsch verfasstes Tagebuch und einen dicken braunen DIN-A4-Umschlag. Es gab Stifte und Briefpapier, vermutlich für jeden, der sich angeregt fühlte, den vorhandenen Geschichten seine eigene hinzuzufügen. Ich setzte mich auf die Bank und las die Postkarten und das Rezept, bevor ich mich den Briefen zuwandte. Schon bald fiel mir auf, dass niemand Nachnamen nannte. In manchen Berichten wurden die Handelnden beim Vornamen genannt, in anderen standen nur Anfangsbuchstaben, und einige waren gänzlich anonym gehalten, was ihre mysteriöse Ausstrahlung noch unterstrich.
Anonymität ermöglicht offenbar aufrichtiges Besinnen. Ich las von einer Frau, die nach einem Kampf gegen den Krebs in einem christlichen Buchladen dem Mann ihrer Träume begegnet war, aber befürchtete, nicht gut genug für ihn zu sein. Ich las von einem Kind, das eines Tages Astronaut zu werden hoffte. Es gab einen Text von einem jungen Mann, der vorhatte, seiner Liebsten in einem Heißluftballon einen Antrag zu machen, und einen weiteren von einem, der sich aus Angst vor Zurückweisung nicht traute, seine Nachbarin zum Essen einzuladen. Ein Brief stammte von jemandem, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden war und sich nichts sehnlicher wünschte, als sein Leben neu beginnen zu können. Das letzte Schreiben war von einem Mann, dessen Hund Teddy vor nicht langer Zeit eingeschläfert worden war. Er trauerte immer noch, und ich betrachtete das Foto von einem schwarzen Labrador mit freundlichen Augen und ergrauter Schnauze, das mit in dem Umschlag steckte. Der Mann hatte mit A. K. unterschrieben, und ich hoffte unwillkürlich, dass er einen Weg finden werde, die durch Teddys Fehlen entstandene Leere zu füllen.
Inzwischen wehte der Wind stetig, und die Wolken verdunkelten sich. Ein Gewitter war im Anmarsch. Ich legte das Rezept, die Postkarten und die Briefe in den Kasten zurück und überlegte, ob ich den großen braunen Umschlag öffnen sollte. Sein Volumen deutete auf eine beträchtliche Anzahl von Seiten hin, aber ich hatte eigentlich keine Lust, auf dem Rückweg zum Auto nass zu werden. Während ich noch nachdachte, drehte ich den Umschlag um und entdeckte, dass jemand außen auf das Papier geschrieben hatte: Die tollste Geschichte aller Zeiten!
Eine Bitte um Anerkennung? Eine Herausforderung? Vom Verfasser oder von jemandem, der sich mit dem Inhalt befasst hatte? Ich war nicht sicher, aber wie konnte ich da widerstehen?
Ich öffnete die Klappe. In dem Umschlag befanden sich ungefähr zehn Blätter, Kopien von drei Briefen und von einigen Zeichnungen von einem Mann und einer Frau, die sehr ineinander verliebt aussahen. Diese legte ich beiseite und widmete mich der Geschichte. Die erste Zeile ließ mich kurz innehalten.
Am meisten wird das Leben eines Menschen durch die Liebe bestimmt.
Der Ton las sich anders als der in den bisherigen Berichten, er verhieß etwas Besonderes, schien mir. Ich begann zu lesen. Nach einer Seite verwandelte sich Neugier in Interesse, nach einigen weiteren konnte ich den Text nicht mehr aus der Hand legen. In der nächsten halben Stunde lachte ich und spürte gleichzeitig einen Kloß im Hals. Ich kümmerte mich nicht um die fast schon pechschwarzen Wolken. Blitz und Donner hatten bereits das gegenüberliegende Ende der Insel erreicht, als ich staunend die letzten Sätze las.
In dem Moment hätte ich gehen sollen. Ich sah eine Regenwand über die Wellen auf mich zu wandern, aber stattdessen las ich die Geschichte ein zweites Mal. Jetzt konnte ich die Stimmen der Figuren klar und deutlich im Kopf hören. Während ich auch die Briefe las und die Zeichnungen betrachtete, nahm allmählich die Idee Gestalt an, irgendwie den Urheber der Seiten aufzuspüren und ihn darauf anzusprechen, dass man aus seiner Geschichte ein Buch machen könnte.
Allerdings würde es nicht einfach sein, diesen Menschen zu finden. Die meisten Ereignisse hatten sich vor langer Zeit zugetragen, vor einem Vierteljahrhundert, und es wurden keine Namen genannt, nur Anfangsbuchstaben. Selbst in den Briefen waren die Namen vor dem Kopieren geschwärzt worden. Nichts deutete darauf hin, wer der Verfasser oder Zeichner gewesen sein mochte.
Wobei – ein paar Anhaltspunkte gab es doch. In dem Teil, der 1990 spielte, wurde ein Restaurant mit einer Terrasse und einem Kamin erwähnt, den eine angeblich von Blackbeards Schiffen stammende Kanonenkugel zierte. Außerdem kam ein Cottage auf einer Insel vor der Küste North Carolinas vor, und zwar in Laufweite des Restaurants. Und auf den offenbar zuletzt geschriebenen Seiten wurde von Renovierungen an einem Strandhaus auf einer ganz anderen Insel gesprochen. Ich hatte keine Ahnung, ob der Bau inzwischen fertiggestellt war, aber irgendwo würde ich anfangen müssen. Obwohl Jahre vergangen waren, hoffte ich, dass die Zeichnungen mir letztlich halfen, die Beteiligten zu identifizieren. Und natürlich gab es noch den Briefkasten, neben dem ich gerade saß und der eine zentrale Rolle in der Geschichte spielte.
Mittlerweile sah der Himmel geradezu bedrohlich aus. Ich schob die Blätter zurück in den Umschlag, legte ihn in den Kasten und hastete zu meinem Wagen. Ich erreichte ihn gerade noch, bevor der Wolkenbruch alles unter Wasser setzte, und obwohl die Scheibenwischer auf höchster Stufe liefen, konnte ich kaum die Straße erkennen. Ich fuhr nach Hause, kochte mir ein spätes Mittagessen und starrte aus dem Fenster, in Gedanken immer noch bei dem Pärchen, von dem ich gelesen hatte. Abends wusste ich bereits, dass ich zum Briefkasten zurückkehren und den Bericht noch einmal genau durchforsten wollte, doch das Wetter und eine Geschäftsreise hinderten mich fast eine Woche lang daran.
Als ich es endlich schaffte, waren die anderen Briefe, das Rezept und das Tagebuch noch da, der braune Umschlag aber nicht mehr. Ich fragte mich, was wohl damit geschehen war. War ein anderer Besucher ebenso bewegt davon gewesen wie ich und hatte ihn mitgenommen? Oder gab es vielleicht eine Art Verwalter, der den Briefkasten hin und wieder ausmistete? Doch ich fragte mich auch, ob dem Verfasser Bedenken gekommen waren und er den Umschlag selbst wieder abgeholt hatte.
Diese Entwicklung steigerte meinen Wunsch, mit ihm zu reden, sogar noch, allerdings hielten mich Familie und Arbeit einen weiteren Monat auf Trab, sodass ich erst im Juni die Zeit fand, meine Suche zu beginnen. Ich möchte nicht mit den ganzen Einzelheiten langweilen – jedenfalls investierte ich annähernd eine Woche, zahllose Telefonate, Besuche bei mehreren Handelskammern und Landratsämtern, in denen Baugenehmigungen registriert waren, und Hunderte von Kilometern im Auto. Da der erste Teil der Geschichte Jahrzehnte her war, gab es einige der Orientierungspunkte schon längst nicht mehr. Es gelang mir immerhin, den Standort des damaligen Restaurants ausfindig zu machen – nun ein schickes Fischlokal mit weißen Tischdecken –, und von dort aus unternahm ich Erkundungstouren, um ein Gefühl für die Gegend zu bekommen. Im Anschluss folgte ich der Spur der Baugenehmigungen, suchte eine Insel nach der anderen auf und hörte eines Tages bei einer meiner vielen Strandwanderungen ein Hämmern und Bohren – keine Seltenheit bei den von Salz und Witterung angegriffenen Häusern an der Küste. Als ich aber einen älteren Mann auf einer von der Düne zum Strand hinunterführenden Rampe arbeiten sah, durchfuhr mich ein Ruck. Ich erinnerte mich an die Zeichnungen und ahnte selbst aus einiger Entfernung, dass ich eine Figur der Geschichte gefunden hatte.
Ich ging auf ihn zu und stellte mich vor. Von Nahem war ich mir noch sicherer, dass er es war. Ich bemerkte an ihm die stille Eindringlichkeit, von der ich gelesen hatte, und genau die aufmerksamen blauen Augen, von denen in einem der Briefe die Rede war. Zudem schätzte ich ihn auf Ende sechzig, also passte auch sein Alter. Nach etwas Small Talk fragte ich ihn unumwunden, ob er die Geschichte geschrieben habe, die ich im Briefkasten gefunden hatte. Daraufhin wandte er bedächtig das Gesicht dem Meer zu und schwieg für viele Sekunden. Als er mich wieder ansah, sagte er, er werde meine Frage am Nachmittag des nächsten Tages beantworten, aber nur, wenn ich bereit sei, ihm bei seiner Arbeit zur Hand zu gehen.
Am nächsten Morgen erschien ich mit einem Werkzeugkasten, der sich schnell als überflüssig erwies. Denn der Mann ließ mich Sperrholzplatten, Kanthölzer und druckimprägnierte Balken vom Haus über die Düne zum Strand schleppen. Der Stapel an Material war riesig, und durch das anstrengende Gehen im Sand erschien mir jede Ladung doppelt so schwer. Ich brauchte fast den ganzen Tag, und abgesehen von Anweisungen, wo ich das Holz abzulegen hatte, sprach der Mann nicht mit mir. Den ganzen Tag lang bohrte und nagelte und rackerte er unter der sengenden Frühsommersonne, mehr an der Qualität seiner Arbeit als an meiner Anwesenheit interessiert.
Kurz nachdem ich die letzte Ladung an den Strand getragen hatte, bedeutete er mir, mich auf die Düne zu setzen, und öffnete eine Kühlbox. Aus einer Thermoskanne goss er zwei Plastikbecher voll mit Eistee.
»Ja«, sagte er schließlich. »Das habe ich geschrieben.«
»Ist die Geschichte denn wahr?«
Er blinzelte, als wollte er mich einschätzen.
»Manches davon ja«, räumte er ein. Er sprach mit dem Akzent, der in der Geschichte beschrieben worden war. »Der ein oder andere mag die Tatsachen bestreiten, aber bei Erinnerungen geht es eben nicht immer um Tatsachen.«
Ich erklärte ihm, dass ich glaube, die Geschichte könne ein faszinierendes Buch ergeben, und setzte zu einer leidenschaftlichen Argumentation an. Wortlos und mit undurchdringlicher Miene lauschte er mir. Aus unerfindlichen Gründen war ich nervös, versuchte beinahe verzweifelt, ihn zu überzeugen. Nachdem ich geendet hatte, entstand eine unbehagliche Stille, während der er meinen Vorschlag abzuwägen schien. Schließlich sprach er. Er sei bereit, die Idee zu besprechen und vielleicht sogar meiner Bitte nachzugeben, allerdings nur unter der Bedingung, dass er das Manuskript als Erster lesen dürfe. Sollte es ihm nicht gefallen, dürfe ich es nicht veröffentlichen. Ich wand mich. Einen Roman zu schreiben bedeutet monatelange, wenn nicht gar jahrelange Anstrengung – doch er ließ nicht locker. Am Ende willigte ich ein. Um ehrlich zu sein, konnte ich seinen Wunsch nachvollziehen. Wäre ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich dasselbe verlangt.
Daraufhin gingen wir in das Haus. Ich stellte Fragen und bekam Antworten. Erneut erhielt ich eine Kopie der Schilderung und durfte mir die originalen Zeichnungen und Briefe ansehen, die die Vergangenheit noch lebendiger machten.
Der Mann erzählte die Geschichte weiter und sparte sich sogar das Beste bis zum Schluss auf. Gegen Abend zeigte er mir ein mit Liebe zusammengestelltes Erinnerungsstück, durch das ich mir die Ereignisse so detailliert und klar vorstellen konnte, als wäre ich selbst Zeuge gewesen. Ich sah sogar nach und nach schon die Worte vor mir, wie sie auf dem Papier erscheinen würden, so als schriebe die Geschichte sich selbst und meine Rolle bestünde lediglich darin, sie auf Papier festzuhalten.
Bevor ich ging, bat er mich noch, keine echten Namen zu verwenden. Er hatte nicht den Wunsch, berühmt zu werden, da er ein eher zurückhaltender Mensch war. Vor allem aber wusste er, dass die Geschichte alte und neue Wunden aufreißen konnte. Einige Beteiligte lebten noch, und mancher wäre vielleicht aufgebracht oder bestürzt über die Enthüllungen. Dieser Bitte habe ich entsprochen, weil die Geschichte meiner Ansicht nach eine höhere Bedeutung besaß.
Bald nach jenem ersten gemeinsamen Abend begann ich mit der Arbeit an dem Roman. Wann immer ich im folgenden Jahr Fragen hatte, rief ich den Mann an oder fuhr vorbei. Ich besichtigte die Schauplätze, zumindest diejenigen, die noch existierten. Ich durchsuchte Zeitungsarchive und prüfte mehr als fünfundzwanzig Jahre alte Fotos. Um mehr Details ausarbeiten zu können, verbrachte ich eine Woche in einer Pension in einem Küstenstädtchen im Osten North Carolinas und flog sogar nach Afrika. Mein Glück war, dass die Zeit in beiden Gegenden langsamer voranzuschreiten scheint; es gab Augenblicke, in denen ich das Gefühl hatte, tatsächlich tief in die Vergangenheit gereist zu sein.
Mein Aufenthalt in Simbabwe war besonders hilfreich. In diesem Land war ich noch nie gewesen, und ich war überwältigt von der spektakulären Tierwelt. Früher einmal wurde Simbabwe die Kornkammer Afrikas genannt, aber zur Zeit meines Besuchs war, hauptsächlich aus politischen Gründen, ein Großteil der landwirtschaftlichen Infrastruktur verfallen, und die Ökonomie war zusammengebrochen. Ich lief an baufälligen Bauernhäusern und brachliegenden Äckern vorbei und konnte mir nur vorstellen, wie grün das Land einst, als die Geschichte begann, gewesen war. Außerdem verbrachte ich drei Wochen auf verschiedenen Safaris, wo ich alles um mich herum aufsaugte. Ich unterhielt mich mit Guides und Fahrern, informierte mich über ihre Ausbildung und ihren Alltag. Ich begriff, wie schwierig es für sie sein musste, ein Familienleben zu haben, da sie den Großteil ihrer Zeit im Busch verbringen. Ich muss gestehen, dass ich Afrika extrem verführerisch fand. Seit diesen Reisen habe ich oft den Drang gespürt zurückzukehren, und das werde ich auch bestimmt bald tun.
Trotz all dieser Recherche bleibt weiterhin vieles im Ungewissen. Siebenundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit, und ein längst vergangenes Gespräch zwischen zwei Menschen im Wortlaut zu rekonstruieren ist unmöglich. Unmöglich, jeden Schritt eines Menschen exakt nachzuvollziehen oder die Konstellation der Wolken am Himmel oder den Rhythmus der ans Ufer schlagenden Wellen. Was ich sagen kann, ist, dass der folgende Text angesichts dieser Einschränkungen das Beste ist, was ich hervorzubringen vermochte. Da ich zum Schutz der Privatsphäre der Beteiligten noch weitere Änderungen vorgenommen habe, kann ich dieses Buch guten Gewissens als Roman bezeichnen und nicht als Tatsachenbericht.
Seine Entstehung gehört zu den unvergesslichsten Erfahrungen meines Lebens. In mancherlei Hinsicht hat es meine Einstellung zur Liebe verändert. Ich vermute, dass die meisten Menschen hin und wieder überlegen: »Was, wenn ich meinem Herzen gefolgt wäre?«, und die wahre Antwort darauf wird man nie erfahren. Denn ein Leben ist ja letzten Endes eine Abfolge kleiner Leben, von einem Tag nach dem anderen, und jeder einzelne Tag verlangt Entscheidungen und hat Konsequenzen. Stück für Stück formen diese den Menschen, der man wird.
Wenn es um Liebe geht, wird es immer Zweifler geben. Sich zu verlieben ist der einfache Teil; die Gefühle trotz der unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens dauerhaft zu gestalten bleibt für viele ein schwer zu erfüllender Traum. Aber wenn Sie diese Geschichte mit dem gleichen Staunen lesen, das ich beim Schreiben empfand, dann wird Ihr Glaube an die unheimlichen Kräfte, die die Liebe auf das Leben von Menschen ausüben kann, vielleicht wieder gestärkt. Möglicherweise machen Sie sich sogar eines Tages selbst auf den Weg zum Briefkasten »Seelenverwandte«, mit einer eigenen Geschichte … einer, die die Macht besitzt, das Leben eines anderen auf eine Art und Weise zu verändern, die Sie nie für möglich gehalten hätten.
Nicholas Sparks, 2. September 2017
Teil 1
Tru
Am Morgen des 9. September 1990 trat Tru Walls vor die Tür und betrachtete forschend den Morgenhimmel, der in der Nähe des Horizonts die Farbe von Feuer hatte. Die Erde unter seinen Füßen war rissig und die Luft trocken, es hatte seit über zwei Monaten nicht geregnet. Staub hüllte seine Stiefel ein, als er zu dem Pick-up lief, den er schon über zwanzig Jahre lang besaß. Wie seine Schuhe war auch der Wagen eingestaubt, von außen und innen. Hinter einem Elektrozaun zerrte ein Elefant Zweige von einem am frühen Morgen umgestürzten Baum. Tru beachtete ihn nicht. Er gehörte zur Landschaft seines Geburtsortes – seine Vorfahren waren vor über einhundert Jahren aus England eingewandert – und war für ihn dementsprechend nicht aufregender als ein Hai, den ein Fischer beim Einholen des täglichen Fangs entdeckte.
Tru war schlank und hatte dunkle Haare und Falten in den Augenwinkeln, die einem in der Sonne verbrachten Leben geschuldet waren. Mit seinen zweiundvierzig Jahren fragte er sich manchmal, ob er sich den Busch zum Leben ausgesucht hatte oder der Busch ihn.
Es war still im Camp, die anderen Guides – einschließlich seines besten Freundes Romy – waren früh am Morgen zur Haupt-Lodge aufgebrochen, von wo aus sie Gäste aus aller Welt in den Busch führten. Seit zehn Jahren arbeitete Tru im Hwange-Nationalpark. Davor hatte er eher ein Nomadenleben geführt und etwa alle zwei Jahre den Arbeitsplatz gewechselt, um Erfahrungen zu sammeln. Nur die Lodges, in denen Jagd gestattet war, hatte er aus Prinzip gemieden, was sein Großvater nicht verstanden hätte. Denn sein Großvater, den alle nur den »Colonel« nannten, obwohl er nie beim Militär gewesen war, behauptete von sich, in seinem Leben über dreihundert Löwen und Geparden getötet zu haben, um das Vieh der riesigen Farm in der Nähe von Harare zu schützen, auf der Tru aufgewachsen war. Und sein Stiefvater und seine Halbbrüder näherten sich stetig der gleichen Anzahl. Neben der Rinderzucht betrieb seine Familie auch Ackerbau und erntete mehr Tabak und Tomaten als jede andere Farm im Land. Kaffee ebenfalls. Sein Urgroßvater hatte einst beim legendären Cecil Rhodes – dem Bergbau-Magnaten, Politiker und Symbol des britischen Imperialismus – gearbeitet und Ende des neunzehnten Jahrhunderts Land, Geld und Macht angehäuft, die er seinem Sohn vererbte.
Als der das Unternehmen von seinem Vater bekam, florierte es bereits, nach dem Zweiten Weltkrieg aber wuchs es exponentiell und machte die Walls zu einer der wohlhabendsten Familien des Landes. Trus Wunsch, dem Geschäftsimperium und dem Leben im Luxus zu entfliehen, hatte der Colonel nie nachvollziehen können. Vor seinem Tod, als Tru sechsundzwanzig war, besuchte er einmal ein Naturschutzgebiet, in dem Tru gerade arbeitete. Obwohl er nicht im Camp schlief, sondern in der Haupt-Lodge, war es für den alten Mann ein Schock, Trus Unterkunft zu sehen. Für ihn wirkte sie vermutlich nur wenig besser als ein Schuppen, ohne Isolierung oder Telefon. Eine Petroleumlampe sorgte für die Beleuchtung, und ein kleiner Gemeinschaftsgenerator betrieb einen Minikühlschrank. Kein Vergleich zu dem Haus, in dem Tru aufgewachsen war, aber mehr als diese karge Umgebung brauchte Tru nicht, besonders nicht, wenn abends ein Sternenmeer über ihm erschien. Gegenüber seinen vorherigen Arbeitsplätzen war es sogar schon ein Fortschritt, denn in zweien davon hatte er in einem Zelt geschlafen. Dort gab es wenigstens fließendes Wasser und eine Dusche, wenn auch in einem Gemeinschaftsbad, was er selbst fast als Luxus betrachtet hatte.
An diesem Morgen hatte Tru seine Gitarre in dem verbeulten Kasten dabei, eine Thermoskanne und eine Plastikdose, ein paar Zeichnungen, die er für seinen Sohn Andrew angefertigt hatte, und einen Rucksack mit Wäsche zum Wechseln für ein paar Tage, Kulturbeutel, Zeichenblöcken, Bunt- und Kohlestiften und seinen Pass. Obwohl er eine Woche lang verreiste, ging er davon aus, dass er nicht mehr benötigen würde.
Sein Wagen stand unter einem Affenbrotbaum. Einige seiner Kollegen mochten die trockene, breiige Frucht und mischten sie sich morgens unter ihr Porridge, aber Tru hatte sich nie dafür erwärmen können. Jetzt warf er seinen Rucksack auf den Beifahrersitz und sah schnell hinten auf der Ladefläche nach, ob dort auch nichts lag, was gestohlen werden konnte. Zwar würde er den Pick-up auf der Farm seiner Familie parken, aber dort gab es über dreihundert Feldarbeiter, die alle sehr wenig verdienten. Gutes Werkzeug löste sich gern mal in Luft auf, selbst unter den wachsamen Augen seiner Verwandtschaft.
Er klemmte sich hinters Steuer und setzte die Sonnenbrille auf. Bevor er den Schlüssel herumdrehte, vergewisserte er sich noch einmal, dass er nichts vergessen hatte. Viel gab es ja nicht, abgesehen von Rucksack und Gitarre hatte er den Brief und das Foto aus Amerika bei sich, dazu die Flugtickets und seine Brieftasche. In dem Gestell hinter ihm stand ein geladenes Gewehr, falls er eine Autopanne hatte und in der Dunkelheit durch den Busch laufen musste – immer noch einer der gefährlichsten Orte auf der Welt, vor allem nachts und selbst für jemanden, der so erfahren war wie er. Er tastete nach dem Zelt unter dem Sitz, ebenfalls für den Notfall. Es war kompakt genug, um auf die Ladefläche seines Pick-ups zu passen. Das half zwar gegen Raubtiere nicht besonders viel, war aber immer noch besser, als auf dem Boden zu schlafen. Also gut, dachte er. Es konnte losgehen.
Es wurde bereits warm, und im Wagen war es schon heiß. Er würde die natürliche Klimaanlage nutzen: maximalen Durchzug bei heruntergekurbelten Fenstern. Viel brachte das nicht, doch Tru war an die Hitze gewöhnt. Er krempelte sich die Ärmel seines hellbraunen Hemdes hoch. Dazu trug er seine übliche Trekkinghose, die im Laufe der Jahre weich und bequem geworden war. Die Gäste am Pool der Lodge hatten wahrscheinlich Badesachen und Flipflops an, aber in dieser Aufmachung hatte er sich noch nie wohlgefühlt. Außerdem hatten ihm die Stiefel und die lange Hose einmal, als er einer wütenden Schwarzen Mamba begegnet war, das Leben gerettet. Ohne die richtige Kleidung hätte das Gift ihn in weniger als dreißig Minuten umgebracht.
Er sah auf die Uhr. Kurz nach sieben, und er hatte zwei lange Tage vor sich. Er ließ den Motor an, setzte zurück und fuhr los. Am Tor sprang er aus dem Wagen, zog es auf, ließ den Pick-up durchrollen und schloss es wieder. Das Letzte, was seine Kollegen brauchten, war, bei ihrer Rückkehr ein Löwenrudel vorzufinden, das es sich im Camp gemütlich gemacht hatte. So etwas war schon vorgekommen, wenn auch nicht in diesem, sondern in einem anderen Camp, in dem er gearbeitet hatte, im Südosten. Das war ein chaotischer Tag gewesen. Niemand hatte so recht gewusst, was tun, außer abzuwarten, bis die Löwen sich entschieden hatten, was sie ihrerseits zu tun gedachten. Zum Glück waren die Tiere später am Nachmittag auf die Jagd gegangen, aber seitdem überprüfte Tru immer das Tor, auch wenn er nicht selbst fuhr. Einige der Guides waren noch neu, und er wollte kein Risiko eingehen.
Schließlich legte er den Gang wieder ein und lehnte sich zurück, um die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten. Die ersten einhundertfünfzig Kilometer führten über unbefestigte Straßen voller Schlaglöcher, erst im Naturschutzgebiet, dann an einer Reihe kleiner Dörfer vorbei. Dieser Teil dauerte bis zum frühen Nachmittag, und da er die Strecke gut kannte, ließ er seinen Gedanken freien Lauf, während er die Welt betrachtete, die er seine Heimat nannte.
Die Sonne glitzerte durch Federwölkchen über den Baumwipfeln auf eine Gabelracke, die sich gerade links von Tru aus den Ästen erhob. Vor ihm kreuzten zwei Warzenschweine die Straße und trotteten an einer Pavianfamilie vorbei. Er hatte diese Tiere schon Tausende Male gesehen, und wieder staunte er, wie sie, umringt von so vielen Raubtieren, überleben konnten. Tiere, die sich weit unten in der Nahrungskette befanden, bekamen mehr Nachwuchs. Weibliche Zebras zum Beispiel waren bis auf neun oder zehn Tage pro Jahr trächtig. Löwinnen dagegen, so die Schätzung, mussten sich für jedes Junge, das sein erstes Lebensjahr vollendete, über eintausendmal paaren. Es war evolutionäres Gleichgewicht in Reinkultur, und obwohl Tru das jeden Tag erlebte, empfand er es immer noch als außergewöhnlich.
Gäste fragten ihn oft nach seinen aufregendsten Erlebnissen bei Safaris. Dann erzählte er, wie es war, von einem Spitzmaulnashorn attackiert zu werden, oder dass er einmal Zeuge gewesen war, wie eine Giraffe sich wild aufgebäumt hatte, bis sie schließlich explosionsartig und mit überraschender Geschwindigkeit ihr Junges zur Welt brachte. Er hatte einen jungen Leoparden ein Warzenschwein, das beinahe doppelt so groß wie er selbst war, hoch auf einen Baum schleppen sehen, nur Zentimeter vor einem Rudel knurrender Hyänen, die seine Beute gerochen hatten. Einmal war er einem von seinem Rudel ausgestoßenen Wildhund gefolgt, der sich einer Schakalgruppe angeschlossen hatte – derselben Schakalgruppe, die er früher gejagt hatte. Die Geschichten nahmen kein Ende.
War es möglich, überlegte er, eine Tour zweimal auf die gleiche Art zu erleben? Die Antwort lautete Ja und Nein. Man konnte in derselben Lodge wohnen, mit denselben Guides arbeiten, zur selben Zeit aufbrechen und dieselben Straßen bei genau demselben Wetter in derselben Jahreszeit abfahren, und trotzdem waren die Tiere immer an anderen Stellen und verhielten sich anders. Sie wanderten zu Wasserlöchern oder davon fort, horchten und beobachteten, fraßen und schliefen und paarten sich, waren alle schlicht und einfach damit beschäftigt, einen weiteren Tag zu überleben.
Etwas seitlich entdeckte er eine Impalaherde. Die Guides scherzten gern, dass Impalas das McDonald’s des Buschs seien, Fast Food im Überfluss. Sie standen auf dem Speisezettel jedes Raubtiers, und die Gäste wurden es normalerweise schon nach einer einzigen Fahrt überdrüssig, sie zu fotografieren. Tru allerdings ging vom Gas und beobachtete, wie eins nach dem anderen unfassbar hoch und anmutig über einen Baumstamm sprang. Es sah aus wie choreografiert. Auf ihre eigene Art, dachte er, waren sie so besonders wie die großen Fünf – Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und Wasserbüffel – oder die großen Sieben, zu denen zusätzlich Geparden und Hyänen zählten. Das waren die Tiere, die Besucher am liebsten sehen wollten, die Arten, die am meisten Aufregung hervorriefen. Dabei war Löwen zu finden nicht sonderlich schwierig, zumindest wenn die Sonne schien. Diese Tiere schliefen achtzehn bis zwanzig Stunden am Tag, und normalerweise lagen sie im Schatten. Einen sich bewegenden Löwen zu entdecken hingegen kam selten vor, außer nachts. Tru hatte auch schon in Lodges gearbeitet, die Abendtouren anboten. Einige waren haarsträubend verlaufen, und oft hatte man kaum etwas erkennen können vor Staub, den Hunderte von Büffeln oder Gnus oder Zebras auf der Flucht vor Löwen aufwirbelten, sodass Tru gezwungen gewesen war, den Jeep anzuhalten. Zweimal hatte sich der Wagen genau zwischen dem Löwenrudel und seiner Beute befunden, was Trus Adrenalinspiegel jäh in die Höhe getrieben hatte.
Die Straße wurde stetig holpriger, und Tru fuhr noch langsamer und in Schlangenlinien. Sein Ziel heute war Bulawayo, die zweitgrößte Stadt des Landes, wo seine Exfrau Kim und sein Sohn Andrew wohnten. Er besaß dort ein Haus, das er nach seiner Scheidung gekauft hatte. Rückblickend war offensichtlich, dass er und Kim nicht gut zueinander gepasst hatten. Sie hatten sich damals in einer Bar in Harare kennengelernt, wohin Tru zwischen zwei Jobs gekommen war. Später erzählte Kim ihm, dass er auf sie exotisch gewirkt hatte, was in Kombination mit seinem Nachnamen ausreichte, um ihr Interesse zu wecken. Sie war acht Jahre jünger und schön, mit einem lässigen und gleichzeitig selbstbewussten Charme. Eins führte zum anderen, und letzten Endes verbrachten sie die nächsten sechs Wochen zusammen. Dann zog es Tru schon wieder in den Busch, und er wollte die Beziehung beenden, doch Kim teilte ihm mit, sie sei schwanger. Also heirateten sie, Tru nahm die Stelle in Hwange an, weil es relativ nah an Bulawayo lag, und bald darauf kam Andrew.
Obwohl sie gewusst hatte, womit Tru sein Geld verdiente, war Kim davon ausgegangen, dass er sich, wenn das Kind da war, einen Job suchen würde, für den er nicht wochenlang fort sein musste. Doch er arbeitete weiter als Guide, Kim lernte einen anderen Mann kennen, und keine fünf Jahre später war ihre Ehe vorbei. Keiner war dem anderen böse, im Gegenteil, ihr Verhältnis hatte sich seit der Scheidung im Grunde verbessert. Wenn Tru Andrew abholte, unterhielten er und Kim sich ein Weilchen, erzählten sich ihre Neuigkeiten wie alte Freunde, die sie ja auch waren. Sie war wieder verheiratet und hatte mit ihrem zweiten Mann Ken eine Tochter, und bei seinem letzten Besuch hatte sie Tru erzählt, dass sie erneut schwanger war. Ken arbeitete bei Air Zimbabwe in der Buchhaltung. Er trug einen Anzug zur Arbeit und war jeden Abend zum Essen zu Hause. Das hatte Kim sich gewünscht, und Tru freute sich für sie.
Was Andrew anging …
Sein Sohn war inzwischen zehn und das großartigste Ergebnis ihrer Ehe. Wie es das Schicksal wollte, hatte Tru sich ein paar Monate nach Andrews Geburt mit den Masern angesteckt, wodurch er unfruchtbar geworden war, aber er hatte nie das Bedürfnis nach einem weiteren Kind gespürt. Für ihn war Andrew mehr als genug, und er war auch der Grund, warum Tru jetzt einen Umweg über Bulawayo machte, statt direkt zur Farm zu fahren. Mit seinen blonden Haaren und braunen Augen ähnelte Andrew seiner Mutter, und in Trus Hütte hingen Dutzende von Zeichnungen von ihm. Im Laufe der Jahre waren auch Fotos hinzugekommen, denn bei jedem Besuch bekam er welche von Kim – unterschiedliche Versionen seines Sohns verschmolzen miteinander, entwickelten sich zu jemand gänzlich Neuem. Mindestens einmal pro Woche skizzierte Tru etwas, das er im Busch gesehen hatte, meistens ein Tier, aber zusätzlich zeichnete er sich und Andrew, als Erinnerung an seinen jeweils letzten Besuch.
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen war schwierig gewesen, besonders nach der Scheidung. Immer sechs Wochen am Stück arbeitete Tru im Camp. Kim hatte das Sorgerecht und er keinerlei Anteil am Leben seines Sohnes, keine Anrufe, keine Besuche, keine spontanen Fußballspiele oder Ausflüge zur Eisdiele. Im Anschluss übernahm Tru zwei Wochen lang die Betreuung und spielte die Rolle des Vollzeitvaters. Dann wohnte Andrew mit ihm in dem Haus, Tru brachte ihn zur Schule, schmierte Butterbrote, kochte und half bei den Hausaufgaben. An den Wochenenden machten sie, was Andrew sich wünschte, und in jedem einzelnen Augenblick staunte Tru, wie es möglich war, seinen Sohn so sehr zu lieben, selbst wenn er nicht immer da war und es zeigen konnte.
Rechts von ihm kreisten zwei Truthahngeier. Vielleicht hatten die Hyänen gestern Abend etwas übrig gelassen, oder ein Tier war frühmorgens verendet. In letzter Zeit hatten viele Tiere zu kämpfen gehabt. Es herrschte wieder einmal Dürre, und die Wasserlöcher in dieser Region des Schutzgebiets waren ausgetrocknet.
Das war nicht überraschend. Nicht weit von hier Richtung Westen, in Botswana, lag die riesige Kalahari-Wüste, Heimat der legendären San. Deren Sprache galt als eine der ältesten noch existierenden, mit vielen Klick- und Schnalzlauten, und klang für Außenstehende beinahe außerirdisch. Obwohl sie fast keine materiellen Güter besaßen, scherzten und lachten sie mehr als jede andere Volksgruppe, der Tru je begegnet war. Wobei er sich fragte, wie lange sie ihre Lebensweise noch aufrechterhalten konnten. Die Moderne drang immer weiter vor, und es gab Gerüchte, die botswanische Regierung wolle eine allgemeine Schulpflicht erlassen, auch für die San. Das bedeutete vermutlich über kurz oder lang das Ende einer jahrtausendealten Kultur.
Doch Afrika veränderte sich ohnehin ständig. Tru war noch in Rhodesien geboren, einer britischen Kolonie. Als Halbwüchsiger hatte er miterlebt, wie das Land von Unruhen erschüttert wurde, sich schließlich von Großbritannien abspaltete und letztlich zu Simbabwe und Sambia wurde. Wie in Südafrika – wegen der Apartheid immer noch ein Paria unter den Ländern der Welt – konzentrierte sich ein Großteil des simbabwischen Wohlstands in den Händen einiger weniger, und zwar fast ausschließlich Weißer. Tru bezweifelte, dass das ewig so bleiben würde, aber Politik und soziale Ungerechtigkeit diskutierte er mit seiner Familie nicht mehr. Sie gehörten immerhin zu ebenjener privilegierten Gruppe, und wie alle privilegierten Gruppen glaubten sie, ihr Reichtum und ihre Macht stünden ihnen zu, egal wie brutal sie einst erworben wurden.
Als Tru die Grenze des Naturschutzgebiets erreichte, passierte er das erste kleine Dorf, Heimat für etwa einhundert Bewohner. Wie das Camp der Guides war es sowohl zum Schutz der Menschen als auch der Tiere umzäunt. Tru trank einen Schluck aus seiner Thermoskanne und stützte den Ellbogen auf den Fensterrahmen. Er überholte eine Frau auf einem mit Gemüsekisten beladenen Fahrrad und einen Mann, der zu Fuß unterwegs war, vermutlich zum nächsten Dorf in knapp zehn Kilometern Entfernung. Tru hielt an, der Mann schlenderte zum Wagen und stieg ein. Für eine Unterhaltung reichten Trus Sprachkenntnisse aus, alles in allem beherrschte er sechs Sprachen einigermaßen fließend, zwei davon indigene. Die anderen waren Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. Das war einer der Gründe, warum er als Angestellter in den Lodges begehrt war.
Nach einer Weile setzte er den Mann wieder ab und fuhr weiter, bis er schließlich eine asphaltierte Straße erreichte. Am Mittag machte er Rast auf der Ladefläche seines Pick-ups, im Schatten einer Akazie. Die Sonne stand mittlerweile hoch am Himmel, und um ihn herum war es still, kein Tier in Sicht.
Von dort aus kam er schneller voran. Die Dörfer wichen kleinen Städten, dann größeren, und am späten Nachmittag erreichte er die Außenbezirke Bulawayos. Er hatte Kim seine Ankunftszeit brieflich mitgeteilt, allerdings konnte man sich auf die simbabwische Post nicht unbedingt verlassen. Normalerweise kamen die Briefe zwar an, aber nicht immer rechtzeitig.
Als er in die Straße einbog, sah er Kims Wagen und parkte dahinter. Er ging zur Tür, klopfte, und Sekunden später wurde geöffnet. Kim hatte eindeutig auf ihn gewartet. Während sie einander umarmten, hörte Tru bereits die Stimme seines Sohnes. Andrew stürzte die Treppe herunter und sprang ihm auf den Arm. Tru wusste, dass Andrew sich schon bald für viel zu alt für solche Liebesbekundungen halten würde, deshalb drückte er ihn noch fester. Konnte irgendeine Freude jemals diese übertreffen?
❋
»Mummy hat erzählt, dass du nach Amerika fliegst«, sagte Andrew am Abend zu ihm. Sie saßen vor dem Haus auf einer niedrigen Mauer, die als Zaun zwischen Kims Haus und dem des Nachbarn diente.
»Stimmt. Aber ich bleibe nicht lange. Nächste Woche komme ich zurück.«
»Ich wünschte, du müsstest nicht weg.«
Tru schlang den Arm um seinen Sohn. »Ich weiß. Ich werde dich auch vermissen.«
»Und warum fährst du dann?«
Das genau war die Frage. Warum war nach all den Jahren dieser Brief eingetroffen? Mit einem Flugticket?
»Ich treffe meinen Vater«, antwortete Tru schließlich.
Andrew blinzelte, seine blonden Haare leuchteten im Mondlicht. »Du meinst Papa Rodney?«
»Nein. Meinen leiblichen Vater. Ich bin ihm noch nie begegnet.«
»Möchtest du ihn denn kennenlernen?«
Ja, dachte Tru, dann, nach weiterem Nachdenken, nein, eigentlich nicht. »Weiß ich nicht«, gab er zu, denn er war sich nicht sicher.
»Und warum fährst du dann?«
»Weil in seinem Brief steht, dass er bald stirbt«, sagte Tru.
❋
Nachdem er sich von Andrew verabschiedet hatte, fuhr Tru zu seinem Haus. Zuerst öffnete er die Fenster zum Lüften, dann packte er seine Gitarre aus und spielte und sang eine Stunde, bevor er schließlich ins Bett ging.
Am nächsten Morgen brach er früh auf. Im Gegensatz zu den Straßen des Naturschutzgebiets waren die in die Hauptstadt in relativ gutem Zustand, dennoch brauchte er fast den ganzen Tag. Erst nach Einbruch der Dunkelheit traf er bei der Farm ein, und es brannte schon Licht in dem herrschaftlichen Gebäude, das sein Stiefvater Rodney nach dem Brand wieder aufgebaut hatte. Nicht weit entfernt standen drei weitere Häuser, jeweils eins für seine beiden Halbbrüder, sowie das Haupthaus, in dem der Colonel früher gewohnt hatte. Dieses gehörte ihm theoretisch, dennoch lief Tru zu einem kleineren Gebäude in der Nähe des Zauns. Vor langer Zeit hatte darin der Koch mit seiner Frau gewohnt, später dann, als Jugendlicher, hatte Tru es für sich eingerichtet. Als der Colonel noch lebte, hatte er dafür gesorgt, dass es mehr oder weniger regelmäßig geputzt wurde, aber das war vorbei. Überall lag Staub, und Tru musste die Käfer und Spinnen aus seinem Bettzeug schütteln, ehe er sich hinlegte. Es machte ihm nicht viel aus, er hatte schon unzählige Male unter schlechteren Bedingungen geschlafen.
Am Morgen ging er seiner Familie aus dem Weg und ließ sich von Tengwe, dem Vorarbeiter, zum Flughafen bringen. Tengwe war grauhaarig und drahtig und konnte dem Boden noch unter den härtesten Bedingungen Leben entlocken. Seine sechs Kinder arbeiteten auf der Farm, und seine Frau Anoona kochte für Rodney. Nach dem Tod seiner Mutter war Trus Verhältnis zu den beiden enger gewesen als das zum Colonel, und sie waren die Einzigen auf der Farm, die er vermisste.
Die Straßen in Harare waren mit Autos und Lastwagen, Karren und Fahrrädern und Fußgängern verstopft, und am Flughafen ging es noch chaotischer zu. Tru bestieg zunächst eine Maschine nach Amsterdam, dann flog er über New York und Charlotte weiter nach Wilmington, North Carolina.
Mit Aufenthalten war er annähernd einundzwanzig Stunden unterwegs, bevor er zum ersten Mal Fuß auf amerikanischen Boden setzte. Als er in Wilmington an der Gepäckausgabe ankam, entdeckte er einen Mann, der ein Schild mit seinem Namen hielt, darunter stand der Name eines Limousinenservices. Der Fahrer war verblüfft über das wenige Gepäck und erbot sich, den Gitarrenkasten und den Rucksack zu tragen. Tru schüttelte den Kopf. Draußen war es sehr schwül, und Tru spürte, wie sein Hemd an seinem Rücken zu kleben begann, als sie zum Wagen liefen.
Die Fahrt verlief ereignislos, aber die Welt hinter den Scheiben schien ihm fremd. Die Landschaft dehnte sich flach, üppig und grün in alle Richtungen aus. Er sah Palmen zwischen Eichen und Kiefern, und das Gras hatte die Farbe von Smaragden. Wilmington war eine kleine Stadt mit einer Mischung aus Filialen großer Ladenketten und einheimischen Geschäften am Rand und einem historischen Viertel mit Häusern, die mindestens zweihundert Jahre alt aussahen. Der Fahrer zeigte Tru den Cape Fear River, auf dessen brackigem Wasser diverse Fischerboote dümpelten. Um sich herum bemerkte er Limousinen und SUVs und Minivans, und niemand fuhr bedächtig, um notfalls Karren und Tieren ausweichen zu können. Niemand fuhr Fahrrad oder ging zu Fuß, und fast alle Menschen waren weiß. Die Welt, die er hinter sich gelassen hatte, schien ihm so fern wie ein Traum.
Eine Stunde später überquerten sie eine Pontonbrücke und hielten vor einem dreistöckigen Haus, das sich in einem Ort namens Sunset Beach, auf einer Insel unweit der Küste und nahe der Grenze zu South Carolina, an eine flache Düne schmiegte. Tru brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass das gesamte Erdgeschoss aus Garagen bestand. Das Gebäude wirkte beinahe grotesk im Vergleich zu dem viel kleineren nebenan, vor dem ein Schild Zu verkaufen stand. Er überlegte, ob der Fahrer sich geirrt haben konnte, aber der überprüfte die Adresse noch einmal und versicherte ihm, sie stimme. Als der Wagen wegfuhr, hörte Tru das tiefe, rhythmische Geräusch von auf die Küste treffenden Meereswellen. Er versuchte sich zu erinnern, wann er es zuletzt gehört hatte. Mindestens zehn Jahre war das her, schätzte er, während er die Treppe in den ersten Stock hinaufstieg.
Der Fahrer hatte ihm einen Umschlag mit dem Hausschlüssel ausgehändigt, und jetzt trat er durch den Flur in einen riesigen Raum mit Dielenboden und Holzbalken unter der Decke. Die Einrichtung sah aus wie aus einer Zeitschrift, jedes Kissen und jede Decke war mit geschmackvoller Präzision angeordnet. Große Fenster boten einen Blick auf die Terrasse und dahinter Seegras und Dünen bis zum Meer. An dieses Zimmer schloss sich ein geräumiger Essbereich an, und die Designerküche war mit Einbaumöbeln, Marmorflächen und hochwertigen Geräten ausgestattet.
Ein Zettel auf der Arbeitsfläche informierte ihn darüber, dass Kühlschrank und Speisekammer gefüllt seien und er bei Bedarf den Fahrservice anrufen könne. Falls er an Freizeitaktivitäten interessiert sei, finde er ein Surfboard und Angelausrüstung in der Garage. Laut dieser Nachricht hoffte Trus Vater, am Samstagnachmittag einzutreffen. Er entschuldigte sich dafür, es nicht früher zu schaffen, gab aber keine Erklärung für die Verzögerung ab. Als Tru den Zettel beiseitelegte, kam ihm der Gedanke, dass sein Vater möglicherweise genauso unschlüssig hinsichtlich dieser Begegnung war wie er selbst … was die Frage aufwarf, warum er überhaupt das Flugticket geschickt hatte. Na ja, er würde es bald erfahren.
Es war Dienstag, was bedeutete, Tru hatte ein paar Tage für sich, womit er nicht gerechnet hatte. Zunächst machte er sich mit dem Haus vertraut. Das Schlafzimmer lag hinter der Küche den Flur hinunter, und dort stellte er seine Habseligkeiten ab. Im oberen Stock gab es noch weitere Schlaf- und Badezimmer, die alle makellos und unbenutzt wirkten. Im unteren Schlafzimmer fand er frische Handtücher neben Seife, Shampoo und Spülung, also gönnte er sich eine schöne lange Dusche.
Seine Haare waren noch feucht, als er auf die Terrasse trat. Es war nach wie vor warm, doch die Sonne sank bereits, und der Himmel hatte unzählige Schattierungen von Gelb und Orange angenommen. Als Tru die Augen zusammenkniff, konnte er in der Ferne eine Gruppe von Tümmlern ausmachen, die in den Wellen spielten. Durch ein Tor mit einem Riegel gelangte er auf Stufen, die zu einem Fußweg aus Holzplanken über den Sand führten. Er wanderte bis zur letzten Düne und entdeckte dort eine Treppe zum Strand hinunter.
Es waren nur wenige Leute da. Weit entfernt sah er eine Frau, die offenbar hinter einem kleinen Hund herschlenderte, und auf der anderen Seite trieben ein paar Surfer auf ihren Brettern neben einem Pier, der wie ein ausgestreckter Zeigefinger ins Meer ragte. In diese Richtung wandte Tru sich und lief auf dem festen Sand am Wasserrand entlang. Bis vor Kurzem hatte er noch nie von Sunset Beach gehört, er war nicht einmal sicher, ob er sich überhaupt schon je mit North Carolina befasst hatte. Kurz überlegte er, ob im Laufe der Jahre irgendwelche Safari-Gäste aus diesem Staat gestammt hatten, konnte sich aber nicht erinnern. Eigentlich spielte es auch keine Rolle.
Am Pier stieg er die Treppe hinauf und spazierte bis zum Ende. Die Arme auf das Geländer gestützt, blickte er aufs Wasser, das sich bis zum Horizont erstreckte. Der Anblick, die ungeheure Weite überstiegen beinahe sein Fassungsvermögen. Das machte ihm deutlich, dass es jenseits von Simbabwe noch eine weite Welt zu erkunden gab, und er fragte sich, ob er jemals dazu käme. Vielleicht konnte er mit Andrew, wenn der älter war, ein paar Reisen unternehmen.
Nach einer Weile ging der Mond am dunkelblauen Himmel auf, was Tru zum Anlass nahm zurückzugehen. Er vermutete, dass das Haus seinem Vater gehörte. Natürlich konnte es auch gemietet sein, aber dafür war die Einrichtung eigentlich zu edel, außerdem hätte er Tru dann auch einfach in einem Hotel unterbringen können. Wieder dachte er über die Verzögerung bis Samstag nach. Warum hatte sein Vater ihn so viel früher anreisen lassen? Wenn der Mann tatsächlich im Sterben lag, konnte es natürlich medizinische Gründe haben, und in dem Fall gab es auch für Samstag keine Garantie.
Aber was passierte, wenn sein Vater doch erschien? Er war ein Fremder, und daran würde ein einzelnes Treffen nichts ändern. Dennoch hoffte Tru, Antworten auf ein paar Fragen zu erhalten, was der einzige Grund für ihn gewesen war, überhaupt herzukommen.
Im Haus holte er ein Steak aus dem Kühlschrank. Er musste einige Schränke öffnen, bis er eine gusseiserne Pfanne gefunden hatte, aber der Herd, so schick er auch war, funktionierte ähnlich wie der zu Hause. Es gab außerdem einige Lebensmittel aus einem Laden namens Murray’s Deli, und Tru tat etwas, das wie Krautsalat aussah, sowie einen Klecks Kartoffelsalat auf einen Teller. Nach dem Essen wusch er das Geschirr von Hand ab und ging mit seiner Gitarre auf die Terrasse. Eine Stunde lang spielte und sang er leise vor sich hin, während hin und wieder eine Sternschnuppe über ihm hinwegschoss. Er dachte an Andrew und Kim, an seine Mutter und seinen Großvater, bis er endlich müde genug war, um ins Bett zu gehen.
Am nächsten Morgen machte er einhundert Liegestütze und einhundert Sit-ups und versuchte dann, sich Kaffee zu kochen, leider vergeblich. Er schaffte es einfach nicht, die Maschine in Gang zu setzen. Zu viele Knöpfe, zu viele Optionen, und er hatte keine Ahnung, wo man das Wasser eingießen musste. Schließlich entschied er sich, zum Strand zu gehen, in der Hoffnung, dort irgendwo eine Tasse Kaffee zu bekommen.
Wie am Abend vorher hatte er den Strand fast für sich allein. Wie angenehm, einfach spontan einen Spaziergang machen zu können, dachte er. In Hwange ging das nicht, jedenfalls nicht ohne Gewehr. Als er den Sand erreichte, atmete er tief ein, schmeckte Salz in der Luft, fühlte sich so fremd, wie er war. Er steckte die Hände in die Taschen und lief los. Nach etwa fünfzehn Minuten sah er auf der Düne eine Katze hocken, neben einer Terrasse, die gerade repariert wurde und deren Stufen zum Strand hinunter noch nicht fertiggestellt waren. Auf der Farm hatte es drei in der Scheune lebende Katzen gegeben, aber diese hier wirkte, als verbrächte sie die meiste Zeit im Haus. Genau in dem Moment raste ein kleiner weißer Hund an ihm vorbei auf einen Möwenschwarm zu, der daraufhin explosionsartig in die Luft stieg. Irgendwann bog der Hund Richtung Düne ab, entdeckte die Katze und schoss erneut los wie eine Rakete. Die Katze sprang auf die Terrasse, dicht gefolgt von dem Hund, und beide verschwanden außer Sicht. Eine Minute später glaubte Tru, in einiger Entfernung das Quietschen von Autoreifen und im Anschluss das Aufjaulen und Winseln eines Hundes zu hören.
Er warf einen Blick über die Schulter. Weiter unten am Strand stand eine Frau, sicherlich die Besitzerin des Hundes, und blickte unverwandt aufs Meer. Tru vermutete, dass es dieselbe war, die er am Abend vorher bemerkt hatte, aber sie war zu weit entfernt, um gesehen oder gehört zu haben, was passiert war.
Nach kurzem Zögern lief Tru dem Hund nach und erklomm im rutschigen Sand die Düne. Oben folgte er dem Fußweg bis zu ein paar Stufen, die zu der Terrasse eines Hauses führten. Er lief seitlich an dem Haus vorbei, dann kletterte er über eine niedrige Stützmauer und gelangte zur Straße. Kein Auto weit und breit. Keine hysterischen Menschen, auch kein auf dem Asphalt liegender Hund. Das war schon mal gut. Aus Erfahrung wusste er, dass verletzte Tiere sich oft einen Unterschlupf suchten, um dort versteckt vor Fressfeinden gesund werden zu können.
Also lief er den Straßenrand auf einer Seite ab und hielt unter Büschen und Bäumen Ausschau. Nichts zu sehen. Dann überquerte er die Straße, suchte auf der anderen Seite und entdeckte schließlich den Hund. Er stand an einer Hecke, ein Hinterlauf zuckte auf und ab. Das Tierchen keuchte und zitterte, ob vor Schmerz oder Schreck, konnte Tru nicht beurteilen. Er überlegte, ob er zurück zum Strand gehen und die Frau holen sollte, hatte aber Angst, der Hund würde in der Zwischenzeit davonlaufen. Deshalb setzte er die Sonnenbrille ab, ging in die Hocke und streckte langsam die Hand aus.
»Hallo, du«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Alles gut?«
Der Hund legte den Kopf schief, und Tru schob sich etwas näher und redete dabei leise weiter. Als er nah genug war, reckte der Hund die Schnauze, um Trus Hand zu beschnüffeln, und wagte sich ein paar zaghafte Schritte vor. Schließlich schien er hinlänglich überzeugt von Trus guten Absichten und entspannte sich. Tru streichelte ihm den Kopf und suchte ihn nach Blut ab. Nichts. Am Halsband hing eine Marke, auf der Scottie stand.
»Hallo, Scottie«, sagte er. »Komm, wir bringen dich zum Strand zurück, okay? Na los.«
Er musste ihn noch ein Weilchen locken, dann aber folgte Scottie Tru Richtung Düne. Er humpelte nur schwach, deshalb glaubte Tru nicht, dass er sich etwas gebrochen hatte. Als Scottie vor der Stützmauer anhielt, bückte Tru sich, nahm ihn behutsam auf den Arm und trug ihn an dem Haus entlang, die Stufen hinunter bis auf den Fußweg und schließlich über die Düne. Am Strand entdeckte er die Frau, sie war jetzt viel näher gekommen und schien durch den sonnengelben Stoff ihres im Wind flatternden ärmellosen Oberteils geradezu zu leuchten.
Während der Abstand zwischen ihnen schrumpfte, musterte Tru sie. Trotz ihres verwirrten Gesichtsausdrucks war sie wunderschön, mit ungezähmtem rotbraunem Haar und Augen in der Farbe von Türkisen. Und fast unmittelbar regte sich etwas in seinem Inneren, etwas, das ihn leicht nervös machte, wie es immer in Gegenwart einer attraktiven Frau geschah.
Hope
Hope stieg von der Terrasse auf den Fußweg, der über die Düne führte, und bemühte sich, ihren Kaffee dabei nicht zu verschütten. Scottie, ihr passend getaufter Scottish Terrier, zerrte an der Leine, weil er unbedingt an den Strand wollte.
»Zieh nicht so«, sagte sie.
Der Hund ignorierte sie. Scottie war ein Geschenk von ihrem Freund Josh gewesen, und er gehorchte schon an guten Tagen kaum. Seit ihrer Ankunft im Cottage am Vortag gebärdete er sich geradezu wie wild. Hope nahm sich vor, mit ihm noch einmal ein paar Stunden bei einem Hundetrainer zu buchen, obwohl sie bezweifelte, dass es etwas nutzen würde. Er war schon bei den ersten beiden Kursen mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Scottie war der niedlichste und süßeste Hund der Welt, aber leider nicht sonderlich helle, der Gute. Oder aber er war einfach störrisch.
Da Labor Day vorbei war, war es am Strand recht leer, und die meisten der eleganten Häuser lagen dunkel da. In der Ferne sah Hope jemanden joggen, auf der anderen Seite ein Paar am Wasser entlangschlendern. Sie bückte sich, stellte ihren Styroporbecher im Sand ab und hakte Scotties Leine los. Wen sollte es schon stören, wenn er frei herumlief?
Hope marschierte los und trank einen Schluck Kaffee. Sie hatte nicht gut geschlafen. Normalerweise schläferte sie das immer gleichbleibende Geräusch der Wellen sofort ein, aber nicht letzte Nacht. Sie hatte sich von einer Seite auf die andere gewälzt, war immer wieder aufgewacht und hatte es schließlich aufgegeben, als die Sonne ins Zimmer zu scheinen begann.
Wenigstens war das Wetter perfekt – blauer Himmel und eine Temperatur, die typisch für den Frühherbst war. In den Nachrichten waren für das Wochenende Gewitter vorhergesagt worden, und ihre Freundin Ellen war halb durchgedreht vor Sorge. Ellen heiratete am Samstag, und sowohl die Hochzeit als auch das Fest sollten im Wilmington Country Club im Freien stattfinden, irgendwo beim achtzehnten Grün. Zwar ging Hope fest davon aus, dass es einen Plan B gab – sicherlich durften sie das Clubhaus nutzen –, dennoch hatte Ellen gestern Abend am Telefon beinahe geweint.
Hope hatte sich Mühe gegeben, teilnahmsvoll zu sein, was ihr allerdings nicht leichtfiel. Ellen war momentan derart mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt, dass sie nicht einmal gefragt hatte, wie es Hope ging. In gewisser Hinsicht war das sogar gut, denn das Letzte, worüber Hope gerade reden wollte, war Josh. Wie sollte sie erklären, dass er bei der Hochzeit durch Abwesenheit glänzen würde? Oder dass es, so enttäuschend eine verregnete Hochzeit auch sein mochte, eindeutig Schlimmeres gab?