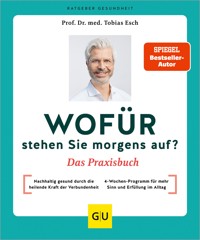Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GU Audiobook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition Medizin
- Sprache: Deutsch
Was fehlt der heutigen Medizin, um nachhaltig Gesundheit und Heilung zu erzeugen? Dieser Frage ist der Neurowissenschaftler, Arzt und Gesundheitsforscher Prof. Dr. Tobias Esch nachgegangen. Sein Fazit? Es fehlt das Bewusstsein einer neuen, vierten Dimension der Gesundheit: Bedeutsamkeit. Zusammen mit seinen Patienten geht er auf die Spur ungeklärter Symptome und findet Ursachen – bis hin zur Wiederherstellung von Sinn im Leben. Denn wenn Bedeutsamkeit im Tun sowie eine Verbundenheit zwischen Sein und Leben bestehen, wenn wir wissen, wofür wir morgens aufstehen (und warum gerade hier), kann Heilung erfolgen. Das Buch ist wegweisend für alle, die gesund bleiben, sich von Krankheiten erholen und ein glückliches Leben führen wollen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
Gräfe und Unzer Edition ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Simone Kohl
Lektorat: Stephanie Ehrenschwendner
Bildredaktion: Stephanie Ehrenschwendner
Covergestaltung: Ki36 Editorial Design, München, Bettina Stickel
eBook-Herstellung: Jie Song
ISBN 978-3-8338-9101-4
1. Auflage 2023
Bildnachweis
Coverabbildung: Kay Blaschke
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-9101 11_2023_02
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
Für Maren
Hat man sein WARUM des Lebens, so verträgt man sich mit fast jedem WIE.
Friedrich Nietzsche
»Meine Karriere als Arzt begann vor vielen Jahren als Pflegehelfer auf einer Krebsstation. Traurig, denken Sie jetzt vielleicht. Es war alles andere als das. Das Leben kann überall schön sein. Zumindest lebenswert. Das habe ich gelernt. So ist es auch mit dem Glück. Menschen können in den unmöglichsten Situationen glücklich sein, aber auch traurig und unglücklich, selbst wenn eigentlich alles zu passen scheint.
Mich hat immer fasziniert, dass Glück und Zufriedenheit, ebenso wie Gesundheit und Krankheit, nicht nur objektive Anteile haben. Sondern dass es einen ganzen Kosmos von subjektiver Erfahrung und Individualität gibt, in dem das Geheimnis der individuellen Widerstandskraft und Resilienz beheimatet scheint. Die Frage der Bedeutung – etwa der eigenen Existenz und des Lebens in und um einen herum. Und schließlich die große Frage nach dem Sinn. Die Antworten darauf finden sich nicht im Außen und auch nicht in irgendwelchen Krankenakten oder Lehrbüchern. Solche Fragen werden von Ärztinnen und Ärzten oft noch nicht einmal gestellt. Aus medizinischer Sicht scheinen sie auch kaum relevant, denn es geht vorrangig darum, einen Standard zu definieren und alles dafür zu tun, dass nach objektiven Kriterien Heilung hergestellt oder Gesundheit erhalten werden kann. Auf meinem Weg als Arzt und Forscher habe ich den Missing Link für ein nachhaltige Medizin gefunden, den ich mit Ihnen teilen möchte.«
Einleitung
Dieses Buch erzählt die Geschichte von Bauer Henningsen, von Francesca, Sarah, Carsten und Jürgen. Aber auch meine eigene. Es ist kein politisches Buch. Es thematisiert weder den Klimawandel noch enthält es einfache Ratschläge zur Optimierung von Seele und Welt.
Auf den folgenden Seiten zeichne ich den Weg von Menschen nach, die krank wurden, weil sie ihren Sinn nicht kannten oder er ihnen auf ihrer Reise durchs Leben abhandenkam. Weil sich selbst verloren hatten, sich nicht mehr zurechtfanden in der Welt, nicht mehr zu Hause waren in ihrem Leben, weder in sich selbst noch in ihrer Umgebung eine Heimat sahen. Menschen können auch kulturell obdachlos sein.
Dieses Buch handelt von nahezu wundersamen Veränderungen und Heilungen, die eintraten, als ebenjene Menschen plötzlich wieder Sinn fanden, wieder verbunden waren mit sich selbst, mit ihrer Welt, den Mitmenschen, auch mit etwas Höherem. Mit dem Boden, auf dem sie standen, mit der Luft, die sie atmeten, mit ihrem Herzen und der Essenz, aus der sie kamen und die in ihnen wohnte. Wenn die Dinge wieder ihren Platz und eine Bedeutung hatten. Wenn sie wieder wussten, wofür sie morgens aufstanden.
Was ist Ihnen wichtig im Leben? Wofür stehen Sie morgens auf? Haben Sie sich das auch schon einmal gefragt? Und kennen Sie bereits die Antwort? Der Verhaltenstherapeut Jens Corssen sagt hierzu mit einem Augenzwinkern: „Wenn Ihnen auf diese Frage nichts einfällt, bleiben Sie einfach liegen.“
Bereits die ersten Patientinnen und Patienten, mit denen ich als Student in Kontakt kam, beeindruckten mich tief. Bei ähnlichen, manchmal gleichen Diagnosen zeigten ihre Gesichter – ihr tägliches Dasein in der Welt, wenn man sie etwa morgens zum Waschen begrüßte –, dass doch jeder Fall anders ist. Dass hinter jeder Krankenakte, jedem Kurvenverlauf ein ganz individuelles Schicksal steckt. Eine ganz eigene Persönlichkeit mit einer ganz eigenen Geschichte.
Mich hat immer fasziniert, dass Glück und Zufriedenheit, ebenso wie Gesundheit und Krankheit, nicht nur objektive Anteile haben. Sondern dass es einen ganzen Kosmos von subjektiver Erfahrung und Individualität gibt, in dem das Geheimnis der individuellen Widerstandskraft und Resilienz beheimatet scheint. Die Frage der Bedeutung – etwa der eigenen Existenz und des Lebens in und um einen herum. Und schließlich die große Frage nach dem Sinn. Die Antworten darauf finden sich nicht im Außen und auch nicht in irgendwelchen Krankenakten oder Lehrbüchern. Solche Fragen werden von Ärztinnen und Ärzten oft noch nicht einmal gestellt. Aus medizinischer Sicht scheinen sie auch kaum relevant. Schließlich geht es ja genau darum, einen Standard zu definieren und alles dafür zu tun, dass nach objektiven Kriterien Heilung hergestellt oder Gesundheit erhalten werden kann.
Doch wer sagt im individuellen Fall, was dies genau bedeutet? Wer interpretiert den eigenen Zustand, die eigene Situation eigentlich als gesund oder heil? Und haben diese Fragen und deren individuelle Beantwortung Auswirkungen auf Gesundheit und Genesung?
All diese Fragen waren ein zentraler Grund für mich, überhaupt Medizin zu studieren. Ich wollte mehr darüber erfahren, wie man als Mediziner solche Fragen stellen und herausfinden könnte, ob sie wesentlich waren. Und natürlich, ob sich daraus mögliche Antworten ableiten ließen, um etwas Bedeutsames zu erfahren.
Ein Teil meiner späteren Profession brachte mich schließlich dazu, das zu werden, was heute verkürzend Glücksforscher genannt wird. Dieser Forschungszweig erlaubte mir unter anderem, bei mehreren tausend Patientinnen und Patienten sowie bei Studienteilnehmenden die folgenden Fragen systematisch und konkret zu stellen: Was ist Ihnen wichtig im Leben? Was ist bedeutsam für Sie? Wofür stehen Sie morgens auf?
Die zentralen Erkenntnisse aus dieser Forschung finden Sie in diesem Buch wiedergegeben. Dabei habe ich mich bemüht, sie aus Sicht der Betroffenen und Befragten zu erzählen. Ebenso habe ich mich selbst zur Diskussion gestellt.
Können Sie sich noch erinnern, wie Sie als Kind in der Sandkiste spielten? Oder haben Sie möglicherweise das Bild vor Augen, wie Ihre eigenen Kinder auf einem Spielplatz ganz versunken und glücklich bei einer Sache sind, selbstvergessen und absolut eins mit sich und der Welt? Wären Sinn und Zweck aus Sicht dieses Kindes, das Sie gerade vor sich sehen, bedeutsam? Wahrscheinlich nicht. Es ist ja alles da.
Wann also waren Sie zuletzt ganz da? Bewusst und ganz überzeugt, völlig anwesend und sinnlich im gegenwärtigen Moment? Und wie lange konnte Sie das aushalten? Wann fühlten Sie sich zuletzt wirklich zu Hause? Vermählt mit dem Hier und Jetzt, verbunden mit der Natur, beheimatet auch im eigenen Körper? Wie fühlt sich das an? Was macht das mit Ihnen?
Auf meinem Weg als Arzt und Forscher fand ich etwas Bedeutsames – einen Missing Link! In diesem Buch möchte ich Sie einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen. Ich möchte meine eigenen Beobachtungen teilen, als Mediziner und als Mensch. Ich möchte vom Sinn in der Medizin sprechen und mit Ihnen den Spuren einer vierten Dimension der Gesundheit folgen. Dazu finden Sie am Ende jedes Kapitels jeweils eine Übung, mit der Sie diese Sinn- und Bedeutungsebene in Ihren Lebensalltag mit integrieren können.
Wir sitzen alle in einem Boot. Deshalb verstehe ich meine Reise auch als Sinnbild unser aller Reisen. Stechen wir in See!
Wenn einem das Leben entgleitet – Bauer Henningsens Geschichte
Wenige Wochen bevor ich Bauer Horst Henningsen zum ersten Mal begegnete, hatte ich in einer großen Hausarztpraxis im Münsterland, fünfzig Kilometer entfernt von der nächsten Großstadt, als Assistenzarzt angefangen. Meine Frau und ich lebten zuvor in den USA, wo ich als Wissenschaftler in einem faszinierenden Umfeld an der Harvard Medical School arbeiten durfte. Die Geschehnisse rund um den 11. September 2001 sowie die fortschreitende Schwangerschaft meiner Frau stellten den Entschluss, in den USA zu bleiben, so sehr infrage, dass wir kurzerhand beschlossen, für die Geburt unseres ersten Kindes und alles Weitere, ohne genau zu wissen, was das sein könnte, nach Deutschland zurückzukehren.
Es musste schnell ein Job für mich als Arzt gefunden werden. Eine neue Existenz, um die kommende junge Familie, wie wir nun aufgeregt feststellten, sicher zu ernähren und natürlich auch, um eine gesicherte ärztliche Weiterentwicklung in Aussicht zu haben. Wir beschlossen, dass ich als Hausarzt arbeiten würde, um die Medizin nach Jahren im Elfenbeinturm der Forschung am Bostoner Mind/Body Medical Institute wieder so richtig von der Pike auf zu erfahren. Dieser Schritt „zurück“ mit aufgekrempelten Hemdsärmeln und letztlich auf dem Boden der Tatsachen schien uns aus pragmatischen Gründen geboten.
Nach einigen Telefonaten aus den USA nahm ich die freundliche Einladung, als neuer ärztlicher Kollege einem etablierten hausärztlichen Praxisteam auf dem Land beizutreten, an. Der Praxisinhaber war zugleich Professor für Allgemeinmedizin, was mir den Entschluss erleichterte, da ich mir erhoffte, die akademische Anbindung nicht völlig zu verlieren. Auch für ihn war es fraglos eine mutige Entscheidung. Bereits nach unserem ersten Telefonat bot er mir die Stelle an, die es so eigentlich gar nicht gab. Er habe „das so auch noch nie gemacht“, resümierte er im Gespräch, nur aufgrund eines telefonischen Eindrucks und ohne weitere Referenzen. Wir schlugen gewissermaßen mündlich am Telefon ein, wurden Freunde und sind es bis heute, auch wenn meine Frau und ich damals das Für und Wider des Angebots erst noch erörterten und als Team die Entscheidung trafen. Der Professor sagte, ich solle am Montag, dem 3. Juni 2002, um 9 Uhr in seiner Praxis erscheinen. Meine Frau, so beschlossen wir, würde in Münster den neuen Wohnort für uns erkunden und etablieren, bald schon mit Kind. Ich dagegen würde täglich morgens eine Stunde mit dem Auto aufs Land fahren und abends zurück, wenn keine Nachtdienste anfielen, um meinen neuen Beruf als „Hausarzt in Ausbildung“ auszuüben.
Nie zuvor hatten wir im Münsterland gelebt, wir hatten dort keine Bekannten, keine Familie, wir kannten weder Land noch Leute, allenfalls aus Erzählungen oder aus dem Fernsehen. Nie zuvor hatte ich in einer Landpraxis als Arzt gearbeitet, kannte aber zum Glück prinzipiell das Umfeld, denn ich hatte mein Medizinstudium als Hilfskraft in einer Hausarztpraxis in Göttingen zum Teil mitfinanziert.
Natürlich wollten die alteingesessenen Patientinnen und Patienten, deren Familien zum Teil über Generationen mit dem Praxisinhaber und seinem Team verbunden waren, das neue ärztliche Mitglied der Hausarztpraxis, das „Küken“ mit noch nicht abgeschlossener allgemeinmedizinischer Facharztweiterbildung, erst mal kennenlernen. Auch wenn klar war, dass die meisten selbstverständlich weiterhin Termine mit dem lang bekannten Ärzteteam machen würden.
Bereitwillig nahm ich also zu Beginn die Rolle an, hauptsächlich diejenigen Patienten zu sehen, die neu waren oder ohne Termin – aufgrund eines Notfalls oder eines akuten Leidens, das keinen Aufschub erlaubte – in die Praxis kamen. So waren anfangs alle Patienten und Patientinnen neu für mich: jedes Mal eine neue Geschichte, ein neues Gesicht, ein neues Kennenlernen, ein neuer Beziehungsaufbau. Und all das unter einem enormen Zeitdruck. Denn die riesige Praxis war in der Gegend beliebt. Viele kamen mit akuten Leiden oder akuten Verschlechterungen von vorbestehenden Erkrankungen und konnten deshalb nicht lange auf einen Termin warten. An manchen Tagen, die oft bis spät abends gingen, sah ich bis zu 200 Patientinnen und Patienten. An einem solchen Tag im Sommer begegnete ich zum ersten Mal Bauer Henningsen.
Schon die Art und Weise, wie er frühmorgens die Praxis betrat, ließ mich im wahrsten Wortsinn aufhorchen: Mit lautem Poltern und unter deutlich hörbarem Stöhnen und Ächzen, einer Mischung aus Luftnot und schmerzbedingter Qual, ging er zum Empfangstresen im Vorraum. In verschlammten Gummistiefeln und einem blaugrauen Overall, ebenfalls verdreckt, den gewölbten Bauch kaum kaschierend, den typischen bäuerlichen Schlapphut auf dem Kopf stand er da, nur etwa einen Meter siebzig groß. Mit einer Hand hielt er sich den Allerwertesten und sprach mit sonorer Stimme.
Dieser Mann hatte eine enorme Präsenz, das konnte ich sofort spüren, als ich, zwischen zwei Besprechungsräumen hin- und hersprintend, kurz die Diskussion zwischen Bauer Henningsen und unserer „Chefin an der Front“ vorne im Foyer verfolgte.
„Ich muss zum Doktor, hab Schmerzen. Spritze!“
„Der Professor ist heute gar nicht im Haus“, antwortete die Kollegin am Tresen, „die anderen Kollegen sind auch alle ausgebucht. Ich muss Sie zu unserem neuen Kollegen, Dr. Esch, schicken.“
„Na, dann hoffen wir mal, dass sie dem was beigebracht haben und der weiß, wie man ’ne ordentliche Spritze setzt!“
„Der kommt von weit her zu uns – er war auch in der Forschung, wie der Professor!“, erklärte sie geduldig.
„Dann bin ich halt das Versuchskaninchen. Hauptsache, es hilft! Schlimmer kann es eh nicht werden, halt’ ich eben meinen Hintern dafür hin.“
Henningsen wurde mein Patient – und blieb es.
An jenem Morgen holte ich ihn kurze Zeit nach seinem Eintreffen in der Praxis persönlich aus dem Wartezimmer ab und geleitete ihn in einen kombinierten Besprechungs- und Untersuchungsraum. Er folgte mir laut jammernd und schimpfend, wobei er deutlich zum Ausdruck brachte, dass er nur widerwillig mit mir mitkäme. Dabei wirkte er aber doch irgendwie freundlich und nicht abweisend. Bei der Begrüßung streckte er mir seine fleischigen, etwas rötlich glänzenden Hände entgegen, an denen man deutlich die Spuren von täglichem Gebrauch – Risse, Krusten, Verhornungen und abgebrochene Nägel –, erkennen konnte. Keine Frage, ich hatte jemanden vor mir, der schwere Arbeit gewohnt war. Leicht gebeugt, mit gerötetem Gesicht, aber zugleich mit einem verschmitzten Lächeln, das auch einen Blick auf seine gelblichen Zähne und eine riesige Zunge freigab, trat er durch die Tür, die ich hinter ihm schloss.
Ich mochte den Mann vom ersten Moment an. Er hatte etwas Lebenserfahrenes und Gütiges. Die vielen Falten in seinem Gesicht zeigten nicht nur das fortgeschrittene Alter an, sondern genauso alle gemachten Erfahrungen, gedachten Gedanken, erlittenen Sorgen – und, wie ich vermutete, jede Menge Humor. So war es dann auch. Aber erst einmal hatte er starke Schmerzen, vor allem im unteren Rücken.
Aus den Eintragungen in seiner Karteikarte konnte ich schnell ersehen, dass dieser Zustand nicht zum ersten Mal auftrat. In der Regel bekam er eine Spritze zur Schmerzlinderung und Entspannung der akut verhärteten Muskulatur, dazu etwas zur Unterdrückung einer möglichen begleitenden Schwellung und Entzündung im Gewebe. Danach verschwand er wieder, um etwa sechs Wochen später mit den gleichen Beschwerden wiederzukommen.
Henningsen machte an dem Morgen deutlich, dass er weder zu langen Gesprächen noch zu ausführlichen Untersuchungen aufgelegt war, schließlich sei ja „alles klar“, normalerweise wäre er ja „zum Doktor“ gegangen, nun müsse er halt mit mir vorliebnehmen. Ich solle nur das machen, was bei ihm üblich sei, ihn so behandeln, wie das die „eigentlichen Ärzte“ in seinem Fall täten, der Doktor zumal, den sie hier „den Professor“ nannten, den er aber schon kannte, als er noch lange kein Professor gewesen war, und dann sei alles gut. Eine kurze Untersuchung erlaubte ich mir dennoch, auch wenn ich letztlich den erhaltenen Auftrag befolgte. Zu meiner Spritzentechnik gab es keine Beschwerden, wir wechselten noch ein paar kurze Worte über seinen Tag, er würde jetzt wieder zurück in den Stall gehen, wo der Schmerz heute Morgen aufgetreten war, als er sich mit der Mistgabel in der Hand mal wieder verhoben hatte. „Das ist eben die blöde Hexe.“ Nun würde er das Tagwerk im Stall und auch sonst alles weitere verrichten. „Schönen Dank, Herr Doktor, war gar nicht so schlecht, wir sehen uns wieder, hoffentlich nicht sehr bald. Und: Herzlich willkommen hier bei uns!“
Die nächsten drei bis vier Monate kam Bauer Henningsen mindestens dreimal in die Praxis, immer in der gleichen Weise und mit den gleichen Beschwerden. Zunehmend entwickelte sich eine Vertrautheit, ja ein fast freundschaftliches oder familiäres Verhältnis zwischen uns. Dieses Phänomen hatte ich zuvor schon mehrfach erlebt: eine Art Großeltern-Enkel- beziehungsweise Vater-Sohn-Beziehung, die sich mitunter mit älteren männlichen Patienten ergab. Diese Beziehung erfuhr jedoch eine grundlegende Veränderung, als ich eines Nachts auf den Hof von Bauer Henningsen gerufen wurde.
Unsere Praxis nahm regelmäßig an den kassenärztlichen Notdiensten teil, was bedeutete, dass wir auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten nicht nur für unsere Patienten und Patientinnen, sondern stellvertretend auch für die aus anderen Praxen im Ort erreichbar waren. Zu den Aufgaben im Notdienst gehörte es, mit einem Handy und einem umfangreichen Arztkoffer ausgestattet, mit dem privaten Auto zu Hausbesuchen zu fahren beziehungsweise die Rat suchenden Patienten bei bestimmten Notwendigkeiten auch direkt in die Praxis einzubestellen.
Solche notärztlichen Dienste, die unter der Woche vom Abend und bis zum nächsten Morgen und am Wochenende von Samstag bis einschließlich Sonntag gingen, hatte ich etwa alle vier bis sechs Wochen zu leisten. Nachdem das restliche Team die Praxis verlassen hatte, blieb ich allein zurück und erledigte Schreibtischarbeit, während ich auf eintreffende Anrufe wartete. Weil ich zu weit entfernt von der Praxis wohnte, rollte ich irgendwann eine Matratze auf dem Boden des Sprechzimmers aus, um in der wenig heimeligen Atmosphäre, auf dem Boden liegend zwischen Computern, Kabeln, Untersuchungsliegen, Büchern und Medikamenten, kurze Momente der Ruhe zu finden.
In einer solchen Nacht, es war ein Samstag, erreichte mich der Anruf von Bauer Henningsens Sohn. Seinem Vater ginge es gar nicht gut, er habe starke Schmerzen, sähe sich nicht in der Lage, bis zum nächsten Morgen zu warten, außerdem sei er auch kaum transportfähig, ob ich nicht vielleicht zu ihnen kommen könne. Ich ließ mir die Adresse geben, fand den Hof auf meinem Faltplan, weit draußen in der Bauernschaft, jenseits regulärer Straßen, und machte mich mit meinem Arztkoffer auf den Weg.
In tiefer Dunkelheit bog ich von der Landstraße auf einen Feldweg ab. Es gab keine Straßenlaternen, der Weg war nicht asphaltiert und führte, wie ich vermutete, zu dem kaum erleuchteten Gehöft, das in der Ferne zu erahnen war. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, als ich die Landkarte checkte, und es gab plötzlich einen Rumms. Mein alter Golf neigte sich vorne auf einmal bedrohlich zur Seite und war manövrierunfähig, weil ich in einer Kurve des schmalen Weges in einen Graben am Rand gefahren war. Es ging weder vor noch zurück. Schließlich ließ ich das Auto an Ort und Stelle stehen, nahm eine Taschenlampe sowie den Arztkoffer aus dem Auto und machte mich zu Fuß auf den Weg. Nach etwa zehn Minuten erreichte ich den Hof.
Der Sohn des Bauers öffnete mir die Tür. Henningsen selbst saß an einem Holztisch in der offenen Küche, die zugleich Ess- und Wohnzimmer zu sein schien. Vor sich ein Glas Wasser – wie ich annahm – und eine aufgeklappte Zeitschrift. Ein halb ausgefülltes Kreuzworträtsel und ein Kugelschreiber verrieten, dass er versucht hatte, sich damit von den Schmerzen abzulenken. Von seinem Platz auf einer eingebauten schlichten Holzbank ohne Polster, Kissen oder Auflagen blickte er zu mir auf. Der Boden im Raum war aus Stein, es war recht kühl, das Licht fahl, man hörte eine Standuhr ticken, eine insgesamt recht trostlose Atmosphäre.
Der sonst so wache, oft kecke Blick von Henningsen war getrübt, seine Augen schauten traurig. Und doch konnte man die Freude und Erleichterung spüren, als ich an seinem Sohn vorbeiging, um ihm die Hand zu schütteln.
„Ich bin so froh, Sie zu sehen, Herr Doktor!“
Henningsen erzählte mir, was vorgefallen war, letztlich das Übliche. Jedoch hatte er sich dieses Mal nicht in die Praxis getraut, es sei ihm irgendwie peinlich gewesen, weil die letzte Behandlung doch erst so kurz zurücklag. Dieses Mal war alles anders. Er hatte den Schmerz über den Tag geschleppt, jetzt aber ging gar nichts mehr. „Sohn, der Doktor muss kommen!“
In dieser Nacht erlebte ich den Bauern das erste Mal in seinem privaten Umfeld, in seinem Heiligtum, in seiner eigenen Welt. Ich konnte ihn und sein Umfeld riechen, hören, tasten. Er hatte mir sprichwörtlich die Tür geöffnet – und dann auch sein Herz, sein Innerstes. Die Spritze setzte ich nebenbei, denn diesmal stand Bauer Henningsen als ganzer Mensch im Mittelpunkt, der das dringende Bedürfnis hatte, mich an seinem Leben teilhaben zu lassen. Er packte aus. Er konnte nicht mehr, er konnte auch nicht mehr länger verdrängen – die Scheunentore seines Lebens standen offen.
Henningsen führte den Hof in dritter Generation. Seine Frau kam vom Nachbarhof. Als sie vor Jahrzehnten geheiratet hatten, brachte sie ein beträchtliches Stück Land mit in die Ehe ein. Es ging ihnen damals sehr gut, in der Ehe, persönlich, aber auch finanziell. Mittlerweile war der Nachbarhof verlassen. In der Familie seiner Frau hatte es keine Söhne gegeben, die beiden Schwestern waren lange schon fort, und nach dem Tod des Vaters wurde der Hof geräumt. Die Mutter lebte noch bis vor Kurzem in einem Pflegeheim, hochbetagt, doch „ohne Gedächtnis, völlig verwirrt“. Einen weiteren Teil der Fläche übernahmen die Henningsens, der größere ging an die Kommune und wurde in ein Gewerbegebiet umgewidmet. „Seelenlos!“
Bauer Henningsen hatten zwei Söhne. Der eine war Single geblieben, kam nicht wirklich mit dem Leben klar, wie er erzählte. Er half hin und wieder auf dem Hof, lebte dann auch dort, schlief in seinem alten Kinderzimmer, hatte aber sonst eine kleine Wohnung in der nächsten Kleinstadt, wo er sein Geld an Wochenenden in einer Fußballkneipe am Tresen verdiente. Henningsen war offenbar enttäuscht von ihm, sagte das aber nicht direkt. „Ist ja schließlich mein Sohn.“
Der andere Sohn hatte eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Er war der ganze Stolz des Vaters, seine Hoffnung für die Zukunft, und sollte den Hof eines Tages übernehmen.
„Für ihn habe ich das alles hier gemacht. Wir sind doch die Henningsens, ein Teil der Gegend hier ist nach uns benannt – das muss doch weitergehen!“
Der Sohn war verheiratet, hatte mittlerweile selbst zwei jugendliche Söhne, „eine gute Ehe mit einem Mädel aus Münster“. Die Schwiegertochter sei eine tolle Frau. Einzig: Sie mochte das Land nicht, fand es auch für ihre eigenen Söhne, deren Schulausbildung und Freundeskreis, keinen guten Ort. Schließlich überredete sie ihren Mann, im Fernlehrgang ein „Computer-Studium“ zu machen. Das bekam er alles neben der Arbeit auf dem Hof hin. Sie hatten extra für die kleine Familie angebaut, damit sie „es sich hier schön machen konnten“. Vor eineinhalb Jahren dann eröffnete Bauer Henningsens Sohn dem Vater, dass er einen Job in einer Firma in Münster angenommen habe.
Seit über einem Jahr waren sie nun schon weg. An den Wochenenden kam sein Sohn aus Münster zuweilen zum Helfen. Meistens alleine und nur, wenn der andere Sohn nicht da war, weil die beiden nicht gut miteinander klarkamen und sich lieber aus dem Weg gingen. Die Enkelkinder und auch die Schwiegertochter hatte Henningsen schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Das machte ihn traurig. Früher war es immer so lebhaft auf dem Hof gewesen. Aber das war mittlerweile vorbei. Sonst lebte auch niemand aus der Familie mehr hier. Seine eigenen Eltern waren schon lange tot, die eine verwitwete Schwester wohnte in Süddeutschland. Er habe sie schon seit über zehn Jahren nicht mehr gesprochen.
Henningsens Frau hatte mittlerweile eine „schlimme Vergesslichkeit“ entwickelt, sie könne sich kaum mehr an die Kinder erinnern, geschweige denn an die Enkel. Mit ihr hatte er immer über alles reden können. Doch nun sei da nur noch Schweigen. Sie sei nicht in der Lage, sich allein anzuziehen und zu versorgen. Hilfe hätten sie noch keine in Anspruch genommen. „Das kriegen wir schon selber hin!“, sagte der Bauer und es war offensichtlich, wie peinlich ihm die Situation war. So wollte er nicht gesehen werden, und schon gar nicht wollte er, dass man seine Frau so sah. Er schirmte sie ab. Eine langjährige Haushaltshilfe sei vor einigen Monaten in den Anbau vom Sohn gezogen, Kost und Logis frei. Dafür kochte sie und putzte das Haus, schaute auch ein bisschen mehr nach der Frau, denn er sei ja die meiste Zeit draußen. Auch die Wäsche machte sie. „Aber reden tun wir nicht viel.“ Einkäufe brachte der Supermarkt zweimal in der Woche direkt zu ihm nach Hause. Der Sohn eines alten Schulfreundes hat das Geschäft übernommen. „Doch die werden wohl auch bald dichtmachen. Kein Personal. Das Gewerbegebiet hat zwei große Märkte, diese seelenlosen Ketten, wissen Sie.“ Zum Glück würden sie im Moment noch die meisten Lebensmittel selbst produzieren. „Wir sind echte Selbstversorger, keine Transportwege, alles öko, schon von Natur aus – das sollen sich die Grünen mal hinter die Ohren schreiben!“
Heute Morgen war sein Sohn wieder aus Münster gekommen. Früher als sonst. Henningsen wollte gerade in den Stall aufbrechen. Da hatte ihn sein Sohn abgefangen und erzählt, dass die Familie überlegte, ins Ausland zu gehen. Sie würden sich Sorgen um ihn machen und um die Mutter, die müsse in ein Heim. Sie und er bräuchten mehr Hilfe. Den Hof könne er, der Sohn, auf keinen Fall übernehmen. Das sei ja immer klar gewesen, aber er wolle das dem Vater noch einmal klipp und klar sagen. Das könne so alles nicht weitergehen.
Henningsen wirkte sehr niedergeschlagen. Auch seine Sprache war verlangsamt, die Stimme leiser als sonst. Man hatte ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Er wusste augenscheinlich nicht mehr weiter, schien wie erstarrt. Er, der sonst immer eine Lösung für alles gefunden hatte, der Fels in der Brandung, an dem sich alles orientierte, der die Richtung vorgab, sah plötzlich keinen Sinn mehr, keinen rechten Weg, keine Zukunft. Er hatte das Zutrauen verloren. Alles zog sich in ihm zusammen. Und jetzt waren da immer öfter diese Schmerzen, seit Kurzem auch noch ein Bluthochdruck. Schlafen konnte er nach eigenen Angaben auch kaum mehr, „nur mit Hilfe – Doppelkorn!“ Alles schien irgendwie falsch.
Ich fragte Bauer Henningsen, ob sein Sohn wüsste, wie es ihm wirklich ging. Er zuckte bloß mit den Achseln. Ich schlug vor, den Sohn hinzuzuholen. Mit einem lautlosen Nicken stimmte er zu. Um mich dann zu bitten, dass ich es ihm erzählen möge.
So gut es ging, schilderte ich dem Sohn, was ich gehört hatte. Dazu auch meine Beobachtungen, meinen eigenen Eindruck. Ich ließ nichts weg, während ich hin und wieder zur Seite blickte und mich rückversicherte, dass Henningsen einverstanden war und ich fortfahren sollte. Dabei war mir nicht entgangen, dass der Bauer sich zwischenzeitlich mit dem Handrücken Tränen aus den Augenwinkeln wischte. Im Laufe meiner Schilderungen hatte der Sohn zunehmend seinen Blick von mir ab- und dem Vater zugewandt. Als ich schließlich zu Ende gekommen war, blickte der Sohn dem Vater fest in die Augen und ergriff seine Hände: „Vadder, du kannst dich darauf verlassen, wir werden den Hof erhalten!“
Ich machte mich wieder auf den Heimweg. Damit mein Auto wieder auf den rechten Weg kam, holte der Sohn einen Traktor aus der Scheune, und wir fuhren zusammen die dunkle Zufahrt entlang in Richtung meines stecken gebliebenen Golfs. Der Sohn schien genauso erleichtert wie der Vater, als wir ihn verließen. Fast gut gelaunt rief er: „Wir sind die Henningsens – wir halten zusammen. Das kriegen wir schon hin!“ Dann merkte er noch an, dass sein großer Sohn – Bauer Henningsens ältester Enkel – bereits mehrfach lebendiges Interesse an der Landwirtschaft gezeigt habe. Sie hätten schon öfters darüber gesprochen, dass er doch beim Opa zugucken und lernen könne, sicher ließe er ihn auch Trecker fahren. Sie planten ohnehin, an den kommenden Wochenenden auch wieder gemeinsam zu den Großeltern zu fahren. Überhaupt wolle er das jetzt alles angehen, auch mit der Mutter, vielleicht mit einem richtigen Pflegedienst und einer guten medizinischen Anbindung. Ob ich ihnen dabei helfen würde und die Mutter auch meine Patientin werden könne? Natürlich bejahte ich beides. Der Sohn erklärte noch einmal, dass er bis zum heutigen Abend über das Ausmaß der Probleme und die Sorgen des Vaters nicht wirklich Bescheid gewusst habe. Der Vater habe immer alles weggewischt. Auch die Situation der Mutter sei ihm erst jetzt richtig bewusst geworden.
Nachdem mein Auto wieder auf der Fahrbahn stand und wir im Begriff waren, uns zu verabschieden, kam mir noch eine Idee. Bauer Henningsen hatte erzählt, dass er bis vor einigen Jahren mit seiner Frau im Gemeindechor gesungen habe. Durch die damals schon beginnende Erkrankung der Frau und die damit behaftete Scham sei er nicht mehr hingegangen. Der Chor sei bald darauf wegen des fortgeschrittenen Alters der anderen Mitglieder aufgelöst worden. Von einem anderen Patienten wusste ich, dass man gerade dabei war, hier in der Gegend einen „Landmänner-Chor“ zu gründen, wo es vor allem darum ging, Volkslieder zu singen und die Mundart zu pflegen. Ich sagte dem Sohn zu, einen Kontakt herzustellen.
Im Anschluss an diese Nacht sah ich Bauer Henningsen längere Zeit nicht mehr zur Behandlung. Nur zur Blutdruckkontrolle und für das gelegentliche Ausstellen eines neuen Rezeptes, bei mittlerweile nur noch leicht erhöhten Werten. Schmerzen beklagte er nicht mehr. Er kam dafür jetzt mit seiner Frau, die nun bei einem Neurologen in Behandlung war und hausärztlich von uns betreut wurde. Das Ehepaar hatte inzwischen auch einen Pflegedienst, der täglich kam. Die Situation schien sich insgesamt entspannt zu haben.
Ein knappes Jahr später bekam ich einen Anruf von Bauer Henningsens Sohn aus Münster. Eigentlich ging es nur um ein Rezept für die Mutter, aber nach kurzer Zeit sprudelte es aus ihm heraus: Er wolle sich bedanken. Der Vater sei seit geraumer Zeit wie ausgewechselt. Er sänge in der Männergruppe, spiele Skat, unter anderem mit dem Schulfreund, dem einst der Supermarkt in der Nachbarschaft gehört hatte. Sie kämen jetzt fast jedes Wochenende aus Münster zu „Vaddern“, die Situation der Mutter sei aus seiner Sicht unverändert, aber sie schiene ihm nicht unglücklich zu sein. Sein Ältester würde regelmäßig Trecker mit dem Opa fahren, auf dem Hof helfen. Er habe außerdem neulich den Wunsch geäußert, ebenfalls Landwirt zu werden und möglicherweise eines Tages den Hof zu übernehmen. Das sei zwar im Moment noch unrealistisch und weit in der Zukunft, aber es habe seinen Vater doch sehr gefreut.
Den Hof hätten sie inzwischen so bestellt, dass die Arbeit insgesamt zu schaffen sei, sofern der Vater stabil bliebe, wie es im Moment ja aussähe. Grundsätzlich sei die Landwirtschaft seiner Meinung nach für den Vater inzwischen eher ein Zeitvertreib, das würde er ihm aber so nicht sagen. Die Eltern kämen finanziell klar. Und das Beste sei, dass sich seine eigenen Söhne seit Kurzem politisch interessierten und lokal auch engagierten. Sie protestierten gegen die Vernichtung von Kulturland durch den Braunkohlebergbau im Süden ihrer Gegend, was den Opa überraschenderweise begeistere und schließlich inspiriert habe: Sein Vater würde neuerdings selbst mit dem Trecker zu Protestaktionen fahren – „zusammen mit den Grünen!“
Es sei wunderbar zu sehen, wie eine neue Generationenbrücke dabei war zu entstehen. Großvater und Enkelkinder agierten Hand in Hand. Das würde ihn selbst sehr glücklich machen. Auch er fühlte sich wieder mehr verbunden mit der Region, mit der „Erde“ insgesamt, aber auch mit dem Boden, auf dem ihr Hof stünde. Das sei ja schließlich auch seine eigene Heimat. Er würde sich nun selbst mehr berufen fühlen, gegen den Verlust von Heimat etwas zu tun, sie alle hätten plötzlich das Gefühl, eine Aufgabe zu haben. Allerdings könne es immer noch sein, dass sie beruflich demnächst ins Ausland gingen, das sei noch nicht entschieden. Die Kinder würden dann wohl mitkommen, was für den Vater sicher sehr hart wäre. Vielleicht würde der ältere Sohn aber auch hierbleiben wollen – im Moment sei das alles noch unklar. Insgesamt seien sie alle wieder enger zusammengerückt, und der Vater würde wieder mehr Sinn und Freude im Leben empfinden.
Ich habe im Laufe meines Lebens noch oft an Bauer Henningsen gedacht. Vor allem auch an dieses letzte Gespräch mit dem Sohn. Hätte ich Henningsen bei unserer ersten Begegnung – mit der Spritze in der Hand – gefragt, was ihm Sinn im Leben geben würde, ob das Thema überhaupt eine Rolle für ihn spielen würde, dann hätte er mit seinen fleischigen Händen sicher abgewunken, mich kopfschüttelnd angeguckt und eventuell für einen „von denen“ gehalten oder gefragt, was das denn nun zu bedeuten habe. Möglicherweise hätte er festgestellt, dass ihm das alles nichts sagen würde, dass das einfach nicht sein Thema sei – ich solle ihm doch bitte jetzt die Spritze geben, deswegen sei er ja schließlich gekommen. Und überhaupt, für so etwas habe er keine Zeit. Denn er müsse zurück in den Stall.
Verbundenheit mit dem eigenen Körper: Der Body Scan
Der Body Scan ist eine Übung der Achtsamkeit, mit der Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment lenken und eine tiefere Verbindung zu Ihrem Körper herstellen. Indem Sie sich auf die physischen Empfindungen fokussieren, kann der Geist zur Ruhe kommen und eine tiefe Entspannung erfahren. Mit dieser Übung können Sie Stress abbauen, körperliche Verspannungen lösen, die Konzentration verbessern und das allgemeine Wohlbefinden steigern; „Burnout-Symptome“ oder gar Depressionen – begleitend – lindern. Mitunter kommt es auch zum Erleben tiefer Glücksgefühle.
Es handelt sich um eine Form der selbst angeleiteten Meditation, bei der Sie die Aufmerksamkeit bewusst durch Ihren Körper führen. Sie sind dabei angehalten, sich auf verschiedene Körperbereiche zu konzentrieren. Angefangen bei den Zehen bis hin zum Kopf lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die physischen Empfindungen, die Sie in jedem Bereich Ihres Körpers wahrnehmen, wie zum Beispiel ein Pulsieren, Wärme oder Kälte, Spannungen oder Schmerzen, die Berührung der Kleidung auf der Haut etc. Ziel der Übung ist es, ein bewusstes Körperbewusstsein zu entwickeln und eine tiefe Verbindung zum eigenen Körper herzustellen. Ein achtsamkeitsbasierter Body Scan läuft folgendermaßen ab:
Finden Sie eine bequeme Position: Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl oder legen Sie sich auf eine Matte oder eine weiche Unterlage. Schließen Sie Ihre Augen oder senken Sie Ihren Blick.Machen Sie sich Ihren Atem bewusst: Spüren Sie, wie der Atem in Ihren Körper hinein- und hinausströmt. Beobachten Sie seinen natürlichen Rhythmus, ohne ihn zu verändern.Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf die Füße: Spüren Sie das Gewicht Ihrer Füße auf dem Boden oder die Berührung der Füße mit der Unterlage. Achten Sie auf die Empfindungen in Ihren Zehen, Fußsohlen und Fußrücken. Gibt es irgendwelche Spannungen, ein Kribbeln, oder spüren Sie Wärme? Seien Sie einfach nur achtsam, das heißt wirklich anwesend, und nehmen Sie wahr: offen und beobachtend, ohne zu bewerten.Bewegen Sie Ihre Aufmerksamkeit langsam weiter nach oben, wie bei einem imaginierten Scanner: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Waden, Knie, Oberschenkel, Hüften und Ihr Becken. Beachten Sie jede Empfindung, die Sie in diesen Bereichen wahrnehmen, sei es Druck, Entspannung oder irgendeine andere Empfindung. Wieder gilt: Nur beobachten, alles annehmen, wie es ist, und das, was Sie spüren, auch wieder ziehen lassen.Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf den Rumpf: Spüren Sie, wie der Atem in den Bauchraum strömt, ihn wieder verlässt, wie sich Ihr Brustkorbs dabei hebt und senkt. Was beobachten Sie in Ihrem Rücken und Ihrer Wirbelsäule, im Unter- und Oberbauch, den Flanken, zwischen den Schultern? Welche Empfindungen kommen aus dem Körperinneren? Was immer in Ihr Wahrnehmungs- oder Aufmerksamkeitsfenster gerät, ist willkommen.Gehen Sie nun vom Rumpf zu den Armen und Händen: Fühlen sich Ihre Arme leicht oder schwer an? Spüren Sie Verspannungen, Kribbeln oder andere Empfindungen? Konzentrieren Sie sich auch auf Ihre Hände und achten Sie auf das Gefühl in Ihren Fingern und Handflächen.Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf den Nacken und den Kopf: Ist Ihr Nacken entspannt oder angespannt? Lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit durch Ihren gesamten Kopfbereich wandern. Wie fühlen sich Ihr Gesicht, Ihre Kopfhaut und Ihre Stirn an?Weiten Sie Ihre Aufmerksamkeit als Nächstes auf Ihren gesamten Körper als Ganzes aus. Wie nehmen Sie das Zusammenspiel aller Körperteile und die Verbindung zum Boden oder zur Unterlage wahr? Spüren Sie das Heben und Senken, Weiten und Zusammenziehen einzelner Körperbereiche im Kontext des Atmens? Verweilen Sie einen Moment in diesem achtsamen Gewahrsein Ihres Körpers als Ganzes.Beenden Sie schließlich den Body Scan, indem Sie ein paar tiefe Atemzüge nehmen und langsam die Augen öffnen, sofern sie geschlossen waren. Spüren Sie noch einen Moment nach, wie es sich anfühlt, achtsam mit Ihrem Körper verbunden zu sein.Dreidimensionalität: Woraus sich Gesundheit bisher zusammensetzt
Ich bin in einem Mediziner-Haushalt aufgewachsen. Bürgerlich, relativ behütet und weitgehend sorglos. Nicht alles war leicht, aber unterm Strich passte es gut. Mein Vater war früher Leiter des Bremer Hafengesundheitsamtes, davor Direktor eines kleineren städtischen Krankenhauses. Meine Mutter hatte wegen der Kinder ihr eigenes Medizinstudium abgebrochen, aber später unter anderem als Laborantin gearbeitet. Medizin spielte also bei uns zu Hause eine prägende Rolle.
Als Heranwachsender war für mich immer klar, dass ich auf keinen Fall Arzt werden wollte. Ich liebte meine Eltern, und mir war auch nicht entgangen, dass mein Vater großen Respekt genoss, nicht nur seitens seiner Patientinnen und Patienten, sondern auch unter der Kollegenschaft und den hansestädtischen Gesundheitspolitikern. Er war eine Respektperson im wahrsten Sinn des Wortes: schlicht überzeugend durch seine menschliche Präsenz – positiv und ernsthaft zugleich. Nie etwa habe ich meinen Vater ungerecht oder außer sich erlebt. Stattdessen zeigte er sich stets abwägend, verständig und sachlich gewinnend. Aber er war in meinen Augen auch aus der Zeit gefallen, Anfang der 1920er-Jahre geboren – wir teilten wenig in unseren Alltagswelten. Meine Eltern repräsentierten für mich eine vergangene Zeit. Deshalb wehrte ich mich mit Händen und Füßen allein schon gegen die Vorstellung, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten und mich ebenfalls an der Medizin zu orientieren. Das schien mir zu bequem, zu einfach und zu uninspiriert. Ich mochte nicht gedankenlos einem vermeintlich ausgetretenen Pfad folgen. Für meinen eigenen Beruf stellte ich mir etwas anderes vor, auch wenn ich nicht genau wusste, was. Als inneres Verbotsschild hatte ich lediglich vor Augen: Auf keinen Fall dürfte meine Visitenkarte später genauso lauten wie die meines Vaters, lediglich mit einem anderen Vornamen.