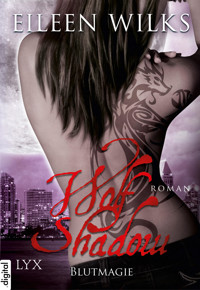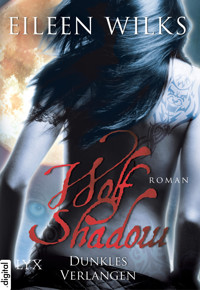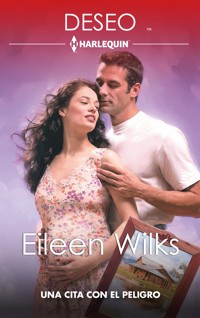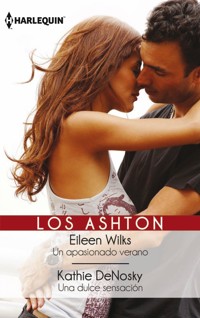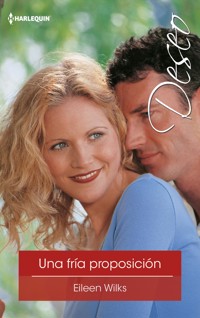9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wolf-Shadow-Reihe
- Sprache: Deutsch
Lily Yus Verbindung mit dem Werwolf Rule Turner sorgt für böses Blut unter den Gegnern der Gestaltwandler. Lily erhält Todesdrohungen, und ihr Auto wird demoliert. Eine mysteriöse Einbrecherin schleicht sich in das Clanshaus der Nokolai und wird von Rules Bruder Benedict gestellt. Und zu allem Überfluss taucht in Tennessee auch noch ein Werwolf auf, der Menschen tötet. Die Situation droht zu eskalieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Glossar
Danksagung
Impressum
EILEEN WILKS
VERBOTENE PFADE
Roman
Ins Deutsche übertragen von Stefanie Zeller
Prolog
Zwei Monate zuvor …
»Kniet nieder.«
Die beiden jungen Männer taten, wie ihnen geheißen. Der eine war blond und schlank. Seine Haare hatten die Farbe von Weizen und seine Augen das sonnige Blau des Himmels, der ihn reifen lässt. Der andere hatte ein rosiges Gesicht, dunkles Haar, und seine Mundwinkel waren nach oben gebogen, als würde er so oft lächeln, dass sein Gesicht gar nicht mehr anders konnte. Beide trugen abgeschnittene Jeans und sonst nichts.
Isen saß in seinem Lieblingsarmsessel und musterte sie. Dies war ein bedeutsamer Moment. David Auckley und Jeffrey Lane waren die ersten Leidolf, die dieses Haus betraten.
Außer seinem Sohn natürlich.
Isen warf Rule, der zwei Meter hinter den beiden jungen Männern stand, einen Blick zu. Mit dem gens compleo – der Zeremonie, durch die diese beiden als Erwachsene in ihren Clan aufgenommen werden sollten – hatte Rule sie unbeabsichtigt auch mit in den Clan der Nokolai gebracht. Isen hatte genau den Moment gespürt, als es passiert war. Jedes neues Clanmitglied veränderte die Clanmacht, subtil, aber merklich.
Eigentlich hätte so etwas gar nicht möglich sein dürfen. Aber andererseits war Isens zweitgeborener Sohn auch der erste Lupus seit grob geschätzt dreitausend Jahren, der mehr als eine Clanmacht innehatte. In letzter Zeit war das Unmögliche an der Tagesordnung.
Auch was danach kam, war schwer zu glauben, wenngleich möglich. Denn nachdem er David und Jeff aus Versehen in zwei Clans statt nur in einen aufgenommen hatte, war es Rule nicht gelungen, ihre Zugehörigkeit zu den Nokolai rückgängig zu machen. Zwar war Rule nur der Thronfolger, trotzdem sollte seine Macht dazu ausreichen. Doch weder er noch Isen verstanden, warum es nicht geklappt hatte.
Heute wollten sie es noch einmal versuchen. Isen hatte die gesamte Clanmacht der Nokolai inne, und das schon seit langer Zeit. In gewissem Sinne auch den Teil, den sein Sohn und Erbe in sich trug, denn Isen hatte stets die Gewalt über die gesamte Macht, egal, wo sie gerade war. Sie würde immer nur ihm gehorchen. Daran zweifelte er genauso wenig wie an seiner Fähigkeit, seinen Fuß oder seine Hand zu lenken.
Heute würde keine Zeremonie durchgeführt. Niemand rief seco, auch wenn die Prozedur die gleiche war wie die, mit der ein Lupus aus dem Clan ausgestoßen wurde. Aber was ihnen heute geschah, war keine Schande für diese jungen Männer. Es musste sein. Anschließend würden sie zwar keine Nokolai mehr sein, doch sie wären nicht clanlos.
»David«, sagte Isen leise und in sachlichem Ton. »Jeffrey.« Er legte beiden Männern eine Hand auf die Schulter. Die Clanmacht regte sich, erkannte sie. Dieses Erkennen hielt er in seinem Bewusstsein fest … und wies es zurück, mit Worten und mit seinem Willen, indem er die winzigen Teile der Clanmacht in ihnen zu sich zurückrief. »Ihr seid keine Nokolai.«
Nichts geschah. Einen langen Moment geschah gar nichts.
Isen lehnte sich zurück und lachte lange und laut.
»Isen«, sagte Rule, nur dieses eine Wort, und auch sein Ton verriet nicht mehr. Doch Isen wusste, dass er besorgt war. Sicher wollte er es vor den beiden jungen Männern nicht zeigen, die nun zu Isen hochstarrten – der Blonde alarmiert, der Dunkle so erstaunt, dass er sein unerschütterliches leichtes Lächeln verloren hatte.
Auch das amüsierte Isen. »Ah«, sagte er und wischte sich die Lachtränen aus den Augen. »Der Spaß ging wohl auf meine Kosten.«
»Ich verstehe nicht, was daran lustig sein soll«, sagte Rule trocken.
Isen betrachtete seinen Sohn sehr liebevoll und beinahe ebenso nachsichtig. Er hatte zwei noch lebende Söhne, und beide waren ein wenig zu ernst. Dennoch verstand er Rules Sorge. Bisher war es ihnen gelungen, den Zustand dieser beiden jungen Leidolf-Nokolai-Hybriden zu verheimlichen, indem sie sie hierher gebracht hatten, um sie zu Bodyguards für ihren Rho auszubilden. Angeblich, um Rules erstes genscompleo als Leidolf-Rho zu würdigen und das neue freundschaftliche Band zwischen den Nokolai und den Leidolf auch nach außen zu demonstrieren.
Aber was noch wichtiger war: Damit war auch erklärt, warum die beiden anders rochen. Schließlich arbeiteten sie tagtäglich mit Nokolai zusammen, lebten bei ihnen. Jeder musste annehmen, dass der Duft der Nokolai nur angenommen und nicht ihr eigener war.
Aber ihre kleine Trickserei würde nicht für immer unentdeckt bleiben. Und dann wäre – wie sagte man so schön? – die Kacke am Dampfen.
Isens Blick traf auf den seines Sohnes, während ihm noch ein letztes kurzes Auflachen entschlüpfte. »Ah, nun ja. Du und ich können nicht immer über dieselben Dinge lachen. Die Clanmacht hat nicht reagiert.«
»Das ist mir nicht entgangen.«
»Rule.« Isen schüttelte den Kopf, voller Zuneigung, aber auch leicht ungeduldig. »Ein Rho hat die volle Kontrolle über die Macht seines Clans … mit einer Ausnahme.«
Rules Augen weiteten sich. Sein Blick glitt zu den Männern, die immer noch gehorsam auf dem Boden knieten. Wortlos sah er seinen Vater wieder an, eine Frage in den dunklen Augen.
Isen nickte. Ja, du hast mich ganz richtig verstanden.
Oh, Hybris. Isen lächelte ironisch. Dass es eine Ausnahme gab, daran hatte er nicht mehr gedacht. Obwohl es einige gute Gründe dafür gab. Es war über dreitausend Jahre her, dass die Dame direkt auf die Clanmächte eingewirkt hatte. Seit dem Großen Krieg. Trotzdem blieb es ihr Vorrecht, über sie zu bestimmen, genau wie über die Lupi, die sie geschaffen hatte.
Warum wollte sie, dass diese beiden Männer zwei Clans angehörten? Das wusste niemand. Aber ganz offenkundig war es ihr Wille. So wie es offenkundig war, dass ihnen das kaum jemand in den anderen Clans glauben würde.
Interessante Zeiten, dachte Isen. Gab es nicht einen chinesischen Fluch, der so lautete? Mögest du in interessanten Zeiten leben.
1
Angst schmeckt immer unterschiedlich. Heute Abend schmeckte sie nach sauren Äpfeln mit einem Hauch von Galle. Arjenie schluckte einmal, dann noch einmal.
Der Mond stand hoch und war beinahe voll. Ein paar Fetzen von hohen Zirruswolken zogen sich über die Himmelskuppel wie Kratzspuren, die ein paar Riesen beim Schlittern hinterlassen hatten. Arjenie hielt ganz still, damit ja kein Knacken oder Rascheln in die mondbeschienene Nacht drang.
Sie war froh über das Mondlicht. So weit entfernt von der Stadt gab es nicht viel künstliches Licht, nur die Gartenbeleuchtung rund um Robert Friars großes, teures Haus. Die allerdings spross überall wie elektronische Pilze – Lampen entlang der Wege, Spots, die Bäume und Büsche anstrahlten, und Unterwasserlampen, die den Pool diamanten schimmern ließen.
Überall, außer beim Gästehaus. Ungefähr fünfzehn Meter hinter dem glitzernden Pool stand eine Holzhütte, so groß wie eine Doppelgarage. Hier war es dunkel, vor allem hinter dem Dornenbusch, wo Arjenie kauerte. Weder der Mond noch die Gartenlampen schienen in das Fenster einen halben Meter links von ihr, das einen Spalt offen stand. Hinter der Scheibe war es dunkel. Aus der Dunkelheit drang ein Flüstern zu ihr. »Du gehst besser.«
»Ja.«
»Und trotzdem bist du noch da.«
»Ich will dich nicht hier zurücklassen.«
»Ich kann nicht mit dir kommen. Das weißt du. Geh. Sie bringen bald die Tränen.«
Arjenie sagte nichts. Es gab nichts zu sagen. Dya brauchte die Tränen, aber Arjenie hasste sie und alles, für das sie standen.
»Psst. Ich hätte dich nicht rufen sollen. Du bist nicht –«
»Du willst mich doch nicht beleidigen, oder?«
»Du hast Angst.«
»Kannst du da drinnen hören, wie meine Knie aneinanderschlagen?«
»Ach, das ist dieses Geräusch?« Dya prustete leise. »Mach dir keine Sorgen, Füchschen. Mir wird nichts geschehen. Ich bin nicht glücklich, aber mir geht es gut. Er wagt es nicht, mir etwas zuleide zu tun.«
»Er wagt es nicht, dich zu töten«, stellte Arjenie richtig. »Das hast du mir selber gesagt. Weil deine Familie es herausfinden würde.«
»Es ist auch deine Familie. Jidar-Verwandte gehören auch zur Familie.«
Eine Familie, die sie nie gesehen hatte und auch nie sehen würde. »Ich will damit sagen, wenn du dich nicht zum vereinbarten Zeitpunkt meldest, werden sie Alarm schlagen, und dann wird Friar beweisen müssen, dass du lebst und wohlbehalten bist, sonst werden sie Beschwerde einlegen. Das ist da, wo du herkommst, eine große Sache, deswegen wird er es lieber vermeiden, dich zu töten.«
»Außerdem braucht er mich für die Umsetzung seiner Pläne. Wenn ich tot bin, bin ich ihm nicht mehr nützlich.«
»Zwischen wohlbehalten und tot kann eine Welt des Schmerzes liegen.«
Ein einzelnes Zungenschnalzen. »Dann geh, bevor du müde wirst und Fehler machst und mit diesen Glasfläschchen in der Tasche erwischt wirst. Dafür würde er mich streng bestrafen.«
»Eine gute Idee.« Vor allem, weil niemand Friar zur Rechenschaft ziehen würde, wenn sie nicht mehr auftauchte. Arjenie hatte den schlimmen Verdacht, dass Friars sie nur zu gern für immer verschwinden lassen würde, wenn er sie hier entdeckte. »Du hast das Prepaid-Handy, das ich dir gebracht habe. Erinnerst du dich noch, wie man es benutzt? Handys sind ein wenig anders als –«
»Ich weiß, wie man es benutzt, aber ich werde es nicht tun. Glaub nicht gleich, dass etwas nicht stimmt, wenn ich dich nicht anrufe. Ich will dich nicht in Gefahr bringen.«
Große Schwestern hörten vermutlich nie auf, sich um ihre kleinen Schwestern zu sorgen, dachte Arjenie. Wenigstens hatte Dya angerufen, als sie sie wirklich brauchte. »Ich komme wieder. Hab dich lieb, Dya.«
»Komm nur, wenn ich anrufe. Hab dich lieb, Arjenie-hennie.«
Als sie den Kosenamen hörte, musste Arjenie lächeln. Es war zwar ein recht wackeliges Lächeln, aber nun ja, das sah ja keiner. Sie drehte sich herum, um vorsichtig unter dem Busch hervorzukriechen und … »Au!«
»Was ist?«
»Blöder, böser Busch«, murmelte sie. »Er hat mich gestochen.«
»Blutet es? Arjenie, wenn es blutet –«
»Kannst du es wieder in Ordnung bringen?« Ihre Hand blutete, sicher war auch Blut an dem Busch.
»Gib mir das Stück, an dem du dich verletzt hast.«
Arjenie tastete nach dem Busch, vorsichtiger dieses Mal, und brach den Übeltäter ab. Sie erstarrte, als es »Knack« machte, wollte instinktiv ihre Gabe nutzen – und zuckte zusammen, als sie einen stechenden Schmerz an der Schläfe spürte. Sie befand sich zu nah an dem Glas der Fensterscheibe, um so viel Energie zu ziehen.
Niemand kam, um nachzusehen, dank sei dem Licht, dem Gott und der Göttin. Ungelenk lehnte Arjenie sich vor, um den dornigen Zweig durch den Fensterspalt zu schieben.
Einen langen Moment wartete sie, so leise atmend, wie sie konnte. Schließlich flüsterte Dya: »Fertig. Jetzt wird ihn niemand nutzen können, um deine Spur zu finden.« Der Ast glitt wieder durch den Spalt zurück und fiel leise raschelnd zu Boden.
»Dya –«
»Geh! Und achte darauf, dass du kein Blut hinterlässt.«
Arjenie schaffte es hinter dem Busch hervor, ohne sich noch einmal zu stechen. Dann hielt sie inne, immer noch in der Hocke, um das Blut von ihrer Hand zu saugen. Verfluchtes dorniges Dingsbums. Kein Wunder, dass Friar glaubte, niemand könnte sich seinem Gästehaus nähern. Er hatte es mit Kampfpflanzen geschützt.
Und natürlich waren da noch die Wachen. Und die Schutzbanne.
Die Wachen wären nicht das Problem, sprach sie sich Mut zu. Sie war nicht erschöpft – auf jeden Fall nicht so erschöpft, dass sie sie bemerken würden. Was die Schutzbanne anging … immerhin war sie bis hierher gekommen, ohne einen auszulösen, oder nicht? Jetzt musste sie es nur wieder zurückschaffen.
Langsam richtete sie sich auf. Zwischen ihr und dem Pool lagen nur ein Weg von fünfzehn Metern und ein paar niedrige Pflanzen – und dahinter das Haus. Sie fühlte sich schrecklich ungeschützt. Ihr Herz hämmerte. Ihr Mund war trocken.
Stell dich nicht so dumm an, sagte sie sich. Niemand würde sie bemerken, also gab es keinen Grund, so ein Angsthase zu sein. Aber das viele Glas im Haus machte ihr Sorgen.
Ihr Herz behielt seinen schnellen Rhythmus bei, als sie langsam über den Steinweg ging, der zur Hinterseite der kleinen Hütte führte, die hier in Südkalifornien fehl am Platze wirkte. Aber Friar hatte eine Vorliebe für den rustikalen Stil. Das Haupthaus war ein wenig eleganter – viel Holz, viel Glas und ein hohes Giebeldach, damit der Schnee, der niemals fiel, daran abglitt.
Dummes Glas. Sie nahm es wahr wie ein leises Vibrieren, eine dumpfe, aber irritierende atmosphärische Störung. Glas störte ihre Gabe. Doch noch war es zu weit weg, um ein echtes Problem darzustellen, versicherte sie sich.
Auch wenn es nicht recht in die Umgebung passte, Friars Haus war schön. Sie wünschte, es wäre nicht so. Ihr war schon klar, dass das Böse nicht als buckeliger Glöckner von Notre-Dame daherkam, doch irgendwie erschien es ihr falsch, dass jemand wie Robert Friar Schönheit erkannte und sie zu schätzen wusste.
Auch die Landschaft drumherum war schön, auf eine raue und wilde Art. Sie war hindurchgefahren, als es noch hell war, nicht ganz bis zum Haus, das ein gutes Stück vom Highway entfernt an einer Privatstraße lag. Aber nah genug, um die besondere Schönheit dieser struppigen Berge zu bewundern … oder befand sie sich immer noch im Vorgebirge? Wo endete das eine, und wo begann das andere?
Ist doch egal, sagte sie sich streng. Sie wusste, sie neigte dazu, sich in Grübeleien über interessante Details zu verlieren. Egal wie es hieß, die Gegend um Friars Haus war hügelig. Doch die Steigungen waren nicht allzu steil – Gott sei Dank, denn um hierherzugelangen, hatte sie einen Bergkamm überwinden müssen. Sie selber konnte sich vor unerwünschten Blicken verbergen, nicht aber zusätzlich noch ihren Mietwagen. Deshalb hatte sie ihn am Rande eines Feldwegs zurückgelassen, der auf den meisten Karten der Gegend nicht verzeichnet war.
Das war Arjenies Stärke: Informationen zu beschaffen, die nicht leicht verfügbar waren.
Auf der Rückseite der Hütte war kein Garten, nur eine kleine Terrasse. Kurz dahinter standen auch schon die Bäume – vor allem Kiefern und noch ein paar andere dürre Dinger. Vermutlich bezeichnete man so etwas in diesem trockenen Teil des Landes als Wald. Doch da, wo sie herkam, in Virginia, da gab es ganz andere Wälder.
Über den Fluss und durch den Wald gehen wir zu Großmutters Haus… Hier gab es keinen Fluss und auch keine Großmutter, aber der Weg zurück führte durch die Bäume und über den Hügel. Oder den Berg. Was auch immer.
Sie hatte gerade den Weg verlassen und ging über knirschende Kiefernnadeln, als sie Stimmen vernahm. Sie erstarrte, und ihr Herz spielte wieder den Angsthasen. Sie widerstand der Versuchung, ihre Gabe noch zu verstärken. Die Stimmen kamen von dem anderen Ende der Hütte, und sie hatte ihre Gabe seit zwei Stunden ohne Unterbrechung genutzt. Sie konnte es sich nicht leisten, all ihre Energie zu verbrauchen. So mächtig war sie nicht.
Die Stimmen gehörten Männern, und was sie sagten, war nur undeutlich zu verstehen … dass sie später ein Bier trinken wollten oder so. Kurz darauf hörte sie einen dumpfen Schlag, als sich die Tür der Hütte schloss, und die Stimmen verstummten plötzlich.
Zittrig atmete sie aus. Wenn sie doch nicht so in Panik geraten würde. Dies hier war nichts anderes als die Hunderte von Male, die sie ihre Gabe zum Spaß oder zur Übung genutzt hatte … abgesehen natürlich von den Leuten von der Miliz. Leute mit Schusswaffen aller Art. Kurzwaffen in Holstern an den Hüften und Gewehren über der Schulter.
Sturmgewehre, dachte sie und ging vorsichtig weiter in den Wald hinein. Tatsächlich zu Gesicht bekommen hatte Arjenie noch kein Sturmgewehr, aber sie hatte darüber gelesen und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Sturmgewehre hatten einen selektiven Feuermodus, was bedeutete, dass sie auf vollautomatische Schussfolgen umstellen konnte. Das M16 zum Beispiel konnte je nach Modell 950 Schuss pro Minute abgeben. Natürlich waren das Mittelpatronen, die nicht die gleiche Durchschlagskraft wie die eines normalen Gewehrs hatten, aber 950 Schuss pro Minute reichten, um einen Menschen zu Hackfleisch zu verarbeiten.
Wie lang waren diese Gewehre, die die Miliztypen hatten? Mir gerunzelter Stirn ging sie bergauf und versuchte sich zu erinnern. Sturmgewehre hatten kürzere Läufe. Aber sie war den Waffen nicht sehr nah gekommen – Gott sei Dank – und hatte fürchterliche Angst gehabt. Normalerweise sah sie so etwas nur auf Fotos oder auf einem Bildschirm, nicht wirklich live und in Farbe.
Vielleicht war es auch ein Kampfgewehr gewesen, so etwas wie ein M14. Arjenie wusste nicht viel darüber, nur dass sie einen längeren Lauf besaßen und Gewehrpatronen mit stärkerer Ladung verschossen. Beim Militär benutzte man sie, um Ziele in einer Entfernung von etwa einhundert Metern zu treffen, aber sie glaubte nicht, dass –
Ein Schutzbann – ein Bann genau hier, und sie wäre fast daraufgetreten. Sie stolperte zurück, weg von der Linie, von der sie wusste, dass sie da war, auch wenn sie sie nicht sehen konnte.
Ihr linker Fuß knickte weg. Sie ruderte mit den Armen und landete auf dem Hintern. Ein scharfes Kribbeln schoss ihren Knöchel hoch.
Heftig atmend klopfte sie ihre Taschen ab. Beide Glasfläschchen schienen unversehrt. Sie tastete nach den Stopfen – sie waren beide noch fest – und stieß erleichtert die Luft aus. Sie rieb sich den Knöchel und runzelte die Stirn, als ihr die Tränen in die Augen stiegen.
Wann würde sie es endlich lernen? Sie konnte nicht einfach nur gehen. Sie musste aufpassen. Vor allem, wenn sie im Dunkeln auf einem großen Hügel oder kleinen Berg herumspazierte – einem Hügel mit Schutzbannen und Männern mit Schusswaffen, die sofort angerannt kommen würden, wenn sie einen der Schutzbanne aktivierte.
»Scheibenkleister«, flüsterte sie. Ihr Knöchel begann zu pochen. Er war heiß und tat weh, so weh, dass sie nicht aufhören konnte zu weinen. »Heiliger Scheibenkleister. So ein Mist.«
Wenigstens hatte sie den Schutzbann nicht ausgelöst. Womöglich hätte sie ihn gar nicht aktiviert, wenn sie darübergegangen wäre – ihre Gabe täuschte die meisten Banne –, aber dieser hatte viel Energie und sie nicht. Sie hatte sehr viel Kraft dabei verbraucht, sich so lange zu verbergen.
Die Fähigkeit, Schutzbanne zu erspüren, war eine Nebenwirkung ihrer Gabe. Sie sah sie weder noch spürte sie sie. Sie wusste es einfach. Voraussetzung war, dass sie gerade aktiv ihre Gabe nutzte, aber wenn das der Fall war, genügte ein kurzer Blick. Es war, als hätte die Gabe das Sehen für sie übernommen, sodass die Informationen nicht den Weg über die Sehrinde nahmen, sondern direkt bei ihr ankamen. Gewöhnlich hatte sie eine ungefähre Vorstellung davon, wie stark ein Bann war, wie komplex, und manchmal wusste sie auch, welcher Art er war.
Der, auf den sie fast getreten war, war ein Rufzauber – so viel wusste sie immerhin –, und ein starker noch dazu, wahrscheinlich so angelegt, dass er Friar warnte, sobald etwas Großes, Lebendiges ihn überquerte. Und sie hatte gewusst, dass sie danach Ausschau halten musste, denn diesen hier hatte sie bereits auf dem Hinweg entdeckt. Sie hatte vorgehabt, ihm zu dem Punkt zu folgen, wo die Erde ihn nicht mochte. Viele Praktizierende würden die Vorstellung belächeln, dass die Erde Vorlieben und Abneigungen hatte, aber Arjenie hatte es von ihrer Mutter gelernt, die eine Erdhexe gewesen war, eine starke Erdhexe. Arjenie glaubte, dass es daran lag, dass sie selbst auch ein bisschen die Erde spürte, obwohl ihre eigene Gabe eine Luftgabe war.
Die Erde war keine einheitliche Fläche. Hier war Granit, dort war Sand und irgendwo anders Lehm. Einige Stellen ließen Pflanzen wachsen, andere nicht. An der Stelle, an der die Erde den Bann nicht mochte, arbeitete sie auch nicht mit ihm zusammen, das hieß, dort war er schwach, sodass Arjenie ihn mithilfe ihrer Gabe unbemerkt überqueren könnte.
Durch ihre Verletzung würde das nun noch schwerer. Wenn sie doch nur achtgegeben hätte, dann hätte sie … Arjenie schnitt eine Grimasse. Wenn, wenn, wenn … damit kam man nicht weiter. Besser, sie stand auf und fand heraus, wie lädiert sie tatsächlich war. Nein, Moment. Zuerst sollte sie sich einen Ast suchen, den sie als Spazierstock verwenden konnte. Mit diesem Knöchel brauchte sie etwas, auf das sie sich stützen konnte.
Ihre Wangen waren feucht. Sie wischte darüber. Sie weinte immer, wenn sie Schmerzen hatte. Früher war es ihr peinlich gewesen – es kam ihr so kindisch vor –, aber dann hatte sie gemerkt, dass Tränen einfach zum Standardmodell »Arjenie« dazugehörten: stolpert schnell, gutes Gedächtnis, weint, wenn sie Schmerzen hat.
Arjenie sah sehr gut im Dunkeln, und der Mond stand direkt über ihr. So hatte sie schnell einen schönen langen Stock entdeckt, der kräftig genug aussah, sie zu tragen – und auch das große haarige Tier, das genau daneben saß und sie beobachtete.
Ihr Herz machte einen Satz und begann wie wild zu hämmern.
Er war groß. Viel zu groß. Und er konnte sie sehen. Dessen war sie sich sicher. Sie hatte ihn nicht kommen hören, aber dort war er nun, riesig und dunkel … war sein Fell tatsächlich schwarz oder sah es im Mondlicht nur so aus? Er hatte den Kopf aufmerksam gehoben, die Ohren gespitzt, nicht angelegt – das war ein gutes Zeichen, oder nicht? Er knurrte weder noch bleckte er die Zähne … »Br-braves Hundchen«, stammelte sie, doch schon als sie es aussprach, wusste sie, dass dies kein Hund war.
Er legte den Kopf schief. Als wollte er ihr antworten, trafen sich ihre Blicke. Und ließen sich nicht wieder los.
Sie fiel. Obwohl sie schon auf ihrem Hintern saß, fiel sie – für einen Moment, einen unermesslich kurzen Augenblick, tat sich die Erde um sie herum auf, oder sie fiel durch die Erde und endete …
Er sprang auf alle viere. Machte einen Schritt zurück – einen unbeholfenen Schritt, fast taumelnd. Dann noch einen.
»Nein – nicht da lang. Pass auf den –«
Zu spät. Dort, wo seine Hinterpfote über den Bann strich, strahlte plötzlich Licht auf, hell wie ein Leuchtfeuer.
»Oh nein.« Ein visueller Rufzauber. Die waren selten. Ihr war es gar nicht in den Sinn gekommen, dass Friar über einen verfügen könnte, aber es ergab Sinn. Die Miliztypen würden ihn sehen und kommen. »Geh.« Sie wedelte mit beiden Händen. »Los, lauf weg.«
Stattdessen nahm er den Stock, den sie im selben Moment wie ihn entdeckt hatte, zwischen die Zähne. Dann kam er zu ihr und legte ihn auf den Boden neben sie.
Oh, er war wirklich riesig. Sie schluckte.
Aber er war nicht nur ein Wolf. Das war gut, sagte sie sich bestimmt. Sie hatte noch nie einen Werwolf persönlich kennengelernt, aber ein paarmal hätte sie beinahe Rule Turner getroffen – der der Öffentlichkeit als der Werwolfprinz bekannt war, auch wenn er selber sich anders nannte. Aber sein Volk nannte sich ja auch nicht Werwölfe. Sie waren Lupi. Lupi waren keine reißenden, blutdurstigen Bestien, die Menschen töteten.
Wenigstens nicht ohne wirklich guten Grund. Auch FBI-Agenten töteten niemand ohne einen wirklich guten Grund, und mit ihnen arbeitete sie ständig zusammen, oder nicht? Warum hämmerte ihr Herz dann so heftig?
»Äh – danke.« Sie nahm den Stock und stützte sich darauf, als sie sich unsicher aufrappelte. Wieder wurden ihre Augen feucht. Mit diesem Knöchel würde sie unmöglich rennen können. Aber gehen konnte sie. Vorsichtig. Langsam. Vielleicht gelang es ihr, genug Abstand zwischen sich und den leuchtenden Bann zu bringen, bis die Männer mit den Gewehren eintrafen. Sie begann zu humpeln, der Linie des Banns zu seinem schwachen Punkt folgend.
Der Wolf blieb bei ihr, aber auf der anderen Seite des Banns. Konnte er ihn sehen oder spüren? Sein Kopf näherte sich ihrem Brustkorb. Dem oberen Ende ihres Brustkorbs. »Geh schon«, flüsterte sie. »Sie werden mich nicht sehen, dich aber schon.«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich will nicht mit dir mitgehen«, erklärte sie. »Mir wird nichts passieren, aber wenn du bei mir bist –«
Er rempelte sie an. Nur einmal, aber absichtlich, mit der Flanke. Sie taumelte, stürzte aber nicht.
Was hatte das zu bedeuten? War er … oh. Er starrte den Weg zurück, den sie gekommen war. Vielleicht lauschte er. Lupi hatten ein sehr gutes Gehör. Vielleicht wollte er, dass sie den Mund hielt, damit er besser hören konnte. Möglicherweise waren die Miliztypen auf dem Weg zu ihnen. Was hatte er –
Schneller als sie blinzeln konnte, löste er sich aus seiner statuenähnlichen Erstarrung und begann zu rennen – Anmut und Geschwindigkeit verschmolzen zu einer verwischten Bewegung.
Er war wunderschön.
Und außerdem sehr laut, als er nun durch einen Busch brach, als bliebe keine Zeit, ihn zu umlaufen. Er rannte auf direktem Wege zurück zum Haus. Wo die bewaffneten Männer waren. Direkt auf sie zu.
Ihre freie Hand hob sich, als könnte sie ihn zurückrufen – aber da war er schon außer Sichtweite.
Der erste Schuss war unwirklich laut. Der zweite ebenso, aber der dritte klang, als würde er ein bisschen weiter weg abgegeben. Arjenies Augen füllten sich mit Tränen und liefen über, als könnte sie so die neue ungeheure und unbestimmte Angst ertränken.
Sie schluckte heftig. Ihre Hand war immer noch ausgestreckt, versuchte immer noch, ihn zurückzurufen. Sie ließ den Arm sinken.
Arjenie wandte sich um. Die immer neuen Tränen zurückblinzelnd, begann sie langsam und unter Schmerzen den Hügel entlangzugehen, dem Bann zu seiner Schwachstelle folgend. Zurück zu ihrem Wagen. Nun war sie sicher, dass sie es schaffen würde. Sie musste. Schließlich hatte er nur für sie die Aufmerksamkeit der Männer mit den Schusswaffen auf sich gelenkt, nicht wahr? Um sie von ihr abzulenken.
Sie konnte ihm nicht helfen. Konnte nichts tun, außer sich selbst in Sicherheit bringen. Sie hatte keine Waffen, konnte nicht mit Waffen umgehen, hatte keine Möglichkeit, das, was immer nun passierte, zu verhindern. Aber sie wünschte, so inständig wie vergeblich, dass sie sich erinnern könnte, wie lang die Läufe der Feuerwaffen der Wachen, damit sie wusste, ob sie in der Lage waren, 950 Schüsse pro Minute zu feuern.
Arjenie hatte den Bann überquert und war schon fast am Gipfel des Hügels angekommen, als ihr ihre Frage beantwortet wurde. In der Ferne erklang Gewehrfeuer, schwer und lang andauernd. Ganz offensichtlich hatte zumindest einer von ihnen ein vollautomatisches Gewehr.
2
Jawohl. Alle vier Reifen, aufgeschlitzt und platt.
Schweiß rann unter Lilys BH hervor, fuhr mit einem klammen Finger über ihren Rücken und drohte in ihren Augen zu brennen. Nicht dass es sehr heiß gewesen wäre. Die Hitzewelle war endlich abgeebbt, und San Diego genoss die Milde des späten Septembers. Aber diese Stadt machte zu dieser Jahreszeit einen Mangel an Regen gern mit hoher Luftfeuchtigkeit wett, vor allem morgens. Der Schweiß, den ihr Körper während des Joggens abgegeben hatte, wusste nun nicht, wohin.
Sie fuhr sich mit dem Unterarm über das Gesicht, verteilte aber eher die Feuchtigkeit, als sie zu trocknen, und runzelte die Stirn.
Werwolfshure.
Das war mit schwarzer Farbe auf die Motorhaube des Fords, ihrem Dienstwagen, gesprüht. Und auf dem Kofferraum hatte der Täter ein PS angefügt: Scheißschlampe Verräterin.
Einer ihrer Nachbarn?, überlegte sie, während sich ihr Herz langsam beruhigte. Zugang zu ihrem Auto hatten sie zwar, aber eigentlich hielt sie es für unwahrscheinlich.
Fanatiker – die, die Worten rasch Taten folgen ließen – waren für gewöhnlich berechenbar. Es gab Ausnahmen, wie zum Beispiel der Typ, der einen Wachmann des Holocaust-Museums getötet hatte. Er war beinahe neunzig gewesen. Aber die Chancen standen gut, dass das Arschloch, das ihren Wagen beschmiert hatte, ein weißer, heterosexueller Mann war, zwischen zwanzig und sechzig und entweder arbeitslos oder beruflich frustriert. Vermutlich hasste er auch Schwule und Immigranten, Schwarze und Juden – jeden, den er beschuldigen konnte, die »natürliche Ordnung« gestört zu haben, in der seine rechtmäßige Position selbstverständlich an der Spitze war. Da er aber meilenweit entfernt von der Spitze war, musste wohl irgendjemand Schuld daran haben.
Lily hatte zahlreiche Nachbarn, die männlich und zwischen zwanzig und sechzig Jahre alt waren. Manche hassten vielleicht auch ihre Arbeit, aber sie verdienten alle gut ihren Lebensunterhalt. In dem Hochhaus, in dem sie jetzt wohnte, waren die Mieten entsprechend hoch.
Aber nicht jeder Fanatiker hatte finanzielle Probleme. Der Beweis war Robert Friar.
Lily schüttelte den Kopf. Schade, dass sie nach einem guten Lauf diesen Mist hier vorfand. Das machte die ganzen schönen Endorphine wieder zunichte. Wenn der Täter noch in der Nähe gewesen wäre, hätte sie sich noch einmal ein Hoch verschafft, indem sie sich den Mistkerl vorgeknöpft hätte. Aber sie war allein in der Garage … bis auf ein paar ihrer Nachbarn.
Der Prius, der jetzt aus seiner Parknische zurücksetzte, gehörte einer alleinerziehenden Mutter aus dem ersten Stock. Wendy Soundso. Wendy verließ jeden Wochentag um diese Zeit das Haus, um die Kinder in der Tagesstätte abzusetzen. Sie war weiß, hatte braune Augen, braune Haare, war unter vierzig, arbeitete in irgendeiner Bank – Lily erinnerte sich nicht mehr, in welcher – und sah immer müde aus. Es war sehr unwahrscheinlich, dass sie solche Ausdrücke auf einen Wagen sprühte, während ihre Kinder dabei zusahen.
Der Mann, der jetzt den Betonboden überquerte, um zu seinem Lexus zu gehen, fuhr in der Woche ebenfalls täglich um sieben Uhr los. Er war leitender Angestellter in irgendeiner Firma mit einem Namen aus Buchstabensalat, übergewichtig, gepflegt, um die vierzig und Hispanoamerikaner. Braune Augen, schwarzes Haar mit ein paar grauen Strähnen. Fünfter Stock, dachte sie. Er käme in Betracht, dachte sie, aber mehr auch nicht.
Dann war da noch das Motorrad, das sie beim Ankommen aus der Garage hatte herausfahren sehen. Jack war ein netter Kerl, der in einer spektakulär erfolglosen Band spielte. Außerdem modelte er dann und wann, aber wenn nicht sein Freund gewesen wäre, der irgendeinen Treuhandfonds besaß, hätte er sich die Miete nicht leisten können. Besagter Freund war, fand Lily, ein Arschloch, aber nicht die Sorte Arschloch, die vor sieben Uhr morgens aufstand, um Beleidigungen auf den Wagen eines FBI-Agenten zu kritzeln.
Obwohl es unwahrscheinlich war, dass der Täter noch in der Nähe war, blieb sie wachsam, als sie jetzt ihr Handy aus der Armbinde holte, die sie zum Laufen trug. Sie machte ein paar Fotos von dem Schaden und sah dann nach den Überwachungskameras.
Sie schienen unversehrt zu sein. Vielleicht hatten sie das Arschloch auf frischer Tat und aus einem guten Winkel erwischt. Es wäre nett zu wissen, dass es niemand war, neben dem sie tagtäglich im Aufzug stand.
Aber um die Aufnahmen der Kameras einsehen zu können, musste sie es Rule sagen. Ihm gehörte das Gebäude. Oder seinem Vater. Aber eigentlich gehörte es dem Clan. Dem Clan der Nokolai, um genau zu sein. Denn Rule gehörte nun zwei Clans an, was ebenfalls eine Quelle für Ärger war.
Lily betrat den Aufzug und drückte den Knopf für den neunten Stock. Sie hätte es Rule lieber nicht gesagt. Sie musste, aber sie wollte nicht. Bis die Hitzewelle ausbrach und sie wieder draußen laufen konnte, war ihr nicht klar gewesen, wie besorgt er tatsächlich um sie war. Er wollte nicht, dass sie alleine joggte. Er hatte immer neue Gründe gefunden, um sie zu begleiten, und als er nicht selber mitkommen konnte, hatte er versucht, eine oder zwei seiner Wachen mitzuschicken.
Das hatte sie sofort unterbunden. Zugegeben, im letzten Monat hatte es eine Situation gegeben, da hatten die Wachen sich als nützlich erwiesen. Aber dieser Fall war nun abgeschlossen. Seine Vorsicht war übertrieben und lästig. Auch deswegen wollte sie ihm lieber nichts von dem Wagen erzählen.
Ein weiterer Grund war, dass Rule nur allzu schnell bereit sein würde, sich selbst die Schuld für den Vandalismus zu geben. Was noch schwerer für sie zu ertragen war, denn sie konnte ihm deswegen nicht böse sein. Sie verstand ihn sogar. Sie hatte ganz ähnlich gefühlt, als sie sich Sorgen gemacht hatte, was für Folgen ihre Heirat für ihn haben würde.
Als Rule sie gebeten hatte, ihn zu heiraten, hatte er ein jahrhundertealtes Tabu seines Volkes verletzt. Und als sie seinen Antrag annahm, hatte sie den Fanatikern dieser Welt ein neues Ziel verschafft. Sich selbst.
Der Aufzug hielt mit einem »Kling« an. Lily stieg aus und wandte sich nach links. Rule bewohnte eine Eckwohnung. Nein, siebewohnten eine Eckwohnung. Gemeinsam. Es war vier Monate her, dass sie ihre alte Wohnung aufgegeben hatte, und noch länger, dass sie so gut wie zusammenlebten … und beinahe ein Jahr, dass sie ihn das erste Mal gesehen hatte, im Krach und schwachen Licht des Club Hell.
Beinahe ein Jahr, dass sich ihr Leben geändert hatte, und dann wieder und wieder. Es war an der Zeit, dass sie diese Wohnung nicht mehr nur als die seine betrachtete.
Wenn sie vielleicht ein paar neue Kissen oder einen neuen Teppich kaufen würde …
Vor der Wohnungstür standen zwei von Rules Bodyguards. Dieses Team gehörte zum Leidolf-Clan. Sie hatte beschlossen, sie als neugierige, aber wohlmeinende Nachbarn zu sehen – so wie viele sehr muskulöse Mrs Kravitzes aus Verliebt in eineHexe – nur mit Waffen und der irritierenden Bereitschaft, wenn nötig, ihr Leben für sie zu riskieren.
Sie sahen beide jung aus, nur einer von ihnen war es tatsächlich. Jeffrey Lane war vierundzwanzig Jahre alt, kaum erwachsen in den Augen eines Lupus, und einer der beiden Leidolf, die Rule mit nach San Diego gebracht hatte, damit sie hier zu Wachen ausgebildet wurden.
»Jeff«, sagte sie, als sie näher kam. »Was haben Sie sich bloß dabei gedacht?«
Der Kleinere der beiden fasste sich verlegen ans Haar. »He, das hier ist doch Kalifornien, oder nicht?«
»Es ist pink.«
Er grinste. »Dafür habe ich bereits Ärger bekommen. José sagt, ich falle jetzt zu sehr auf. Aber ich dachte, hier könnte ich … Sie wissen schon.«
»Siehst du etwa viele Männer mit pinkfarbenen Haaren in diesem Gebäude?«, sagte der Größere. »Vielleicht in ein paar von diesen Clubs, wo du so gern herumhängst, aber nicht hier, wo Rule wohnt. Hier fällst du auf.« LeBron schüttelte den Kopf. Seit Kurzem rasierte er sich den Schädel. Groß und kräftig, wie er war, sah er aus wie ein brauner Meister Proper, nur ohne den Ohrring.
Jeff versuchte beschämt auszusehen. Es gelang ihm nicht sehr überzeugend.
»Wie war der Lauf? Gut?«, fragte LeBron Lily.
»Sehr gut.« Sie sagte nichts von den Schmierereien auf ihrem Wagen. Das war eine FBI-Angelegenheit, nichts, worum sich die Clans kümmern müssten. Ihren neugierigen Nachbarn hätte sie schließlich auch nichts davon erzählt, oder? »Heute soll es noch regnen. Glauben Sie, das stimmt?«
»Regnet es denn tatsächlich in San Diego?«, sagte LeBron. »Ich dachte immer, das wäre nur ein Mythos. Etwas, das man den Neuankömmlingen erzählt, um sie auf den Arm zu nehmen.«
Die Leidolf-Wachen stammten aus North Carolina – dem grünen, feuchten North Carolina. Sie schüttelte den Kopf. »Mist, jetzt sind Sie mir auf die Schliche gekommen. Haben Sie von Samuel gehört? Hat er den Job bekommen?«
LeBron hatte zwei erwachsene Söhne. Samuel war der jüngere. LeBron sah aus, als wäre er nur zehn Jahre älter als Jeff, aber in Wahrheit war er eher sechzig als dreißig. Natürlich war auch das jung – für einen Lupus, die erst mit achtzig in den mittleren Jahren waren.
»Bisher hat er noch nichts gehört, aber er hatte den Eindruck, dass das Vorstellungsgespräch gut gelaufen ist.«
»Lassen Sie es mich wissen, wenn es etwas Neues gibt.« Lily benutzte ihren eigenen Schlüssel. Jeder der beiden Männer hätte ihr aufschließen können, aber sie zog es vor, es selbst zu tun. Sie redete sich ein, dass es nur praktisch war – so hatten sie die Hände frei und waren im Falle einer plötzlichen Bedrohung nicht abgelenkt – aber eigentlich wusste sie, dass sie damit auch ein bisschen die Augen vor der unangenehmen Wahrheit verschloss.
Denn wenn sie die Tür selbst öffnete, konnte sie so tun, als hätten die beiden keine Schlüssel.
Die Wohnung war herrlich. Das war ein Teil des Problems. Nichts, das sie sich hätte leisten können, passte hier hinein. Rule hatte alles in einem modernen, männlichen Stil eingerichtet, mit Ledersofas und schönen alten Holzmöbeln. Die Kristallschale, in die sie nun ihre Schlüssel warf, stand auf einem zweihundert Jahre alten Konsolentisch im Flur. Ihre schnöde Wasserflasche passte nicht recht dazu, aber der Platz bot sich an, wenn sie laufen ging. Sie nahm die Flasche und trank im Gehen.
Der Hauptraum war der Star der Show. Eine riesige Glaswand verband den Wohn- mit dem Essbereich. Die erste Morgensonne fiel durch die Scheibe und verlieh dem Haar des Mannes, der an dem großen Esstisch aus dunklem Holz am anderen Ende des Raumes saß, einen mahagonifarbenen Schimmer.
In anderem Licht war Rules Haar fast schwarz. Und es war struppig, egal in welchem Licht. Früher hatte sie gedacht, dass es zu seiner Rolle dazugehörte, ein Look, den er als Auftreten der Lupi in der Öffentlichkeit kultivierte. Dabei war es nur so, dass Rule sich nicht gern die Haare schneiden ließ. Doch es stand ihm, weil er so unverschämt sexy war. Dennoch gefiel ihr der Gedanke, dass das struppige Haar nicht nur Teil einer Rolle war, sondern zu ihm gehörte.
Ohne von dem Laptop aufzusehen, der auf einem Wust von Papieren stand, die über den halben Tisch ausgebreitet waren, sagte Rule: »Deine Mutter hat einen billigeren Drucker für die Einladungen gefunden. Du möchtest sie bitte zurückrufen. Das kannst du gleich jetzt tun, ich habe bereits Maßnahmen wegen des Schadens an deinem Wagen ergriffen.«
Sie blieb stehen. »Ah … oh. Wen hast du angerufen?«
»Deine derzeitigen Waffenbrüder. Das hiesige FBI-Büro.« Jetzt sah er auf. »Du hattest doch vor, es mir zu sagen, oder?«
»Ich habe drüber nachgedacht. Wie hast du es herausgefunden?«
»José hat es gesehen, als er das Gebäude verließ, um etwas für mich zu erledigen.«
José war ein Nokolai und der Chef der Bodyguards. »Dann hast du also das Büro angerufen, ohne vorher mit mir darüber zu reden.«
Jetzt blickte er sie an. »Ich habe dich angerufen. Du bist nicht drangegangen.«
Lily öffnete den Mund, um zu widersprechen – und schloss ihn wieder. Sie zog die Armbinde ab, nahm ihr Telefon heraus und sah nach. Und zog eine Grimasse. »Der Ton ist ausgestellt. Tut mir leid. Mit wem hast du gesprochen?«
»Agent Gray. Er hat mir zugesagt, dass er sofort jemanden herschickt. Ich soll dir ausrichten, dass der Handschriftenexperte bestätigt hat, dass der Brief, den du letzte Woche erhalten hast, von … äh … dem Täter geschrieben wurde, den du in Verdacht hattest. Der, der so gern sexuell anzügliche Briefe schreibt.«
»Es tut gut, wenn man recht hat.« Der Brief war abstoßend gewesen, nicht bedrohlich. Der Typ, der ihn verfasst hatte, war bekannt – nicht namentlich, aber er war schon früher auffällig geworden. Es erregte ihn, schmutzige »Liebesbriefe« an Frauen zu schicken, über die in den Nachrichten berichtet wurde. Dabei zeigte er sich enttäuschend promisk und beglückte alle, von Britney Spears bis zur First Lady. »Ich habe dir von dem Brief erzählt.«
Seine Augenbrauen – die im Übrigen sehr attraktiv waren – hoben sich. »Ja, das hast du. Aber nicht von den anderen Briefen. Die, die das FBI immerhin so ernst genommen hat, dass es ermittelt hat. Von denen hast du mir nicht erzählt.«
Erwischt. Gray, diese Petze. »Weil du voreilige Schlüsse gezogen hättest. Das FBI verfolgt alle Drohungen, die seine Agenten bekommen. Das ist das übliche Verfahren und nichts, weswegen man sich Sorgen machen müsste.«
»Wenn dich jemand bedroht, mache ich mir Sorgen.« Er erhob sich. »Halte solche Dinge nicht vor mir geheim, nur weil du fälschlicherweise glaubst, mich schützen zu müssen.«
Rule war einer dieser Männer, die immer elegant aussahen, egal was sie trugen. Vielleicht lag es an den Schultern oder an den Läuferbeinen oder einfach an seiner anmutigen Art sich zu bewegen. Heute war er ganz in Schwarz gekleidet, wie immer – schwarze Hose mit einem schwarzen Hemd, dessen Ärmel er aufgekrempelt hatte. Er war barfuß.
Wahrscheinlich war es seltsam, dass sie seine Füße sexy fand, wenn er ganz offensichtlich böse auf sie war. Und nicht ohne Grund, musste sie zugeben. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, wäre sie stinksauer. »Okay.«
Seine Brauen schossen in die Höhe. »Okay? Einfach so?«
»Unter einer Bedingung. Wir streiten uns nicht wieder darüber, ob ich Bodyguards brauche.«
Er überlegte einen Moment. »Vertagen wir das Thema fürs Erste. Aber ich behalte mir das Recht vor, es wieder anzusprechen, falls die Situation es erfordert.«
»Rule, ich kann nicht mit Lupus-Bodyguards durch die Gegend laufen! Abgesehen davon, dass Friar seinen Spaß daran haben wird, wenn er es herausfindet – und er wird es irgendwann herausfinden –, verstößt es gegen den Grundsatz der Vertraulichkeit. Zivilisten dürfen bei Ermittlungen nicht anwesend sein.«
»Ich dachte, wir hätten das Thema vertagt.«
Sie schnaubte. »Warum kommt es mir so vor, als hättest du gewonnen, wenn ich doch eigentlich bekommen habe, was ich wollte.«
Er lächelte, schnell und ungezwungen. »Weil du eine zutiefst misstrauische Frau bist. Und was diese Drohbriefe angeht –«
Eine Herde Elefanten kam durch den Flur, der zum Schlafzimmer führte, getrampelt. Eine Sekunde später kam die Herde in Sicht: ein neun Jahre alter Junge mit dunklem Haar und den Augenbrauen seines Vaters. Er trug Unterhosen – und sonst nichts.
Toby kam schlitternd vor ihnen zum Stehen. Er grinste. »Ich habe Hunger! Was gibt’s zum Frühstück?«
»Hamburger«, sagte Rule. »Aber du scheinst noch nicht fertig zu sein.«
»Das ist meine neue Strategie«, erklärte Toby. »Hi, Lily. Du bist ganz verschwitzt.«
»Das stimmt«, bestätigte sie, erstaunt über das Gefühl, das sich in ihr regte. Wie war es möglich, dass sie so für einen Jungen empfand, den sie erst so kurz kannte? »Ich brauche eine Dusche.«
»Ich habe schon gestern Abend geduscht. Das gehört ebenfalls zu meiner Strategie. Wenn Dad sagt, ich soll aufstehen, lege ich meine Kleider bereit, aber ich ziehe sie erst nach dem Essen an. So brauche ich keine Angst zu haben, mich zu bekleckern. Na ja, abgesehen von meiner Unterwäsche, aber wenn ich darauf Flecken mache, sieht es ja keiner.«
Rule nickte nachdenklich. »Ich glaube, das nennt man eine Taktik, keine Strategie. Eine Taktik meint die Mittel, mit denen man ein bestimmtes Ziel erreichen will. Eine Strategie ist der übergeordnete Plan, wie man Mittel und Ressourcen einsetzt, um ein Ziel zu erreichen.«
»Ja?« Toby dachte darüber nach. »Dann ist es also meine Strategie, meine Kleider sauber zu halten, und meine Taktik, sie nicht zu tragen, wenn ich esse.«
»Ganz genau. Unglücklicherweise funktioniert diese Taktik nur zu Hause.«
»Na klar! In der Schule würden die anderen doch denken, ich hätte sie nicht mehr alle, wenn ich mich zum Mittagessen in der Cafeteria ausziehen würde.«
»Damit ist diese Taktik wirkungslos. Das übergeordnete Ziel wird es sein, dass du lernst, dich nicht mit Essen zu bekleckern.«
Toby machte ein trauriges Gesicht. »Du meinst, ich soll mich anziehen.«
»Ich fürchte, ja.«
»Wenn ich bei Grandpa bin, muss ich mich nie vor dem Frühstück anziehen.«
Grandpa war Rules Vater, Isen Turner – der Rho der Nokolai. Die Zeit bis zum Schulanfang hatte Toby bei ihm auf dem Gut des Clans verbracht.
»Das war während der Sommerferien«, sagte Rule entschieden. »Wenn die Schule anfängt, gelten andere Regeln.«
Das war ein vielsagendes Argument. Bis vor zwei Monaten, als Rule endlich das Sorgerecht erhalten hatte, war der Junge von seiner Großmutter mütterlicherseits aufgezogen worden, Louise Asteglio. Lily wusste, dass Louise darauf bestanden hatte, dass Toby bekleidet zum Frühstück erschien.
Toby zog ein Gesicht. »Aber –«
»Toby.«
Toby seufzte schwer. Dann hellte sich seine Miene wieder auf. »Hamburger?«
Rule nickte.
»Machst du für Lily auch einen?«
Auf diese Frage antwortete sie selbst. »Ich habe schon vor dem Laufen gegessen. Sport auf leeren Magen ist nicht gut.«
»Ja, aber …Hamburger. Zum Frühstück.«
So etwas hatte es bei seiner Großmutter in North Carolina nicht gegeben. Und bei Lily zu Hause, als sie noch klein war, ebenfalls nicht. Einige von Mrs Asteglios Regeln behielt Rule bei, zum einen, weil sie sinnvoll waren, und zum anderen, weil er Toby eine Kontinuität bieten wollte. Aber er sah nicht, was dagegen sprach, Hamburger zum Frühstück zu essen. Selbst ein menschlicher Junge braucht morgens Proteine, pflegte er zu sagen.
Und Toby war kein Mensch. Er war ein Lupus, auch wenn er sich erst in einen Wolf wandeln würde, wenn er in die Pubertät kam. Lupi brauchten große Mengen an Protein, auch vor dem Wandel.
»Ich fürchte, ich habe keine Zeit mehr«, sagte Lily. »Ich muss mich duschen und anziehen, sonst schaffen wir es nicht mehr pünktlich zur Schule.« Es war ihre Idee gewesen, Toby morgens zur Schule zu fahren. Eigentlich hätte Rule es übernehmen können. Und auch die Wachen hätten diese Aufgabe ausnahmslos freudig übernommen – und würden es vielleicht auch tun müssen, wenn ihre Arbeit sie in Beschlag nahm. Aber Lily waren die wenigen Minuten mit Toby allein im Auto wichtig.
Toby nickte. »Dad kann dir einen machen, den du mitnehmen kannst. He, Dad!« Er wurde aufgeregt. »Hast du ihr erzählt, dass –«
»Noch nicht«, sagte Rule, »und es sollte eine Überraschung sein, also zieh dich an, bevor du sie verdirbst.«
Toby kicherte, warf Lily einen verschmitzten Blick zu und rannte davon.
Staunend schüttelte Lily den Kopf. »Der hat aber heute Morgen Hummeln im Hintern. Rule, was diese Überraschung angeht –«
Im selben Moment sagte er: »Was diese Briefe angeht –«
Sie sahen sich an. Lächelten. »Okay«, sagte sie. »Von den Briefen war zuerst die Rede, also fangen wir damit an. Aber schnell, ich muss unter die Dusche.«
3
»Wir reden, während ich koche«, sagte Rule und ging in Richtung der Küche, die neben dem Eingang lag.
Die Küche ihrer Eltern war zwar größer, aber im Vergleich zu der in ihrer alten Wohnung war diese hier riesig. Bisher hatte sie allerdings eine Küche nur gebraucht, um eine Kaffeemaschine und einen Kühlschrank dort abzustellen, doch seit Neuestem lernte sie Kochen. Langsam. »Ich habe keinen Hunger. Ich habe vor dem Laufen gegessen.«
»Ein Joghurt-Smoothie ist keine Mahlzeit.«
»Für dich vielleicht nicht. Außerdem habe ich eine Banane gegessen.«
Er holte das Hackfleisch aus dem Kühlschrank. »Ich bereite dir einen Hamburger zu. Du musst ihn ja nicht essen. Wie viele Drohungen hast du erhalten?«
»Keine, die ich ernst nehmen würde.«
»Das ist keine Antwort.« Er begann, einen Fleischfladen zu formen.
Lily bückte sich, um die große Grillpfanne hervorzuholen, und reichte sie ihm. »Sieben insgesamt. Sechs waren an die FBI-Außenstelle adressiert. Einer ging nach Quantico. Zwei dieser Verrückten haben sogar mit ihrem Namen unterschrieben«, sagte sie trocken. »Sie wurden überprüft und eindringlich verwarnt. Die restlichen Briefe beinhalten offene und versteckte Drohungen.«
»Sag mir ganz genau, mit was sie dir drohen.«
Sie zuckte mit den Achseln. »Einer war ganz traditionell: ›Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen.‹ Von dem haben wir ein paar gute partielle und einen vollständigen Fingerabdruck, aber bisher hat sich noch keine Übereinstimmung ergeben. Die anderen … Rule, sie sind übel, aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Verfasser es nicht bei Worten belassen werden. In den allermeisten Fällen will ein Briefschreiber nur Dampf ablassen, und es kommt zu keiner Eskalation.«
»Anscheinend war das jemandem nicht genug. Er hat deinen Wagen beschmiert und die Reifen zerstochen.«
»Was bedeutet, dass wir sein Bild brauchen, oder nicht?« Sie stellte die Pfanne auf das Kochfeld. »Mittlere Hitze?«
»Ein bisschen mehr. Ich will diese Briefe sehen.«
»Das bringt doch nichts. Du würdest nur –«
»Lily.« Er warf die Fleischfladen in die Pfanne – eins, zwei, drei, vier, fünf. Mindestens zwei waren für ihn, vielleicht auch drei. Toby schaffte keine zwei dieser dicken Frikadellen. »Ich werde nicht in Panik geraten. Denkst du denn, ich hätte nicht auch Drohbriefe erhalten?«
Natürlich. Sie kam sich dumm vor. »Du meinst, du kannst unterscheiden, wann es eine echte Drohung ist, wann nur Vorsicht geboten ist und wann du ihn nicht ernst nehmen musst?«
»Es ist immer zumindest Vorsicht geboten.«
»Okay. Und wie viele Briefe hast du bekommen, seitdem Friar in all diesen Talkshows erscheint?«
Er erstarrte. Dann zuckten seine Lippen. »Ach so … zeigst du mir deins, zeig ich dir meins?«
Sie lächelte nicht. »Wie viele, Rule?«
»Vier. Aber darunter ist nichts –«
»Worum ich mir Sorgen machen müsste? Nichts, dass man ernst nehmen müsste?«
Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Verdammt, Lily, egal wie viele Leute jetzt große Reden schwingen, die Zahl derer, die sich tatsächlich mit dem großen, bösen Werwolf anlegen, ist verschwindend gering. Du bist –«
»Eine große, böse FBI-Agentin«, beendete sie den Satz, bevor er »klein« oder »eine Frau« sagen konnte oder irgendetwas anderes, weswegen sie ihm böse sein müsste. »Ob du es glaubst oder nicht, auch mit uns legen sich die wenigsten gerne an. Wir sind nicht ganz so Furcht einflößend wie du, aber wir können mit dem Gesetz drohen.«
Für einen langen Moment blickte er sie nur mit dunklen Augen an. Sie sah ihm an, dass er nachdachte, konnte aber nicht erkennen, welche Richtung seine Gedanken einschlugen. Daher war es dann auch keine Überraschung für sie, dass er sie überraschte. »Dann lag es nicht an den Drohbriefen, dass du heute Nacht schlecht geträumt hast?«
Sie erwog mehrere Erwiderungen, entschied sich dann aber für »Nein«.
Seine Miene wurde weicher. Er ging zu ihr und strich ihr Haar zurück. Dann blieben seine Hände auf ihren Schultern liegen. »Glaubst du, ich hätte es nicht gemerkt, dass du nach Angst gerochen hast, als du aufgewacht bist?«
»Manchmal ist es tröstlich für mich, dass du meine Stimmungen riechen kannst. Und manchmal ist es einfach nervig.«
Das brachte ihn zum Lächeln, wenn auch nur kurz. »Du hattest gestern eine Sitzung mit Sam.«
Darauf sagte sie nichts. Darüber hatten sie bereits gesprochen. Nun gut, nicht ausführlich – sie war nicht der Typ, der alles ausdiskutieren musste. Aber sie hatten darüber gesprochen.
Letzten Monat hatte Lily erfahren, dass ihre Gabe noch mit weiteren Fähigkeiten verbunden war. Mit der ersten fühlte sie sich äußerst unwohl. Sie war zu einfach zu missbrauchen, selbst wenn man die besten Absichten hatte. Niemand sollte in der Lage sein, einem anderen die Magie zu nehmen … außer in ganz seltenen Ausnahmefällen. Zum Beispiel, wenn der andere ein tausend Jahre altes Wesen aus einer anderen Welt ist, das versucht, einen zu töten, damit es Millionen von Menschen in den Wahnsinn treiben und sich an ihrer Angst nähren kann.
Lily bereute nicht, was sie getan hatte, aber es war sehr unwahrscheinlich, dass sie ein zweites Mal in eine solche Situation kommen würde. Deshalb, fand sie, könnte sie auf diese besondere Gabe gut verzichten. Die andere Fähigkeit war auf ihre ganz eigene Art seltsam, aber nicht annähernd so beunruhigend.
Eigentlich konnten sich nur Drachen mithilfe von Gedanken verständigen, doch Sam meinte, sie hätte das Potenzial, es zu lernen. Tatsächlich hatte sie schon einmal mit Rule in Gedankensprache kommuniziert, aber das war nur ein Zufall gewesen, denn danach hatte sie es nicht wiederholen können. Aber Sam hatte ihr angeboten, es ihr beizubringen. Und nach reiflicher Überlegung hatte sie sein Angebot angenommen.
Sam, ihr Lehrer, auch bekannt unter dem Namen Sun Mzao, war ein schwarzer Drache, und zwar nicht per DNA, aber per Magie sozusagen ihr Großvater. Nun besuchte sie ihn zweimal wöchentlich in seiner Höhle. Was dann dort passierte, war schwer zu beschreiben. Auf bewusster Ebene zumindest nicht viel. Sie setzte sich einfach, und nach einer Weile entzündete er einen Kerzendocht – was für einen Drachen auch ohne Streichholz ein Klacks war – und sagte zu ihr: Sieh hin. Das erste Mal, als er die Kerze angezündet hatte, sagte er noch: Finde mich hier.
Doch bisher hatten die Stunden ihr nichts weiter eingebracht als Albträume.
Rule beherrschte die Kunst, nichts zu sagen, genauso gut wie sie. Er malte sanft mit den Daumen kleine Kreise auf ihrem Schlüsselbein und wartete.
»Ich habe wieder von Helen geträumt«, gab sie zu. »Ich weiß auch, warum, dazu muss ich nicht Psychologie studiert haben. Ich versuche, Gedankensprache zu lernen, und auch wenn Sam behauptet, Gedankensprache wäre keine Telepathie, ist sich beides doch sehr ähnlich. Und ich habe die einzige Telepathin getötet, die ich je getroffen habe.«
»Du hast eine Verrückte getötet, die versucht hat, dich umzubringen und ein Höllentor zu öffnen.«
»Das stimmt, ist aber trotzdem irgendwie nicht relevant.« Sie schüttelte den Kopf. Es störte sie, dass sie sich so unklar ausdrückte, doch sie konnte nicht anders.
Seine Daumen kreisten nun rückwärts und drückten fester zu. Sie fanden die Verspannung in ihrem Nacken und lösten sie. »Willst du wirklich Gedankensprache lernen? Zuerst warst du dir nicht sicher, dass es die Mühe wert ist. Und wenn dadurch solche Ängste hochkommen …«
Sie schnaubte. »Das sagt der Mann, der in ein Hochhaus gezogen ist, weil er so gezwungen ist, jeden Tag mit dem Aufzug zu fahren.«
Er lächelte schwach. »Jetzt erst recht, was?«
»So ungefähr. Aber jetzt habe ich eine Woche frei. Sie versammeln sich wieder zum Singen. Äh … ich darf mit niemandem außer dir darüber sprechen, und du darfst es keinem weitersagen.« Eigentlich waren Drachen Einzelgänger, aber in unregelmäßigen Abständen kamen sie zusammen, um zu singen. Lily war davon überzeugt, dass in dieser Welt sie und Rule die Einzigen waren, die davon wussten. Außer Großmutter natürlich. »Da fällt mir ein: Während Sam fort ist, fahren Großmutter und Li Qin nach Disneyland.«
Er grinste. »Da wäre ich gern dabei.«
»Sie liebt Disneyland. Früher ist sie mit mir und meiner Schwester jedes Jahr dorthin gefahren. Brennen da gerade die Burger an?«
»Mist.« Er ließ sie los und drehte sich hastig zum Herd.
Schritte stampften durch den Flur. »Ich bin angezogen!«, rief Toby. »Sind die Burger fertig? Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich noch Harry streicheln musste. Er hat sich einsam gefühlt.«
Harry war Dirty Harry, Lilys Kater. Obwohl sich die Lage zwischen ihm und Rule entspannt hatte – was vor allem daran lag, dass Rule ihm regelmäßig Schinken zusteckte –, trug Harry ihm gegenüber weiterhin eine verächtliche Toleranz zur Schau.
Aber Toby liebte er.
Warum, wusste niemand. Laut Rule roch Toby noch nicht nach Wolf, doch es lag nicht nur am Geruch, dass Harry Rule nicht mochte. Vermutlich war es noch nicht einmal der Hauptgrund. Harry war einfach kein freundliches Tier. Um ihn zum Tierarzt zu bringen, musste er ruhiggestellt werden. Die Bodyguards griff er an, wann immer er dazu Gelegenheit hatte. Und Lilys Familie konnte er nicht ausstehen – nun ja, abgesehen von Li Qin, aber Li Qin musste man einfach gernhaben.
Lily hatte sich Sorgen gemacht, ob der Kater und der Junge sich vertragen würden. Toby war ein normaler neunjähriger Junge, der rannte, sprang und schrie, kurz alles tat, was einem misstrauischen, auf sein Revier bedachten Kater missfiel. Sie war sich sicher gewesen, dass Harry ihn kratzen, nach ihm schlagen und ihn verachten würde.
Aber von dem Moment an, als Harry an Tobys ausgestreckter Hand geschnüffelt hatte, war er ihm treu ergeben. Wenn er Toby sah, schnurrte er. Er schlief bei Toby im Bett. Er ließ sich sogar herab, mit dem Spielzeug zu spielen, das Toby ihm unbedingt hatte kaufen wollen.
Und Toby hatte beschlossen, nun nicht sofort einen Hund zu kaufen, obwohl er seit Ewigkeiten von nichts anderem sprach. Es wäre nicht richtig, sagte er. Harry wäre furchtbar traurig.
Vor allem würde Harry dem Neuen nach dem Leben trachten, dachte Lily. Irgendwo da draußen würde ein Hund ein langes, narbenloses Leben leben, weil Toby seine Träume von einem Hund fürs Erste begraben hatte.
Lily holte ein paar Teller aus dem Oberschrank und stellte sie neben Rule auf die Arbeitsplatte. Dann ging sie zum Kühlschrank. Toby schändete seine Hamburger nicht mit frischem Gemüse, aber an den Soßen bediente er sich stets reichlich.
»Die Frikadellen sind fertig«, sagte Rule. »Holst du bitte die Brötchen raus, Toby?«
»Klar!« Toby hüpfte zur Speisekammer – eine Speisekammer war ein ganz ungewohnter Luxus für Lily – und kam mit der Packung wieder zum Vorschein. »Hast du es ihr gesagt?«, wollte er wissen. Sein Blick flog von Rule zu Lily. »Sie sieht gar nicht aus, als würde sie sich freuen.«
»Ich habe auf dich gewartet.« Rule nahm ihm die Brötchen ab. »Es scheint so, als müssten wir Toby erlauben, nächsten Mittwoch lange aufzubleiben. So lange zumindest, dass er The Daily Show sehen kann.«
Sie sah von Tobys grinsendem Gesicht zu Rules eher verhaltener, selbstzufriedener Miene. »Du bist bei Jon Stewart eingeladen?«
Toby konnte nicht mehr an sich halten. »Ist das nicht obercool?«, rief er. »Er wird mit Jon Stewart reden!«
»Ja, das ist cool«, stimmte sie ihm zu. »Aber ist das nicht … Ich meine, Jon Stewart versucht seine Gäste nicht reinzulegen, so wie andere es tun, aber er ist immer auf einen Lacher aus. Ist das nicht …« Sie brach ab. »Richtig. Du machst das schon.«
Rule lächelte amüsiert, während er die Fleischfladen auf die Brötchen gleiten ließ. Er sagte nichts.
Das musste er nicht. Ein Jon Stewart würde es nicht schaffen, Rule vor der Kamera schlecht aussehen zu lassen. Dass er so fotogen war, kam ihm sicherlich dabei zugute. Sofort als das Oberste Bundesgericht dafür gesorgt hatte, dass es sicher war, hatte er sich geoutet und war das Gesicht der Lupi geworden. In der Öffentlichkeit spielte er die Rolle einer Art Werwolf-James-Bond – geheimnisvoll und kultiviert, mit einem Hauch von Gefahr. Aber nur ein Hauch. Genug, um ihn interessant zu machen, ohne dass er Furcht einflößend wirkte.
Dass er tatsächlich geheimnisvoll und kultiviert war, schadete dabei nicht. »Ist das Studio nicht in New York?« Schnell ging sie im Kopf die Fälle durch, die sie im Moment bearbeitete, um zu überlegen, ob sie nach New York fliegen könnte. Das Band der Gefährten hatte einige Vorteile, die sie gerade in der letzten Zeit mehr zu schätzen wusste. Aber ein Nachteil war, dass sie sich nie sehr weit voneinander entfernen konnten. Wenn Rule quer durchs Land flog, musste sie mit.
»Nächste Woche wird die Show in L.A. aufgenommen. Stewart moderiert dieses Jahr wieder die Emmys, deswegen findet die Show in der Woche davor dort statt.«
»Was ist mit St. Paul? Dem Zirkel?« Rule traf sich mit den Lu Nuncios der anderen nordamerikanischen Clans. Das war eine große Sache. Auch sie sollte daran teilnehmen, um den anderen zu beweisen, dass die Nokolai friedliche Absichten hatten. Für die Clans war eine Auserwählte heilig. Selbst die Misstrauischsten unter ihnen würden nicht annehmen, dass ein Nokolai seine Auserwählte bewusst einer Gefahr aussetzte. Lilys Eigenschaft als Amtsperson würde für Ordnung sorgen. Sie war dafür bekannt, dass sie das Gesetz nicht auf die leichte Schulter nahm.
»Das ist am Montag.«
»Ich weiß.« Sie hatte Termine verschieben müssen, um ihn begleiten zu können. Die anderen hatten gewollt, dass das Treffen auf neutralem Boden stattfand, und schließlich hatte man sich auf St. Paul geeinigt. »Aber wenn es nicht gut läuft – wenn du verletzt wirst oder so.«
»Wir wollen nur reden und uns nicht an die Gurgel gehen. Selbst wenn es schlecht läuft, werde ich am Mittwoch nach L.A. fliegen können. Die Frage ist nur, kommst du mit? Wenn nötig, können wir am selben Abend hin- und zurückfliegen.«
Nach L.A. würde er vermutlich auch allein fliegen können. In der letzten Zeit hatte das Band der Gefährten ihnen viel Freiraum gelassen. Doch das Risiko war zu groß, das Band konnte sich jederzeit wieder enger ziehen. Ohne Vorwarnung. Und ohne Grund, soweit Lily es beurteilen konnte. Was sie sehr viel mehr störte als Rule.
Zumindest war es nie wieder so eng gewesen, wie kurz nachdem es sie erkannt hatte und sie das erste Mal miteinander geschlafen hatten. Damals hatten sie fast aneinandergeklebt. »Na gut«, sagte sie schließlich. »Ich denke, es klappt. In keinem meiner Fälle gibt es neue Entwicklungen, und in der Task Force wird ohnehin nur geredet. Ein paar Stunden an Bord eines Flugzeugs dürften also kein Problem sein. Es geht um Friar, nicht wahr? Und um Humans First.«
Toby zog ein Gesicht. »Er ist ein Arsch.«
»Darfst du diesen Ausdruck benutzen?«, fragte Lily. Dann warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Mist. Ich muss unter die Dusche.«
»Sag ihr auch das andere«, sagte Toby. »Schnell, damit wir nicht zu spät kommen.«
Das andere? Lily sah Rule mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Letterman?«
»Er hat sein Studio in New York, deshalb musste ich absagen.«
Also war er gefragt worden. Manchmal war es schon ein komisches Gefühl, mit jemandem zusammen zu sein, der zu Letterman eingeladen wurde. Und sicher war es nicht das erste Mal. »Wer dann?«
Als er sanft lächelte, wurde sie auf der Stelle misstrauisch. »Du musst noch zustimmen, denn die Einladung gilt auch für dich. Es findet heute in zwei Wochen statt, und wir müssen dafür nach Chicago.«
Toby hielt es nicht mehr aus. »Oprah! Du wirst zusammen mit Dad bei Oprah auftreten! Sie hat insbesondere nach dir gefragt.«
Entsetzt starrte sie Rule an. »Du hast doch hoffentlich noch nicht zugesagt. Du kannst immer noch absagen, oder?«
»Lily!« Toby war schockiert.