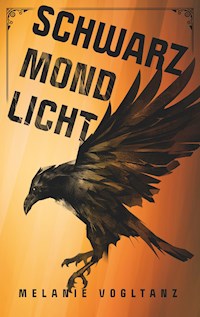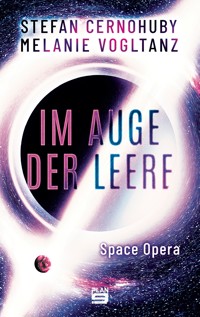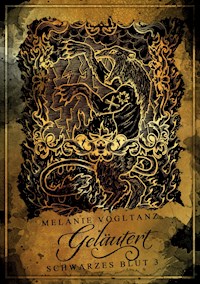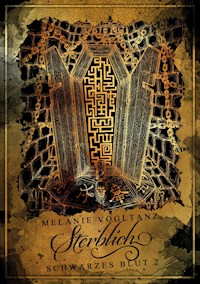Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Weißer Wolf
- Sprache: Deutsch
New Orleans im Jahr 1909 Wieso bist du so wütend? Alfio schlägt sich im wahrsten Sinne des Wortes durch. Mit illegalen Ringkämpfen bestreitet er seinen Lebensunterhalt, wobei ihm seine Fähigkeiten als Wolfsmensch helfen, schnell zu heilen und dem Publikum eine Show zu liefern. Doch in ihm brodelt Wut über die Ungerechtigkeit seiner Lage - und über die Ungerechtigkeit, die ihn umgibt. Die Mauer der Kontrolle, die er sich über die Jahrhunderte aufgebaut hat, bröckelt. Eines Tages taucht ein Fremder auf, der Unruhe in der Stadt stiftet und Alfio zu kennen scheint. Zu allem Überfluss lassen ihn auch noch seine Heilkräfte im Stich. Wie soll Alfio anderen helfen, wenn er nicht einmal sich selbst helfen kann? Eine Geschichte über verbundene Schicksale, die vielen Gesichter der Wut und die Macht der eigenen Stimme. Vollständig überarbeitete Neuauflage
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Melanie Vogltanz wurde 1992 in Wien geboren und hat ihren Magister in Deutscher Philologie, Anglistik und Lehrer*innenbildung an der Universität Wien gemacht. Sie hat als Lehrerin, Regaleinräumerin, Spielzeugverkäuferin und Hundefutterträgerin gearbeitet. Aktuell ist sie selbstständige Lektorin und macht gute Worte mit großartigen Menschen und Verlagen.
2007 veröffentlichte sie ihr Romandebüt; weitere Veröffentlichungen im Bereich der Dunklen Phantastik folgten. 2016 wurde sie mit dem »Encouragement Award« der European Science Fiction Society ausgezeichnet. Ihr Roman »Shape Me« wurde für den Deutschen Science Fiction-Preis und den Kurd Laßwitz-Preis nominiert. Gemeinsam mit Jenny Wood schreibt sie in der »Kemet«-Reihe über ägyptische Gottheiten.
Mehr Informationen auf:
http://www.melanievogltanz.com
https://lektoratvogltanz.wordpress.com/
Inhaltswarnungen
Die folgenden Content Notes dienen dazu, einen Überblick über die wichtigsten möglichen belastenden Inhalte des Romans zu geben, um ein informiertes und geschütztes Leseerlebnis zu ermöglichen. Die Liste erhebt trotz sorgfältiger Erarbeitung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Ableistische Sprache
Alkohol und Trunkenheit (explizit)
Amnesie (erwähnt)
Armut
Blut (explizit)
Bodyhorror und Splatter
Drogenkonsum (Opium, Laudanum) und Rauschzustände
Eingeweide und Organe (explizit)
Emeto/Erbrechen
Ertrinken (explizit)
Essen
Experimente an Menschen (erwähnt)
Feuer, Verbrennungen, Brandstiftung (explizit)
Erwähnung von Genitalien
Gewalt (explizit)
gegen Erwachsene
gegen Tiere
Halluzinationen
Homofeindlichkeit, strafrechtlich verfolgte Homosexualität, internalisierte Homofeindlichkeit, homofeindliche Slurs
Kampfhandlungen (explizit)
Kannibalismus
Krieg (erwähnt)
Kulturelle Aneignung
Leichen (explizit)
Mord
Nacktheit
Narben
Rassismus und Othering (explizit), rassistisch motivierte Gewalt, internalisierter Rassismus, rassistisch motivierte Polizeigewalt(erwähnt) und Racial Profiling
Saneistische Sprache
Schlangen
Schiffbruch, Seenot
Segregation (erwähnt)
Selbstverletzung (selbst zugefügte Schnitte)
Konsensueller Sex (erwähnt, keine expliziten Szenen)
Sklaverei (thematisiert, keine direkte Darstellung)
Sucht
Suizidgedanken und parasuizidales Verhalten
Tabakkonsum
Tod
durch Ertrinken (explizit)
durch Verbluten (explizit)
wichtiger Figuren
Unterernährung
Vergiftung
Verletzungen (explizit)
Blutergüsse
gebrochene Knochen
Schusswunden
Stichwunden
Verbrennungen
Verlust des freien Willens
Waffen (Schusswaffen, Stichwaffen) und Waffengewalt
Zivile Unruhen und rassistisch motivierte Aufstände
Inhaltsverzeichnis
Über die Wut der Ohnmacht und die Macht der Wut
Vorwort
Erstes Buch: Verwundet
Kapitel I.
Kapitel II.
Kapitel III.
Kapitel IV.
Kapitel V.
Kapitel VI.
Kapitel VII.
Kapitel VIII.
Kapitel IX.
Zweites Buch: Verflucht
Kapitel I.
Kapitel II.
Kapitel III.
Kapitel IV.
Kapitel V.
Drittes Buch: Verlassen
Kapitel I.
Kapitel II.
Kapitel III.
Kapitel IV.
Kapitel V.
Kapitel VI.
Kapitel VII.
Kapitel VIII.
Kapitel IX.
Kapitel X.
Kapitel XI.
Kapitel XII.
Nachwort und Danksagung
Über die Wut der Ohnmacht und die Macht der Wut
Vorwort
Liebe Lesende,
es folgen ein paar ernstere Worte der Vorrede. Wenn ihr euch damit gerade nicht befassen möchtet, was ich absolut verstehe, denn Lesen ist auch Weltflucht und die brauchen wir im Moment dringend, dürft ihr sie natürlich gern überspringen. Aber von der Seele schreiben muss ich sie mir.
Während die neue Fassung dieses Romans entsteht und entstanden ist, befindet sich unsere Welt im beängstigenden Wandel. Die Themen dieses Buches sind nicht so weit entfernt, wie ich es mir wünsche, auch wenn sie hundert Jahre in der Vergangenheit angesiedelt sind. Sowie ich das hier schreibe, beschneiden Milliardäre die sozialen digitalen Räume von LGBTQIA+- Personen, die wir uns so mühsam aufgebaut haben, und geben direkte Erlaubnis für den Hass, der sich dort graduell gegen uns aufgestaut hat. Gleichzeitig wird mit jedem Jahr und jeder Wahl Rassismus salonfähiger, der Faschismus sitzt längst nicht mehr bloß an den Stammtischen, sondern in unseren europäischen Regierungen. Und von den USA möchten wir besser gar nicht reden.
Ich hätte dieses Vorwort gern anders geschrieben, über etwas anderes. Aber dies ist die Welt, der wir gerade ausgesetzt sind. Wenn euch in diesem Buch Rassismus begegnet, und Queerfeindlichkeit, und ihr die Ohnmacht der Wut und die Lähmung spürt, die ihr folgt, dann wisst ihr, dass es sich nicht um Probleme von vor hundert Jahren handelt. Dann wisst ihr, dass wir uns mittendrin befinden.
Wut ist eine Emotion mit so vielen Gesichtern. Manchmal sind wir wütend, weil wir unter der Oberfläche verletzt sind, oder verängstigt. Irgendwann bleibt uns nicht einmal mehr die Wut, wenn der Kampf ins Leere läuft – dann bleibt Stupor. Leere. Handlungsunfähigkeit.
Dieses Buch ist auch eine Erinnerung daran, für mich und für euch, wütend zu bleiben. Wir lassen uns nicht vertreiben und wir lassen uns nicht mundtot machen.
Januar 2025
Erstes Buch:
Verwundet
Da legte der Wolf die Pfote auf das Fensterbrett. Als die Geißlein sahen, daß sie weiß war, glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf.
Gebrüder Grimm, »Der Wolf und die sieben jungen Geißlein«
Sachte, sachte an dem Hang
heimlich, lauernd schleicht‘s entlang,
Und ein Flüstern regt sich ängstlich
fern und nah –
Und der Schweiß deckt dein Gesicht,
denn vorüber strich‘s ganz dicht –
Das ist Furcht, o kleiner Jäger –
Furcht ist da!
Rudyard Kipling, »Gesang des kleinen Jägers«
I.
New Orleans, Louisiana, Vereinigte Staaten von Amerika, 1909 n. Chr.
Die Fäuste seines Gegners prasselten auf ihn nieder wie ein Hagelschauer. Alfio musste all seine Selbstbeherrschung aufbieten, liegen zu bleiben. Die Holzplanken des Rings unter ihm waren rau und kühl. Das Brüllen der Menge tobte über seinem Kopf.
Alfio ließ es toben. Auf- und niederbranden, aufgewühlte See, die gegen eine Klippe anlief. Wie Fels musste er sein, standhaft und gleichgültig.
Lad die Ruhe ein. Lad die Ruhe ein. Die Ruhe ist dein Freund.
Sein ausgerenkter Kiefer pochte heiß im Rhythmus seines Pulsschlags. Schnell, zu schnell.
Ruhig.
Über ihnen erklang eine Stimme. »Eins! Zwei!«
Die Schreie der Menge spitzten sich zu, dröhnten in Alfios Ohren. Es wurde gepfiffen und mit den Füßen gestampft. Bierflaschen flogen. Sein Angreifer war dazu übergegangen, ihm in die Seite zu treten, was definitiv gegen eine der wenigen Regeln in diesem Ring verstieß. Alfio spürte, wie mehrere seiner Rippen splitterten.
Wut kroch in ihm hoch, heiß siedend und weißglühend. Sie prasselte zischend in seinen Eingeweiden, sickerte wie Gift durch seine Adern. Das Pochen an seinem Kiefer war nicht nur länger im Gelenk, es saß in seinen Zähnen, wühlte sich in sein Zahnfleisch. Scharf, viel zu scharf, pressten sich spitze Fänge in seine Lippen.
Doch es war nicht die Wut auf seinen Gegner – nicht wirklich.
Wieso lässt er es zu? Wieso greift er nicht ein? Wieso sieht er einfach nur zu!
»Fünf! Sechs!«
Ein Stiefel traf Alfio an der Schläfe und schleuderte seinen Kopf gegen die Planken. Es knackte – in seinem Kopf, in seinen Gedanken. Nicht wie Fels, sondern wie unterspültes Eis, das unter schwerem Tritt splitterte. Für einen Moment wurde aus dem Schauspiel Ernst, und es fühlte sich tatsächlich an, als würde ihm sein Bewusstsein aus den Händen gleiten. Alfio schnaubte und schüttelte sich benommen, machte aber immer noch keine Anstalten, sich zu wehren oder auch nur zu schützen. Das Zittern seiner Muskeln konnte er jedoch nicht unterdrücken.
Ruhig. Ruhig. RUHIG!
»Neun! Zehn! AUUUS!«
Das Publikum tobte. Noch mehr Gläser und Flaschen flogen, und auch der eine oder andere Hut. Alfios Gegner riss triumphal die Fäuste hoch. Bevor er den Ring verließ, zog er den Rotz hoch und spuckte Alfio gezielt ins Gesicht.
»Du hättest eingreifen müssen!«
Alfio hatte sich mit dem Betreiber des Rings in einen Lagerraum der Bar zurückgezogen, die als inoffizielles Wettbüro für den illegalen Boxring im Hinterhof diente. Von den Mauern blätterte der blanke Putz, und die Dielen waren von Feuchtigkeit aufgewölbt. In einem unüberschaubaren Chaos standen Flaschen, Fässer und Kisten herum, manche davon dick mit Staub verkrustet. Auf einer der Kisten saß Alfio.
Er wickelte die Bandagen von seinen Händen, die gewöhnlich verhindern sollten, dass beim Zuschlagen die Haut an den Knöcheln aufplatzte, die bei Alfio aber kaum mehr waren als bloße Requisite. Probeweise bewegte er die Finger, dann öffnete er die langen, weißen Haare, die er für den Kampf zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Einige Strähnen hatten sich schon im Ring gelöst und waren braun und verklebt von seinem eingetrockneten Blut.
»Er hat auf einen Gegner eingetreten, der bereits am Boden lag«, fuhr Alfio mit nasaler Stimme fort. Er betastete sein geschwollenes Nasenbein und kniff die Augen zusammen, als Schmerz bis hinter seine Schädeldecke jagte. »In welcher Welt ist das fair?«
Estebans brauner Teint wurde sichtbar um ein paar Nuancen blasser. Seit er den Kampf ausgezählt hatte, schien er nicht in der Lage, Alfio in die Augen zu blicken. Zu gern hätte Alfio geglaubt, dass es an seinem schlechten Gewissen lag – doch seine Worte belehrten ihn eines Besseren.
»Wer kann sich Fairness leisten, White?« Esteban schenkte sich großzügig Brandy ein und stürzte ihn in einem Zug. Prompt schüttelte er sich und zog eine Grimasse. »Ich weiß gar nicht, wo dein Problem liegt. Das war doch gut! Du warst gut! Als es vor dem Ende so aussah, als könntest du das Ruder noch herumreißen … Eine großartige Show. Das Publikum hat gekocht!«
»Genau das hat ihn wohl erst so richtig rasend gemacht.«
»Rasend ist gut. Emotionen sind gut! Emotionen bringen Geld, White.«
Wenn Esteban noch einmal gut sagte, würde Alfio ihm seinen Brandy ins Gesicht kippen. »Er hat mich angespuckt. Nachdem ich ausgezählt war. Mir ins Gesicht gespuckt, Esteban! Und das kümmert dich gar nicht?«
Esteban schenkte sich wortlos nach, immer noch auffällig darauf bedacht, seinem Blick auszuweichen.
Alfio richtete sich drohend auf. Er griff mit einer Hand nach seinem Kiefer, um ihn wieder in die richtige Position zu rücken, da das Sprechen anstrengend wurde. Das Knacken, mit dem er in die angestammten Gelenke schnappte, ließ Esteban zusammenzucken.
Endlich blickte er auf und sah Alfio in die Augen. »Ich kann dich nicht ernst nehmen, solange dein Riechkolben absteht wie ein schiefer Nagel.«
Alfio betastete seine Nase – und ja, sie fühlte sich tatsächlich schief an. Das Ergebnis eines Faustschlags, den er genau hatte kommen sehen und den er bereitwillig in Kauf genommen hatte. Der Kampf hatte zu lange angedauert, und die Knorpel waren falsch zusammengewachsen. Er würde seine Nase ein zweites Mal brechen müssen, um sie wieder geradezurücken, und der Gedanke an die neuerlichen Schmerzen verstärkte seine Frustration.
Er nahm Esteban den Brandy aus der Hand. Anstatt ihn über dem kleineren Mann auszukippen – ganz war der Drang nicht verflogen –, leerte Alfio das Glas selbst. Wohltuend brannte der starke Alkohol seine Kehle hinab und breitete sich als warmes Prickeln in seinem Magen aus.
»Spar dir deine Witze«, knurrte Alfio. »Du nimmst mich für zu selbstverständlich. Was, wenn ich hier und jetzt sage, dass ich genug von diesem Theater habe? Was, wenn ich gehe, durch diese Tür, und nicht wiederkomme?«
Die Drohung ernüchterte Esteban sichtlich. »Das würdest du nicht«, sagte er leise. »Du brauchst mich.«
»Nein«, murmelte Alfio und starrte auf die bernsteinfarbene Pfütze im Glas. »Du bist es, der mich braucht.«
Esteban fuhr sich durch das schwarze, lockige Haar. Der Widerspruch, auf den Alfio wartete, kam nicht.
»Also?« Energisch stellte Alfio das Glas ab.
»Ich weiß nicht, was du hören willst«, presste Esteban hervor. »Wir haben eine Abmachung. Du kämpfst hier einmal die Woche und verlierst, wann immer ich es dir sage, und dafür stelle ich keine Fragen.« Sein Blick zuckte hoch, fixierte Alfios schiefe Nase.
»Glaub mir, ich habe es nicht vergessen.«
»Dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, der letzte Tritt hätte deinem Gedächtnis geschadet. Warte!«, schob Esteban rasch nach, als Alfio sich mit einem Schnauben von der Kiste abstieß. »Keine Witze mehr, ich verspreche es. Ich reiße Witze, wenn ich nervös bin.«
»Ich mache dich also nervös«, stellte Alfio fest.
Esteban senkte erneut den Blick und ging nicht darauf ein. Das musste er auch nicht – es war keine Frage gewesen. »Ich verstehe dich nicht, White. Du kriegst dein Kraut von mir, und einen nicht geringen Anteil am Wettgewinn. Das ist mehr, als ich den meisten meiner Champions gebe. Was willst du noch?«
Alfio öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort. Stattdessen nahm er Esteban die Brandyflasche ab und schenkte sich nach. Während er vor sich hinbrütete, starrte er in den bernsteinfarbenen Alkohol, betrachtete die Schlieren, die er am Glas zog.
Es war eine berechtigte Frage. Was wollte er? Esteban hatte recht. Ihre Abmachung war eindeutig, und bislang hatte Alfio sie allzu bereitwillig erfüllt.
»Respekt«, sagte er dann. »Ich will Respekt.« Er sprach mit erhobener Stimme weiter, als Esteban etwas einwerfen wollte. »Nicht von den Gegnern. Die kenne ich nicht, und sie sind mir auch egal. Aber verdammt noch mal von dir! Du hättest ihn mich nicht treten lassen dürfen. Und auf gar keinen Fall hättest du ihn mich anspucken lassen dürfen. Du hättest den Kampf abbrechen oder den Kerl wenigstens verwarnen müssen. Bei jedem deiner anderen Kämpfer hättest du es getan.«
»Du bist nicht wie meine anderen Kämpfer.«
Alfios Kopf zuckte hoch.
»Es ist ja nicht so, als würde es dir etwas ausmachen«, murmelte Esteban.
Alfio stellte Glas und Flasche auf einer der Kisten ab. Dann öffnete er die Knöpfe an seinem Hemd, das am Rücken immer noch klamm und klebrig vom Bier war, das die Leute im Publikum nach ihm geworfen hatten, und zog es aus. Darunter zum Vorschein kam eine Albtraumlandschaft aus violetten Blutergüssen, die im starken Kontrast zu seinem weißen Teint standen. Die gebrochenen Rippen stachen von innen gegen seine Haut und verliehen seinem Brustkorb den Anschein, als bestünde er aus einem Bündel geknickter Reisigzweige.
Esteban verzog das Gesicht zu einer Grimasse, als hätte er sich den Finger in einer Tür eingeklemmt. Er wandte sich ab.
»Ist das dein Ernst? Du willst nicht einmal hinsehen? Du könntest dir wenigstens ansehen, was du mit mir machst. Denkst du etwa, ich spüre keinen Schmerz?«
»White, ich …«
Alfio packte Estebans Handgelenk, zwang ihn, eine der gesplitterten Rippen zu berühren. Esteban stieß einen fast komischen Laut aus, der nicht mehr weit von einem Wimmern entfernt war.
»Gebrochene Knochen«, sagte Alfio. »Quetschungen. Blutungen. Ich spüre jede einzelne, noch so kleine Wunde, die ich für dich einstecke.«
»White, bitte …«
Widerwillig ließ Alfio zu, dass Esteban sich seinem Griff entzog. Er langte nach dem Brandy – diesmal der Flasche, nicht dem Glas. Trank in langen Zügen. Vom Alkohol schwamm sein Kopf angenehm, doch Alfio wusste, dass das nicht lange anhalten würde. Es hielt nie lange an.
»Aber …«, setzte Esteban nach einigen Minuten der Stille an. »Aber du wirst doch trotzdem nächsten Samstag kämpfen, nicht wahr?«
Die Wut verrauchte unvermittelt. Was blieb, war eine schwere, drückende Leere – bleierne Resignation. Esteban begriff nicht. Wahrscheinlich würde er es niemals begreifen. Weil es ihm gleichgültig war.
Weil Alfio ihm gleichgültig war.
Er hörte, wie Esteban sich unruhig hinter ihm regte. Alfios Drohung ließ ihn offenbar nicht so kalt, wie er ihm weismachen wollte.
»White«, sagte er beschwörend, als sein Schweigen anhielt. »Du hast recht. Ich behandle dich anders als andere Kämpfer. Aber das liegt doch bloß daran, dass … dass du anders bist. Dass du es erträgst.«
Alfio zischte abfällig.
»Das klang falsch, nicht wahr? Ich wollte sagen, du hältst es aus. Du bist stark, stärker als die anderen, du kannst …« Unvermittelt brach Esteban ab. »Oh«, murmelte er dann. »Meine Güte. Ich bin ein Idiot. Verzeih mir, White.«
Zuerst reagierte Alfio auch darauf nicht. Da fasste Esteban ihn behutsam am Arm. Alfio war davon so überrascht, dass er den Kopf wandte. Estebans Blick fixierte ihn nun direkt, eindringlich. Er wirkte aufrichtig reumütig.
»Es tut mir leid. Das war dumm von mir. Sag mir, was du willst. Was immer du willst, du sollst es haben. Du hast recht. Ich …«, Esteban atmete hörbar aus, »ich brauche dich.«
Das entlockte Alfio ein schmales Lächeln. Auch, wenn er wusste, dass es Esteban nicht wirklich um ihn ging, sondern um das Geld, das er ihm einbrachte – das Eingeständnis half dennoch.
»Ich trete an.« Er entzog sich Estebans Hand. »Aber nur unter der Bedingung, dass du für mich dieselben Regeln geltend machst wie für jeden anderen Kämpfer. Nicht nur meinetwegen. Es geht auch um dich, Esteban. Du willst doch nicht, dass ich im Ring die Beherrschung verliere und denen, die du eigentlich als Sieger auserkoren hast, doch noch die Knochen breche?« Oder ihnen das Gesicht abfresse, fügte Alfio im Stillen hinzu. Doch zumindest dies war ein Detail seiner Natur, das Esteban bislang verborgen geblieben war. Und wenn es nach Alfio ging, sollte das auch so bleiben.
Er nahm einen letzten Schluck von der Brandyflasche, die mittlerweile zu zwei Dritteln geleert war. »Fairness, Esteban. Mehr verlange ich nicht von dir. Gleiche Behandlung für alle.«
»Das sollte sich einrichten lassen«, antwortete Esteban kleinlaut. In diesem Moment wirkte er wie ein getretener Welpe, und Alfio hatte ein schlechtes Gewissen, dass er ihn so scharf angegangen war. Für gewöhnlich war das nicht seine Art, und vielleicht hatte Esteban deshalb zuerst mit schalen Scherzen darauf reagiert.
Denn auch in diesem Punkt hatte der Mann recht: Alfio ertrug. Er ertrug schon so lange …
Schweigend reichte Alfio Esteban das frisch gefüllte Glas zurück. Er nahm es zwar, machte aber keine Anstalten, daraus zu trinken. Vielleicht hatte er Angst, dass Alfios Zustand ansteckend war.
»Ich respektiere dich«, fuhr Esteban fort, als die Stille zwischen ihnen anhielt. »Das tue ich wirklich, White. Und ich werde mich bemühen, es deutlicher zu zeigen.«
Alfio faltete sein von Blut und Bier besudeltes Hemd, so gut es ging, und legte es auf eine der Kisten. »Ich weiß das zu schätzen. Reden wir nicht mehr davon. Hat es sich wenigstens für dich gelohnt?«, wechselte er das Thema, während er sich an einer Schüssel mit bereitgestelltem, mittlerweile eiskaltem Wasser das Blut von der Haut und aus den Haaren wusch. Esteban war noch weit davon entfernt, sich für seine Spelunke den Luxus von fließendem Wasser und modernen Sanitäreinrichtungen leisten zu können, und damit war er in diesem Viertel nicht der Einzige.
Es schien, als hätte Esteban nur auf diese Frage gewartet. »So ein Dandy hat dreißig auf den Herausforderer gesetzt. Die Quote stand zehn zu eins.«
Alfio hielt in der Bewegung inne. »Das sind dreihundert Dollar. Die meisten Menschen sehen so viel Geld nicht einmal in einem Jahr. Und du hast die Wette angenommen?«
»Es hätte zu verdächtig ausgesehen, hätte ich abgelehnt. Der Kerl war hier nur auf der Durchreise.«
»Ich verstehe.« Alfio hielt mit der Linken sein Haar hoch, während er sich mit der Rechten den Nacken mit einem feuchten Handtuch wischte. Das Gefühl war angenehm erfrischend, und allmählich spürte er, wie sich sein Pulsschlag verlangsamte und seine vom Kämpfen fiebrige Haut abkühlte, ebenso wie sein Gemüt. »Du wirst ihm den Gewinn doch auszahlen, nicht wahr?«
Alfio glaubte, Estebans Grinsen praktisch hören zu können. »Natürlich. Ich bin doch ein Ehrenmann. Aber falls du für ein wenig Gerechtigkeit sorgen möchtest – wie du weißt, Unfälle passieren.«
Alfio runzelte kritisch die Stirn.
Esteban lächelte schief. »Ja, ich kenne deine Haltung dazu. Und ich habe immer bedauert, dass du dir kein Zubrot außerhalb des Rings verdienen willst. Wenn ich dich als meine Geheimwaffe hätte, um Leute wie diesen Dandy in ihre Schranken zu weisen, würden mir solche unverschämten Glückspilze ihre Wettschulden freiwillig erlassen. Vermutlich würden sie mir Geld zahlen, nur um sicherzugehen, dass du sie niemals wieder heimsuchst.«
Alfio trocknete sich gänzlich ab. Er durchstöberte vier Kisten, ehe er in einer ein einigermaßen sauberes Unterhemd fand, das er überzog. »Ich habe immer noch Prinzipien.«
Esteban lachte verhalten. »Die solltest du mal mitbringen.« Er fasste in die Tasche seines abgewetzten Jacketts und warf Alfio ein Samtsäckchen zu, das dieser aus der Luft fing. »Wo wir schon davon reden: Hier ist deine Bezahlung. Wohl bekomm’s.«
Seine Zweckgemeinschaft mit Esteban war nicht geplant gewesen. Alfio hätte niemals geglaubt, dass er so bald wieder einen Sterblichen in sein Geheimnis einweihen würde, nachdem der letzte, dem er sich anvertraut hatte, seinen Körper für unethische Experimente missbraucht und dabei vorübergehend Alfios Gedächtnis gelöscht hatte. Doch in seinem mehrere Jahrhunderte andauernden Leben hatte Alfio eines gelernt: Die Zukunft ließ sich nicht vorhersehen.
Esteban einzuweihen, war gewissermaßen ein Unfall gewesen. Als sie sich begegneten, hatte Alfio bereits einige Jahre in den Staaten gelebt – sofern man es denn »Leben« nennen wollte. Nach all dem Leid und den Enttäuschungen, die er in London erfahren hatte, wollte er so viel Abstand wie möglich zwischen sich und diesen Moloch von Stadt bringen. Wie viele andere vor ihm überquerte er den großen Teich, um neu anzufangen. Eine weitere Strecke konnte er kaum zurücklegen, ohne über den Rand der westlichen Zivilisation zu fallen.
Die großen Bürgerkriege, die das vielgepriesene Land der unbegrenzten Möglichkeiten erschüttert hatten, waren bereits vorüber, als er seinen Fuß das erste Mal auf amerikanischen Boden setzte. Doch der Schrecken von Kampf, Hunger, Entbehrung und nicht zuletzt Hass steckte der blutjungen Nation immer noch tief in den Knochen. Frustriert musste Alfio feststellen, dass es nicht so einfach war, sich in diesem Land zurechtzufinden, das in seiner scheinbaren Grenzenlosigkeit selbst Alfios Vorstellungskraft auf die Probe stellte. Ein Land, in dem man auch mit modernsten Transportmitteln nicht Tage, sondern Wochen brauchte, um von einer Staatsgrenze zur anderen zu gelangen. Er versuchte, die Weite als Chance zu sehen, als Geschenk. Als er sich das letzte Mal an einem Ort zu lange heimisch gefühlt hatte, hätte es ihm fast das Leben und buchstäblich den Verstand gekostet, und er war nicht auf eine Wiederholung dieser Erfahrung aus. Also zog er von einer Stadt in die nächste und blieb nie länger als wenige Tage an einem Ort, lebte als ewiger Fremder unter Fremden. Dabei hauste er meist auf der Straße oder in schäbigen Hotelzimmern.
Immer wieder sagte er sich, dass es so richtig war – dass es keine Alternativen für eine Kreatur wie ihn gab. Doch insgeheim sehnte er sich nach Beständigkeit, nach einem sicheren Hafen, in den er zurückkehren konnte. Es war Schwäche. Pure, banale, menschliche Schwäche. Vielleicht war das der Grund, weshalb Alfio ihr am Ende nachgab: um sich selbst zu beweisen, dass er sich nach allem, was geschehen war, einen Rest Menschlichkeit bewahrt hatte.
In den kommenden Jahren tat Alfio vieles, auf das er nicht stolz war – er stahl, betrog und tötete. Nicht etwa, um sich selbst zu bereichern, sondern um an das kostbare Kraut zu gelangen, das seine zerstörerische Seite unter Kontrolle brachte und seine Existenz unter Menschen erst möglich machte. Nur durch den regelmäßigen Konsum von Opium konnte er das Tier in sich zuverlässig in Zaum halten, konnte verhindern, dass er unter den ahnungslosen Sterblichen ein blutiges Massaker anrichtete. In dieser Zeit war Opium sein einziger Antrieb.
Boxkämpfe wurden irgendwann zu seiner bevorzugten Art der Geldbeschaffung, denn dabei hatte er es wenigstens mit Gegnern zu tun, die ihre Gesundheit freiwillig aufs Spiel setzten. Die wenigsten Kämpfe, an denen Alfio teilnahm, richteten sich nach den Queensberry-Regeln, die Boxen vor einigen Jahren sicherer, aber aus Sicht vieler zahlungswilliger Zuschauer auch deutlich langweiliger gemacht hatten. Wenn Alfio kämpfte, dann in versifften Hinterhöfen von Armutsvierteln, in die sich selten ein Gesetzesvertreter verirrte. Ein- oder zweimal im Monat stieg Alfio in den Ring und gewann Preisgelder unterschiedlicher Höhe, die er schnellstmöglich für das so dringend nötige Rauschmittel versetzte. Nachts kämpfte er gegen gesichtslose Fremde in verrauchten, stickigen Dreckslöchern, tagsüber betäubte er seinen Verstand mit großzügig gestopften Pfeifen. So krochen die Jahre dahin. Es war kein angenehmes Leben, doch das einzige, das er kannte – das einzige, das er sich gestattete.
Da er aufgrund seiner übermenschlichen Stärke jeden Kampf spielend gewann, achtete er akribisch darauf, nicht öfter als zweimal in denselben Ring zu steigen, um nicht aufzufallen. Die Notwendigkeit, unsichtbar zu bleiben, machte es ihm unmöglich, sich irgendwo dauerhaft niederzulassen.
Bis er nach New Orleans kam. Eines Nachts verschlug es ihn in Estebans Spelunke. Er trat gegen seinen damaligen Champion an, ein Bär von einem Mann mit Haaren wie brennendes Stroh, dessen schwerer schottischer Akzent klang, als würde er mit Reißnägeln gurgeln. Alfio stampfte ihn ungespitzt in den Boden. Davor aber war seinem Gegner noch ein Tritt gelungen, der Alfios Kniescheibe zertrümmert und ihn gezwungen hatte, den Ring humpelnd zu verlassen.
Nachdem Esteban ihm sein Preisgeld ausgehändigt hatte, wollte Alfio sich wie üblich zurückziehen. Einige Querstraßen von der Bar entfernt, in einer dunklen Seitengasse, hörte er hastige Schritte in seinem Rücken.
»Du willst schon gehen?«
Alfio, der Ärger witterte, drehte sich um. Esteban war außer Atem und verschwitzt, was Alfio verriet, dass er gerannt war, um ihn abzufangen. Die Sonne war bereits lange untergegangen, aber eine Gaslaterne beleuchtete Alfios hochgewachsene Gestalt. Da wurden Estebans Augen groß.
»Dein … Bein!«, brachte er hervor. »Im Ring war es noch völlig verdreht! Wie … wie hast du das gemacht?«
»Sie täuschen sich«, sagte Alfio.
»Du warst verletzt«, beharrte Esteban. »Und nun bist du es nicht mehr.«
Alfio hatte nicht vor, auf die implizite Frage in den Worten des schmächtigen Mannes mit der braunen Haut und dem schwarzen Lockenhaar einzugehen. Er wandte sich ab, mit dem festen Entschluss, ihn einfach stehenzulassen. Ein Gerücht mehr über ihn in der Welt, damit konnte er leben. Er würde diesem Ort den Rücken kehren und niemals wiederkommen, wie schon so viele Male davor.
Doch Esteban hatte andere Pläne mit ihm. »Ich will dich.«
Es war wohl eher die Entschlossenheit in Estebans Worten als ihr Inhalt, die Alfio erneut innehalten ließ. »Sie wollen mich? Was soll das bedeuten?«
»Bleib hier. Kämpf für mich. Dein Schaden wird es nicht sein.«
Alfio würdigte das Angebot nicht einmal einer Antwort, sondern ließ Esteban wortlos stehen. Er versuchte nicht, ihn aufzuhalten – hätte er es getan, wäre Alfios Entscheidung vermutlich anders ausgefallen. Aber Estebans Worte ließen ihn nicht los. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, dann war er das rastlose Herumstreifen schon seit Jahren leid. Zum ersten Mal, seit er das Vereinigte Königreich verlassen hatte, bot sich ihm die Chance, sein Vagabundendasein wenigstens für kurze Zeit ruhen zu lassen, und Alfio war mittlerweile mürbe und desillusioniert genug, gierig danach zu greifen wie ein Verdurstender nach einem Sack Schnee.
Schon am nächsten Tag kehrte er in die Spelunke zurück, und er und Esteban trafen die Abmachung, die ihn seither zum besten – und verhasstesten – von Estebans Champions gemacht hatte. Von da an bestritt Alfio jede Woche einen der riskanten und daher illegalen Bare-Knuckle-Kämpfe für ihn. Damit die Zuschauer ihr Geld auch gelegentlich gegen Alfio setzten, was sie wohl früher oder später nicht mehr getan hätten, wenn er ausnahmslos jeden Gegner besiegt hätte, einigten Esteban und er sich darauf, dass er auch hin und wieder verlieren musste. Seine Gegner wurden über diese Abmachung selbstredend im Dunkeln gelassen.
Alfio war sich bewusst, dass er ein Risiko einging, wenn er sich dem kleinen Mann mit den großen Ambitionen auslieferte. Doch mit Esteban, davon war er bereits nach dem ersten gemeinsamen Gespräch überzeugt, war es anders als mit Doktor Hendrik van Streiken, der ihre Freundschaft mit einem Händedruck begonnen und mit einer Knochensäge beendet hatte. Esteban schien gar kein echtes Interesse daran zu haben, mehr über die Beschaffenheit von Alfios Wesen herauszufinden. Er stellte niemals Fragen zu seiner Vergangenheit, und auf den Ursprung seiner Unverwundbarkeit hatte er ihn noch kein einziges Mal angesprochen, fast so, als würde er ahnen, dass er andernfalls Gefahr lief, Alfio für immer zu vergraulen und so seinen lukrativsten Kämpfer zu verlieren. Seit er in jener Nacht das erste Mal die Auswirkungen von Alfios Kräften erlebt hatte, nahm er sie mit stoischer Akzeptanz hin, ganz so, als hätte Alfio eine zwar ungewöhnliche, aber nicht weiter besorgniserregende anatomische Anomalie, wie eine dritte Brustwarze oder einen elften Finger.
Anfangs hatte Alfio diese Gleichgültigkeit misstrauisch gemacht, doch bald war ihm klar geworden, dass diese zur Schau gestellte Ignoranz gegenüber der Vergangenheit seiner Kämpfer ein grundlegender Bestandteil von Estebans Lebenseinstellung war. Es kümmerte ihn nicht, was seine Leute außerhalb des Ringes trieben oder wie sie ihren Lebensunterhalt vor der Zeit als seine Champions verdient hatten. »Wer nicht fragt, wird auch nicht belogen« gehörte zu seinen liebsten Aussprüchen. Ihre Vergangenheit gehörte ihnen allein und lag dort, wo sie hingehörte – hinter ihnen.
Estebans Kämpfer wussten seine Diskretion ebenso zu schätzen wie Alfio – vielleicht auch ein Grund für ihre ungewöhnlich starke Loyalität. Obwohl die meisten von ihnen ihn wahrscheinlich in der Mitte entzweibrechen hätten können wie einen Ast am Wegesrand, respektierten sie ihn bedingungslos.
Respekt. Alfio wusste nicht genau, warum er zuvor so auf Respekt gepocht hatte. In seinem unnatürlich langen Leben hatte er nie wirklich Wert darauf gelegt, von irgendwem respektiert zu werden – weder in dem Kloster, in dem er als Waise aufgewachsen und in dem er kaum besser behandelt worden war als ein tollwütiger Hund, noch als Schutzbefohlener des fanatischen Hemykinen Nero, der der festen Überzeugung gewesen war, dass nur Schmerz Alfios Ausbrüche kontrollieren konnte. In Hunderten von Jahren hatte Alfio formvollendet gelernt, sich zu disziplinieren und diszipliniert zu werden – hatte gelernt, zu erdulden, was die meisten anderen unentschuldbar fanden. Unter all jenen, denen Alfio sich untergeordnet hatte, zählte Esteban noch zu den fürsorglichsten und verständnisvollsten Herren.
Warum also war er nach dem heutigen Kampf so wütend gewesen?
Der Wolf. Eine andere Antwort fand Alfio nicht.
Der Wolf verstand nicht, warum Alfio willentlich Kämpfe verlor, warum er schwachen Gegnern ungestraft gestattete, ihn zu demütigen. Alfio spürte das unter seiner menschlichen Hülle lauernde Tier in einem Kampf so viel deutlicher, wenn er dazu verdammt war, untätig zu bleiben. Auch heute im Ring hatte er es wahrgenommen: das Zittern seiner Muskeln, das Vibrieren seiner Haut, gegen die der Wolf gierig seine Fratze gepresst hatte.
Die Bestie war begierig darauf, die Kontrolle zu übernehmen, wann immer Alfio im Ring freiwillig Schläge einsteckte. Verlieren war um so vieles schwerer – und gefährlicher – als gewinnen. Irgendwann, das wusste Alfio nur zu gut, würde er das Tier nicht mehr zurückhalten können, und dann würde alles Opium der Welt ihm nicht mehr helfen, es zurück in seinen Käfig zu sperren.
Gedankenverloren betastete Alfio die fühlbare Erhebung an seinem Nasenbein, wo die Knorpel schief zusammengewachsen waren. In der freien Hand hielt er das Säckchen, mit dem Esteban ihn ausgezahlt hatte, ließ es langsam durch seine Finger wandern.
Wie immer nach einem Kampf war er im Schutze der Nacht zu seiner kleinen, zugigen Doppelhaushälfte zurückgeschlichen, die nur wenige Straßen von Estebans Spelunke entfernt lag. Beide Teile des heruntergekommenen Double-Shotgun-Houses gehörten seinem Vermieter, mit dem Alfio sich als direkter Nachbar eine Wand und den Hintergarten teilte. Esteban hatte den Kontakt hergestellt, und auch, wenn Alfio es zu Anfang nicht behagt hatte, dass sein Arbeitgeber auch wusste, wo er sich abseits seiner Kämpfe aufhielt, musste er zugeben, dass es von Vorteil war, in seinem Vermieter einen Mann gefunden zu haben, der Estebans Einstellung zu neugierigen Fragen teilte.
Für gewöhnlich würde Alfio sich nach einem solchen Kampf strategisch betäuben, um den aufgeputschten Wolf in die Ecke seines Bewusstseins zurückzutreiben, in die er gehörte. Doch diesmal lagen die Dinge anders. Alfio versuchte sich daran zu erinnern, wann er dem Tier das letzte Mal gestattet hatte zu jagen, und konnte es nicht. Der Wolf war ausgehungert. Hungrige Tiere waren unberechenbar.
Alfio legte das Opium widerwillig beiseite und stand von dem ungeordneten Haufen aus alten Decken und Kissen auf, der ihm als Bettstatt diente. Vor einem halbblinden Spiegel mit einem von Grünspan überzogenen Messingrahmen nahm er Aufstellung und betrachtete sein hohlwangiges Konterfei. Mit Zeige- und Mittelfinger beider Hände umfasste er seine Nase. Atmete tief ein.
Es knackte grässlich, als Alfio den Druck an den Bruchstellen verstärkte. Der Schmerz, der bis in sein Hirn hinaufschoss, fühlte sich schlimmer an als der ursprüngliche Faustschlag, der ihn getroffen hatte, als er mit Adrenalin vollgepumpt gewesen war. Er blinzelte die Tränen ungeduldig weg, die der Reflex in seine Augen trieb, und rückte seine Nase knirschend gerade.
Dann wartete er.
Während er zusah, verflüchtigte sich die violette Verfärbung unter seinen Augen. Es dauerte ungewöhnlich lange, bis der stechende Schmerz in seinem Nasenbein abklang und die Knochen sich wieder zusammenfügten. Zu lange.
Alfio versuchte, diesen Gedanken zu vertreiben, und zog das Hemd aus. Unzufrieden betrachtete er seinen Brustkorb im Spiegel. Die Blutergüsse waren mittlerweile verblasst, doch als er mit den Fingern über die einzelnen Rippen wanderte, spürte er immer noch ein schmerzhaftes Ziehen. Er atmete tief ein und fühlte die Bruchstellen der Knochen übereinanderreiben.
Alfio konnte die Warnsignale nicht länger ignorieren: Seine Heilkräfte ließen nach. Jede Faser seines unnatürlichen Körpers schrie nach Beute. Wenn Alfio sie ihm noch länger vorenthielt, würde der Wolf die Kontrolle mit Gewalt an sich reißen, und dann würden Unschuldige sterben. Ihm blieb nur eine Wahl: Er musste den Wolf freilassen – zu seinen eigenen Bedingungen – und hoffen, dass er sich zurückziehen würde, sobald er sattgefressen war. Bislang war es Alfio noch jedes Mal gelungen, seinen Körper zurückzuerobern, auch wenn es mitunter Wochen, manchmal sogar Monate dauerte. Doch er hatte den Wolf auch noch nie zuvor so frustriert, noch nie so gereizt erlebt. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, dann hatte er die Jagd so unverantwortlich lange hinausgezögert, weil er Angst hatte. Angst, dass er es diesmal zu weit getrieben hatte. Angst, dass er vom nächsten Beutezug nicht mehr zurückkehrte.
Du kannst es ohnehin nicht verhindern, sagte er sich. Nur aufschieben. Und dadurch wirst du es nur schlimmer machen.
Wie es aussah, würde er sein Versprechen gegenüber Esteban brechen müssen. Er würde am nächsten Samstag wohl doch nicht in den Ring steigen. Anders als alle Kämpfe, die er für Esteban bestritt, war der Ausgang des Kampfes, der ihm nun bevorstand, ungewiss.
Mit einem letzten reuigen Blick auf das gut gefüllte Opiumsäckchen zog Alfio das Hemd wieder an, setzte seinen Hut auf und hüllte sich in seinen Mantel. Dann ging er hinaus in die klare Nacht.
II.
In New Orleans musste man keine weiten Strecken zurücklegen, um die ersten tückischen Sümpfe zu erreichen, die mit einem Dickicht robuster Vegetation überwachsen waren. Mit der letzten Stadtbahn fuhr Alfio an die Peripherie der Stadt, anschließend ging er zu Fuß weiter. Schon nach einigen Stunden hatte er das Gefühl, sich durch menschenverlassene Wildnis zu bewegen. Er orientierte sich am Bayou St. John und folgte dem Strom tief in den Sumpf. Nachdem er ein im Schilf liegendes Boot im Wasser gefunden hatte, dessen abgeblätterter Lack ebenso wie die verschimmelten Decken im Heck davon zeugten, dass sein Besitzer es vergessen oder aufgegeben hatte, ging er an Bord und stakte damit den Bayou entlang. Nach einer Weile mündete der Fluss über einen Kanal in den breiteren Mississippi River. Alfio manövrierte das Boot durch den reißenden Fluss, ließ sich von ihm tiefer und tiefer in unberührtes Sumpfgebiet tragen.
Ringsum zeugte ein Rascheln und Knacken und Wispern und Schleifen im Gebüsch von der Anwesenheit kleiner und großer Tiere, die seine Ankunft mit Skepsis oder sogar Furcht verfolgten. In das gleichmäßige Plätschern des Mississippi mischte sich gelegentlich ein lautes Platschen, wenn etwas die Flucht ergriff, das sich bislang am Ufer gerekelt hatte. Gefährlicher jedoch waren die Tiere, die fast lautlos durch das trübe Wasser oder über Laub und Farne glitten. Tiere im Schuppenkleid, deren geschlitzte Pupillen Alfio taxierten, um einzuschätzen, ob es sich bei diesem Neuankömmling um Beute oder Rivale handelte.
Diese Einschätzung würde ihnen schon sehr bald leichter fallen. Selbst die großen Reptilien des Sumpfes hatten seiner Schnelligkeit und seiner Körperkraft nichts entgegenzusetzen, sobald er jede Kontrolle fahren ließ. Bestimmt würde ihr kaltes Blut hochinteressant schmecken.
Der Morgen dämmerte bereits, als Alfio schließlich aus dem Boot ans Ufer kletterte. Nun sollte er tief genug in den Sumpf vorgedrungen sein, um keiner Menschenseele mehr zu begegnen. Obwohl er nur wenige kurze Pausen eingelegt hatte, fühlte er sich nicht erschöpft. Seine Sinne sangen wie gespannte Drahtseile.
Während sich der Horizont zwischen den dichten Baumkronen violett färbte, ein Farbton, der den Blutergüssen auf seiner Brust vor wenigen Stunden auf unheimliche Weise glich, legte Alfio seine Kleider ab. Es war Frühling, und ihm fröstelte, als er Hemd, Hose und Mantel sorgsam zusammenlegte und in einem umgestürzten, hohlen Baumstamm versteckte, dessen Wurzeln wie haltsuchende Finger aus dem aufgeschwemmten Sumpfboden ragten. Seine Stiefel und sein Hut folgten. Nackt wie vor dem Sündenfall stand er inmitten ungezähmter Wildnis. Nackt, doch nicht schutzlos.
Die Vögel, die eben noch den neuen Tag begrüßt hatten, waren verstummt.
Alfio zitterte. Nicht vor Kälte, sondern vor Anspannung. Er witterte das Leben ringsum, hörte den Puls zahlreicher Tiere, spürte das Pochen ihrer kleinen Herzen bis in seine Fingerspitzen, als wären sie lediglich Verlängerungen seines eigenen Körpers.
Alles war Beute.
Seine Kopfhaut kribbelte, die Härchen an seinen Armen und seinem Nacken richteten sich auf. Seine Knie zitterten. Alfio suchte Halt an einem der umstehenden Bäume. Seine Nägel waren lang, schwarz und scharf. Als Alfio die Hand zur Faust ballte, hinterließen sie tiefe Wunden in der alten Borke.
Der Wolf knurrte.
»Ich habe keine Angst vor dir«, flüsterte Alfio. »Ich werde wiederkehren. Nichts wird mich davon abhalten, zurückzukommen.«
Er überstreckte den Nacken. Sank auf alle viere, als sein Rückgrat sich bog und den aufrechten Gang unmöglich machte. Seine krallenartigen Finger wühlten den schlammigen Boden auf.
»Ich. Habe. Keine. Angst.«
Wieder knurrte der Wolf.
Alfio knurrte mit ihm.
Schmerz.
Seine erste bewusste Empfindung war Schmerz.
Ein Reißen, Brennen und Kreischen in seiner Brust. Das Klopfen seines Pulses in seinen Fingern und an seinem Hals. Er kannte dieses Gefühl. Sein Herz wollte mehr Blut pumpen, als seine Venen fassten.
Alfio stöhnte. Wie immer nach der Jagd wusste er nicht, wie lange er weggetreten gewesen war oder was er getan hatte. Verschwommene Bilder von aufgesperrten Alligatorenrachen, davonhuschenden Opossums und um sich schlagenden Schlangenleibern schwappten durch seinen Kopf. In seinem Rachen saß der Geschmack von salzigem Fleisch. Der Wolf hatte gefressen. Hatte getötet.
Alfio richtete sich auf, fand jedoch keinen Halt im morastigen Boden. Er rutschte weg und klatschte geräuschvoll in den Schmutz zurück. Schlamm spritzte. Das Reißen in seiner Brust nahm zu. Alfio blickte an sich hinunter. Aus seinem nackten Oberkörper, der von einer dicken Schicht Blut und Schmutz verkrustet war, ragte der Griff einer Waffe.
Alfio presste die Augen zu. Waffen bedeuteten Menschen. Dabei war er so sicher gewesen, dass sich niemand so tief in den Sumpf wagen würde. Offensichtlich hatte er sich getäuscht. Der Wolf hatte einen Menschen attackiert – vermutlich sogar mehr als einen. Und dann, als irgendjemand einen glücklichen Stich gegen das Tier geführt hatte und es nicht in der Lage gewesen war, den Schmerz zu beseitigen, hatte es sich feige zurückgezogen und Alfio in diesem beschädigten Körper zurückgelassen. Der Wolf war noch nie gut darin gewesen, Probleme zu lösen.
Alfio schnaubte unwillig. Mit einer Hand, die taub vom Blutverlust war, fasste er nach dem Messergriff zwischen seinen Rippen. Er brauchte einige Anläufe, ehe er die Finger fest genug um das raue Leder des Hefts geschlossen hatte, um die Waffe aus seinem Fleisch zu ziehen.
Überrascht sog er die Luft zwischen den Zähnen ein. Die Klinge saß fest. Er konnte sie keinen Fingerbreit bewegen. Da sein Körper bei der Rückverwandlung eilfertig jegliche Fremdkörper überwucherte, die sich noch in ihm befanden, hatte Alfio mit einem gewissen Widerstand gerechnet, doch das war absurd. Was sein Gewebe in die eine Richtung hatte teilen können, musste es schließlich auch in der anderen Richtung teilen können.
Er nahm die zweite Hand hinzu, und unter großer Kraftanstrengung gelang es ihm, die Klinge ein Stück weit hervorzuzerren; allerdings nur, indem er sie ruckartig hin- und herbewegte und die Einstichwunde großzügig ausweitete. Dabei musste er sich auf die Lippen beißen, um einen Schmerzlaut zu unterdrücken.
Er erkannte das Problem bereits, als er den feucht glänzenden Stahl wenige Fingerbreit aus seinem Torso befreit hatte. Offensichtlich hatte er es nicht mit einer herkömmlich geschliffenen Klinge zu tun. Diese hier war mit zahlreichen hässlichen Widerhaken versehen, die sich tief in sein Fleisch gegraben und dort verankert hatten. Welcher Schmied produzierte eine so sinnlos grausame Waffe? Ein solches Messer konnte nur einem einzigen Zweck dienen: Schmerzen zu bereiten. Zugegeben, Pfeile mit Widerhaken waren keine absolute Seltenheit, wenn auch nicht unbedingt die feine Art, aber ein Messer war noch einmal eine gänzlich andere Dimension. Etwas Vergleichbares hatte Alfio noch nie zuvor gesehen, nicht einmal im Folterarsenal der Genuinità.
Kein Wunder, dass der Wolf das Weite gesucht hat, dachte Alfio grimmig. Wie es aussieht, ist er an den falschen Gegner geraten. Der Gedanke hätte ihn mit Schadenfreude erfüllt, wäre da nicht sein Blut gewesen, das in Strömen über seine Finger lief, während er am glitschig gewordenen Messerheft herumzerrte.
Endlich kam die Klinge mit einem Ruck frei. Sie rutschte ihm aus den Fingern und versank ein Stück weit im Schlamm.
Alfio atmete schwer. Seine Arme fielen herab. Aus dem ausgefransten Loch zwischen seinen Rippen quoll Blut und vermischte sich mit dem Schlamm unter seinem Körper. Sein Kopf fühlte sich leicht an, und jedes Gefühl war aus seinen Fingern gewichen. Innerlich zählte er seine Herzschläge, wartete darauf, dass der Blutfluss versiegen würde.
Wartete.
Und wartete.
Es geschah nicht.
Wenn er noch einen Funken Energie in sich gehabt hätte, hätte Alfio gelacht. Hatte er dem Wolf nicht die Führung überlassen, um neue Kraft zu tanken? Hatte er ihn nicht auf die Jagd geschickt, um seinen Heilkräften neuen Auftrieb zu geben? Und nun lag er ausblutend, frierend und missgelaunt in der Wildnis und war offensichtlich genauso geschwächt wie zuvor. Wenn nicht sogar noch mehr. Der Wolf hätte sich wenigstens sattfressen können, bevor er wie ein unerfahrener Straßenköter in ein Messer gelaufen war.
»Er wird wohl alt«, murmelte Alfio mit tauben Lippen und musste grinsen. Vielleicht war es auch bloß ein Zähnefletschen, er spürte sein Gesicht kaum. »Nach dreihundert Jahren wäre das … wohl das Mindeste.«
Seine eigene Stimme klang weit entfernt, als hätte jemand seine Ohren mit Holzwolle verstopft. Obwohl seine Augen weiterhin geöffnet waren, hatte Schwärze sein Sichtfeld gefressen. Er glaubte zwar, dass sein Blick in den Himmel gerichtet sein musste, doch er konnte ihn nicht sehen. Immerhin ebbte der Schmerz in seiner Brust endlich ab. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass die lange überfällige Heilung einsetzte.
Oder ein Zeichen dafür, dass er dabei war, zu verbluten.
Alfio war schon lange nicht mehr gestorben. Bestimmt seit zwanzig Jahren nicht mehr. Doch gewisse Dinge verlernte man nie.
Er lief mit ausgreifenden Sprüngen über eine weite Ebene, über ihm ein stahlfarbener Himmel. Die Luft flirrte vor Hitze. Trotz seines dichten Pelzes empfand er sie nicht als unangenehm. Er genoss es, wie jeder Atemzug seine Lungen zum Singen brachte. Durch sie fühlte er sich lebendig.
Er war der Fährte eines großen Tieres bereits über einige Meilen hinweg gefolgt, konnte es aber immer noch nicht sehen. Allmählich begann er sich zu fragen, ob seine Sinne ihm vielleicht einen Streich gespielt hatten. Wenn es so gewesen wäre, hätte es ihn nicht einmal gekümmert. Solange er den heißen Wind spürte, der sein Fell durchwühlte, und die harte, von nur wenigen robusten Halmen durchbrochene Erde unter seinen Pfoten, hätte er ewig so laufen können.
Ewig … ewig …
Mitten im Schritt erstarrte der Wolf. Der Wind war umgeschlagen und hatte ihm eine gänzlich andere Fährte zugetragen. Sein Kopf ruckte herum, seine Ohren zuckten nervös.
Das Land war so flach, dass der Wolf meilenweit sehen konnte. Am Horizont, in der Windrichtung, aus der er gekommen war, stand eine Gestalt und blickte starr zu ihm herüber. Sie hatte vier Beine, wie er. Aber sie zeigte keine Furcht. Und das machte keinen Sinn.
Ein Schaudern ergriff den Wolf, an dem auch die Hitze nichts ändern konnte. Obwohl das Tier begriffen zu haben schien, dass er seine Anwesenheit bemerkt hatte, setzte es sich in Bewegung und kam auf ihn zu.
Du bist dreist genug, den Jäger zu jagen?, bellte der Wolf ihm zu.
Und zu seiner Überraschung antwortete ihm das Tier, mit einer Stimme, die viel zu nah war: Ich bin mutig genug, die Bestie zu jagen. Und als es einen Satz vorwärts machte, war es plötzlich unmittelbar vor dem Wolf, und es hatte Reißzähne und gelbe Augen, in denen wilder Hass loderte. Mit einem Geifern stürzte es sich auf seine Kehle, und der Wolf schrie und schrie und schrie …
Ewig.
»Ist er tot? Er sieht ziemlich tot aus.«
»Wenn er tot ist, begraben wir ihn hinter dem Haus? Ich weiß noch, wo die Schaufel liegt.«
»Wieso darfst du ihn begraben? Ich will das machen.«
»Du kannst das nicht. Mädchen begraben keine Leute. Die waschen höchstens die Leichen.«
Ein dumpfer Schlag von Haut auf Haut.
»Mamá, Felicia schlägt mich schon wieder!«
»Gar nicht wahr.«
»Jetzt lügt sie auch noch!«
»Hey, der Tote wacht auf!«
»Jetzt will sie nur ablenken.«
»Nein, wirklich, schau!«
Alfio setzte sich stöhnend auf. Die kleinen, hohen Stimmen ringsum taten ihm in den Ohren weh – und das waren nicht die einzigen Schmerzen, die er spürte. Mit einer Hand tastete er über seinen Brustkorb. Jemand hatte einen Verband um seinen Oberkörper gewickelt. Automatisch suchten seine Finger nach dem Anfang, wollten ihn von der Gaze befreien.
»Tío, komm schnell, der Tote zieht sich aus!«
»Geht mal beiseite, ihr Quälgeister. Na los, trollt euch.« Eine schroffe, aber warme Stimme mischte sich ein. Eine Stimme, die Alfio kannte.
Wo war er überhaupt? Eben war er noch tief in den Sümpfen Louisianas gewesen, und nun lag er hier in … was? Einer Kinderstube?
Nach ein paar halbherzigen Protesten erklang das Trappeln kleiner Füße, gefolgt von einer zuschlagenden Tür, dann kehrte fast so etwas wie Ruhe ein.
»White?«
Alfio wandte den Kopf und blickte geradewegs in das abgehärmte Gesicht von Esteban.
»Wo … wo bin ich?«, fragte Alfio.
»Zu Hause.«
Alfio blinzelte.
»Ich meine … Bei mir zu Hause.« Esteban zwang ein Lächeln auf seine Lippen. »Wasser? Du musst am Verdursten sein.« Er griff nach einer Karaffe, die auf einem grob gezimmerten Beistelltisch stand. Alfio legte eine Hand auf Estebans Unterarm und hielt ihn ab.
»Ich brauche kein Wasser. Ich brauche Antworten.«
Estebans Lächeln wich nicht, wurde jedoch erheblich bitterer. »Da sind wir schon zu zweit.«
Alfio ließ den Blick durch das hohe Zimmer schweifen. Er saß auf einem Bett, in Laken, die zwar löchrig und grau gewaschen waren, aber sauber rochen. Auf dem Beistelltisch reckten ein paar Veilchen in einer Vase ihre Blütenköpfe gen Decke. So grün und knospend, wie sie sich präsentierten, mussten sie erst kürzlich geschnitten worden sein. Daneben blickten eine Frau und zwei Kinder in einer Schwarzweiß-Fotografie aus einem Bilderrahmen, wahrscheinlich Estebans Familie. An der Wand gegenüber hing ein Ölgemälde, das ein Boot darstellte. Ein junger Mann im Wasser hielt sich an der Reling fest, zwei weitere saßen im Boot und sahen auf ihn hinab. Ein dritter stand am Rand und blickte ins Meer. Das Bild kam Alfio vage bekannt vor.
Ein langer Vorhang mit einem kompliziert aussehenden, geschmackvollen Blütenmuster verdeckte vermutlich ein Fenster, durch das weiches Sonnenlicht fiel und an den Rändern des Stoffes entlang sickerte. Abgesehen von einem Schrank, der deutlich zu groß für die Tatsache wirkte, wie oft Esteban dieselben Kleidungsstücke in der Kneipe trug, konnte Alfio keine anderen Möbelstücke entdecken.
Der Kontrast zu Estebans Bar war frappierend und stieß Alfio vor den Kopf. Während das Etablissement rudimentär eingerichtet war, dominiert von abgewetztem Holz und ohne jeglichen Schmuck oder Zierrat, fast militärisch pragmatisch und notdürftig sauber gehalten, wirkte dieser Raum mit nur wenigen sorgfältig ausgewählten dekorativen Details warm und heimelig auf ihn. Nie hätte er für möglich gehalten, dass für beide Räumlichkeiten dieselbe Person verantwortlich wäre.
»Dein Haus?«, fragte Alfio.
»Mein Zimmer«, antwortete Esteban, als gäbe es dabei einen entscheidenden Unterschied.
»Ich liege in deinem Bett.«
»Du hattest es dringender nötig als ich.«
»Ich verstehe nicht, wie ich hierherkomme. Wie hast du mich gefunden?«
»Das war nicht weiter schwierig.« Esteban wich seinem Blick aus. »Du lagst auf der Veranda deiner Hütte. Bewusstlos. Schlammbedeckt. Blutend. Und … nackt. Rafael hat dich gefunden. Er hat dich ins Haus getragen, mich verständigt. Ich bin froh, dass er mich rief und nicht sofort einen Arzt holte. Der hätte womöglich gemerkt, dass du … anders bist als die meisten seiner Patienten. Ich meinte, es wäre besser, dich zu uns zu bringen. Verwundete sollten nicht allein sein.«
»Mein Vermieter hat mich vor meiner Haustür gefunden?« Alfio schüttelte den Kopf. »Das ergibt keinen Sinn.«
»Das ist es, was dir Sorgen macht? Dass du vor deiner Hütte lagst? Nicht etwa, dass du blutgebadet und unbekleidet warst?«
»Ich bedanke mich für deine Gastfreundschaft.« Alfio schwang die Beine über den Bettrand. »Ich strapaziere sie besser nicht länger. Wir sehen uns beim nächsten Kampf.«
»Du wirst jetzt nicht einfach gehen! Du warst vier Tage lang verschollen! Niemand wusste, wo du warst! Und dann tauchst du plötzlich mit einer Stichwunde wieder auf und willst mir nicht einmal sagen, was passiert ist? Ich habe letzte Nacht wegen dir kein Auge zugemacht, du egoistischer Saukerl!«
Alfio starrte ihn an. Mit diesem Ausbruch hatte er wahrhaftig nicht gerechnet. Noch nie hatte Esteban so mit ihm gesprochen. »Esteban, ich … Ich wusste nicht …« Er räusperte sich. Es kostete ihn einige Atemzüge, sich zu sortieren und eine Antwort zu finden. »Ich bin nicht gewöhnt, dass sich jemand um mein Wohlergehen sorgt.«
In Estebans Miene zuckte etwas, das an Schmerz erinnerte. Oder war es … Mitleid? »Dann solltest du besser anfangen, dich daran zu gewöhnen.«
Alfio wusste nicht, was er darauf erwidern sollte.
»Im Übrigen solltest du so sowieso nicht vor die Tür«, murmelte Esteban. »Du hast nichts an.«
Alfio blickte an sich herab und stellte fest, dass Esteban recht hatte. Alfios eigenes Schamgefühl war nicht sonderlich stark ausgeprägt – eine Bürde, die, wie er wusste, die meisten Wolfsmenschen trugen und die ihm auch seine strengkatholische Erziehung nicht hatte austreiben können –, doch da Estebans Gesicht mittlerweile hochrot angelaufen war, zog er beiläufig die Decke wieder über sich.
»Also?« Mit einem Knall stellte Esteban die Karaffe ab. Die Veilchen in der Vase erbebten. »Wie kam es dazu?« Er deutete auf Alfios bandagierten Oberkörper. »Und wo hast du dich in den letzten Tagen rumgetrieben? Du bist mir keine Rechenschaft schuldig, darauf hatten wir uns geeinigt, aber in diesem Fall … Wenn mein bester Kämpfer schon sein Leben leichtfertig aufs Spiel setzen muss, will ich wenigstens wissen, wofür. Das ist ja wohl kaum zu viel verlangt.«
Nur vier Tage, hatte Esteban gesagt. Länger war Alfio nicht in den Sümpfen gewesen. Der Wolf hatte offenbar tatsächlich kein Jagdglück gehabt. »Ich hatte etwas zu erledigen«, sagte Alfio. »Und bin dabei an die falschen Leute geraten. Das ist alles.«
»Das ist alles, ja?« Esteban verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich habe dich kämpfen sehen, White. Willst du mir etwa weismachen, es gibt auf Gottes grüner Erde irgendeinen Gegner, der dich überrumpeln kann?«
»Offenbar.« Weil er merkte, wie Estebans Miene sich zunehmend verdunkelte, griff er nach dem Wasserbecher und trank ein paar Schlucke, um ihn ein wenig milder zu stimmen. »Ich weiß nicht, wer mich angegriffen hat«, sagte er, als er den Becher wieder abstellte. »Das ist die Wahrheit. Ich erinnere mich nicht.«
Estebans markante Augenbrauen rutschten nach oben. »Du erinnerst dich nicht? Wegen der Wunde?«
»Nein. Nein, nicht deswegen.« Alfio überlegte, wie viel er Esteban anvertrauen wollte. Er betrachtete das Bett, in dem er saß – Estebans Bett –, den sorgfältig gebundenen Verband und nicht zuletzt seine von Blut und Schlamm gereinigte Haut. Überrascht stellte er fest, dass er Esteban vertrauen wollte. Doch auch van Streiken hatte seine Wunden versorgt. Bevor er dazu übergegangen war, ihm selbst welche zuzufügen. Wenn er eines gelernt hatte, dann, dass man nicht in einen Menschen hineinblicken konnte.
»Es ist kompliziert«, beschied Alfio. »Ich habe manchmal Erinnerungslücken.«
»Kommt das vom Opium?«
»Nein.«
Esteban schien zu überlegen. »Ich verstehe, dass du mir nicht alles sagen kannst«, meinte er schließlich. »Und vermutlich will ich es auch gar nicht so genau wissen. Aber eine Sache musst du mir erklären.« Sein Blick fixierte den von Wundwasser gelblich verfärbten Verband auf Alfios Brust. »Wieso hat sich diese Wunde nicht geschlossen? Ich habe dich schon weit schlimmer zugerichtet gesehen. Aber diesmal war es anders. All das Blut …« Er schauderte sichtlich. »Ich hab ja schon einiges erlebt, aber das? Es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf. Das war beängstigend. Zum ersten Mal dachte ich …« Seine Stimme brach. »Ich dachte, du würdest sterben.«
Alfio schüttelte den Kopf. »Du musst dich irren. Sie hat sich geschlossen. Es hat nur länger gedauert als üblich.« Er begann, den Verband abzulösen.
»Das solltest du nicht tun«, warnte Esteban.
Alfio hörte nicht auf ihn. Er löste mehrere Schichten Mullbinden ab. Dann erstarrte er mitten in der Bewegung. »Was ist das?« Mit den Fingern betastete er den Schorf, der sich über dem großen, ausgefransten Loch zwischen seiner vierten und fünften Rippe gebildet hatte.
»Du hattest recht. Es sieht schon erheblich besser aus.« Esteban klang erleichtert. »Als wir den Verband anlegten, war es, als könnten wir direkt in dich hineinsehen. Kein schöner Anblick.«
Vorsichtig löste Alfio etwas von dem Schorf mit seinem Fingernagel. Warme Feuchtigkeit brach darunter hervor. Ein dünnes, hellrotes Rinnsal lief an seinem Bauch und seiner Hüfte hinab und versickerte in den Laken.
»Tu das besser nicht.«
»Da sollte nicht mehr als eine Narbe zu sehen sein«, murmelte Alfio. »Meine Heilkräfte haben in den letzten Tagen nachgelassen, aber die Verletzung muss doch schon Stunden her sein.«
»Wir haben dich gestern hergebracht«, sagte Esteban leise. »Du warst über einen Tag lang ohne Bewusstsein.«
Alfio starrte ihn an. »Das ist völlig unmöglich.«
»Es ist aber so.«
»Bist du sicher, dass ich bewusstlos war? Habe ich noch geatmet? Hatte ich einen Puls?«
Esteban wurde bleich. »White … fragst du mich etwa, ob du gestorben bist? Du redest doch mit mir! Wie kannst du da gestorben sein?«
Alfio hörte ihm kaum zu. »Ich muss tot gewesen sein. Verblutet. Aber selbst das erklärt nicht, warum die Wunde noch so … so frisch aussieht.« Erneut löste er etwas Schorf ab. Das Rinnsal verbreitete sich. Mittlerweile waren Laken und Verband mit roten Sprenkeln durchsetzt, und Blut klebte unter seinen Fingernägeln.
»Himmel, würdest du bitte damit aufhören?«
Alfio blickte auf. Estebans Stimme hatte vor mühsamer Beherrschung gezittert.
»Willst du mir etwa erklären«, fuhr er mit immer noch bebender Stimme fort, »dass es zu deinem Alltag gehört, zu sterben und … und wieder aufzuwachen? Du kehrst von den Toten zurück?«
Alfio bereute, dass er davon angefangen hatte. »Ich dachte, du wüsstest das.«
»Ich wusste, dass du Wunden überlebst, die jeden anderen Mann niederstrecken. Aber nicht, dass du wie … wie ein verdammter Untoter aus dem Grab aufsteigst.«
»Ganz so ist es nicht«, log Alfio.
Esteban schien ihm gar nicht zuzuhören. »Ja … nein …« Fahrig fuhr er sich mit einer Hand durch sein ohnehin zerzaustes Haar und brachte es noch mehr in Unordnung. »Ich sollte einen Topf Brühe aufsetzen, du bist doch sicher hungrig.« Seine Augen zuckten zu Alfio. »Du … du isst doch, nicht wahr?« Offenbar fiel ihm eben ein, dass er Alfio noch niemals etwas anderes als Alkohol und Opium zu sich hatte nehmen sehen.
»Ja.« Wieder ging ihm diese Unwahrheit spielend über die Lippen. Er wollte Esteban nicht noch mehr verunsichern, indem er über seine ungewöhnlichen Essgewohnheiten sprach. Und außerdem wirkte er ganz so, als würde er ein paar Minuten für sich brauchen, um diese neue Erkenntnis zu sortieren. »Ein Teller heiße Brühe wäre jetzt genau das Richtige.«
Esteban nickte unbestimmt und ging in Richtung Tür. Auf halbem Weg wandte er sich noch einmal um. »Du bleibst hier!«, befahl er. »Wenn ich wiederkomme und du hast das Weite gesucht, kannst du dir dein Opium zukünftig selbst pflücken, kapiert? Du bleibst mit deinem Arsch im Bett!«
»Ich gehe nirgendwohin, keine Sorge«, versprach Alfio.
Esteban wirkte wenig überzeugt, verließ das Zimmer jedoch und zog die Tür hinter sich ins Schloss.
Sobald er allein war, verdunkelte sich Alfios Miene. Wieder betrachtete er die Wunde in seiner Brust. Die Stellen, an denen er den Schorf abgelöst hatte, waren von nun getrocknetem Blut verschlossen. Zu langsam. All das passierte viel zu langsam. Alfio begriff nicht, was mit ihm geschah. Zwar ging der Heilprozess immer noch schneller vonstatten als bei einem gewöhnlichen Menschen, doch so schleichend waren seine Verletzungen noch nie geheilt. Sein erster Gedanke war gewesen, dass die Klinge, die ihn durchbohrt hatte, mit dem Speichel eines Unsterblichen versetzt gewesen sein musste, doch dann wären seine übernatürlichen Genesungskräfte für diese Wunde völlig außer Kraft gesetzt. Esteban hatte recht: Die Wunde heilte immer noch schnell. Aber eben nur nach sterblichen Maßstäben. Wie er es auch drehte und wendete, er konnte es sich nicht erklären.
Alfio schreckte aus seinem Grübeln hoch, als die Tür sich wieder öffnete. Anstelle von Esteban kam jedoch eine kleine, stämmige Frau ins Zimmer, die ihr seidig schwarzes Haar zu einem strengen Knoten hochgebunden hatte. Er erkannte sie von der Fotografie auf dem Beistelltisch.
Ihr Blick fiel auf Alfios halb gelösten Verband. »Das sollten Sie besser bleiben lassen«, meinte sie im Tonfall einer Feststellung. »Warten Sie, ich mach das.« Sie ging vor ihm in die Hocke und machte sich an der Gaze zu schaffen. Alfio wich irritiert zurück.
Sie wirkte amüsiert. »Kein Grund, schüchtern zu sein. Was glauben Sie, wer Ihnen den Dreck von Ihrem Prachtkörper gewaschen hat?«
Alfio räusperte sich. »Esteban«, sagte er wahrheitsgemäß.
»Stimmt auch. Aber ich hab geholfen. Und den Verband hab ich Ihnen allein angelegt. Deswegen weiß ich es auch nicht zu schätzen, dass Sie da dran rumfummeln.«
Als sie erneut nach ihm griff, ließ er es zu. Stirnrunzelnd beobachtete er sie dabei, wie sie die Mullbinden wieder fest um seinen Torso wickelte und ihm dabei so nahekam, dass er die Seife in ihrem Haar riechen konnte. Seine Nacktheit schien sie, im Gegensatz zu Esteban, nicht sonderlich zu beunruhigen.
Nach einer Weile richtete sie sich auf und betrachtete ihre Arbeit abschätzend. »So, sieht doch wieder ganz ordentlich aus. Vielleicht haben Sie ja diesmal die Güte, die Finger davon zu lassen. Blutflecken gehen nur schwer raus, und Sie haben schon bei Ihrer Ankunft einige meiner schönsten Laken ruiniert.« Missbilligend betrachtete sie die roten Flecken in der Bettwäsche.
»Das war nicht meine Absicht«, entschuldigte Alfio sich reflexhaft. »Wenn Sie möchten, verrate ich Ihnen einen Trick. Gegen die Blutflecken.«
Die Frau zog die Augenbrauen hoch. »Es überrascht mich nicht, dass Sie Erfahrung mit Blut haben. Was mich überrascht, ist, dass Sie wissen, wie man wäscht.«
»Ist das ungewöhnlich?« Alfio lächelte milde. »Meine Kleidung muss lange vorhalten. Ich ziehe es vor, sie gut in Stand zu halten. Ich nehme an, Sie sind Estebans Gattin?«
Sie brach in so heftiges Gelächter aus, dass ihr ein Grunzen durch die Nase schlüpfte. »Seine Gattin? Himmel, nein! Ich bin Gracia, seine Schwester.«
Diese Frau hatte ein seltsames Talent dafür, Alfio vor den Kopf zu stoßen. Sein Blick huschte verwirrt zu der Fotografie. »Oh, ich dachte …«
»Sie dachten falsch, mein Lieber.« Es schien ihr schwerzufallen, sich zu beruhigen. Immer noch kichernd schüttelte sie den Kopf über ihn, als hätte er etwas unvorstellbar Naives gesagt.
»Und die Kinder, die hier vorhin im Zimmer waren …«
»Sind meine«, ergänzte Gracia. »Kleine Satansbraten.« Die Wärme und Zuneigung, die in dem letzten Wort mitschwang, stand in absurdem Gegensatz zu seiner Bedeutung.
Alfio bemühte sich, den letzten Rest Manieren zusammenzukratzen, die er in dieser unschmeichelhaften Situation zustande bringen konnte. »Mein Name ist …«
»Oh, ich weiß sehr gut, wer Sie sind«, unterbrach Gracia ihn und zerstörte auch diesen Versuch, wieder so etwas wie Kontrolle über das Gespräch zu erringen. »Mein Bruder spricht ununterbrochen von Ihnen. Und seit Sie blutüberströmt und nackt durch unsere Haustür getragen wurden, höre ich ihm dabei sogar gelegentlich zu. Der Zeitpunkt ist zwar sicherlich ungünstig, aber ich spreche Ihnen dennoch meinen aufrichtigen Respekt aus.«
Alfio spürte, wie ihm Hitze in die Wangen stieg. Hatte die schamlose Offenheit dieser Frau ihn tatsächlich gerade dazu gebracht, zu erröten? Es gab nicht viele Menschen, die das zustande brachten. Um genau zu sein fiel Alfio gerade kein einziger ein.
Ernster fügte Gracia hinzu: »Ich bin froh, dass es Ihnen besser geht. Esteban war ganz krank vor Sorge.«
»Ich bringe ihm eben gutes Geld ein. Er will seinen besten Kämpfer nicht verlieren.«
Gracia gab ein verächtliches Schnauben von sich. Nun wirkte sie regelrecht beleidigt. »Sie sind mir ja einer, Mr. White! Da kratzt Sie jemand vom Bürgersteig, gibt Ihnen sein Bett, wäscht und umsorgt Sie, und Sie denken, es ist nur wegen ein paar Dollar? Ich würde mich ja ein klein wenig schämen, an Ihrer Stelle.«
Er begriff, dass er etwas grundlegend Falsches gesagt hatte. »Ich wollte nicht undankbar erscheinen«, versicherte er ihr. »Ich wollte nur …«