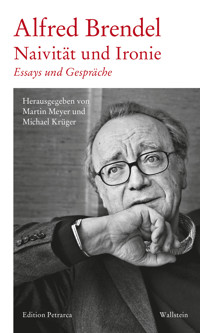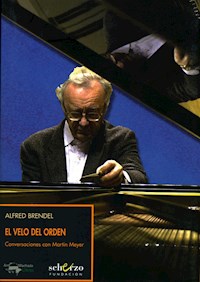Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alfred Brendel versteht sich außer am Klavier auch sprachlich glänzend auszudrücken. In diesem Buch gibt der Musiker kritische Einblicke in die musikalische Praxis – insbesondere zu Beethovens und Schuberts Streichquartetten – und einen erhellenden Rückblick auf seine Plattenaufnahmen. Und der Leser Brendel interessiert sich für die Literaten des 18. und 19. Jahrhunderts. Lebhafte Beobachtungen eines großen Pianisten zu Musik, Literatur und Film – ergänzt um Gedanken des großen Dichters Jean Paul.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Alfred Brendel
Wunderglaube und Mißtonleiter
Aufsätze und Vorträge
Mit einem Beitrag von Andreas Dorschel
Carl Hanser Verlag
Foto: Maria Majno
ISBN 978-3-446-24692-8
Alle Rechte vorbehalten
© 2014 Carl Hanser Verlag München
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Motiv: © Sergtt/Thinkstock
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
Jean Pauls Sprachkürze
Aus Jean Pauls »Gedanken« I
Meine Schallplattenaufnahmen
»Great Pianists«
»Artist’s Choice«
Musikleben im Wandel
Aus Jean Pauls »Gedanken«II
Zweierlei Pianistinnen
1. Katja Andy
2. Joyce Hatto
Aus Jean Pauls »Gedanken« III
Vielfalt und Dogma. Über Spielgewohnheiten
Aus Jean Pauls »Gedanken« IV
Kühne Kammermusik
1. Schubert und sein G-Dur Quartett
2. Erweiterung und Synthese. Beethovens
»Große Fuge und das Quartett op. 130«
Aus Jean Pauls »Gedanken«V
Kinderorchester
Zwischen Grauen und Gelächter.
Einführung in eine Filmserie
Die Filme der Serie
Aus Jean Pauls »Gedanken«VI
Andreas Dorschel: Brendeliana
Nachweise
Jean Pauls Sprachkürze
2013
Besonders achtete er die Hefte kurzer, kaum zusammenhängender Sätze höchst schätzenswert.
Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre,
1. Buch, 10. Kapitel
Daß Sprachkürze Denkweite gibt, hat Jean Paul in einem wunderbar knappen Aphorismus festgehalten. Seinen eigenen Lesern hat er diese Denkweite selten zugetraut. Nicht nur in den vielhundertseitigen Marginalien zu seinen Romanen hat er diese Denkweite bis ins Uferlose verbalisiert – schon im Duktus des Haupttexts ist Überfülle die Regel, eine Überfülle oft hinreißender Art, von der sein Bewunderer Georg Christoph Lichtenberg in einem kritischen Moment sagte, eine Blüte ersticke darin die andere.
Nicht wenige hochgestellte Damen ließen sich von dieser Blütenpracht betäuben, ohne daß der Dichter dies ausreichend zu schätzen wußte. Ich gestehe, daß ich es vorziehe, seine Blüten einzeln zu besichtigen, staunend daran zu riechen, wenn nicht darüber zu lachen. Denn Jean Pauls schönste Einfälle sind oft jene eines Humoristen. »Der Scherz ist unerschöpflich, nicht der Ernst«, heißt es im »Titan« (Komischer Anhang, Clavis Fichtiana), und an anderer Stelle: »Wenn so zuweilen die Eingeweidewürmer des Ichs, Erbosung, Entzückung, Liebe und dergleichen, wieder herumkriechen und nagen und einer den anderen frisset: so seh’ ich vom Ich herunter ihnen zu; wie Polypen zerschneide und verkehr’ ich sie, stecke sie ineinander. Dann seh’ ich wieder dem Zusehen zu, und da das ins Unendliche geht, was hat man dann von allem?«
Sehr viel, würde ich antworten. Es ist ja nicht nur die Denkweite, die Jean Paul den Lesern eröffnet. Seinem Freund Thieriot schreibt er von der »pikanten Süßigkeit«, sein Leben zugleich zu spielen, zu leben und zu parodieren. Die Resonanz seiner besten Notizen erfaßt ja nicht nur den Verstand. Zu dem aufgeklärten Leser philosophischer und wissenschaftlicher Schriften gesellt sich in ihm der Somnambulist, der Sprachphantast, der von Sprachlust, Sprachmut und Sprachwitz hingerissene, seiner selbst kaum mehr mächtige Sprachspieler, dessen überraschende Verrückung von Wörtern und Sätzen den Funken des Entzückens oft erst herstellt. Der Satz »Shakespear hat alle Karaktere gemalt, einen ausgenommen, seinen« wäre, konventionell formuliert, bei aller Triftigkeit sehr viel weniger reizvoll. Für den Wortlaut der Eintragung »Und der Mensch wäre gern ganz Herz« müßte man allein schon dem »Und« zuliebe Jean Paul beide Hände küssen, oder vielmehr in seinen eigenen Worten zurufen: »Ich wollte, Sie hätten 4 Hände, damit ich öfter küssen könnte.«
Wenn er nicht schrieb, dann las er. Es ist nicht zu schätzen, was von beidem er in größeren Mengen getan hat. Und wenn er beides nicht tat, dann exzerpierte er. Jean Paul war wohl der belesenste Autor seiner Zeit, der aber selbst, wie es heißt, nur wenige Bücher besaß. Hingegen hielt er sich in den späten Bayreuther Jahren in seinem Schreibzimmer einen Wetterfrosch, Mäuse und eine Spinne, die er persönlich mit Fliegen fütterte. Außerdem wimmelten ein Eichhörnchen, sein Hund (ein Spitz mit Namen Alert) und seine Kinder im Raum herum, wenn er sich nicht in die Rollwenzelei zurückzog.
Neben der riesigen Wörterflut seiner Satiren, Romane, Traktate, Visionen, Vorschulen und Erziehungslehren sind seine Aufzeichnungen (»Gedanken«) tausendfacher Beweis dafür, daß seine Feder auch im Biernebel nicht zur Ruhe kam. Zur späteren Verwendung in größeren Zusammenhängen notiert, aber meist fragmentarischer und schnipselhafter als jene Lichtenbergs in den »Sudelbüchern«, sind die gelungensten dieser Notizen Blitze komischer Erleuchtung. Eine Wortschöpfung wie »Mißtonleiter« reißt mehrere Perspektiven zugleich auf: Sie wird einem vom Hörsturz Befallenen nur allzu real erscheinen, blickt aber zugleich prophetisch in die Zukunft. In einer anderen Aufzeichnung sagt uns Jean Paul nämlich: »Wie die Tonkunst zunimmt, wird der Ekel an ewig wiederkommenden Wohllauten und der Überdruß an gewöhnlichen Auflösungen so reich gedeihen, daß man am Ende zu Mißtönen greifen wird.« Spielerisch ist hier die Musik unserer Tage vorausgehört.
Während der berühmte Autor zunehmend »dicker und wilder« wird und ständig neue Richtlinien für das Schreiben erfindet, weiß er dennoch stets um die andere Seite: Das Unbewußte bleibt für ihn »das Mächtigste im Dichten, welches den Werken die gute und die böse Seele einbläset.« In seinen »Gedanken« macht es sich als Spontaneität erster Hand bemerkbar, wobei die Kollision der beiden Seelen im Witz diesem Leser ein Vergnügen bereitet, wie es ernsthafte Sentenzen im Polonius-Ton nie zustandebrächten.
Meine Auswahl aus diesen Notizen ist in sechs Abschnitten auf das ganze Buch verteilt.
Aus Jean Pauls »Gedanken« I
Er würde seinen Regenbogen nur aus 1 Farbe machen, schwarzer.
I/45
Herz auf die Fleischwaage legen.
I/149
Man sollte geistig die Menschen weniger einteilen in Blinde und Sehende, als in die mit grauem und schwarzem Star.
I/173
Er liebt die Weiber bis sogar unter den Heringen und Krebsen.
I/341
Ich will mich lieber auf Bergen als in Thälern beregnen lassen.
I/533
Wenn die Hebamme den Kopf nicht abreißet, thun’s nachher die Lehrer.
II/23
Es gehört schon Muth dazu, seinen Hund auf der Gasse zu prügeln.
II/178
Ihr Herz ist wie ein Großvaterstuhl ausgesessen.
II/279
In der Freude geht man nicht gern bergauf.
II/294
Der Mensch muß wie eine Kutsche auch hinter sich Fenster haben.
III/14
Manche Menschen sind Flügel, zum Spiel im Konzert; manche Klaviere zu einsamem Spiel.
III/140
Der Parnaß hat 2 Spitzen, auf der einen wohnen die genialischen Engel, auf der anderen die genialischen Teufel.
III/169
Ein halbes Beet im Zuckerfeld der Lust haben.
III/212
Einen absüßen zu einem süßen Herrn – er ist eine weiche Zucker-Erbse, sein Kopf ein Hutzucker.
III/228
Wenn man immer eine Mandel ist, so muß man sich statt der rauhen Schale noch süß überziehen.
III/230
Mädgen: keine Blumen, sondern ein Blumenbeet.
III/245
Die Zukunft stört den Schlaf mehr als die Vergangenheit.
III/246
Um ihr Herz gar für die Ehe zu braten, müßte man eine Sonne unterschüren.
III/250
Meine Schallplattenaufnahmen. Ein Rückblick
2013
Innerhalb der sechzig Jahre meines Pianistendaseins sehe ich als besondere Anomalie die ungewöhnlich große Zahl meiner Tonaufnahmen. Um zu erklären, wie sie zustande kamen, muß ich etwas weiter ausholen.
Wenn man das übliche Bild einer erfolgreichen Karriere vor Augen hat – Wunderkind, frühe Begeisterungsstürme, verblüffende Spielsicherheit – dann war meine Entwicklung untypisch. Ich komme weder aus einem musikalisch aktiven oder auch nur musischen, osteuropäischen oder jüdischen, akademischen oder abenteuerlustigen Haus. Vor meinem fünfzehnten Jahr hatte ich noch kein Sinfoniekonzert, keinen Klavierabend und keine Opernaufführung erlebt. Sporadische Lichtblicke bot manchmal das Radio.
Seit meinem sechzehnten Lebensjahr arbeitete ich, vom Besuch kurzer Meisterkurse abgesehen, allein. In diese Arbeit waren damals auch das Komponieren, Malen und Schreiben mit eingeschlossen. Ludovika von Kaan, die Grazer Klavierpädagogin, entließ mich freundlich, riet mir zu einem ersten Klavierabend und knüpfte den Kontakt zu dem großen Pianisten Edwin Fischer. In den folgenden Jahren gab es drei Sommeraufenthalte in Luzern bei Fischer, einen bei Eduard Steuermann in Salzburg sowie wenige Kurzbesuche bei Paul Baumgartner in Basel. In Wien absolvierte ich die Staatsprüfung für Klavier, um meinen Eltern etwas vorzuweisen. Mein erster öffentlicher Klavierabend als Siebzehnjähriger in Graz mit selbst ausgedachtem, ungewöhnlichem Programm (Die Fuge im Klavierwerk) hatte Erfolg, was meine Mutter, eine geborene Pessimistin, fürs erste besänftigte.
Erste Aufnahmen in Wien
In den fünfziger Jahren strömten kleinere amerikanische Schallplattenfirmen nach Wien, weil es sich dort besonders billig aufnehmen ließ. Meine erste Aufnahme fand im Januar 1951 statt. Kurz vor Weihnachten hatte ich ein Telegramm bekommen, das mich einlud, das fünfte Klavierkonzert von Prokofjew aufzunehmen. Ich hatte nie eine Note von Prokofjew gespielt, genauso wenig wie das Wiener Volksopernorchester, mit dem ich das Werk dann in zwei Sitzungen aufnahm. Der Dirigent war jung, freundlich und unerfahren. Kurz danach tauchte ein wesentlich älterer Herr namens Adler aus den Vereinigten Staaten auf, der sich darüber freute, daß er einmal mit einem kleinen Orchester Artur Schnabel als Solisten dirigieren durfte, was ihm in der lokalen Zeitung die Überschrift »Schnabel und Adler« einbrachte. Für seine winzige Firma wählte er aus einer langen Liste von Werken, die ich hingeschrieben hatte, Busonis »Fantasia contrappuntistica«. Busoni hatte mich schon frühzeitig als eine Künstlerfigur gefesselt, die über das Pianistische weit hinausreichte. Mit der Aufnahme von Liszts für seine Enkelin Daniela komponierter später Klaviersuite »Weihnachtsbaum« begann meine Beschäftigung mit dieser damals noch so gut wie unbekannten Musik, deren Noten ich in der Wiener Nationalbibliothek fotokopieren ließ.
Die VOX-Periode
Als nächster erschien George H. Mendelssohn, eine an den Filmschauspieler Adolf Wohlbrück erinnernde Gestalt, der mir als Präsident der VOX dann über zehn Jahre lang eine Flut von Dingen zu spielen gab. Unter seiner Ägide verbrachte ich viele Stunden in den Sälen des Wiener Konzerthauses oder Musikvereins, in denen die meisten Aufnahmen stattfanden. Ich erinnere mich zunächst an ein Programm mit russischer Klaviermusik: Strawinskys »Petruschka«, Balakirews »Islamey« und Mussorgskys »Bilder einer Ausstellung«. Während des Studiums der »Petruschka-Suite« ersann ich die Methode, Hansaplast über meine Fingerkuppen zu kleben, um das Splittern der Fingernägel zu verhindern. Dann gab es, abgesehen von mindestens sieben Liszt-Platten, meine ersten Aufnahmen von Mozart-Konzerten und die Gesamtaufnahme von Beethovens Klavierwerken, die sich über fünf Jahre hinzog. (Die Firma VOX hat als erste die Idee realisiert, sogenannte VOX-Boxen von Langspielplatten herauszubringen, die ganze Serien von Werken eines Komponisten enthielten.)
Nur weniges von Beethovens Klaviermusik, wie die kindlichen Variationen über einen Marsch von Dreßler, habe ich weggelassen. Zuerst spielte ich alle kleineren Variationenwerke ein, Nebenwerke, die dennoch die Kenntnis Beethovens wesentlich ergänzen. Die Aufnahme der 32 Sonaten wurde zufällig am 5. Januar 1963, also an meinem 32. Geburtstag, abgeschlossen, allerdings nicht mit den späten Sonaten, die ich schon Ende der fünfziger Jahre eingespielt hatte. Daneben entstanden meine ersten Schubert-Aufnahmen: Impromptus, »Moments musicaux«, die drei nachgelassenen Stücke und die Wandererfantasie, ein Werk, das ich ebenso wie Liszts h-Moll-Sonate seit meinen Jünglingstagen im Repertoire hatte. Nicht vergessen sei das Klavierkonzert op. 42 von Arnold Schönberg, ebenfalls noch in den fünfziger Jahren in Baden-Baden aufgezeichnet. Dirigent war der junge Michael Gielen. (Die beiden anderen Aufnahmen dieses Werkes kamen später mit Rafael Kubelik in München und noch einmal mit Gielen in Baden-Baden zustande.) Es ist kaum zu beschreiben, wie schwierig eine Aufführung dieses Werkes anfangs war, und wie einfach, ja fast selbstverständlich sie inzwischen geworden ist.
Ein Teil meiner Wiener Aufnahmen wurde von einem Kontrabassisten als Aufnahmeleiter betreut, der hauptsächlich den Baßschlüssel verfolgte. Ferner war da ein einziger Tontechniker, der das Magnetophon bediente, aber keine Noten lesen konnte. Während des »Schneidens« saß ich mit diesem allein im Studio und gab ihm an den Schnittstellen die Einsätze; das Tonband wurde damals tatsächlich mit einer Schere geschnitten. Ich habe bei diesen Aufnahmen viel gelernt, und nicht nur tontechnisch: Es ergab sich ein erster Überblick über das Panorama Beethovenscher Klavierkompositionen, die Leichtes, Verspieltes, Graziöses, Komisches, Witziges ebenso beherbergen wie Drama und Tragödie, Intellektualität und Gefühlsgewalt, Wärme und Schroffheit, die Knappheit der Bagatellen und den Riesenorganismus der »Hammerklaviersonate«. Ans Ende dieser VOX-Turnabout-Periode gehören meine ersten »Diabelli-Variationen«, ein Lieblingswerk, das ich, wie auch einige der Sonaten, zunächst im Studio spielte, bevor ich damit vierzig Jahre lang durch die Konzertsäle zog.
Das Vanguard-Intermezzo
Von der VOX wechselte ich für ein kurzes Zwischenspiel zu Vanguard. Es zeitigte unter anderem meine erste Schumann-Aufnahme (Sinfonische Etüden und Fantasie) und Schuberts Sonaten in c-Moll und C-Dur. Als ich in den sechziger Jahren Schuberts c-Moll-Sonate in Wien spielte, hatte der Schubert-Forscher Otto Erich Deutsch, der im Publikum saß, dieses Werk noch nie gehört. Weiters produzierte die Vanguard Mozarts Konzerte KV 271 und 449 mit den Solisti di Zagreb sowie einige der Lisztschen Rhapsodien und Chopin-Polonaisen. Ich hatte mir mehrere Monate freigehalten, um in den virtuosen Geist dieser Werke einzudringen. Wiewohl ich mich nicht für einen geborenen Chopin-Spieler hielt, reizte mich die Beschäftigung mit seinen Polonaisen, die ja, mit Ausnahme der selbst von Greisen heruntergedonnerten in As-Dur, die Konzertprogramme seltener erreichen.