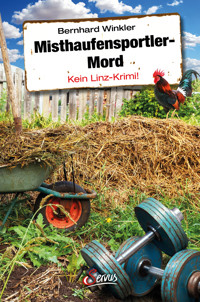Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie konnte es nur so weit kommen? Politik ist zum Sammelbegriff für Frust, Wut und Missgunst geworden. Doch die grassierende Unzufriedenheit mündet nicht in neuen Ideen, sondern alten Gegensätzen. Politiker, Medien und Bürger widmen ihre ganze Aufmerksamkeit der Furcht vor einer Krise nach der nächsten. Das muss aufhören, fordert Bernhard Winkler. Er bringt spannende neue Ideen, erzählt amüsant aus seinem jungen Leben und ruft zu gegenseitigem Respekt auf. Mit diesem Buch wagt er das Unmögliche: Politische Themen zu diskutieren, ohne in einem zornigen Rundumschlag zu enden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kapitel
#Wutbürgertum
Vom Hass im Netz zu gegenseitigem Respekt
Kapitel
#Demokratie
Die Macht geht dem Volk aus Ideen für eine bessere Demokratie
Kapitel
#Populismus
Die Schwäche ihrer Gegner ist die Stärke der FPÖ
Kapitel
#Flucht
Die Flucht vor der Realität
Kapitel
#Europa
Der Wunsch ist der Vater des Europäischen Gedankens
Kapitel
#Föderalismus
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit
Kapitel
#Pensionen
Der Stillstand von heute ist die Altersarmut von morgen
Kapitel
#Generationengerechtigkeit
Kinder an die Macht – aber wirklich!
Kapitel
#Medien
Make Journalismus great again
Kapitel
#Oberflächlichkeit
Die Macht der Bilder braucht Kontrolle
Kapitel
#Gipfel
Was man als Fernsehzuschauer alles nicht sieht Ein unfreiwilliger Selbstversuch
Kapitel
#Diskussion
Offen für Neues zu sein, ist nicht immer einfach
Epilog
#Meinungsfreiheit
Besonnen in die neuen Zeiten
1. Kapitel
#Wutbürgertum
Vom Hass im Netz zu gegenseitigem Respekt
Wer auf Reisen geht, lernt sein Ziel erst dann richtig kennen, wenn er mit den Bewohnern in Kontakt tritt. Stur eine Liste von Sehenswürdigkeiten abzuarbeiten, ist nicht mehr als das Besichtigen toter Kulissen. Erst die Menschen erfüllen all die Gemäuer, Skulpturen und Landschaften mit Leben und Authentizität. Würden alle 1,8 Millionen Wiener nach Hamburg auswandern und alle 1,8 Millionen Hamburger nach Wien ziehen, bliebe Wien zwar die Stadt des Stephansdoms und Hamburg die Stadt des Michels. Aber es entstünden dennoch zwei völlig neue Metropolen. Am Hamburger Hafen würde keiner der Ausflugsschiff-Matrosen mehr den Touristen in marktschreierischer Manier und mit norddeutschem Timbre die immer wiederkehrende Frage „Wollt ihr noch miiit?“ zurufen. Und in Wien müsste man in keinem der traditionellen Kaffeehäuser die liebgewonnene Arroganz der altehrwürdigen Kellner in Kauf nehmen, um eine Tasse des heiß ersehnten Koffeintranks zu ergattern.
Die Emotionen, die Ortsansässige ihren Gästen entgegenbringen, machen eine Reise besonders. Im Hamburger Stadtteil Blankenese erlebten meine Freundin und ich eine dieser Begegnungen mit Einheimischen, aufgrund derer sich Touristen in ihre Urlaubsorte verlieben. Wir überquerten auf einem Zebrastreifen eine Straße. Kurz bevor wir auf der anderen Seite ankamen, schaltete die Fußgängerampel auf Rot. In Österreich geschieht das erst, nachdem die Ampel drei Mal grün geblinkt hat. In Deutschland gibt es diese Vorwarnung nicht. Die Ampel wechselt sofort auf Rot. Die Reaktion des deutschen wie österreichischen Fußgängers, der sich auf dem Schutzweg befindet, ist freilich dieselbe: Man eilt nicht wieder an den Startpunkt der Straßenüberquerung zurück, sondern verlässt die Fahrbahn zügig in Zielrichtung. Das gelingt allerdings nur, wenn einem nicht ein Auto den Weg abschneidet, wie bei uns an jenem Tag. Die Ingenieurskunst deutscher Autohersteller ist zwar abseits von Abgasskandalen recht bemerkenswert, aber sie lässt sich andernorts doch um einiges besser bewundern als mitten auf der Straße. Entsprechend ablehnend fiel meine Reaktion auf den Rüpel im schwarzen Boliden aus, der nur einen Meter vor uns quer über den Schutzweg brauste. Ich setzte zu einer international verständlichen Handbewegung an, die dem Bedachten ein Defizit geistiger Zurechnungsfähigkeit attestiert. Dort, wo ich herkomme, würde mich ein Autofahrer dafür entweder demonstrativ ignorieren oder mit ebenbürtiger Gestik antworten. Jener in Hamburg hielt mittels Vollbremsung an, entstieg flink wie ein Wiesel seinem Wagen und hieß mich mit krebsrotem Gesicht und den Worten „Was ist denn mit dir los, du Penner?“ in seiner Stadt willkommen. Offenbar dachte er, wir seien von Anfang an mutwillig bei Rot über die Kreuzung marschiert. Sein riskantes Fahrmanöver war der klägliche Versuch einer Maßregelung. Ich antwortete unbeeindruckt mit der Erklärung, die Ampel sei ja Grün gewesen, als wir losgegangen waren. Das interessierte den großgewachsenen Mittsechziger wenig. „Du kriegst gleich eine auf die Nuss!“, lud er mich ein, näher zu kommen. Aber anstatt mir die ehrliche Chance zu geben, das Grün der Fußgängerampel abzuwarten und mich zu ihm auf die andere Straßenseite zu gesellen, stieg er wieder ins Auto. Und wie das bei älteren Männern und Sportwägen so üblich ist, tat er das mit einer entwürdigenden Rückenschonbewegung, die er so unbeholfen ausübte, dass er sich dabei offensichtlich den Ischias-Nerv einklemmte. Anders ist die absurd hohe Geschwindigkeit nicht zu erklären, mit der er, wahrscheinlich zur nächsten Arztpraxis, davonbrauste.
Jeder von uns ist gelegentlich wütend. Wie unsinnig das in den meisten Situationen ist, wird einem erst klar, wenn die Kraft, die zum Wütend sein notwendig ist, bereits verschwendet und jemand anderer bereits beleidigt ist. Bei der Wut über Politik ist das ganz anders. Sie ist zum Dauerzustand geworden. Sie gehört zum guten Ton. Jemand, der nicht wütend auf unsere Politiker ist, erscheint fast schon verdächtig. Situationen, in denen es einem Bürger peinlich ist, auf die Politik wütend gewesen zu sein, existieren nicht. Im Gegenteil. Viel häufiger werfen aktuelle Geschehnisse die Frage auf, warum man nicht schon viel früher noch wütender gewesen ist. Ungewiss bleibt, ob irgendwann in ferner Zukunft doch einmal der Tag kommen wird, an dem man sich für die Wut über die politischen Zustände von damals, also heute, schämt. Etwa weil die Probleme in dieser fernen Zukunft viel größer und weitreichender sind als jene, die uns jetzt beschäftigen. So außerhalb jeder Vorstellungskraft sind solche viel größeren und weitreichenderen Probleme gar nicht. Anstatt in die Zukunft zu schauen, reicht es, den Blick einige tausend Kilometer nach Osten zu richten. Dort befinden sich viele Menschen entweder in offiziellen Kriegsgebieten oder sie leben ihren Alltag mit der Gefahr jederzeitiger Bombenanschläge und Entführungen. Dagegen sind viele unserer alltäglichen Probleme nicht die Emotionen wert, die wir ihnen widmen. Bei allem berechtigten Ärger leben wir in Mitteleuropa das Privileg weitgehenden Friedens und ein so großer Bevölkerungsanteil wie nirgendwo sonst hat alles, was es für ein menschenwürdiges Leben braucht. Das negative subjektive Sicherheitsgefühl, das auch hierzulande überhandgenommen hat, steht in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Gefahrenlage. Auf dem „Global Peace Index“, der 163 Länder nach ihrem Sicherheitsniveau reiht, belegt Österreich den dritten Platz.1
Dies ist kein Plädoyer dafür, jede Kritik an der heimischen Politik mit dem Argument abzutun, dass es in anderen Ländern schlimmer zugeht. Schließlich gibt es kein Problem, das man nicht mit dem Verweis auf ein größeres kleinreden könnte. Österreich hat, vor allem was die langfristigen Zukunftsperspektiven angeht, gravierende Probleme. Dennoch ist Wut nicht der passende Umgang damit. Sie nebelt den Weg zur Lösung nur ein. Sie verstellt die Sicht auf gute Ideen. Sie lässt uns selbstmitleidig im aktuellen Zustand verharren. Diese Zeilen sollen dazu anregen, differenziert zu bleiben anstatt blinde Wut walten zu lassen. Konsequent, aber offen für Gegenargumente. Leidenschaftlich, aber nicht emotional. Das klingt alles irgendwie nach Wahlplakatsprüchen. Austauschbar und nichtssagend. Doch es beschreibt genau das, was in der öffentlichen Diskussion über Politik fehlt. Mehr noch: Es ist das Gegenteil dessen, wie die öffentliche Diskussion jetzt ist.
Im Internet wird das ganze Schlamassel für jeden sichtbar. Dort, wo sich viele Leute so verhalten, als bliebe ihr Tun anonym und ohne Konsequenzen, zeigt es sich besonders gut. Bei der Mehrheit der Internet-Postings zu politischen Themen handelt es sich nicht um argumentierte Meinungen, sondern um unkontrolliert freigesetzte Emotionen. Fast immer ist es Wut. Wut über die herrschende Politik. Wut über Andersdenkende. Wut über Ausländer. Wut über Nationalisten. Wut über die grassierende Wut. Wut lässt sich herrlich einfach in die Computertastatur hämmern. Das ist viel bequemer als sie jemandem ins Gesicht zu sagen. Allerdings richtet die im Internet ausgelebte Aggressivität großen realen Schaden an. Sie bringt Menschen dazu, aus Angst vor Anfeindungen lieber zu schweigen anstatt zu argumentieren. Diese Selbstzensur ist eine Bedrohung für die Demokratie und unser friedliches Miteinander.
Es ist ein großer Irrtum, diese Zerstörung der Diskussionskultur einer asozialen oder ungebildeten Schicht am Rand der Gesellschaft zuzuschreiben. Es sind ganz gewöhnliche Bürger, die sich im Internet nicht immer so zu benehmen wissen, wie es sich gehört. Der Hass im Netz ist auch keine Frage der Weltanschauung. Er geht nicht, wie oft behauptet wird, nur von schlecht gebildeten, frustrierten, rechten Modernisierungsverlierern aus. Das ist zwar häufig der Fall. Postings mit nationalsozialistischem Inhalt tun aufgrund der Geschichte Österreichs besonders weh. Für sie gibt es das Verbotsgesetz, das den Urhebern mit Gefängnisstrafen droht. Gut so. Aber abseits dieser schweren Fälle schenken sich Rechts und Links beim Austausch ihrer gegenseitigen Abneigung nichts. Oder um es mit einem Phänomen zu veranschaulichen, das auf Facebook besonders oft zu beobachten ist: Ob ein Rechter einen Linken mit deftigen Schimpfworten bedenkt oder ob sich ein Linker über die schlechten Grammatikkenntnisse des Rechten lustig macht, ist im Ergebnis egal. Beides ist kein wertvoller Beitrag zur öffentlichen Diskussion. Beides ist eine Folge dessen, was allen diesen Hassbotschaften gemein ist: Die nicht vorhandene Fähigkeit oder Bereitschaft, sich in die Perspektive des Gegenübers hinein zu versetzen. Bevor es Facebook und ähnliche Plattformen gab, blieben all die Aggressionen und niederen Instinkte, die in uns allen wohnen, entweder im kleinen Kreis oder überhaupt verborgen. Politische Kommentare, die die Meinungsfreiheit bis an ihre Grenzen ausreizten, gab es am Stammtisch zu hören oder maximal auf den Leserbriefseiten der „Kronen Zeitung“ zu lesen.
Alleine vorm Bildschirm sitzend oder mit dem Handy in der Hand Gedanken zu verschriftlichen, ist ein intimer Moment. Kein Gegenüber, dessen Reaktion wir wahrnehmen. Niemand da, auf den es Rücksicht zu nehmen gilt. Dabei dennoch ein Millionenpublikum erreichen zu können, ist evolutionär völlig neu. Entsprechend schlecht können wir damit umgehen. Falsch ist, angesichts der neuen technischen Möglichkeiten zu behaupten, die Leute seien streitsüchtiger oder ungehobelter geworden. Sie haben beim Ausleben dieser Charakterzüge nur ein viel größeres Publikum als früher. 2013 veröffentlichte ich mein erstes Buch. Es hieß: „So nicht! Anklage einer verlorenen Generation“. Der Titel klang laut, frech und den Politikern die Meinung sagend. Dass die 160 Seiten, die sich hinter dem schrillen Cover verbargen, auch deeskalierende Botschaften enthielten und oft mehr abwiegend als aufrührend waren, blieb von verblüffend vielen Menschen unbemerkt. Egal, was ich in Interviews oder in Diskussionen sagte: Die Meinungen über mich und mein Buch waren schneller gebildet, als ich das Buch aufschlagen oder meinen Mund aufmachen konnte. Ich erntete wohlwollende Schulterklopfer von Leuten, die nur den Titel des Buchs kannten und ich bekam harte Kritik zu hören – wiederum ausschließlich aufgrund des Covers. Als ob ich nur eine Buchseite veröffentlicht hätte. Da waren sie, die Wutbürger aller Richtungen und Couleurs. Und ich war mittendrin.
*
„Jetzt denk‘ an einen Politiker, den du überhaupt nicht ausstehen kannst und schrei 'Du Arschloch!'.“ Ich tat wie mir aufgetragen. Auf dem Bildschirm der Spiegelreflexkamera erschien mein Gesicht mit weit aufgerissenem Mund, der gerade das „A“ des Wortes Arschloch formte. Meine Augen vermittelten aber nicht die Aggressivität, die sich der Fotograf erhofft hatte, sondern etwas ganz anderes. Unsicherheit. Bedrängnis. Auch Belustigung. Sie fragten: „Was zum Teufel mache ich eigentlich hier?“
Um mich herum war alles geradezu perfekt auf Düsterkeit und Pessimismus getrimmt. Der Raum, ein in Umbau befindliches Fotostudio so groß wie ein Klassenzimmer, war halb abgedunkelt. Die Sonne war bereits untergegangen, sodass durch die beiden zum Innenhof gerichteten Fenster des alten Stadthauses im Zentrum Wiens kein Licht mehr hereinkam. Helligkeit spendeten nur die direkt auf mein Gesicht gerichteten 1000-Watt-Scheinwerfer, die mich von links und rechts und oben und unten blendeten und grillten. Die Hitze hatte ich wohlweislich vorausgesehen. Schließlich sind Fotostudios mit grellem Licht nicht gerade für angenehme Temperaturen bekannt. Also kam ich im luftigen T-Shirt zum Termin. Im Scheinwerferlicht stand ich aber nun in meiner schwarzen Lederjacke. Das passe thematisch besser, sagte der Fotograf.
Es blitzte und piepte. Der Speicher der Kamera füllte sich mit Fotos. Mein grimassenverzerrtes Gesicht schmerzte und ich fragte mich, ob das, was ich hier tat, wirklich das Richtige war. Der Fotograf konnte nichts dafür. Sein Job war es, mich gemeinsam mit meinem Buch „So nicht! Anklage einer verlorenen Generation“ für ein Magazin adäquat in Szene zu setzen. Dass dies bei einem Werk mit dem genannten Titel nicht beim Blumenpflücken auf der Frühlingswiese oder beim Tee trinken im Schaukelstuhl erledigt werden konnte, lag in der Natur der Sache. Ich war der zornige Revoluzzer. Der, der „denen da oben“ die Meinung sagte. Ein Mann, der dem Wutbürgertum ein junges Gesicht gab. Das wurde zumindest in den Titel des Buchs hineininterpretiert. Aber war ich das wirklich? Wollte ich das überhaupt sein? Ich posierte weiter. Augen, Mund weit auf – und durch.
Trotz seines Engagements und immer neuer kreativer Einfälle konnte mich der Fotograf zu keinem Tobsuchtsanfall bewegen, egal welchen Politiker ich mir auch vor meinem geistigen Auge vorstellte. Als ich es mit einem Gedanken an Frank Stronach, den schrulligen betagten Milliardär mit neuerdings eigener Partei versuchte, huschte mir zu allem Überdruss ein Lächeln übers Gesicht. „Okay, das wird nichts“, sprach der Fotograf aus, was wir beide dachten. Wir wechselten die Strategie. Ich sollte nun mein Buch in die Hand nehmen, es in die Kamera halten und darauf hinunterblicken. Dabei konnte nun wirklich nichts schief gehen. Keine zehn Minuten später waren wir fertig. Erleichterung durchwehte den Raum. Der Schweißgeruch des in Leder gezwängten Jungwutbürgers war wie weggeblasen.
Es war Ende April und noch gut eine Woche Zeit, bis das Buch erscheinen würde. Mir stand eine genauso aufregende wie ungewisse Zeit bevor. Wie wird es ankommen? Bin ich der Aufgabe überhaupt gewachsen, die kontroversen Thesen meines Buchs in der Öffentlichkeit zu vertreten? Schließlich ging es darin um Politik. Und in der Politik wird man nicht mit Samthandschuhen angefasst.
Unter jungen Menschen ist es nicht gerade üblich, die Freizeit mit dem Schreiben eines Buchs zu verbringen. Unter Älteren auch nicht. Aber der Antrieb, das zu tun, war so banal wie effektiv. Irgendwann hatte ich festgestellt, dass alles, was in unserer Gesellschaft mit Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten zu tun hatte, ohne junge Menschen stattfand. Im Parlament saßen praktisch nur Leute, die altersmäßig meine Eltern oder Großeltern sein hätten können. Im Fernsehen diskutierten prinzipiell nur Menschen jenseits des 50. Lebensjahrs über eine Zukunft, die sie selbst nicht mehr erleben würden. In den Zeitungen erschienen in unerträglicher Häufigkeit Artikel, in denen Redakteure in fortgeschrittenem Alter das aburteilten, was da als nächste Generation nachkam. Man bezweifelte, dass der Nachwuchs die großen Fußstapfen der Vorfahren je ausfüllen können würde. Und in meinem Umfeld war alles, was mit Politik zu tun hatte, so verschrien, dass anstatt zu diskutieren geseufzt, geflucht und mit den Augen gerollt wurde. Politik war pfui und gleich nach den bestehenden Akteuren wurde die Jugend als am ungeeignetsten dafür erachtet, etwas zum Besseren zu verändern.
Jugend und Politik – die Kombination dieser beiden Themen trafen bei mir einen empfindlichen Nerv. Sie waren mein Musikantenknochen. Eine sachte Berührung und ich tobte. Zumindest innerlich. So lange mein Buch nicht fertig war, blieb es mein Geheimnis. Somit war es mir möglich, verdeckt zu recherchieren. Die Authentizität dessen, was in meiner Anwesenheit über Politik gesprochen wurde, hätte mit großer Wahrscheinlichkeit gelitten, wenn bekannt gewesen wäre, dass sich so mancher Satz bald in einem Buch wiederfinden würde. So richtig schön schimpfen und jammern lässt sich’s doch nur, wenn man weiß, dass dem Gerede niemals eigene Taten folgen müssen und keinerlei Konsequenzen für einen selbst zu erwarten sind.
Wie die redseligsten und offenherzigsten Menschen plötzlich kleinlaut und verschlossen werden, wenn das, was sie sagen, niedergeschrieben und mit vollem Namen veröffentlicht werden soll, wusste ich nur zu gut. Einige Zeit zuvor gehörte es als Jungjournalist zu meinen Aufgaben, Straßenumfragen durchzuführen. Ich begab mich in unregelmäßigen Abständen in die geschäftigste Einkaufsstraße von Linz, um Passanten zu aktuellen Themen zu befragen. Die Zusammenfassung ihres Statements sollte mit Namen, Wohnort und Foto in der Zeitung abgedruckt werden. Straßenumfragen waren Aufgaben, die in der Redaktion gern an die unterste Hierarchiestufe delegiert wurden, also an die jüngsten Mitarbeiter. Meine Unter-30-jährigen Kollegen und ich nahmen das lethargisch, aber pflichtbewusst zur Kenntnis. Ein Seufzer, ein letzter Blick auf die viel spannenderen Recherche-Ergebnisse der vergangenen Stunden – und dann der Griff zum Regenschirm. Denn Tage, an denen Straßenumfragen in Auftrag gegeben wurden, zeichneten sich durch eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 100 Prozent aus. Der Himmel weinte mit uns. Es war wie ein Naturgesetz.
Selten zuvor war mir in meinem Leben von anderen Menschen so viel Misstrauen entgegengebracht worden wie bei diesen Außeneinsätzen. Die Kunst war es, folgende beiden Sätze einer wildfremden Person vollständig vorzutragen, ohne ihren Fluchtinstinkt zu wecken: „Entschuldigen Sie bitte, ich bin von der Zeitung und mache eine Umfrage. Was ist Ihre Meinung zum Thema…“. Die meisten Leute, die ich ansprach, stellten sich taub. Manche machten sich nach dem einleitenden „Entschuldigen Sie bitte“ davon. Einige teilten mir mit, dass sie kein Abonnement der Zeitung haben wollten. Andere rümpften ob des einfältigen Themas die Nase und verweigerten sich. Besonders Redselige verrieten mir ihre Meinung zu einem Problem, das ich auch nach intensivem Nachdenken nicht in einen Zusammenhang mit der gestellten Frage bringen konnte. Die Ängstlichen waren von der Kamera eingeschüchtert, die ich für das Porträtfoto schussbereit bei mir hatte. Ihren erschrockenen Blicken zufolge hielten sie das Gerät für eine Waffe. Von denen, die mir ihren Standpunkt zum Thema verrieten, erkannten die meisten mitten in ihrem Redefluss, dass sie doch keine druckbare Meinung hatten – oder kein Gesicht, das schön genug war, in der Zeitung abgebildet zu werden. Und dann war da noch die Nadel im Heuhaufen, diese eine von bestimmt zehntausend Personen, die tatsächlich mit Foto, Namen, Wohnort und ihrem Statement in die Zeitung kam.
Eigentlich ist das seltsam. Vor einer Veröffentlichung in der Zeitung fürchten sich die Menschen, aber auf Facebook fallen alle Hemmungen. Dabei werden die Hass-Postings zumeist in Profilen mit vollem Namen und Foto veröffentlicht. Die Privatsphäre-Einstellungen sind dabei so gesetzt, dass die Texte von allen gelesen werden können. Sie schaffen damit das Potential, gleich viele oder sogar mehr Menschen zu erreichen als es Zeitungsleser gibt. Und doch geht so ein Facebook-Posting leichter von der Hand als einem Journalisten von Angesicht zu Angesicht die Meinung zu sagen.
Ein Redakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil tat im Sommer 2016 genau das Richtige. Er kontaktierte die Leute, die ihrer Wut im Internet oder per Leserbrief freien Lauf ließen und bat um ein Treffen. Später schrieb er einen Artikel darüber.2 Eine jener Personen, die dazu bereit waren, hatte der Redaktion zuvor unter anderem die Worte „Geht’s scheißen“ geschickt. Ein anderer hatte sich gewünscht, der Staat würde das Magazin einfach verbieten. Beim Termin mit dem Redakteur wurden die Worte anders gewählt. Der Kommentator, der das Medium zuvor noch verbieten lassen wollte, nannte seine Reaktion „überspitzt“ und das Magazin sogar eine „renommierte Zeitschrift“. Der zum Stuhlgang Auffordernde gab an, nicht damit gerechnet zu haben, dass seine Worte überhaupt jemand liest und meinte, er hätte sie besser anders formulieren sollen. Ein Dritter hatte zuvor den Chefredakteur mit der niedlichen Beschimpfung „du voreingenommener, komplexbeladener Schreiberling“ bedacht und entschuldigte sich von Angesicht zu Angesicht dafür. Auch der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter besuchte einen jungen Mann, der ihn auf Facebook beleidigt hatte. Er hatte geschrieben, der Journalist gehöre angezündet. Zwei Stunden diskutierten sie bei dem persönlichen Zusammentreffen über Politik. „Sehr gesittet“, wie der Redakteur schreibt.3 Eine Entschuldigung des Mannes erfolgte bereits vor dem Treffen.
Die Wut, mit der wir im Internet konfrontiert sind, ist häufig offenbar nur ein erstes, unüberlegtes Dampfablassen von Menschen, die sich im direkten zwischenmenschlichen Kontakt sehr wohl zu benehmen wissen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die dem scheinbar hasserfüllten und missgünstigen Klima in den sozialen Medien einiges an Schrecken nimmt. Es tut gut zu wissen, dass sich dahinter meist Menschen verbergen, die keine asozialen Monster sind, sondern ihre Gedanken und Emotionen einfach nur nicht jederzeit im Griff haben.
Auch ich wurde nach dem Erscheinen meines ersten Buchs mit einigen untergriffigen Zuschriften bedacht. An so etwas muss man sich erst einmal gewöhnen, wenn man zuvor noch nie in der Öffentlichkeit gestanden ist. Am Anfang empfiehlt es sich, nicht jeden Kommentar im Internet selbst zu lesen. Nach meinen ersten Zeitungsinterviews bat ich einen Freund, Leserbeiträge im Internet zu sichten und mir dann zusammenfassend zu erzählen, worum es ging. Inhaltliche Kritik sollte er eins zu eins wiedergeben, bei Beschimpfungen und persönlichen Angriffen nur kurz schildern, worauf sie abzielten. Nach und nach tastete ich mich so an die Sitten im Internet heran, bis ich nach einigen Wochen alles selbst las, ohne Aggressionen persönlich zu nehmen. Eines Tages schrieb mir jemand auf Facebook die folgenden Worte: „Antidemokratische Reflexe, um ein Buch zu verkaufen? Pfui!“ Ich antwortete: „Mal eben schnell auf eine Seite klicken, deren Titel mir nicht gefällt, und ohne mir durchzulesen, worum es eigentlich geht, ein nicht argumentiertes und polemisches Posting verfassen? Pfui!“ Es war ein Dialog jener Art, wie er im Internet millionenfach geführt wird. Zwei Personen tauschten ihre gegenseitige Abneigung aus, ohne sich persönlich zu kennen. Was aber aus dieser Konversation entstand, überraschte mich. Nach einigem Hin und Her folgte eine Verabredung zum Kaffee. So destruktiv der erste Kontakt im Internet auch war, so konstruktiv war das erste persönliche Zusammentreffen. Der Fremde entpuppte sich als anerkannter Kulturmanager. Aus einer in unserem Gespräch gemeinsam entwickelten Idee wurde vier Monate später die im damaligen Nationalratswahlkampf einzige Podiumsdiskussion Oberösterreichs, bei der Nachwuchspolitiker aller Parteien jungen Wählern Rede und Antwort standen. Ich veranstaltete und moderierte sie und der jetzt nicht mehr so Fremde stellte mir dafür den Raum kostenlos zur Verfügung.
Der Weg vom Hass im Netz zum respektvollen Miteinander ist mit einem Verlust an Bequemlichkeit verbunden. Er verlangt, sich vor dem Klick auf den Veröffentlichen-Knopf die beim Empfänger entstehende Botschaft gut zu überlegen. Er verlangt, sich die Mühe zu machen, einen Text im Zweifel umzuformulieren oder überhaupt darauf und somit auf Aufmerksamkeit zu verzichten. Er verlangt, andere Meinungen zu akzeptieren. Es ist nötig, sich gerade beim Thema Politik bewusst gegen die Mechanismen der sozialen Netzwerke zu stel