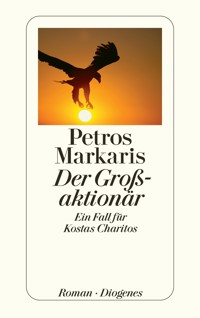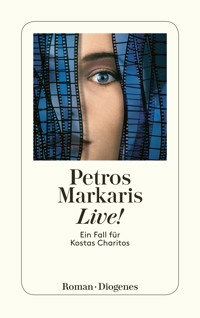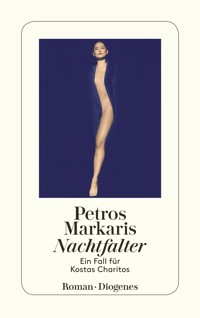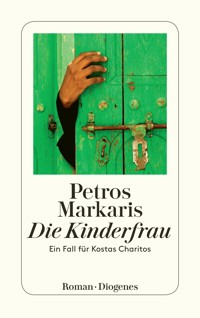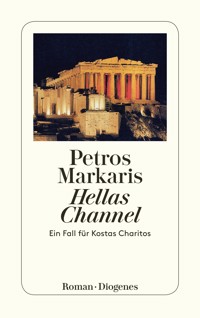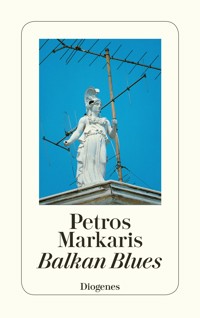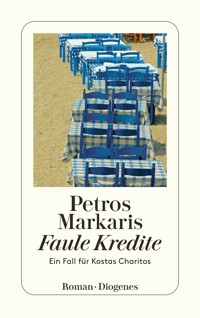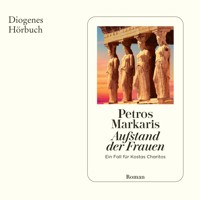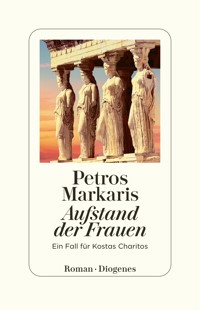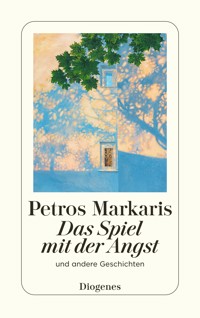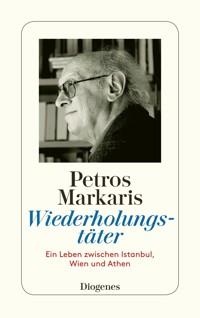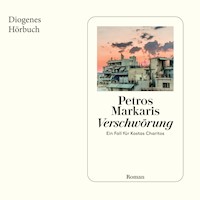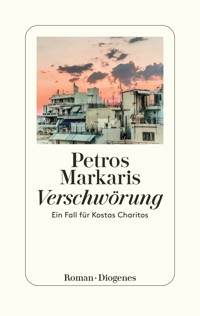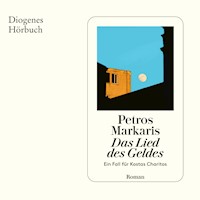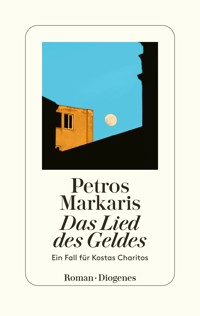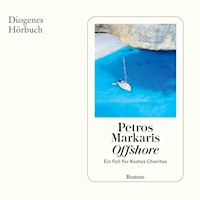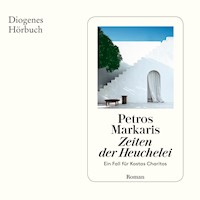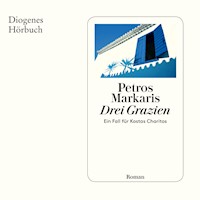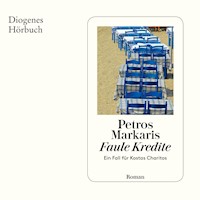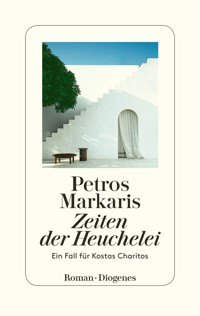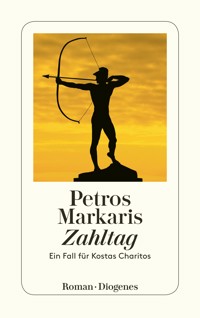
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kostas Charitos
- Sprache: Deutsch
Reiche Griechen zahlen keine Steuern. Arme Griechen empören sich darüber, oder sie verzweifeln ob ihrer aussichtslosen Lage. Im zweiten Band der Krisentrilogie tut ein selbsternannter »nationaler Steuereintreiber« weder das eine noch das andere: Er handelt. Mit Drohbriefen, Schierlingsgift und Pfeilbogen – im Namen des Staates.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Petros Markaris
Zahltag
Ein Fall fürKostas Charitos
Roman
Aus dem Neugriechischen vonMichaela Prinzinger
Die Originalausgabe erschien 2011
bei Samuel Gavrielides Editions, Athen,
unter dem Titel ›Περαίωση‹
Copyright © 2011 by Petros Markaris
und Samuel Gavrielides Editions
Die deutsche Erstausgabe erschien
2012 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von Theresa Förster (Ausschnitt)
Copyright © Theresa Förster
Dieser Band wurde für die deutsche Fassung
in Zusammenarbeit mit dem Autor
nochmals durchgesehen
Für Josefina, wie immer
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24268 3 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60186 2
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Griechenland ist ein riesiges Irrenhaus.
Konstantinos Karamanlis
[7] 1
Die beiden Frauen sitzen in zwei Sesseln mit niedrigen Rückenlehnen und hölzernen Armlehnen. Auf einem Tischchen gegenüber steht ein laufendes Fernsehgerät, das die Ausmaße eines uralten Computers hat. Doch ihr Blick ist nicht auf den Bildschirm gerichtet, die Lider sind geschlossen und die Köpfe zur Seite gesunken. Vor dem Fenster erklingt auf dem Akkordeon eines zugewanderten Straßenmusikers einer jener altmodischen Walzer, die früher auf Hochzeiten beim Eröffnungstanz des frisch vermählten Brautpaars gespielt wurden.
Die anderen beiden liegen auf einem Doppelbett im Nebenzimmer, die Augen unverwandt zur Decke gerichtet. Alle vier sind im schlichten Stil eines Modegeschäfts aus einer armen Wohngegend gekleidet. Drei von ihnen tragen angesichts des nasskalten Wetters schwarze Strickjacken, die Vierte hat ein altmodisches geblümtes Kleid an. Die beiden im Vorderraum tragen dicke Socken und flache schwarze Schuhe. Die zwei anderen haben, ganz brave Hausfrauen, ihre Pantoffeln neben dem Bett abgestellt und sich mit den Strümpfen aufs Bett gelegt.
Koula tritt an mir vorbei, wirft einen Blick auf die sitzenden Frauen und bekreuzigt sich. »Was kommt da noch alles auf uns zu?«, murmelt sie.
Die Zweizimmerwohnung, kaum sechzig Quadratmeter [8] groß, liegt in der zweiten Etage in der Eolidos-Straße im Bezirk Egaleo. Beide Zimmer gehen zur Straßenseite, wohingegen die Küche und das kleine Bad in den winzigen Lichtschacht blicken. Ich trete an den quadratischen Holztisch mit seinem bestickten Tischtuch und lese mir noch einmal den darauf zurückgelassenen Zettel durch:
Wir sind vier alleinstehende Rentnerinnen, ohne familiäre Bindungen oder andere Verpflichtungen. Zuerst hat man unser einziges Einkommen, die Renten, gekürzt. Als wir dann zum Arzt gehen wollten, um uns unsere Medikamente verschreiben zu lassen, haben die Ärzte gestreikt. Kaum hatten wir endlich doch die Rezepte bekommen, sagte man uns in der Apotheke, wir könnten sie dort nicht einlösen, da die Krankenkassen bei den Apotheken in der Kreide stünden, daher müssten wir unsere Medikamente von unseren zusammengestrichenen Renten selbst bezahlen. Da wurde uns klar, dass wir letztlich der gesamten Gesellschaft nur noch zur Last fallen. Daher haben wir beschlossen zu gehen. So gibt es vier Rentnerinnen weniger, für die Ihr nicht mehr sorgen müsst. Und Euch ermöglichen wir damit ein besseres Leben.
Der Zettel ist in klarer, deutlicher Schrift verfasst. Daneben haben sie ihre Personalausweise hingelegt: Ekaterini Sechtaridi, geboren am 23.4.1941, Angeliki Stathopoulou, geboren am 5.2.1945, Loukia Charitodimou, geboren am 12.6.1943, Vassiliki Patsi, geboren am 18.12.1948.
Stavropoulos tritt gerade aus dem Schlafzimmer, als die Sanitäter eintreffen, um die Leichen abzutransportieren. [9] Während er auf mich zutritt, zupft er sich die Einweghandschuhe von den Fingern.
»Sie bezweifeln offensichtlich nicht, dass es sich um Selbstmord handelt«, meint er.
»Kaum. Wie haben sie es getan?«
Er zuckt die Achseln. »Das wird die Autopsie zeigen, aber da keine Einschusswunden und auch keine aufgeschnittenen Pulsadern festzustellen sind, kommt nur Gift in Frage. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber in der Küche steht eine halbleere Flasche Wodka.«
»Alkoholvergiftung durch Wodka?«, frage ich baff.
»Nein, damit haben sie die Schlaftabletten eingenommen. Das ist eine todsichere Methode, um friedlich zu sterben. Haben Sie den Zettel gelesen?«
»Mhm.«
»Was hat dieser Selbstmord für einen Sinn, Herr Stavropoulos?«, fragt Koula dazwischen.
»Tja, das Begräbnis erfolgt auf Staatskosten. Da sie keine Verwandten haben, muss die öffentliche Hand dafür aufkommen. Das ist der einzige Weg, um diesem verdammten Staat noch irgendwie Geld zu entlocken«, erklärt er, bevor er die Wohnung verlässt.
»Und was machen wir jetzt?«, fragt mich Koula.
Da wir für Selbstmorde im Normalfall nicht zuständig sind, wünsche ich mir nichts sehnlicher, als umgehend die Wohnung zu verlassen. Schon möglich, dass ich mich nach so vielen Jahren an den Anblick von Leichen gewöhnt habe, doch es ist etwas anderes, einen Ermordeten vor sich zu haben, als vier Rentnerinnen zwischen dreiundsechzig und siebzig, die ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben.
[10] »Wer hat sie gefunden?«, frage ich Koula.
»Eine Freundin von Frau Patsi. Sie war schon leicht alarmiert, als auf ihr Läuten hin niemand an die Tür ging, da die Patsi vormittags immer zu Hause war. Nachdem sie es kurze Zeit später noch einmal erfolglos probiert hatte, rief sie einen Schlüsseldienst. Da hat man sie gefunden.«
»Wo ist diese Freundin jetzt?«, frage ich Koula.
»Ich habe sie von den Kollegen der örtlichen Polizeiwache nach Hause bringen lassen. Ihre Adresse und die des Schlüsseldienstes habe ich mir notiert. Wenn wir sie noch brauchen sollten, wissen wir, wo wir sie finden können.« Sie denkt kurz nach und fährt dann fort: »Wird aber kaum nötig sein.«
Ich gebe mir einen Ruck und beschließe – mehr aus beruflicher Neugier als aus anderen Gründen –, noch einen letzten Rundgang durch die Wohnung zu machen. Obwohl ich Koula anweise, zur Dienststelle zurückzufahren, läuft sie mir, statt zu gehorchen, wie eine Schlafwandlerin hinterher.
Da das Wohnzimmer nichts weiter Interessantes offenbart, begebe ich mich ins Schlafzimmer. In der Zwischenzeit haben die Sanitäter die beiden toten Rentnerinnen fortgebracht. So bleibt uns wenigstens ihr Anblick erspart.
Im Schrank hängen zwei Kleider, zwei Röcke und ein Mantel, in den Schubfächern liegen fein säuberlich geordnet Unterwäsche, drei Blusen und zwei Pullover.
Ich lasse das Badezimmer aus und werfe stattdessen noch einen Blick in die Küche. Auf der Marmorplatte steht die halbleere Wodkaflasche, und im Hängekasten darüber stehen vier Teller, vier Gläser, zwei Tassen, ein Kochtopf und ein [11] Besteckkasten. Alles ist gründlich geputzt worden, als sei der Patsi daran gelegen gewesen, ihre Wohnung blitzblank zu hinterlassen.
Plötzlich steht eine ausgemergelte Vierzigjährige in der Tür. »Ich bin die Vermieterin«, stellt sie sich grußlos vor. »Eleni Grigoriadou.«
»Sie können die Wohnung räumen lassen. Wir sind hier fertig«, erkläre ich, da sie vermutlich genau das hören will.
»Vassiliki war mir sechs Monatsmieten schuldig. Können Sie mir sagen, wer mir die jetzt bezahlt? Sie hat ja keine Erben!« Ich betrachte jede Antwort als überflüssig und steige mit Koula langsam die Treppenstufen hinunter. »Ich lebe doch von den Mieteinnahmen, das ist mein einziges Einkommen!«, ruft sie uns hinterher. »Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich auch umbringen?«
»Die würde gut zu meinem Vater passen«, sagt Koula, als wir im ersten Stock ankommen.
»Wieso?«
»Weil auch er nur an sich selbst denkt. Meine Mutter, die sich immer um alle gekümmert hat, hat er auf diese Art ins Grab gebracht.«
In der Eolidos-Straße hat sich eine kleine Frauenschar versammelt, die im Nieselregen wortlos die abfahrenden Krankenwagen betrachtet. Zwei von ihnen haben ihre Arme schluchzend vor der Brust verschränkt. Die Übrigen starren stumm den Rettungswagen nach. Als wir gerade in den Seat steigen wollen, nähert sich eine der beiden weinenden Frauen.
»Keti Sechtaridi war meine Grundschullehrerin«, sagt sie mit tränenerstickter Stimme. »An der Ersten Grundschule [12] von Egaleo. Bis zu ihrer Pensionierung hat sie da gearbeitet. Damals herrschte hier große Armut.«
»Wieso? Jetzt etwa nicht?«, ruft eine andere dazwischen. »Mein Sohn sitzt den ganzen Tag vorm Computer und sucht wie verrückt im Internet nach einem Job. Wenn ich ihn so sehe, frage ich mich, was er wohl tun wird, wenn sie uns das Telefon abdrehen, weil wir die Rechnungen nicht mehr bezahlen können!«
Nach einem Seitenblick zu mir wendet sich Koula der schluchzenden Frau zu. »Eins kann ich Ihnen jedenfalls sagen«, erklärt sie mit lauter Stimme, damit auch die anderen sie hören können. »Keine von ihnen hat gelitten. Alle sind ganz friedlich eingeschlafen.«
»Wenigstens das«, ertönt eine Stimme aus dem Hintergrund.
Der Akkordeonspieler, der unter dem Vordach eines Haushaltswarenladens steht, hat mit dem Spielen innegehalten und verfolgt die Szene.
Dann gebe ich Gas, und ein kurzes Stück weiter biege ich nach links zur Thivon- und dann zur Petrou-Ralli-Straße ab. Zwei Schwarze stehen tief über die beiden Müllcontainer am Straßenrand gebeugt und wühlen gierig in deren Eingeweiden.
[13] 2
Merkwürdigerweise fließt der Verkehr in ganz normalem Tempo dahin, während der Mairegen sacht vor sich hin nieselt. Vielleicht liegt es daran, dass wir die Lücke zwischen dem allmorgendlichen und dem allmittäglichen Verkehrsstau erwischt haben. Vielleicht aber auch daran, dass den Leuten kein Geld mehr fürs Benzin bleibt, da uns die Troika ein so striktes Sparprogramm auferlegt hat, dass wir sogar noch unsere Scheiße trocknen müssen, um sie weiterzuverwerten. Zwar könnte ich mit Koula ein Gespräch anfangen, um die Fahrzeit zu verkürzen, doch wenn man unter Schock steht, kriegt man den Mund einfach nicht auf, weder für einen Bissen Essen noch für eine Plauderei.
Auf der Pireos-Straße werden die Wagenkolonnen immer dichter, und ab der Zentrale der Sozialversicherungsanstalt bewegen wir uns im Schritttempo vorwärts. Obwohl der Verkehr in der Menandrou-Straße völlig zum Erliegen kommt, ertönt weder Gehupe noch Gefluche. Geduldig warten die Fahrer, bis sie wieder drei Meter bis zum nächsten Stop weiterfahren können.
»Wieso ist heute so wenig los?«, frage ich Koula.
»Die Leute ziehen den Kopf ein und ergeben sich in ihr Schicksal, Herr Kommissar. Sie sagen sich: Nichts geht mehr. Warum soll der Straßenverkehr da eine Ausnahme bilden?« Ihr Gedankengang erweist sich als irrig, sobald wir den [14] Omonia-Platz erreichen. Die Stadiou- und die Panepistimiou-Straße sind zwischen Eolou- und Patission-Straße unpassierbar. Aus der Ferne dringt der Widerhall skandierter Parolen an unsere Ohren.
»Was gibt’s, Kollege?«, fragt Koula eins der uniformierten Opfer, die hinter dem roten Absperrungsband ihren Dienst versehen.
»Protestmarsch der Arbeiter- und Beamtengewerkschaft«, entgegnet der Uniformierte knapp.
»Ist der Alexandras-Boulevard befahrbar?«
»Ja, aber meiden Sie die Marnis-Straße. Da weiß man nicht, was zwischen Polytechnikum und Gewerkschaftshaus auf einen zukommt. Besser, Sie nehmen die Evelpidon-Straße.«
»Nun, wie man sieht, ziehen nicht alle den Kopf ein«, sage ich zu Koula.
»Manche schon«, entgegnet sie tonlos. »Und manche andere schlagen Dritten die Köpfe ein. Die Frage ist, was passiert, wenn wir alle gleichzeitig mit dem Kopf durch die Wand wollen.«
Ich folge dem Rat des Polizeibeamten und wähle das Gysi-Viertel, um auf den Alexandras-Boulevard zu gelangen. Fünf Minuten später haben wir die Dienststelle erreicht. Koula geht schon in das Büro meiner Assistenten, während ich mir noch einen Kaffee in der Cafeteria besorge.
»Müßiggang ist aller Laster Anfang.« So würde Adriani unsere Lage kommentieren. Denn seit einem Monat ist der Selbstmord der Rentnerinnen der erste Fall, den wir zu bearbeiten haben. Die anderen Dezernate kommen mit der [15] Arbeit nicht nach. Sie sind vierundzwanzig Stunden im Einsatz, da alles an ihnen hängenbleibt, von den Randalen bei Demonstrationen über den Bandenkrieg unter den Zuwanderern in Ajios Panteleimonas bis zu den Aufläufen vor den Privathäusern der Parlamentarier, wo ganze Horden bereitstehen, um die Politiker auszupfeifen und zu beschimpfen. Morde sind momentan nicht an der Tagesordnung, da andere Dinge Vorrang haben.
Auch zu Hause herrscht Stimmungsflaute. Katerina hat ihr Praktikum beendet und einige Fälle übernommen, bei denen es um das beschleunigte Asylverfahren geht. Sie ist nicht gerade aus dem Häuschen vor Freude, da solche Angelegenheiten nur schleppend vorangehen und ihre Tätigkeit weniger mit dem Prozedere eines Gerichtsverfahrens zu tun hat als mehr mit der Arbeit der Schreiberlinge, die früher vor dem Athener Rathaus ihre Tischchen aufstellten und den kleinen Leuten ihre Anträge ausfüllten. Die übrige Familie, allen voran Fanis, verabreicht ihr die bekannten Aufmunterungspillen à la »Das ist nur am Anfang so« oder »Es wird schon werden«, doch Katerina scheint nicht wirklich überzeugt.
Da so wenig los ist, habe ich beschlossen, mir Adrianis Losung zu eigen zu machen, die in solchen Fällen immer sagt: Bevor du dich langweilst, veranstalte ein Großreinemachen. Das tue ich jetzt auch. Ich habe meinen Assistenten verkündet, das sei jetzt die Gelegenheit, auf unserer Dienststelle Ordnung zu schaffen. Als ich hinzufügte, dass wir dabei alten Ballast loswerden und alle abgeschlossenen Fälle ins Zentralarchiv weiterreichen könnten, hielt sich ihre Begeisterung in Grenzen. Meine übrigens auch, da ich mir dabei [16] nicht wie ein Kriminalhauptkommissar vorkomme, sondern wie ein Oberbuchhalter.
Heute ist der dritte Tag unseres Großreinemachens. Als ich das Büro meiner Assistenten betrete, schleppen sie gerade stöhnend und mit hochgekrempelten Ärmeln Aktenordner durch die Gegend. Nur Koula ist guter Dinge, da ich ihr angeordnet habe, das digitale Archiv zu durchforsten. Daraufhin hat sie sich kopfüber in die Arbeit gestürzt. Sobald man sie vor einen Bildschirm und eine Tastatur setzt, ist sie der glücklichste Mensch der Welt. Ihrem zufriedenen Lächeln nach zu schließen, hat sie die Selbstmorde bereits ad acta gelegt. Die Tasten ihres Computers scheinen eine ungeheuer beruhigende Wirkung auf sie zu haben.
»Ach, nur einen einzigen kleinen Mord, Herr Kommissar!«, ruft mir Dermitsakis verzweifelt entgegen.
»Es gibt doch so viele soziale Brennpunkte in Athen«, fügt Vlassopoulos ergänzend hinzu, »so viele Migranten, die sich jeden Abend mit den Rechtsextremisten Straßenschlachten liefern, so viele aufgebrachte Bürger, die auf Politiker losgehen, dazu noch die Plakataktion, in der bekannte Journalisten als Verräter aufs Korn genommen werden. Aber weit und breit kein Mord, der uns von diesem Frondienst erlöst! So ein Pech!«
Dermitsakis knöpft sich Koula vor, die – mit Blick auf ihren Bildschirm – in sich hineinlächelt. »Ja, du hast gut lachen, weil du mit deiner Bildschirmarbeit aus dem Schneider bist. Lass dich bloß nicht dabei erwischen, wie du Patiencen legst, sonst verpfeif ich dich.« Und zu mir gewendet sagt er: »Ich hab sie schon öfter mal beim Kartenspielen überrascht.«
[17] »Das ist eben ein guter Ausgleich. Dabei kann ich viel besser nachdenken«, rechtfertigt sich Koula.
»Kopf hoch, Leute. Bald haben wir’s geschafft«, sage ich, um ihnen Mut zuzusprechen, da auch mir die ganze Aktion als Frondienst erscheint.
»Können Sie sich an den alten Wahlkampfslogan erinnern, Herr Kommissar, in dem uns ›noch bessere Zeiten‹ versprochen wurden? Heutzutage ist es genau andersrum: Egal, was man tut, man tut es, um gewappnet zu sein, denn die Zeiten können nur noch schlimmer werden«, bemerkt Vlassopoulos. Und damit sinkt auf dem Weg zurück zu meinem Büro meine Stimmung auf einen weiteren Tiefpunkt.
Kaum habe ich einen Schluck von meinem Mokka getrunken, läutet das Telefon. »Termin beim Chef«, vermeldet Stella, Koulas Nachfolgerin in Gikas’ Vorzimmer, kurz angebunden. Was das Aussehen betrifft, so kann sie Koula das Wasser reichen, aber in Sachen Charme wirkt sie wie ein ungehobelter Klotz.
»Er ist drin«, blafft sie, ohne den Kopf zu heben, als ich an ihr vorübergehe. Womit sich meine Einschätzung bestätigt…
Gikas sitzt vor seinem Schreibtisch und starrt auf seinen Computerbildschirm. Seit er einen Dienst-PC besitzt, verbringt er den ganzen Tag vor der Mattscheibe. Anfangs unternahm er ein paar Anläufe und griff selbst in die Tasten. Als er jedoch auf keinen grünen Zweig kam, ließ er sich von Koula alles anfängertauglich einrichten und ein hübsches Landschaftsfoto als Bildschirmschoner installieren. Seitdem ist Gikas ein passionierter Naturfreund. Nicht, dass ich weniger unbedarft wäre, aber ich habe wenigstens keinen [18] Antrag auf einen Dienst-PC gestellt, um mich bei Zimmertemperatur in Naturbetrachtungen zu versenken.
»Was war denn mit diesen vier Rentnerinnen los?«, fragt er.
»Ohne Zweifel ein kollektiver Selbstmord«, antwortete ich und liefere ihm eine ausführliche Darstellung.
Nach einer kleinen Pause folgt sein Kommentar: »Verstehen Sie mich nicht falsch, aber: Hoffentlich bleibt’s bei den alten Leuten.«
»Wie meinen Sie das?«
»So, wie sich die Dinge entwickeln, werden es bald die Jungen sein, die Hand an sich legen«, erklärt er trocken.
Im Grunde bestätigt er damit Vlassopoulos’ Vorhersage, dass die Zeiten nur noch schlimmer werden können. Da ich keine weiteren melancholischen Anwandlungen ertragen kann, erhebe ich mich zum Gehen, doch er hält mich zurück: »Bleiben Sie, es gibt da noch etwas.«
Verwundert nehme ich wieder Platz und frage mich, was er mir angesichts der öden Situation auf der Dienststelle eröffnen will. Ich vermute, dass er mir irgendeine Aufgabe übertragen möchte, doch was nun folgt, ist so unerwartet, dass es mich völlig aus dem Konzept bringt.
»Die neue Beförderungsrunde steht an«, sagt er. »Ich denke daran, Sie für den Posten des Kriminalrats vorzuschlagen.« Er hält inne und fährt dann fort: »Ich glaube, das könnte klappen.«
Als sich meine erste Überraschung gelegt hat, ringe ich nach Worten. Was sagt man in solchen Fällen? »Danke, dass Sie an mich gedacht haben« etwa? Oder besser: »Ihr Vorschlag ehrt mich«? Beides erscheint mir leer und schal, daher [19] lasse ich mein verlegenes Schweigen für mich sprechen. Das ist zumindest ehrlich.
»Normalerweise dürfte ich Ihnen das gar nicht sagen«, fährt er fort. »Aber aus zwei Gründen tue ich es trotzdem. Erstens, weil Sie es aufgrund Ihrer Fähigkeiten verdienen. Sie sind ein erfahrener Kriminalist und in schwierigen Situationen erprobt.«
»Ich danke Ihnen«, würge ich hervor.
»Ich bin mir aber nicht so sicher, ob Sie es aufgrund Ihrer Denkweise verdienen.«
»Aha?« Zuckerbrot und Peitsche, der gute alte Gikas.
»Sehr oft setzen Sie einfach Ihren Kopf durch und kümmern sich nicht um das Porzellan, das Sie dabei zerschlagen. Aufsteiger sind wendig und geschmeidig wie Katzen, Kostas, keine trampeligen Elefanten. Sie dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dabei liegt nämlich nicht nur Ihr Name auf der Waagschale. Sie müssen sich absolut korrekt verhalten, bis die Anträge auf Beförderung durch sind. Passen Sie auf, dass Sie keinen Mist bauen! Sonst verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit, und darüber hinaus stellen Sie auch mich bloß. Ist Ihnen das klar?«
»Ja, und vielen Dank.«
»Ihre Dankbarkeit bezeugen Sie mir am besten, indem Sie sich an meine Worte halten.«
Ich überlege, ob es mir denn gefallen würde, tagein, tagaus an meinem Schreibtisch Akten abzuarbeiten. Denn der neue Posten wäre rein administrativ. Dann überschlage ich die Gehaltserhöhung und verdränge den Gedanken an die anfallende Büroarbeit. Zumindest würde ich die letztjährige Lohnkürzung ausgleichen. Solange die Leute einander [20] nicht umbringen, kann ich ja wohl kaum Mist bauen, wie Gikas befürchtet. Sieh einer an – was für Vlassopoulos vorhin noch »ein Pech« war, hat sich plötzlich in einen Glücksfall verwandelt, denke ich mir, während ich mit dem Fahrstuhl zu meinem Büro hinunterfahre.
[21] 3
Während der ganzen Heimfahrt geht mir die Frage nicht aus dem Kopf, ob ich Adriani die frohe Botschaft schon mal verkünden oder zumindest andeuten soll. Seit einem Jahr müssen wir mit weniger Geld auskommen. Adriani kommt zwar ganz gut damit zurecht, ja sie zweigt sogar noch etwas für Katerinas Haushaltsgeld ab. Aber über eine Beförderung würde sie sich dennoch freuen, dann muss sie nicht mehr jeden Cent dreimal umdrehen, und sie steht nicht mehr so unter Druck. Obwohl sie es nicht zugibt, lebt sie in der ständigen Angst vor weiteren Gehaltskürzungen. Dann müsste sogar sie die Waffen strecken. Mein Aufstieg aus den mittleren in die höheren Ränge der griechischen Polizei wird sie nicht weiter beeindrucken. Adriani hat auf meinen Dienstgrad nie besonderen Wert gelegt. Für sie zählt, dass ich ein tüchtiger Polizeibeamter bin, und sonst gar nichts. Außerdem hält sie unerschütterlich an ihrer Überzeugung fest, dass im griechischen öffentlichen Dienst die Tüchtigen immer auch die Gelackmeierten sind. Es fällt ihr allerdings schwer, mit der Diskrepanz zwischen dem tüchtigen Polizisten und dem gelackmeierten Beamten klarzukommen. Daher wirft sie mir – je nachdem – abwechselnd beides vorwurfsvoll an den Kopf.
Wenn ich hingegen nichts von meiner anstehenden Beförderung verlauten lasse, beraube ich sie der Perspektive, dass [22] die Dinge in naher Zukunft besser werden könnten. Andererseits bewahre ich sie damit auch vor einer möglichen Enttäuschung. Erneut fällt mir der alte Wahlkampfslogan ein. Damals hatten die Griechen begeistert für die »noch besseren Zeiten« gestimmt, wohingegen sie heute die schlimmsten Zeiten durchmachen müssen. Diese Einsicht gebietet mir eigentlich, den Mund zu halten. Ganz abgesehen davon, dass für Adriani das höchste der Gefühle in puncto Optimismus »Schlimmer wird’s nimmer« lautet.
Als ich den Schlüssel ins Schloss stecke, tendiere ich eher zum Verschweigen der Neuigkeit. Zu meiner großen Überraschung höre ich bei meinem Eintreten jedoch nicht wie jeden Abend den laufenden Fernseher, sondern Stimmen aus dem Wohnzimmer. Ich tippe auf einen Besuch von Katerina, doch das erweist sich als falsch, Frau Lykomitrou aus dem unteren Stockwerk ist zu Gast. Ich wundere mich ein wenig, dass Adriani sich plötzlich mit der Lykomitrou angefreundet hat, mit der sie doch jahrelang nur einen knappen Gruß gewechselt hat. Nach dem vierfachen Selbstmord bin ich nicht gerade in der Verfassung, Besuch zu empfangen, dennoch versuche ich, mein »Guten Abend« etwas herzlicher als eine reine Formalität klingen zu lassen. Ob das jetzt der gutnachbarschaftlichen Beziehung geschuldet ist oder unserem Berufsbild als Freund und Helfer, wer kann das schon sagen?
»Areti hat mir gerade von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter erzählt, die in London leben« erklärt mir Adriani. »Dort ist die Lage auch nicht gerade rosig.«
»Ja, aber wie diszipliniert man dort reagiert!«, mischt sich die Lykomitrou ein. »Auch die Briten mussten Kürzungen, [23] Entlassungen und Einschnitte über sich ergehen lassen. Aber Sie sollten sehen, wie gefasst die Leute das hinnehmen. Nicht so wie unsere Empörten, die Athen kurz und klein schlagen. Auch die Briten sind empört, aber so etwas machen sie nicht.«
Sie ist der klassische Fall der Griechin, die meint, nur weil ihr Sohn in London lebt, im falschen Land auf die Welt gekommen zu sein. Mit Kommentaren halte ich mich lieber zurück, weil sie mir sonst als Nächstes das griechische Bürgerschutzministerium mit Scotland Yard vergleicht. Doch die Lykomitrou ist entschlossen, mir durch das mustergültige Verhalten der Briten den Rest zu geben. »Können Sie sich vorstellen, was in England los wäre, wenn irgendwelche Krawallmacher auf dem Trafalgar Square oder in der Oxford Street randalieren würden, so wie bei uns auf dem Syntagma-Platz und in der Stadiou-Straße? Genau das fragt mich auch meine Schwiegertochter: ›Was wäre dann, Mama?‹ Und ich kann ihr keine Antwort geben. Entschuldigen Sie, Herr Charitos, wenn ich das so sage, aber sind Ihre Kollegen nicht in der Lage, auf dreißig Quadratmetern mit fünfzig Radaubrüdern fertig zu werden?«
Adriani wirft mir einen Blick zu, doch ich bin fest entschlossen, mich nicht auf eine Diskussion einzulassen. »Was meine Kollegen bei Demonstrationen machen, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht dabei bin, Frau Lykomitrou. Ich habe bloß die Leichen am Hals.«
Die Lykomitrou bekreuzigt sich, Adriani hingegen ist an solche Sprüche gewöhnt und benötigt keinen Abwehrzauber.
»Du magst eine löbliche Ausnahme sein, aber die [24] anderen Polizisten bauen nur Mist«, kommentiert sie und verspritzt mit verächtlicher Miene das Gift, das sie immer griffbereit hat, wenn es um meine Kollegen geht.
»Seit wann bist du denn so dick mit der Lykomitrou befreundet?«, frage ich, als wir wieder allein sind.
»Weißt du noch, als sich letztes Jahr der Mann von gegenüber aus dem Fenster gestürzt hat? Areti kam jeden Tag zu mir hoch und hat mir Gesellschaft geleistet. Sie war mir eine große Stütze. Das hat uns zusammengeschweißt.«
Daran kann ich mich so gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Adriani hatte mit ansehen müssen, wie ein Nachbar aus dem Fenster sprang. Danach war sie fix und fertig. Es dauerte Tage, bis sie sich von dem Schock erholte.
»Also, mir ist Aretis Gesellschaft lieber, als vor dem Fernseher zu hocken. Dort hört man nur noch, dass wir dem Untergang geweiht sind. All die schlimmen Nachrichten ertrage ich einfach nicht mehr.«
Ihre Worte hindern mich daran, auf den Einschaltknopf zu drücken. Höchstwahrscheinlich berichtet man gerade über den vierfachen Selbstmord, zeigt die Krankenwagen, die weinenden Frauen auf der Straße und den üblichen als Nachtisch servierten Cocktail: die Reporter, die Streitgespräche zwischen den Kommentatoren in den verschiedenen Bildschirmfensterchen, die Aufklärungswut der TV-Moderatorinnen, die Analysen von Finanzexperten und Psychologen. Zum Schluss wäre dann Adriani mit den Nerven am Ende, und ich würde beim Dimitrakos-Lexikon Zuflucht suchen.
Da kann ich auch gleich nach dem Wörterbuch greifen. So trete ich ins Schlafzimmer, lege mich mit dem Dimitrakos aufs Bett und schlage beim Eintrag »Selbstmord« nach.
[25] Selbstmord, der: das Sich-selbst-Töten; vorsätzliche Auslöschung des eigenen Lebens. (geh.): Selbstentleibung;
(bildungsspr.): Suizid; (verhüll.): Freitod; (Amtsspr.): Selbsttötung; versuchter S.; erweiterter S. (Rechtsspr.: S., bei dem jmd. noch eine od. mehrere Personen tötet); S. begehen; jmdn. in den/zum S. treiben; mit S. drohen; seine Aussagen kamen einem politischen S. gleich (er hat sich durch seine Aussagen als Politiker disqualifiziert).
Früher hatte der Dimitrakos stets die richtige Antwort auf jede meiner Fragen parat. In der letzten Zeit bringt er mich jedoch immer wieder in Verlegenheit. Ich versuche, den Selbstmord der vier Rentnerinnen irgendwo einzuordnen, doch weder der »Freitod« noch die »Selbstentleibung« scheinen der treffende Ausdruck zu sein. Auch der »erweiterte Selbstmord« will zu diesem Fall nicht passen, obwohl mehrere Personen betroffen sind. Wenn man es genau nimmt, sind sie weder freiwillig aus dem Leben geschieden, noch haben sie den Tod gesucht, noch ihr Leben weggeworfen. Dann bleibe ich beim politischen Selbstmord hängen: Wenn es die Variante »ökonomischer Selbstmord« gäbe, dürfte man gleich ganz Griechenland darunter zusammenfassen, und zwar unter dem Stichwort »kollektiver Selbstmord«. Aber selbst wenn die vier Rentnerinnen die Tat gemeinsam geplant und begangen haben, so war die Entscheidung jeder Einzelnen von ihnen, die Schlaftabletten mit dem Glas Wodka hinunterzuschlucken, doch ein individueller Akt. Meine sonst so fruchtbare innere Zwiesprache mit den Lexikoneinträgen bringt mich diesmal überhaupt nicht weiter.
»Kommst du zum Essen?«
[26] Adriani hat Juvarlakia – Hackfleischbällchen mit Zitronensoße und Reis – zubereitet. Das Gericht schmeckt lecker und hätte einen besseren Esser verdient als mich. Wir kauen eine Weile schweigend darauf herum, bis Adriani die Gabel sinken lässt und mich anblickt.
»Hat sich Katerina bei dir gemeldet?«
»Nein, heute nicht.«
»Wann habt ihr zuletzt miteinander gesprochen?«
»Keine Ahnung, es muss ein paar Tage her sein.«
»Mich ruft sie auch nur jedes Schaltjahr an. Und besucht hat sie uns schon seit einer Woche nicht mehr. Sie hat sich ganz zurückgezogen.«
»Sie wird eben viel zu tun haben.«
»Schön wär’s.« Nach einer kurzen Pause blickt sie mich wieder an: »Da steckt etwas anderes dahinter.«
»Etwas anderes?«, gebe ich überrascht zurück. »Was denn?«
»Wenn ich das nur wüsste… Aber mein Gefühl sagt mir, der Grund liegt nicht darin, dass sie viel zu tun hat.«
»Willst du damit sagen, dass etwas mit Fanis ist?«, frage ich beunruhigt.
»Ich weiß es nicht.« Ihre Antwort bringt mich auf die Palme.
»Also, hör mal, machst du das absichtlich?«, frage ich.
»Was denn?«
»Alles Unangenehme beim Abendessen aufzutischen. Wenn dein Verdacht wenigstens glaubwürdig wäre… Aber du siehst Gespenster.«
»Du wirst schon sehen, dass ich recht habe.« Und dann wirft sie mir einen ihrer Sinnsprüche an den Kopf. »Der Mutterinstinkt irrt nie.«
[27] Damit ist es ihr gelungen, mir eine Laus in den Pelz zu setzen. Ich höre auf zu essen und schiebe den Teller zurück. ›Für schlimmere Zeiten‹, geht mir dabei durch den Kopf.
[28] 4
Ich gebe zu, es ist mir ganz recht, dass keine neuen Mordfälle vorliegen und ich mich auf die Archivarbeit konzentrieren kann. Vermutlich wähne ich mich damit auf der sicheren Seite. Man kann schließlich keine Fehler machen, wenn man nichts zu ermitteln hat. Doch sollte man sich nie zu früh freuen. Das Handy läutet Sturm, als ich um halb neun Uhr beim morgendlichen Kaffee sitze, während Adriani gerade grüne Bohnen putzt.
»Schluss mit dem Großreinemachen, Herr Kommissar. Wir haben einen Toten.« Vlassopoulos’ Stimme vibriert freudig, als hätte er beim Toto gewonnen, das er ausnahmslos jede Woche spielt.
»Wo?«
»Auf dem Kerameikos-Friedhof.«
»Seit wann sind wir auch für Tote zuständig, die zur Bestattung auf dem Friedhof liegen, Vlassopoulos?«, frage ich erstaunt.
»Aber nein, ich meine doch den antiken Kerameikos-Friedhof, Herr Kommissar, in der Pireos-Straße.«
»Gut, ich komme.«
Ich weiß nicht, ob ich fluchen oder mich bekreuzigen soll, damit die Aufklärung erfolgreich vonstattengeht. Auf alle Fälle verfluche ich Gikas, der mir den Floh mit der Beförderung ins Ohr gesetzt hat.
[29] »Nehmen Sie nicht Ihren Wagen, ich schicke Ihnen besser einen Streifenwagen vorbei«, sagt Vlassopoulos.
»Wozu denn?«
»Das Zentrum ist gleich wieder dicht.«
»Was ist jetzt schon wieder los?«
»Fragen Sie mich was Leichteres«, entgegnet er, bevor er auflegt.
»In Griechenland hält ein Wunder nie länger als drei Tage an«, sagte meine selige Mutter immer. Obwohl, in meinem Fall hat es sogar etwas länger gedauert, bis wieder ein Mord passierte. Ich bemühe mich redlich, mir selbst Mut zuzusprechen, denn der Mann auf dem Kerameikos-Friedhof muss ja nicht unbedingt einem Mord zum Opfer gefallen sein, er könnte auch einen Unfall oder einen Herzschlag erlitten haben.
Fünf Minuten später steht der Streifenwagen der Polizeiwache Vyronas vor der Tür. Ein junger Kollege sitzt am Steuer.
»Wie fahren wir hin?«, ist meine erste Frage.
»Wie immer, unter Einsatz der Sirene.«
»Wer geht denn heute wieder auf die Straße?«
Er wirft mir über den Rückspiegel einen Blick zu. »Ist auch nicht weiter wichtig, Herr Kommissar. Einmal ist es ein Berufsverband, dann wieder irgendeine Partei, beim dritten Mal irgendeine Menschenmenge, die vor dem Parlament Politiker beschimpft. In den meisten Fällen wissen wir es selbst nicht. Wir beziehen unsere Posten und warten ab, was auf uns zukommt.«
In der Rizari-Straße schaltet der Fahrer die Sirene ein. Der Vassilissis-Sofias-Boulevard ist in beide [30] Fahrtrichtungen gesperrt. In null Komma nichts haben wir ihn hinter uns gelassen und erreichen die Panepistimiou-Straße. Banken und Geschäfte haben die Rollläden heruntergelassen, die Straße ist menschenleer. Das Bild erinnert mich an den Militärputsch vom 21. April 1967. Nur dass keine Panzer über die Straßen rollen.
Erst nach der Kreuzung mit der Patission-Straße belebt sich der Verkehr wieder, gleichzeitig dringt vom Polytechnikum her der Widerhall von Parolen zu uns herüber. Als wir den Omonia-Platz erreichen, herrscht plötzlich ein ganz anderes Klima, die Wüste Sahara ist übergangslos zum Amazonas-Dschungel geworden. Wagen stehen dicht an dicht auf dem Platz, die Fahrer auf der Suche nach einem Ausweg hinter ihrem Lenkrad hupen wie besessen. Ein paar verirrte Touristen stehen mit ihrem Gepäck mitten auf dem Platz, den schreckerfüllten Blick auf das Chaos gerichtet. Offenbar ist es ihnen unbegreiflich, wie sie plötzlich im Dschungel landen konnten, wo sie doch auf die Kykladen wollten.
»Deutsche wahrscheinlich«, meint der Fahrer.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Franzosen und Italiener sind so etwas eher gewohnt. Deutsche reagieren da schnell schockiert und kriegen Angst vor uns. Sie haben noch nicht kapiert, dass wir keine Ausländer überfallen, sondern uns nur gegenseitig an die Gurgel gehen.«
Der junge Kollege ist ein gewandter Autofahrer. Unter wohldosiertem Einsatz der Sirene manövriert er uns geschickt durch den Verkehr. Schließlich gelingt es uns, über die Pireos-Straße bis zur Ajia-Triada-Kirche vorzudringen und gegenüber einen Parkplatz zu finden. Vlassopoulos und [31] Dermitsakis, meine beiden Assistenten, erwarten mich bereits am Eingang zur Ausgrabungsstätte.
»Kommen Sie, kommen Sie!«, ruft mir Dermitsakis übereifrig und mit einem breiten Lächeln im Gesicht entgegen.
»Seit wann seid ihr Workaholics?«, frage ich mit genervtem Unterton.
»Arbeit ist das halbe Leben«, bemerkt Vlassopoulos, obwohl der Spruch nicht zur Umgebung passt.
Der Tote liegt circa hundert Meter entfernt in der Nähe einer Grabstele, auf der eine sitzende Frau von einer aufrecht stehenden Figur eine Schatulle in Empfang nimmt. Die Leiche befindet sich nicht genau am Fuß der Grabstele, sondern ein Stückchen weiter links auf einer kleinen Lichtung. Im Hintergrund schwanken ein paar Zypressen im Wind.
Der Mann ist zwischen fünfzig und sechzig, trägt einen teuren dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine gestreifte Krawatte. Auf seiner Nase sitzt eine Brille mit filigraner Fassung, und seine Wangen bedeckt ein dichter grauer Vollbart.
Am ungewöhnlichsten ist jedoch seine Körperhaltung. Er liegt auf dem Rücken, die Arme vor der Brust gekreuzt und die Lider geschlossen, als hätte ihn jemand zur Bestattung aufgebahrt. Es fehlen nur der Sarg und das frisch geschaufelte Grab.
»Wer hat ihn gefunden?«, frage ich Vlassopoulos.
»Einer der Antikenwärter. Der war ganz zufällig so früh da. Er hatte nämlich am Vorabend, als er nach Hause kam, bemerkt, dass er sein Handy nicht dabeihatte. Da er vermutete, es bei der Arbeit verloren zu haben, kam er früher als sonst hierher und hat dabei die Leiche entdeckt.«
»Wissen wir schon, wer es ist?«
[32] Vlassopoulos zuckt mit den Schultern. »Ich wollte ihn schon durchsuchen, aber dafür hätte ich ihn von der Stelle bewegen müssen. Da dachte ich mir, ich warte lieber auf die Gerichtsmedizin und die Spurensicherung.«
»Vielleicht war es auch Selbstmord«, mutmaßt Dermitsakis.
»Also hör mal! Meinst du wirklich, jemand zieht sich todschick an, legt sich unter die Grabstele, verschränkt die Arme und bringt sich um?«
»Hast du vielleicht schon mal so einen Selbstmörder gesehen?«, setzt nun auch Vlassopoulos nach.
»Na klar, und zwar hatte er sich vergiftet«, erwidert Dermitsakis pikiert.
»Wenn er sich tatsächlich umgebracht hat, müsste die Spurensicherung irgendein Giftfläschchen oder etwas Ähnliches in seiner Nähe finden«, entgegne ich ihm.
Man kann es nicht von vornherein ausschließen, dass sich erst vier Frauen mit Schlaftabletten umbringen und wenig später ein Mann mit Gift. Doch mich beschäftigt ein anderer Gedanke: Wenn es sich doch um Mord handelt, kann der Fundort nicht der Tatort sein.
Vom Eingang her nähert sich Stavropoulos und in seinem Gefolge die Spurensicherung. Am oberen Ende des Geländes, auf der Seite der alten Synagoge, hat sich eine Menge Schaulustiger versammelt.
Stavropoulos begrüßt mich mit seinem ewig nörgelnden Tonfall. »Können Sie Ihren Mordopfern nicht klarmachen, dass sie polizeilich abgeriegelte Gegenden meiden sollten? Wir haben alle unsere Sünden abgebüßt, bis wir endlich hier waren.«
[33] »Nun, ich bin auch nicht mit dem Helikopter eingeflogen worden«, gebe ich zurück.
Er wirft, ohne sich hinunterzubeugen, einen flüchtigen Blick auf das Opfer. »Gehen Sie von Mord aus?«, will er von mir wissen.
»Ich gehe von gar nichts aus, ich warte auf Ihre Ergebnisse. Alles Weitere ergibt sich dann.«
Ich lasse ihn bei der Leiche zurück, um mich dem Wärter zuzuwenden, der – bekleidet mit Jeans, Stiefeln und einer Sportjacke – etwas abseits unter einer Zypresse sitzt. Als ich mich ihm in Dermitsakis’ Begleitung nähere, erhebt er sich.
»Können Sie sich erinnern, wann Sie ihn gefunden haben?«, frage ich ihn, sobald wir bei ihm anlangen.
Er denkt kurz nach. »Es muss so gegen acht gewesen sein. Am Abend davor war mir beim Schlafengehen aufgefallen, dass mein Handy fort war. Dann habe ich das Nächstliegende getan und vom Festnetz aus meine Handynummer angerufen. Als es in der Wohnung nicht klingelte und auch niemand ranging, war mir klar, dass ich es irgendwo hier verloren haben musste. Also bin ich früher als sonst hergekommen, um danach zu suchen, und habe stattdessen die Leiche hier gefunden.«
»Kommt Ihnen sein Gesicht bekannt vor? Haben Sie ihn schon einmal gesehen?«
»Nein, den sehe ich zum ersten Mal«, lautet seine unmissverständliche Antwort. »Aber das hat nicht viel zu bedeuten, ich arbeite ja erst seit zwei Wochen hier.«
»Sind Sie hierher versetzt worden?«, hakt Dermitsakis nach.
»Ja, von der Griechischen Bahn. Ich bin einer von denen, [34] die man dort loswerden wollte. Die haben sich gesagt: Statt als Bahnwärter kann man ihn auch als Antikenwärter einsetzen, ist doch beides ein Aufpasserjob.«
Mehr hat er nicht zu sagen. Als ich das Gelände schon verlassen will, tritt ein beleibter, bärtiger Fünfzigjähriger auf mich zu.
»Merenditis, ich bin für die Ausgrabungsstätte zuständig, Herr Kommissar.« Mit diesen Worten stellt er sich vor. »Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen spät dran bin, aber das ganze Zentrum war, wie Sie wissen, gesperrt. Ich musste einen Riesenumweg machen.«
Mir fällt auf, dass sich der Wärter strafft und nahezu Habachtstellung annimmt. Bei der Griechischen Bahn würde er seinem Vorgesetzten bestimmt nicht so respektvoll begegnen, doch hier ist er auf ungewohntem Terrain und zieht es vor, auf Nummer sicher zu gehen.
»Haben Sie einen Blick auf das Opfer geworfen?«, frage ich Merenditis.
»Nein, ich habe mich direkt bei Ihnen gemeldet.«
»Na, dann kommen Sie mal mit.«
Ich erwarte nicht viel von Merenditis’ Augenschein und finde mich prompt bestätigt. Er schaut sich den Toten kurz an und schüttelt dann den Kopf.
»Ist mir völlig unbekannt.«
»Vielen Dank. Dann will ich Sie auch nicht weiter aufhalten.«
Merenditis macht jedoch keine Anstalten zu gehen. Sein Blick wandert zwischen der Leiche und der Grabstele hin und her. »Vielleicht will uns der Täter mit der Wahl dieses Ortes etwas sagen«, meint er schließlich.
[35] »Aha, und was wohl?«, frage ich neugierig.
»Sehen Sie, das ist die Grabstele der Hegeso, vermutlich ein Werk des Kallimachos. Was Sie hier vor sich sehen, ist natürlich eine Kopie. Das Original befindet sich im Archäologischen Nationalmuseum.«
Nach einer Pause ergänzt er: »Ach, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Es ist eine Berufskrankheit der Archäologen, immer und überall Symbolisches zu vermuten.«
Bevor er geht, drückt er mir die Hand und nickt den Übrigen zu. Stavropoulos hat seine erste Untersuchung vor Ort beendet, seine Handschuhe jedoch noch nicht abgestreift. Die Arme des Opfers liegen jetzt an der Seite, so dass Vlassopoulos das Jackett aufknöpfen und die Taschen durchsuchen kann. Aus der rechten Innentasche fördert er ein Portemonnaie zutage, das er mir herüberreicht.
»Die anderen Taschen sind leer.«
Rasch überprüfe ich den Inhalt: 280 Euro, zwei Bank- und zwei Kreditkarten. Zumindest wissen wir jetzt, dass er keinem Raubüberfall zum Opfer gefallen ist. Zuletzt fische ich seinen Personalausweis heraus. Es handelt sich um einen gewissen Athanassios Korassidis, geboren am 13. 8. 1957. Das Dokument wurde vom Polizeirevier Pangrati ausgestellt.
»Er hat kein Handy dabei«, bemerkt Vlassopoulos.
»Das hat er vielleicht zu Hause gelassen. Für einen Selbstmord war es ja nicht unbedingt nötig.« Die andere Möglichkeit wäre: Er wurde ermordet, und der Täter hat es an sich genommen.
Dann reiche ich Vlassopoulos den Ausweis weiter. »Gib Koula Bescheid, sie soll Nachforschungen anstellen.«
[36] Vlassopoulos zieht sein Mobiltelefon heraus, und ich wende mich an Stavropoulos. »Sind Sie auf etwas Auffälliges gestoßen? Oder ist es noch zu früh für Vermutungen?«
»Teils, teils«, sagt er. »Auf den ersten Blick ist nichts Verdächtiges festzustellen. Bei der Obduktion stellt sich möglicherweise heraus, dass er an Herzversagen gestorben ist oder Gift genommen hat. Mit Sicherheit hat er sich nicht die Pulsadern aufgeschnitten. Aber es gibt da etwas, das mich stutzig macht.«
Er dreht die Leiche auf den Bauch und deutet auf den Nacken. »Fällt Ihnen etwas auf?«, fragt er mich.
Als ich mich hinunterbeuge, erkenne ich eine Art Furunkel. »Da ist eine kleine Schwellung, so etwas wie ein Mückenstich.«
»Sehen Sie etwas genauer hin.«
Er kramt in seiner Arzttasche, zieht eine Lupe hervor und überreicht sie mir. Ich beuge mich hinunter und betrachte die Sache aus der Nähe. Am Furunkel kann ich einen schwach geröteten Einstich erkennen.
»Was kann das sein?«
Er hebt die Schultern. »Vielleicht ist es tatsächlich ein Mückenstich, der sich entzündet hat. Vielleicht aber stammt der Einstich auch von einer Nadel.«
»Von einer Nadel?«
»Ja, von einer Spritze. Kann sein, dass ihm jemand etwas in den Nacken injiziert hat. Aber das kann ich erst nach der Autopsie mit Sicherheit sagen.«
Bevor ich Klarheit in meine Gedanken bringen kann, werde ich von Vlassopoulos unterbrochen. »Koula ist dran, Herr Kommissar.«
[37] »Athanassios Korassidis, Herr Charitos, war ein Chirurg mit einer Praxis in der Karneadou-Straße 12 in Kolonaki. Den Familienstand konnte ich noch nicht ermitteln.«
Die Adresse im schicken Kolonaki-Viertel und der sündteure Maßanzug deuten auf eine florierende Privatpraxis hin. Sollte Korassidis Selbstmord begangen haben, warum nicht dort? Andererseits ist kaum anzunehmen, dass jemand Korassidis hierhergefahren hat, um ihn vor Ort mit einer Spritze in den Nacken zu töten. Er muss anderswo umgebracht worden sein. Aber wo? Und wieso hat man ihn auf dem antiken Kerameikos-Friedhof abgelegt? Ist an Merenditis’ symbolträchtigen Vermutungen vielleicht doch etwas dran?
[38] 5
Wenn man einen Arzt zum Schwiegersohn hat, sagt man sich: »Hoffentlich brauche ich ihn nie.« Bei mir hat sich jedoch bald herausgestellt, dass ich seinen Rat oft benötige, wenn auch nicht in gesundheitlichen Belangen. Ich beginne also mit meinen Recherchen zum Mordopfer bei Fanis. »Kennst du vielleicht einen Chirurgen namens Athanassios Korassidis?«, frage ich ihn am Telefon.
»Korassidis? Gibt es einen Kollegen, der ihn nicht kennt? Um bei ihm einen Termin zu bekommen, muss man mehrere Monate warten. Wieso fragst du?«
»Weil er heute Morgen tot auf dem Kerameikos gefunden wurde.«
»Wurde er ermordet?«
»Wir wissen es nicht, vielleicht handelt es sich auch um Selbstmord. Wir ermitteln noch.«
»Es würde mich nicht wundern, wenn ihn jemand umgebracht hätte.«
»Wieso?«, frage ich neugierig.
»Weil er zwar ein hervorragender Chirurg, aber ein grässlicher Mensch war. Seine Geldgier war notorisch. Er hat seine Patienten bis aufs Hemd ausgezogen. Und in der Klinik, an der er operierte, legte er sich mal mit den Kollegen, dann wieder mit den Krankenschwestern an. In Magenoperationen war er eine Kapazität, ansonsten aber ein Kotzbrocken.«
[39] »Hatte er vielleicht familiäre Probleme?«
»Hm, über seine Familienverhältnisse kann ich nichts sagen. Finanzielle Sorgen hatte er jedenfalls keine.«
»Weißt du, an welcher Klinik er gearbeitet hat?«
»An der Ajia-Lavra-Klinik, die liegt in der Katechaki-Straße. Seine privaten Sprechstunden hat er jedoch in der Karneadou-Straße abgehalten«, erläutert er mir zum Abschluss.
Fanis’ Aussagen bestärken den Verdacht, dass es sich um Mord handelt, und das begeistert mich wenig. Wenn ich mich auf die Machenschaften medizinischer Großverdiener und teurer Privatkliniken einlasse, laufe ich Gefahr, mir jede Menge Feinde zu machen. An so einem Fall kann man sich gründlich die Finger verbrennen.
Schließlich steige ich mit meinen Assistenten in den Streifenwagen. »Wohin soll’s gehen?«, fragt Vlassopoulos, der am Steuer sitzt.
»In die Klinik. Die Praxis nehmen wir uns später vor.«
Vlassopoulos stellt die Sirene an, doch statt in die Pireos-Straße biegt er in die Iera Odos und dann in die Konstinoupoleos. Das war ein kluger Schachzug, da wir auf diesem Weg den Omonia-Platz umfahren und problemlos auf den Alexandras-Boulevard gelangen.
Die Ajia-Lavra-Klinik ist ein vierstöckiges Gebäude mit einer Glasfassade. Am Empfang sitzt eine junge Frau, die uns mit undurchdringlichem Gesicht taxiert. Offenbar machen wir nicht den Eindruck normaler Patienten, vielmehr scheint sie in uns unerwünschte Besucher zu sehen. Ich bleibe vor ihr stehen und verlange nach dem Klinikchef.
»Haben Sie einen Termin?«, fragt sie kühl.
[40] Ich ziehe meinen Dienstausweis hervor und handle mir die Standardantwort »Einen Moment« ein. Nachdem sie eine Reihe von Telefonaten geführt hat, schickt sie uns in die vierte Etage hoch. Herrn Seftelis’ Büro liege am Ende des Korridors, erklärt sie uns noch.
In der vierten Etage müssen sich die Fünfsternekrankenzimmer befinden, da alle Türen geschlossen sind und absolute Stille herrscht. Nur eine Krankenschwester, die uns den Korridor entlangwandern sieht, wirft uns einen neugierigen Seitenblick zu, während sie uns überholt.
Ich öffne, ohne anzuklopfen, die Tür, und wir treten in einen kleinen Vorraum. Die Sekretärin, die hinter dem Schreibtisch sitzt, sieht aus wie eine sechzigjährige Exschönheitskönigin. Sie erachtet es nicht für notwendig, uns zu begrüßen, sondern öffnet bloß die Tür neben ihrem Schreibtisch, während sie in das zweite Büro »Der Herr Kommissar!« hineinruft.
Ich lasse meine beiden Begleiter im Vorraum warten, damit es nicht gleich nach einer größeren Polizeiaktion aussieht. Ein Mann im Arztkittel kommt zur Begrüßung auf mich zu, er ist mittleren Alters und hat schütteres Haar. Sein Schreibtisch ist, wenn man von seinem Computer absieht, leer. Früher standen auf den Schreibtischen Blumenvasen, heute Bildschirme.
»Nestor Seftelis«, sagt er und streckt mir seine Hand entgegen.
Er deutet auf einen Sessel auf der anderen Seite des Schreibtischs, von wo aus ich freie Sicht auf ein Schildchen habe, das seinen Vor- und Nachnamen nennt und ihn als »Facharzt für Innere Medizin« ausweist. Er wartet, bis ich [41] Platz genommen habe, und äußert dann die stereotype Frage: »Was kann ich für Sie tun?«
»Arbeitet der Chirurg Dr. Athanassios Korassidis mit Ihrer Klinik zusammen?«, frage ich.
»Thanos? Ja, sicher. Seit fünfzehn Jahren schon.« Dann stockt er – vermutlich wird ihm bewusst, dass mein Besuch nichts Gutes verheißt und ihm wohl etwas zugestoßen sein muss, denn er fragt beunruhigt: »Ist etwas passiert?«
»Er ist heute Morgen auf dem antiken Kerameikos-Friedhof tot aufgefunden worden.«
Zunächst verschlägt es ihm die Sprache, dann entfährt ihm der Ausruf »Meine Güte!«. Abschließend fügt er die Frage hinzu: »Ein Unfall?«
»Das können wir noch nicht sagen, wir warten noch das Ergebnis der Obduktion ab. Ich komme zu Ihnen, um mir ein allgemeines Bild zu machen.«
»Fragen Sie nur.« Und dann murmelt er erneut: »Mein Gott, was für eine Tragödie!«
»Fangen wir beim Familienstand an. War er verheiratet?«
»Geschieden. Er hat zwei Töchter, die im Ausland studieren.«
»Die Anschrift seiner Praxis kennen wir bereits. Können Sie uns eventuell seine Privatadresse geben?« Als er seine Vorzimmerdame dazu befragen will, halte ich ihn zurück. »Schalten Sie nicht Ihre Sekretärin ein. Wir möchten vorläufig kein Aufsehen erregen.«
»Was ich Ihnen geben kann, ist seine private Telefonnummer. Er wohnte irgendwo in Ekali.«
Er sucht die Telefonnummer aus einer Computerdatei heraus.
[42] »Was war Korassidis für ein Mensch?«, frage ich ihn.
»Er war ein hervorragender Chirurg.« Mit dieser Antwort legt er das Hauptaugenmerk auf die ärztliche Qualifikation und nicht auf den Charakter. »Die Patienten haben bei ihm Schlange gestanden, weil sie seinen Fähigkeiten vertraut haben.«
»Wie war er denn so im Umgang? Gab es Konflikte oder Differenzen mit Ihnen oder den anderen Ärzten?«, beharre ich. Insgeheim bin ich Fanis für seine Andeutungen dankbar.
»Er war uns allen gegenüber vollkommen korrekt.«
»Hören Sie, Herr Seftelis. Momentan versuchen wir uns ein Bild von Korassidis zu machen. Wenn sich herausstellt, dass es Selbstmord war, können Sie sicher sein, dass wir Ihre Angaben nicht verwenden werden. Wenn es sich hingegen um ein Gewaltverbrechen handelt, kriegen wir ohnehin alle nötigen Informationen heraus.«
Er blickt mir in die Augen und überlegt. »Er war ein unzugänglicher Mensch«, meint er schließlich. »Ein hervorragender Arzt mit einem schwierigen Charakter. Er war nie zufrieden, an allem hatte er etwas auszusetzen. An seinen Kollegen, am Pflegepersonal, überall. Des Öfteren musste ich Feuerwehr spielen und als Streitschlichter auftreten. Das werden Ihnen die anderen bestätigen. Wir hatten uns alle mit ihm arrangiert, weil er eine fachliche Koryphäe war.«
»Vielen Dank. Das reicht uns fürs Erste. Ich möchte Sie bitten, die Sache für sich zu behalten. Wir wollen kein unnötiges Aufsehen erregen, solange nicht geklärt ist, ob es sich um Selbstmord oder Mord handelt.«
Wir verabschieden uns mit einem Händedruck, und ich [43] trete wieder in den Vorraum. Abschließend grüße ich die Sekretärin, die mich neugierig mustert, und bedeute meinen beiden Assistenten, dass wir aufbrechen.
Nachdem wir im Streifenwagen Platz genommen haben, rufe ich Dimitriou von der Spurensicherung an. »Habt ihr etwas gefunden?«
»Fehlanzeige, am Tatort gibt es keinerlei Spuren.«
So hingebungsvoll ich mich auch bemühe, aus Korassidis’ Tod einen Selbstmord herauszulesen, mit jedem neuen Ermittlungsschritt wird Mord wahrscheinlicher. Warum sollte er auch seinem Leben auf dem antiken Friedhof ein Ende setzen? Warum sollte er im Morgengrauen aus Ekali aufbrechen, um sich ausgerechnet dort umzubringen? Hätte er das nicht genauso gut zu Hause tun können? Keine einzige Spur lässt auf Selbstmord schließen.
»Und wohin jetzt?«, fragt mich Vlassopoulos.
»Erst mal zur Dienststelle, wir müssen Stavropoulos’ Bericht abwarten.«
Auf dem Rückweg ins Präsidium sprechen wir alle drei kein Wort.
[44] 6
Stavropoulos’ Anruf erreicht mich, als wir das Altenheim passieren. »Ich habe gleich mit dem Einstich im Nacken begonnen: Volltreffer«, erzählt er befriedigt.
»Stammt er von einer Injektionsnadel?«
»Ja. Um welches Gift es sich handelt, kann ich allerdings noch nicht sagen. Das muss erst noch weiter untersucht werden.«
»Ist das so wichtig?«
»Theoretisch schon. Kann sein, dass es Ihnen hilft herauszufinden, woher der Täter stammt und in welchen Kreisen er verkehrt.«
»Vielen Dank, dann warte ich so lange.«
Er mag ja ein Querulant sein, aber von seinem Metier versteht er etwas. Zudem denkt er nicht nur eingleisig als Gerichtsmediziner.
Eigentlich müssten wir jetzt Korassidis’ Praxis einen Besuch abstatten, doch dabei laufen wir Gefahr, in Demos und Straßensperren steckenzubleiben. Deshalb beschließen wir, zunächst zu Korassidis’ Privatdomizil zu fahren, und heben uns die Karneadou-Straße für später auf, in der Hoffnung, dass sich die Protestversammlungen bis dahin aufgelöst haben.
»Gib der Spurensicherung Bescheid«, weise ich Dermitsakis an.
[45] Korassidis’ Privatadresse liegt in der Myrtias-Straße, einer Nebenstraße des Thisseos-Boulevards. Da wir eine kleine Weltreise vor uns haben, überlasse ich die Wahl der Fahrtroute Vlassopoulos und versuche, mich auf den Fall zu konzentrieren.
Meine Vorahnung hat sich also bestätigt: Ich habe es in der Tat mit einem Mord zu tun. Noch dazu an einer medizinischen Koryphäe, was bedeutet, dass ich mich mit Klinikpersonal, Wissenschaftlern und Journalisten herumschlagen muss. Kurz gesagt, der Fall hat alle Voraussetzungen, den zuständigen Ermittler von einem Fettnäpfchen ins nächste treten zu lassen. Ich versuche mir einzureden, dass ich auch diesmal nur meinen Job erledigen werde – egal, was dabei herauskommt. Aber leicht fällt es mir nicht. All die Jahre war es für mich beschlossene Sache, dass ich mit dem Dienstgrad des Hauptkommissars in Rente gehen würde, und es machte mir überhaupt nichts aus. Jetzt, da sich ein Türchen zu meiner Beförderung aufgetan hat, möchte ich mit aller Kraft vermeiden, dass es mir gleich wieder vor der Nase zugeschlagen wird. Plötzlich ertappe ich mich dabei, wie ich beginne, Rücksichten zu nehmen, und langsam verstehe ich Gikas, der sein ganzes Leben darauf bedacht war, nur ja kein Porzellan zu zerschlagen.
Ich bemühe mich, diese Erwägungen aus meinem Kopf zu bannen und mich stattdessen dem Fall zuzuwenden. Die ersten, noch recht vagen Nachfragen haben ergeben, dass Korassidis ein unsympathischer Typ war, der sich mit vielen Leuten anlegte, also auch eine Menge Feinde hatte. Obwohl das durchaus ein Mordmotiv sein könnte, erklärt es noch lange nicht, wieso die Tat auf diese Art und Weise [46] geschah. Es wäre doch viel einfacher gewesen, Korassidis zu erschießen oder mit einem schweren Gegenstand zu erschlagen. Der Mörder hat ihm jedoch Gift in den Nacken injiziert. Das allein könnte schon eine Botschaft sein, genauso wie die Tatsache, dass die Leiche auf dem archäologischen Kerameikos-Friedhof platziert wurde. Nur, was hat sie zu bedeuten? Und wie soll ich bloß den eigentlichen Tatort ausmachen? Nur da sind weitere Aufschlüsse über die Hintergründe und das Motiv zu finden. Mein armes Hirn läuft auf Hochtouren, doch ich komme nicht weiter. Als ich aus meinen Gedanken auftauche und zum Wagenfenster hinausblicke, fahren wir gerade einen großen Boulevard entlang. »Wo sind wir jetzt?«, frage ich Vlassopoulos.
»Auf dem Thisseos-Boulevard. Die Myrtias liegt ein Stückchen weiter auf der linken Seite.«
Zur Linken der Myrtias-Straße befindet sich ein Park, an dem auch Korassidis’ Haus liegt. »Haus« ist eine glatte Untertreibung, denn es handelt sich um eine zweistöckige Trutzburg, die eher in die Schweizer Berge passen würde als nach Ekali. Davor erstreckt sich eine Gartenanlage, deren dichtes Grün durch verschiedenfarbige Rosenbeete aufgelockert wird. Ein Gärtner ist gerade dabei, die Rosenstöcke zu gießen. Auf unser Klingeln öffnet er die Tür.
»Herr Korassidis ist nicht zu Hause«, erklärt er nach einem kurzen Blick auf meinen Dienstausweis.
»Sind Sie hier fest angestellt?«, frage ich ihn.
»Nein, ich komme nur dreimal die Woche. Dann gieße ich und kümmere mich um den Garten.«
»Wie gut kannten Sie Korassidis?«
Er blickt uns durchdringend an. Die Frage, die ihm auf [47] der Zunge liegt, schluckt er geflissentlich hinunter und antwortet mit einem Achselzucken. »Seit drei Jahren bin ich für den Garten zuständig. Ich erledige meine Arbeit, und er bezahlt mich dafür. Mehr hatten wir nicht miteinander zu tun.«
»Wer arbeitet sonst noch hier außer Ihnen?«
»Frau Anna. Sie führt hier das Kommando. Zweimal die Woche kommen noch zwei Georgierinnen zum Reinemachen.«
»Ist Frau Anna im Haus?«
»Ja, sie wird in der Küche sein. Warten Sie, ich bringe Sie zu ihr.«
Er dreht den Wasserhahn zu und übernimmt die Sightseeingtour. Das Anwesen hat einen Haupt- und einen kleineren Seiteneingang. Der Gärtner wählt die Seitentür und führt mich durch einen schmalen Flur zur offenen Küchentür. Eine weißhaarige Frau steht mit dem Rücken zur Tür und wäscht im Spülbecken Gemüse. Als sie uns kommen hört, wendet sie sich um. Ihrem zerknitterten Gesicht nach zu schließen, muss sie über sechzig sein.
»Frau Anna, die Herren sind von der Polizei und möchten Sie sprechen«, erklärt der Gärtner.