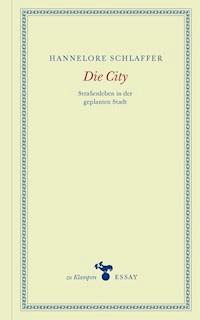Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: zu Klampen Essays
- Sprache: Deutsch
Die Verteilung des Geistes auf die Geschlechter war nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland klar geregelt. Männer sprachen und schrieben mit Aplomb über Literatur und Kunst, Philosophie und Politik, Frauen durften ihnen zuhören und sie bewundern. Wie konnte eine junge Frau, in eine Familie von Sportlern geboren, unter diesen Bedingungen zu einer prägenden Intellektuellen der Bundesrepublik werden? Hannelore Schlaffer hat keine Autobiographie geschrieben, sondern Miniaturen, in denen die Wandlung der geistigen Physiognomie der Bundesrepublik exemplarisch aufscheint. Weshalb löste Tee den Kaffee als Modegetränk für Geistesarbeiter ab, nur um wieder vom Kaffee verdrängt zu werden? Wie ändert sich das Verhältnis zum Geld in einem intellektuellen »Dinks«-Haushalt? Was sagt die Architektur von Bibliotheken über die gesellschaftliche und eigene Wahrnehmung ihrer Nutzer aus? Eine alltagshistorische Bestandsaufnahme, die von der frühen Bundesrepublik bis in die Jetztzeit führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANNELORE SCHLAFFER
Zeit meines Lebens
Was war und noch ist
Reihe zu Klampen Essay Herausgegeben von Anne Hamilton
Hannelore Schlaffer, geboren 1939 in Würzburg, lebt in Stuttgart. Sie war Studienrätin in Erlangen, Lektorin an der Sorbonne, außerplanmäßige Professorin in Freiburg und München. Lehrstuhlvertretungen führten sie nach Melbourne, Berlin, Frankfurt. Sie hat Bücher über die Literatur der Klassik und Romantik geschrieben und Artikel über die kulturellen Institutionen und Ereignisse der Gegenwart publiziert. Drei Essaybände sind bisher bei zu Klampen erschienen: »Die City. Straßenleben in der geplanten Stadt« (2013), das 2014 von der Friedrich-Ebert-Stiftung als »Das politische Buch des Jahres« ausgezeichnet wurde; »Alle meine Kleider. Arbeit am Auftritt« (2015), »Rüpel und Rebell. Die Erfolgsgeschichte des Intellektuellen« (2018).
Inhalt
Schreiben, eine Gymnastik
Lesen
In Gesellschaft von Sportlern
Katholisch
Nach dem Krieg
Aufklären
Männer, meine Erzieher
Geld
Im Café
Laufen
Italien
In der Bibliothek
Nachdenken
Nachweise
Schreiben, eine Gymnastik
WER viel in die Oper geht, kommt nach Hause und will singen; wer viel liest, will bald auch schreiben.
Erst eignet man sich das Gelesene an im Spiel, ist Indianer, wenn man Karl May liest, ist Ferdinand von Walter, wenn man schon etwas weiter und bei Schiller angekommen ist. Man überführt das Geschriebene ins Mündliche, lernt pathetisch reden und wie gedruckt, versucht also, es aus der Schrift ins Leben zu holen. Bald aber will man selbst sich an solcher Erfindung von Leben beteiligen, will zu den Worten des Dichters eigene erfinden, sich Sätze ausdenken, die so nie gesprochen worden sein können – und schon schreibt man sie auf, ist Dichter, ein junger, der noch nicht weiß, was er eigentlich ist und auf welchem Weg er sich befindet.
Ich habe zwar keine Indianergeschichten geschrieben, als ich alle Bände von Karl Mays Romanen las, aber, als ich etwas später bei Schiller ankam, habe ich ein Drama »Herkules und Deianira« geplant, dessen Fragment lange aufbewahrt wurde, bei einem der Wohnungswechsel aber doch verloren ging. Geblieben ist nur die Frage, über die ich noch heute nachdenke: Wie bin ich mit sechzehn Jahren zu solch einem Stoff gekommen? Schiller hat meine Lust, Dramen zu schreiben, angeregt, aber selbst er hätte sich just dieses antiken Paars nie angenommen.
Nun aber setzt eine solch intellektuelle Tätigkeit wie Sätze, Handlungen, Figuren, Ideen erfinden, eine Hand voraus, die das Erdachte sichtbar macht, die niederschreibt, was der Kopf erdenkt. Jede intellektuelle Anstrengung muss von einem physischen Vergnügen begleitet sein, sonst wird sie nicht vollbracht. Deshalb ist es interessant herauszufinden, wie denn die Hand dahinkommt zu schreiben und noch dazu, gern zu schreiben und endlich gar das Schreiben nicht mehr lassen zu wollen. Jegliche Mühe, die diese Tätigkeit des Schreibens machen würde, zöge den Geist von seiner poetischen oder intellektuellen Konzentration ab. Schreiben zu lernen, und zwar so, dass die Bewegung der Hand zur zweiten Natur wird – und was wäre unnatürlicher, als zu schreiben –, ist Voraussetzung dafür, Schriftsteller zu sein. Wie die Füße diesen lebenslangen Spaß »Laufen« früh lernen müssen, so auch die Hand den Spaß »Schreiben«. Und so habe ich laufen und schreiben gelernt und bin vierfüßig geworden: Ich laufe das eine Mal mit den zwei Beinen, ein andermal mit den zwei Händen, mit der, die schreibt, mit der, die das Papier hält und rückt, je nachdem durch Stadt und Wald und Flur oder übers Papier, und will damit nicht enden.
Meine Erinnerung an die ersten Schreibversuche ist schmerzlich, wie eben großes Glück meist mit einem kleinen Schmerz beginnt, denn der gibt der Tätigkeit erst Gewicht. Tränenüberströmt kam ich, die Erstklässlerin, die mit Eltern und Brüdern 1945 nach dem Bombenangriff auf Würzburg in den Tanzsaal eines Dorfs evakuiert worden war, aus der Volksschule nach Hause: Die Lehrerin habe gesagt, so schluchzte ich, ich dürfe von heute an nicht mehr zur Schule gehen. Meine Eltern erklärten mir und trösteten mich, dass dies der Beginn der Weihnachtsferien sei, dass diese Zeit schnell vorüber sei, und danach gehe es mit der Schule weiter und auch ich dürfe wieder dabei sein. Es ging wirklich weiter mit der Schule, und ich lernte, mit weichem Griffel auf die harte Schiefertafel zu schreiben. Weiß auf schwarz – das war in dieser Zeit, da es nur die schüchternen Farben der Natur gab, da noch kein Bildschirm blendete, ein Schock fürs Auge und für ein Kinderauge eine Faszination. Als ich, etwa siebzigjährig, einen Vortrag hielt, sagte mir ein Naturwissenschaftler: »Frau Schlaffer, Sie tragen fast nur schwarzweiß« – und er hatte recht. Da kam mir die Schiefertafel in den Sinn, Buchstaben weiß auf schwarz!
Und auch an den zweiten Schmerz erinnerte ich mich, den ich mit dem Schreiben verband, jene Tränen nämlich, die ich vergoss und die das Weiß der Schrift auf der schwarzen Tafel verwischten, als mich ein Bruder wegen eines kleinen Fehlers ausgescholten hat. Ich saß im Festsaal des Dorfes in einer Fensternische von der Art, wie es sie in Burgen gibt, und schrieb auf meine Tafel, er kam, er schimpfte, ich weinte, meine Buchstaben zerflossen zum tachistischen Gemälde – mein erstes Kunsterlebnis, Grafik in schwarz und weiß; es hat, wie der Naturwissenschaftler es durchschaute, meinen Geschmack fürs Leben geprägt.
Sobald man aber der Zeichen sicher ist, beginnt die noch schönere Erfahrung, dass das Schwarz-Weiß auf der Tafel – oder später das Blau-Weiß auf dem Papier – sich im Kopf in bunte Bilder verwandelt. B-a-u-m wird nach längerer Übung eine Vorstellung, G-e-h-e-n die Vorstellung einer Tätigkeit: schon laufe ich; W-e-i-n-e-n ein Gefühl, das einmal war und wiederkommen könnte; S-o-n-n-e hinaus in Luft und Licht! Die Schulbücher halfen bei der Übersetzung der Zeichen in Anschauung und Erlebnis durch Illustrationen, und am schönsten tat dies das Buch für den Religionsunterricht. Da gab es nicht nur den Baum, die Blume, die Sonne, da gab es Mohren und Engel, eine stillende Mutter und einen geißelnden Knecht, einen Mann im Nachthemd, der ein Kreuz schleppte, und Könige in prächtiger Robe, Gesten noch dazu, die man nie im Leben sah, Betende, Kniende, Niedergeworfene und die Arme zum Himmel Emporstreckende – ein Tanz, der alles, was man als springendes, hüpfendes, hurtiges Kind zustande brachte, überbot. Wie ich später die Rollen aus Schillers Dramen auswendig lernte und vor mich hinsagte, so übte ich die Gesten der religiösen Figuren, nicht aus Frömmigkeit, sondern als Ballett.
Was Wunder, dass es zum Vergnügen wurde, die fünfundzwanzig Klötzchen, die Buchstaben, aus denen diese Bilder sich erahnen, sich erdenken ließen, bald selbst herzustellen. Je leichter dies ging, desto weniger waren die Buchstaben noch Buchstaben, sie verwandelten sich in Schrift – und erst so waren sie mein. Nun sollten sie auch meine Gestalt annehmen, zu meinem Gesicht passen. Ich begann also zu experimentieren, welche Farbe der Tinte – schwarz, blau, violett, grün – meinem Auge am besten gefiel und welche Form diese Schrift haben sollte. Einige Zeit neigte sie sich nach rechts, dann wieder nach links, einmal zog ich die Buchstaben weit auseinander, einmal standen sie eng gedrängt, einmal hatten sie ein paar Schnörkel, aber da wurde mir schnell klar, dass dies Überfluss war und nicht mein Stil. Ich schrieb immer lieber und entwickelte dabei die geschwindeste Art, mit der Hand voranstürmend, Buchstaben aufs Papier zu bringen. Sie waren antikisch karg und manchmal so sehr auf ihr Wesentlichstes reduziert, dass sie gerade noch zu lesen waren. So entstand also dies kleine, schnelle Vergnügen für die Hand, dies Auf und Ab und Hin und Her, und so bin ich, wie gesagt, vierfüßig geworden. Ich laufe gemächlich durch die Natur mit meinen Beinen und eile schnell übers Papier mit der Hand und kann so wenig auf das eine wie auf das andere verzichten.
Allzu viel Gelegenheit zu schreiben gibt es für ein Kind und einen Jugendlichen nicht. Die Eltern schenken ihm, da sie die seltsame und gottlob so ungefährliche Neigung bemerken, ein Tagebuch und dann noch eines. Es schreibt sie voll, bewahrt sie ein Leben lang und schaut nie mehr hinein. Meine Schreibhand übte sich schließlich auch in der Malerei. Es gab sehr gute Noten im Kunstunterricht, und auf all meinen Kunstreisen nach dem Studium habe ich nie fotografiert, sondern gezeichnet. Aber Schreiben und Skizzieren ist zweierlei. Beim Malen habe ich die Welt als Bild vor mir und halte dies fest. Wenn ich aber etwas aufschreibe, notiere, erzähle, sind vor aller Schrift Bilder in mir, ich akzeptiere diese Anregung meiner Fantasie, kombiniere daraus die Welt in meinem Sinne – fasse einen Gedanken, erfinde eine poetische Situation, notiere, übersetze diese in abstrakte Zeichen und hoffe, dass sie sich in anderen Köpfen wieder in Bild und Gedanke zurückverwandeln und den fremden Kopf genauso faszinieren wie den meinen, dem sie entsprungen sind.
Endlich aber kam nach diesen verantwortungslosen Schreibspielen das Abitur, und die Mädchen, die erste Generation, für die Studieren zwar nicht selbstverständlich, wohl aber erwägenswert war, zerstreuten sich in alle Welt. Die Neugier war groß, der Abschied nicht schmerzlich, und für mich hatte er gar das Schöne, dass ich nun Briefe schreiben und in alle Himmelsrichtungen versenden konnte – so begann die wahre Schreiblust oder -wut. Ein Mann, Manager oder Gelehrter, der seine Autobiographie schreibt, könnte sein Leben immer unter dem Titel veröffentlichen: »Pour le mérite«. Über eine Reihe freundschaftlicher, wenngleich immer amtsfördernder Gaben und Gegengaben steigt er empor zu höchstmöglichem Rang. Ich hingegen musste mich begnügen mit einer Karriere unter Freundinnen, und so war der höchste Rang, den ich erreichen konnte, der, dass bei einem unserer Treffen eine der Jungfrauen sagte: »Die Hanne, also, die schreibt so arg schöne Briefe!« Meine Autobiographie könnte deshalb heißen: »Arg schöne Briefe«.
Die Studienrätin, die ich durch das Studium geworden war, hatte nur die Schriften der Schüler zu lesen und mit einigen Korrekturen zu versehen – SCHREIBEN, die heilige Tat, war das nicht. Da in jenen Jahren das Berufsleben das Private noch nicht in dem Maße dominierte wie heutzutage, da man – um es kritischer zu sagen – mit dem Beruf noch nicht so wichtigtat, hatte ich viel Zeit. Bei einigem Geschick konnte ein Lehrer schnell vorbereitet sein auf den nächsten Tag und hatte den Nachmittag, den Abend für sich. Da aber die männlichen Kollegen ungern mit einer Kollegin umgingen, die einen Assistenten von der Universität geheiratet hatte, geriet ich immer mehr in diesen akademischen Kreis und entschloss mich eines Tages zu promovieren – und damit begann ein Schreiben auf eine ganz neue Art. Schließlich war ich auch habilitiert, aus Versehen eigentlich, großzügiger Weise für ein bereits gedrucktes Buch; die Ehre einer Universitätsstelle errang ich nie, und so lancierte mich die Schreiblust zu Zeitung und Rundfunk, wo ich, eine damals durchaus einträgliche Beschäftigung, schreiben durfte, was immer mir in den Sinn kam. Ich erfand Themen und schrieb am Morgen, am Abend, im Zug, im Hotel; in der Pause des Theaters begann ich bereits die Kritik zu schreiben, die am nächsten Morgen über Telefon den Sekretärinnen der Zeitung durchgegeben werden sollte. Am Morgen erwachte ich mit den drei nächsten Themen für Zeitungsartikel und hatte also offensichtlich in der Nacht weitergeschrieben. Ich machte den Tag über fünfstündige Spaziergänge mit den Füßen und fünfstündige mit den Händen am Morgen und am Abend. Die Füße schmerzten oft, das Handgelenk blieb locker und blieb es bis zum heutigen Tag. Aus den Briefen an die Freundinnen wurden Zeitungsartikel, und was sind Zeitungsartikel, Glossen anderes als Briefe an ein freundliches Publikum. Essayistin oder Journalistin nannte ich mich seither in den Formularen, die mir beim Arzt entgegengehalten, vom Finanzamt zugeschickt wurden.
Lust ist der Anfang von Luxus – und so werden auch für den, der schreibt, die Umstände und Hilfsmittel seiner Tätigkeit mit Zeremonien umgeben, die das Tun zur heiligen Handlung, also zu einem besonderen Spaß machen. Stille ist das erste Gebot. Feine Materialien sind das zweite. Feder und Papier müssen sich lieben, sie müssen sanft aufeinander eingehen, sanft soll die Hand mit spitzer Feder über das satinierte Papier fliegen, so als berühre sie es kaum, so als erschienen die Buchstaben wie von selbst auf seinem Samt, so als hätte die Hand, die in der schwerelosen Bewegung innerlich ein wenig kitzelt, sie geradezu aufs Papier gelächelt. Schreiben ist ein Streicheln und deshalb besonders geeignet zur Vertiefung von Freundschafts- und Liebesbeziehungen. Nicht nur die Liebesbriefe, derer es so viele gibt und die so gerne gelesen werden, zeigen dies. Der Leser nimmt immer und bei allen Texten als Voyeur an einem Liebesakt teil, der physisch durch die Hand strömt.
Alles Schreiben ist wenigstens zu einem Teil eine emotionale Kommunikation. Auch Texte für eine Zeitung sind Grüße an das Publikum, und so waren denn auch die Dissertation und die Habilitationsschrift Liebesbriefe für ein akademisches oder halbakademisches Paar, das diese Schriften füreinander und miteinander schrieb, gemeinsam nämlich an ein und demselben Tisch. Die Vorbereitung zu diesen Schriften geschah getrennt in den Arbeitszimmern, zur Niederschrift aber trugen wir unseren Küchentisch ins Wohnzimmer, saßen einander gegenüber im großen, hohen Raum mit dem Blick auf einen der Erlanger Karpfenweiher und schrieben diese zwei Werke, jeder für sich und du für mich und ich für dich. Der Schreiber gegenüber war der erste Leser, und so waren Absicht und Glück allen Schreibens diesmal und für immer, real und symbolisch, in dieser Situation am Küchentisch vor dem Karpfenweiher theatralisch inszeniert. Schreiben war und ist seither, auch wenn es für so einen fremden Adressaten wie ein Zeitungspublikum geschieht, die Werbung um den anderen, ein Gruß der Hand an die Welt.
An den Tätigkeiten, die man wichtig nimmt, zeigt sich am schmerzlichsten das Alter: Die freundlichen Leser werden weniger, der Platz für Artikel wird rarer, und die Welt entwickelt sich in eine Richtung, in die die lockerste Hand nicht mehr mitgehen kann. Durch sie würde ein Urteil aufs Papier fließen, das dem Rhythmus und Stil des neuen Lebens nicht angemessen wäre. Geblieben ist eine körperliche Notwendigkeit. Schreiben ist nicht etwa eine Handlung, sondern eine Tat: die Verwandlung von Fantasie und Denken in Sichtbarkeit. Die einmal gelockerte Hand kann nicht ruhen, weil die Welt, die in den Kopf eindringt, durch die Hand verwandelt in Bild und Meinung, gar zu leicht wieder heraus- und in die Welt entschlüpfen möchte. Der Schreibende verachtet die gegenwärtige Sucht der Menschen, jeden Augenblick auf dem Foto festzuhalten, zu »knipsen«. Was aber ist Schreiben anderes, als Fotos aufzunehmen, Filme ablaufen zu lassen, also einen in einen Rahmen, in ein Format zu fassenden Text herzustellen? Freilich, es braucht dazu mehr Zeit.
Wohin aber mit Samt und Streicheleien, mit den Liebkosungen des Papiers, wenn die Schreibmaschine klappert? Vorbei ist die Stille, der höchste Luxus des Schreibenden, vorbei die sinnliche Nähe zum Schreibzeug. Mit der Maschine begann das Schreiben mit zwei Händen, ein Schreiben, das man kaum spürt. Das Auge zwar, das aufs Blatt starrt, ist mehr beschäftigt als zuvor, es korrigiert unentwegt – der Buchstabe, ist er richtig oder falsch? Die Buchstaben, die man mit einem Stift schrieb, waren immer die, die man schreiben wollte. Nie schrieb man »Mrogen« statt »Morgen«, nie »mien« statt »mein«. Und wenn auch hier das Auge beim Schreiben mit der Hand aufs Papier gerichtet sein musste, störte dies nicht den Schwung des Inneren, weil die Niederschrift sicher gelang. Beim Schreiben mit der Maschine hingegen fordern die Buchstaben eine eigene Aufmerksamkeit; die Technik dominiert das Vergnügen.
Bei einer Ferientätigkeit, 1960 etwa, übte ich mich in einem städtischen Büro auf der Schreibmaschine. Seither bin ich schnell, schreibe blind und bin meine eigene Sekretärin, mit deren Geschicklichkeit ich zufrieden sein kann. Spaß macht nun das Tempo des Schreibens. Jede Zeile ein Spurt. Leider aber stolpere ich doch zu oft bei diesem Kurzstreckenlauf und muss immer wieder einmal zurück zum »vertippten« Buchstaben. Zwischen das Ausdenken von Worten und Sätzen schob sich seither die Korrektur des Geschriebenen. Zunächst schlug man den richtigen über den falschen Buchstaben, es ergab sich ein Klecks, ein Geschmier, das heute literarische Museen gerne ausstellen, weil die Unordnung so viel Scheitern und also so viel Leben enthält. Schließlich half Tipp-Ex aus der Not. Aber noch immer musste jedes Manuskript für den Druck von einer Schreibkraft noch einmal »ins Reine« geschrieben werden: Eine Mark kostete bei meiner Dissertation die Seite. Dann kam der PC, und mit ihm kehrte Ästhetik ins Schreiben zurück. Vor allem Stille herrschte wieder. Zunächst zwar klapperten in den Lesesälen der Bibliotheken die Maschinchen, die die Studenten aufstellten, und verdarben die Stimmung der Kontemplation. Inzwischen vernimmt auch der Hellhörige nichts mehr, und der Eilige kommt auf dem Gerät schneller voran denn je. Ein falscher Buchstabe – kein Problem! Husch! Husch! Schon hat er sich verdrückt!
Und dennoch: Nie wird dies Gehetze zwischen Einfall und Niederschrift des Einfalls mir die Liebe zu Papier und Feder austreiben, zu Buchstaben, die unverwechselbar die meinen sind. Die Schrift ist so etwas wie das Kleid: die Veräußerlichung einer Person, die sich selbst nie sieht, die nicht einmal die Gesten, die nach außen wirken, an sich beobachten kann. Nur beim Schreiben sieht sie die Hand und das Ergebnis ihres Tuns, die individuell gestalteten Zeichen. Nicht einmal im Spiegel geht das, denn auch dort ist man nicht Geste, sondern Maske, starrt ohne Miene hinein ins Glas. Nur im Kleid und in der Schrift sehe ich das, was ich sein will und hoffentlich dann auch wirklich bin.
Der Computer fügt nun den verschiedenen Lüsten des Schreibens aber doch eine neue hinzu: die Reinlichkeit. Jede ausgedruckte Seite ist perfekt. Endlich schreibt und redet man »wie gedruckt«. Zwar wird auch diese Seite wieder durch Korrekturen gedanklich verbessert und optisch verdorben; aber der nächste Ausdruck ist wieder sauber: schwarz auf weiß – wie einst auf der Schultafel: weiß auf schwarz. Die Reinlichkeit lässt sich nicht nur am Ergebnis genießen, sondern schon bei der Arbeit selbst. Jede Korrektur geschieht prompt. Mitten im Schreiben kann das falsche Wort, die schiefe Wendung, der missratene Satz modelliert werden, kann noch einmal ausgedruckt werden und noch einmal und noch einmal, und so fällt mir das, was ich sagen will, auf dem nächsten und übernächsten Ausdruck besser und immer besser in die Hand.
Da das Korrigieren so schnell vonstattengeht, nähert sich der Satz auf dem Computer der gesprochenen Sprache, der Text fließt ungehemmter als beim Schreiben mit der Hand, die Sprache verändert sich, wird leichter, schneller, verständlicher – nicht vorstellbar, dass Adorno seine komplizierten Sätze, die dauernd einhalten und sich vor dem schon andrängenden nächsten Gedanken verbeugen, um auch diesen noch im selben Satz mitzuschleppen, auf einem PC geschrieben hätte.
Doch obwohl nun jeder seine eigene Druckerei im Hause hat und seine Worte beliebig vervielfältigen kann, bleibt das Schreiben, bleiben Papier und Feder das eigentliche Glück des Tuns. Die Lust am Original erlischt für den, der sie einmal genossen hat, nie und nimmer. Sich beugen über das Blatt, die Verbeugung vor dem, was auf ihm steht, heiligt erst den Schreibgenuss. Der Weg vom einhändigen Schreiben zum beidhändigen ist der Weg vom Original zum Druck, vom Malen zum Kopieren, vom Selbstgespräch zur Rede. Und Schreiben heißt nun einmal Selbstgespräch – die Bewegung der schreibenden Hand hat etwas von Onanie. Das Papier ist ein bleiches Gesicht, das einen ansieht, zuhört, aber kein Wort spricht. Man denkt an die anderen, für die man schreibt, und doch ist man dabei so wunderbar allein. Selbstherrlichkeit – eine Sünde, dem Schreibenden aber wird sie von Gott und der Welt nicht angekreidet.
Lesen
Es muss etwas passieren! Etwas Unglaubliches! Jeden Tag – dies wusste auch die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« in den achtziger Jahren, da sie täglich am Ende des politischen Teils ihren Lesern eine »kleine Geschichte« anbot, nur ein paar Zeilen lang: Ereignisse, die so unglaublich waren, dass man sie nicht mehr für Nachrichten halten konnte. Die Unglaublichkeit überbot den berichteten Schrecken der Nachricht und machte sie zum Lesespaß. Übertreibung bis zur Unwahrscheinlichkeit ist ein erprobtes Mittel, das Furchtbare zu bannen, damit es das Schöne werde. Denn das Schöne ist nicht, wie Rilke dichtete, des Schrecklichen Anfang, sondern umgekehrt: das Schreckliche ist des Schönen Anfang. Und eines der probaten Mittel, den Schrecken zum Anfang des Schönen zu machen, ist es, dass man, wie eben damals in den Zeitungsgeschichtchen, nichts glauben muss von dem, was erzählt wird: Zum Beispiel glaubt keiner, dass eine Maus ein brennendes Haus retten kann. Und dennoch wusste man, dass eine Zeitung Geschehen nicht erfindet, sondern Fakten berichtet und dass sie auch diesmal wieder dem Leser eine Realität erschlossen hat.
Die geistreichste Art, das Schreckliche in Schönheit zu verwandeln, ist es, das Unglaubliche zu steigern bis zu dem Grad, da es in Fantasie oder Witz übergeht. Die Geschichten, die man am liebsten liest, sind Schauerlichkeiten, die ein Ende nehmen, bei dem der Leser nur noch den Kopf schüttelt. Nichts aber wird ihm, so weiß er, beim Unglück, von dem er gerade liest, geschehen, und doch meint er, er sei mittendrin. Das Schreckliche ins Schöne hinüberzuführen – dazu reicht, bei viel und auch bei wenig Geist, schon ein bequemer Sessel. In seine Polster versunken, von seiner Gemütlichkeit verwöhnt, wird alles Ungeheuerliche, von dem der Leser erfährt, harmlos und zur angenehmen Unterhaltung. Die wilden Schauerlichkeiten, wie man sie in Büchern oft genug findet, zu genießen, genügt aber, falls kein Sessel da und falls man ein Kind noch ist, allein schon die Hand des Vaters.
So war denn auch das erste Buch, das mir vorgelesen wurde und dessen ich mich erinnere – viele andere mögen vorausgegangen sein –, ein ganz, ganz schönes! Und doch erschien es mir, als ich es vierzig Jahre später aus kritischer Distanz noch einmal selbst las, als das erdenklich Bösartigste, was man einem Kind vorsetzen kann: der »Struwwelpeter«. Sadismus sondergleichen in jedem Wort und jedem Bild – doch die Hand des Vaters auf der Schulter war warm, und die spöttische Stimme, mit der er las, verkehrte die Unholde und Bösewichter der Geschichtchen in drollige Figuren, ihre Taten in Wunder, Zauber, Fantasie. All das, was Erziehungswut sich an Grausamkeiten ausgedacht hatte, war ein Spaß: So ließ sich lachen, schadenfroh, über die brennenden Katzen wie über schöne Fackeln, über den bösen Friederich, diesen Narren, über den fliegenden Robert auch, der hieß wie mein Bruder, dem das Bilderbuch eine wunderbare Himmelfahrt vorauszusagen schien.