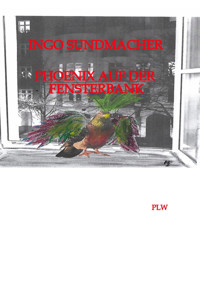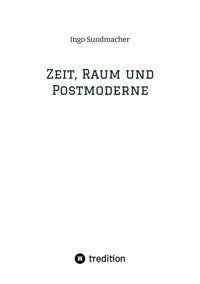
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Alltagsverständnis der meisten Menschen ist Zeit linear und Raum in Abmessungen festgelegt. Dabei sind sie nicht annähernd so leicht zu erfassen, wie man glauben möchte. Tatsächlich unterscheiden sich Zeit-Raum-Auffassungen bereits zwischen verschiedenen Kulturen und auch auf naturwissenschaftlicher Ebene gibt es verschiedene Modelle, je nachdem, was und wie betrachtet wird. So wie in der Physik der Begriff von Raum und Zeit sich von linear, einheitlich und eindeutig messbar zu einer relativen Betrachtungsweise weiterentwickelt hat, hat sich auch die Sicht auf die Welt von der modernen zu einer postmodernen weiterentwickelt, Beide Sichtweisen stehen immer noch in einer vermeintlichen Konkurrenz zueinander. Postmoderne ist aber kein epochaler Begriff in dem Sinn, dass sie zeitlich auf die Moderne folgt, Vielmehr sind Moderne und Postmoderne als verschiedene gleichzeitig existierende Denkweisen zu sehen. Um den Unterschied im Denken, den dies mit sich bringt, anschaulich machen zu können, wird Postmoderne in Abgrenzung zur Moderne diskutiert. Diese verschiedenen Ansätze im Denken bringen aber auch die Notwendigkeit mit sich, Zeit und Raum – auch auf philosophischer und kultureller Ebene – neu zu überdenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ingo Sundmacher
Zeit, Raum und Postmoderne.
© 2024 Ingo Sundmacher
Coverdesign von: Ingo Sundmacher
ISBN 978-3-384-25176-3
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Ingo Sundmacher, Richard-Sorge-Str. 74, 10249 Berlin, Germany.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Postmoderne und Literatur
3. Raum und Zeit
3.1. Alltag und Sprache
3.2. Klassische Philosophie vor Kant
3.3. Zeit und Raum als Kategorie
3.4. Relativitätstheorie und Quantenphysik
4. Raumzeit und postmoderne Literatur
5. Literatur
1. Einleitung
Im Alltagsverständnis der meisten Menschen zumindest westlicher Prägung werden Raum und Zeit in der Regel als einfach gegeben hingenommen. Der Mensch bewegt sich vermeintlich souverän durch räumliche Dimensionen, legt Strecken zurück, für die Maßeinheiten existieren und nimmt selbst bewusst einen Raum ein, den er sogar zu spüren meint. Die drei Dimensionen des Raums werden als Höhe, Breite, Tiefe beschrieben und geben jedem ein einleuchtendes Gefüge an die Hand, unabhängig davon, ob es darum geht, zu Hause Möbel selbst aufzubauen, oder um kompliziertere Arbeiten, die Ingenieurswissen erfordern. Schwieriger wird es bei der Bewertung von Zeit, die mal schneller und mal langsamer zu vergehen scheint, je nachdem wie beschäftigt oder gelangweilt man ist. Im Alltagsgebrauch scheint Zeit etwas zu sein, das linear verläuft und auf der Uhr abgelesen werden kann. Aber schon die subjektive Empfindung von schnell oder langsam vergehender Zeit zeigt, dass dies so einfach nicht ist. Noch komplizierter wird es, wenn wir uns klar machen, dass Zeit und Raum im Verhältnis zueinander stehen. Spätestens dies ist im alltäglichen Empfinden nur noch schwierig nachzuvollziehen.
Möglich, dass der Mensch als dreidimensionales Wesen eine Ahnung von der Zeit als vierte Dimension hat, sie aber dennoch in der räumlichen Verfassung dieser drei räumlichen Dimensionen nicht unmittelbar erfassen kann. Man kann sich das als Gedankenexperiment so vorstellen:
Ein eindimensionales Wesen, das also als Punkt existiert, würde genau diese eine eigene Dimension erkenne, aber nicht darüber hinausgehen. Vermutlich bliebe aber dennoch eine Idee davon, dass es jenseits dieser erkannten Dimension eine Ausdehnung in irgendeiner Weise geben muss, die überhaupt erst die Abgrenzung der punktuellen Existenz vom Rest der Welt eine Selbsterfahrung ermöglicht, aber diese Erkenntnis bliebe theoretischer Natur oder gefühlt.
Entsprechend würde ein zweidimensionale Wesen, das etwa Höhe und Breite, aber keine Tiefe erfährt, sich zwar entlang eines Raumstrahls bewegen können, aber eine räumliche Tiefe diffus erspüren, aber nicht deutlich als Dimension des eigenen Seins erkennen können. Hier müsste ja die Abgrenzung des Strahls in seiner linearen Erscheinungsform im Rahmen einer Tiefendimension zumindest erfühlt werden, um eine Abgrenzung erfahren zu können.
Dem Mensch als dreidimensionales Wesen ergeht es entsprechend. Zwar erkennt er die drei Dimensionen Höhe, Breite und Tiefe und damit bereits eine Dimension mehr als das zweidimensionale Wesen, erfährt aber eine vierte Dimension, die Zeit, nur intuitiv, zum Beispiel als eine Voraussetzung für Alterungsprozesse. Unmittelbar erkennen, wie die drei anderen Dimensionen, kann er sie nicht, bestenfalls kann er sie mit mathematischen Hilfskonstruktionen erfassen. Die Zeit-einteilung, wie sie kalendarisch oder mit einer Uhr angegeben werden, sind solche Konstruktionen.
Ein vierdimensionales Wesen würde dagegen nach diesem Muster Zeit als vierte Dimension genauso unmittelbar wahrnehmen wie der Mensch Höhe, Breite und Tiefe und entsprechend wesentlich mehr als diesen entsprechend betrachten, hätte aber die diffuse Wahrnehmung einer fünften Dimension usw.
Gleichzeitig muss man in Rechnung stellen, dass das westliche Alltagsverständnis von Raum und Zeit nicht allgemeingültig ist. Zum einen hat sich die Betrachtung historisch betrachtet entwickelt und ist nicht zu allen Zeiten gleich gewesen, zum andern gibt es Kulturen, die eine völlig andere Betrachtungsweise entwickelt haben. Das westliche Verständnis folgt hier im Wesentlichen dem Newtonschen Modell. Tatsächlich ist dies aber nach neueren physikalischen Erkenntnissen nur ein Sonderfall von Zeit und Raum. Es gibt hier interessante Parallelen bei kulturellen und physikalischen Weltbildern, die genau genommen in ihrer Einordnung wiederum Parallelen zu verschiedenen Interpretationsansätzen aufweisen, die man als modern beziehungsweise postmodern betrachten kann.
Mehr als im Alltag oder insgesamt in gesellschaftlichen Zusammenhängen haben solche verschieden ausgeprägten Betrachtungen ihren Platz im kulturellen Umfeld, nicht zuletzt in der Literatur gefunden. Auch die meist im philosophischen Rahmen entwickelten Theorien zur Postmoderne wurden schon früh in der Literaturwissenschaft rezipiert und angewendet. Diese neuen Betrachtungsweisen bringen eben auch eine Veränderung von Raum/Zeit-Betrachtungen mit sich.
Die Arbeit beginnt daher mit der Diskussion der Postmoderne in Abgrenzung zur Moderne. Vor allem auch, da es der Natur der Postmoderne entspricht, dass der Begriff Postmoderne fließend ist, wird er mitunter in verschiedener Weise verwendet. Besonders im Rahmen der Moderne wird er oftmals linear zum Beispiel als epochaler Begriff oder per se als Synonym für Abzulehnendes verwendet. Die Untersuchung wird zeigen, dass dies nicht zielführend ist und es vielmehr bei Moderne und Postmoderne um verschiedene Denkansätze geht. Die Betrachtung wird in Bezug auf Kultur, Philosophie und Literatur erfolgen.
Es folgt eine kurze Geschichte von Raum und Zeit, die sowohl philosophische als auch naturwissenschaftliche Gesichtspunkte mit berücksichtigt. Besondere Beachtung sollen dabei Kants Auffassung von Raum und Zeit (Kritik der reinen Vernunft) und Isaac Newtons Gravitationstheorie, die neben anderen die Betrachtung von Raum und Zeit für die Moderne vorgegeben haben, erhalten. Interessant sind diese Bereiche, da hier von kategorischen, damit also grundlegenden Vor-stellungen von Zeit und Raum ausgegangen wird. Zum einen stehen konkret-räumliche und -zeitliche Beschaffenheit bei Kant neben Raum und Zeit im kategorischen Sinne (neben im Sinne paralleler Erscheinungsformen eines Dinges).
Dem gegenüber stehen die Theorien zum Beispiel der Verzeitlichung und Verräumlichung, wie sie Jacques Derrida beschreibt und einige Aspekte der neueren Physik (Quantenphysik, Relativitätstheorie), soweit diese für dieses Thema von Bedeutung sind. Interessant ist hier auch das Nebeneinander der Erscheinungsformen etwa in der Quantenphysik, wenn Licht gleichzeitig als Welle und als Teilchen auftritt (Komplementarität). Der Zusammenhang zu Zeit und Raum ergibt sich aus der Darstellung.
Abschließend sollen der literaturspezifische erste Teil mit den darauf folgenden Problemen von Zeit und Raum in natur-wissenschaftlich-philosophischer Hinsicht diskursiv verknüpft werden. Hier soll auch die Bedeutung einer Theorie zu Raum und Zeit für literaturwissenschaftliches Vorgehen diskutiert werden, die unter anderem mit der Differenz (Derrida: differance) beschrieben werden kann.
Fremdsprachige Zitate werden in den Anmerkungen durch eine jeweilige Übersetzung ins Deutsche ergänzt. Alte Texte werden, wenn sie aus alten Dokumenten zitiert werden, in der dort wiedergegebenen zeitgemäßen Schreibweise wiedergegeben. Ansonsten wurden Anpassungen an aktuelle Schreibweisen so moderat wie möglich vorgenommen, um gegebenenfalls den Charakter des Zitats nicht zu verfälschen.
2. Postmoderne und Literatur
Ausgehend davon, dass der modernen Welt und der Literatur in ihr ein Verständnis von Raum und Zeit zugeordnet werden kann, das ebenfalls modern ist, stellt sich die Frage, in wie weit ein Wechsel im Sinne einer anderen Entwicklung der Welt und Literatur auch einen Wechsel des Verständnisses von Raum und Zeit mit sich bringt. Ausgehend davon, dass ein solcher Wechsel als ein postmoderner gesehen werden kann, ist es nötig, sich mit dem Begriff der Postmoderne auseinanderzusetzen. Dass eine solche Gegenüberstellung von modern und postmodern in gewissen Bahnen sinnvoll ist, ergibt sich aus der folgenden Diskussion. Eine solche Auseinandersetzung ist auch notwendig, weil nicht nur eine einzige Theorie für eine postmoderne Literatur existiert. Stattdessen ist der Begriff der Postmoderne im Zusammenhang mit einer aktuellen Diskussion zu verstehen, was bedeutet, dass es eine reichhaltige Auswahl verschiedener Begriffserklärungen und Diskussionsansätze gibt.1
Selbstverständlich gilt eine entsprechende Vielfalt auch für die verschiedenen Erklärungsansätze der Moderne. Als eine typische Denkart der Moderne kann aber gelten, was Ludwig Wittgenstein folgendermaßen formuliert:
Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. (...) Das Resultat der Philosophie sind nicht „philosophische Sätze“, sondern das Klarwerden von Sätzen.
Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst, gleichsam, trübe und verschwommen sind, klar machen und klar abgrenzen.2
Was Wittgenstein hier speziell für die Philosophie darlegt, hat genauso Gültigkeit für alle anderen Bereiche, die von Begriffen wie Moderne, Postmoderne etc. betroffen sind, also auch beispielsweise für Gesellschaft und Kunst. Immer geht es hier um eine klare Linie und ist das moderne Denken zielorientiert. So beschreibt François Lyotard das Konzept der Moderne folgendermaßen:
In der Tradition der Moderne ist die Beziehung der Menschen zu den Materialien durch das cartesianische Programm festgelegt: es gilt, sich zum Herren und Besitzer der Natur zu machen. Ein freier Wille unterwirft Gegebenheiten, indem er sie ihrem natürlichen Sinn entfremdet, seinen Zielen. Er bestimmt seine Ziele dank der Sprache, die ihm erlaubt zu artikulieren, was möglich ist (ein Projekt), und es dem, was wirklich ist (der Materie), aufzuzwingen.3
Eine solche zugrundeliegende Tradition kann für das Projekt der Postmoderne nicht bestehen. Nimmt sie eine solche Richtung, vollzieht sie ihren inneren Wechsel zu etwas anderem, vorzugsweise zur Moderne, mit der sie im Diskurs steht. Wenn avantgardistische Ansätze die Homogenität der Moderne aufbrechen, indem sie den bekannten abgesteckten Rahmen eben der Traditionen sprengen, stehen sie außerhalb, wenigstens aber auf der Grenze zu ihnen.4 Kommt die Eruption zur Ruhe, besteht eine Situation, in der die Eingliederung der durch sie gewonnenen neuen Gesichtspunkte oder Möglichkeiten vollzogen werden oder bereits worden sind. Mit dieser Einkehr einer „Normalität” ist sie keine Avantgarde mehr. Es geht nicht weiter, jedenfalls nicht mit ihr.
So gesehen gibt es laut Lyotard in ihrem Verhältnis zurzeit keinen Unterschied zwischen einem avantgardistischen Manifest und dem Vorlesungsverzeichnis einer Kunsthochschule. In beiden Fällen liegt das Interesse auf dem Weiterkommen.5 Dieser Wunsch nach Weiterkommen impliziert die Nichtakzeptanz bestehender Regeln und den Versuch, eigene Wege zu gehen, also sich auch eigene Regeln zu schaffen. Am Anfang steht also der Wunsch, das Unbekannte zu schaffen.
Darin wiederum liegt ein stark pluralistischer Ansatz, da in der Nichtvorgabe der bestehenden und allgemein bekannten Regeln eine grundsätzliche Offenheit letztlich allen anderen Möglichkeiten, auch bisher gar nicht bekannten, gegenüber liegt. Nach der Fertigstellung etwa eines Kunstwerks sind sie aber bekannt. In diesem Sinne sind die Übergänge zwischen Moderne und Postmoderne fließend, was unterstreicht, dass es hier nicht um Gattungs- oder Epochenunterschiede geht, wie manchmal landläufig angenommen wird, sondern, grundsätzlicher, um Haltungen. Dabei ist es die Aufgabe, die Avantgarde, „die Anmaßungen des Geistes gegenüber der Zeit aufzulösen. Das Gefühl des Erhabenen ist der Name dieser Blöße.”6
Dieser Pluralismus ist nicht nur maßgeblich für avantgardistische Kunst und damit in Verbindung stehender eventueller Manifeste, sondern auch für u. a. Gesellschaft und Theorie7, z. B. philosophischer und kultureller. Ebenso vielfältig zeigt sich auch das weite Feld der Versuche, sich dem Begriff der Postmoderne überhaupt zu nähern, zum einen weil die Diskussion hierzu noch frisch ist8, zum anderen gerade weil der Pluralismus keine Einheitlichkeit zulässt, sie vielmehr aus einem tief verwurzelten Misstrauen einheitlichen Lösungen gegenüber sogar ausschließt. Peter V. Zima versucht, sich diesem scheinbaren Dilemma in einer Konfrontation verschiedener Ansätze so zu nähern:
Die Definitionen der Postmoderne sind so disparat, dass nur eine lange und gründliche Untersuchung die Ungereimtheiten und Widersprüche entwirren könnte. Uwe Japp weist darauf hin, dass die Unterscheidungsmerkmale, mit deren Hilfe man die Postmoderne zu definieren versucht, zu unspezifisch und auch auf die Moderne anzuwenden sind. Während David Lodge die Postmoderne als „Inszenierung absichtsvoller und unauflöslicher Widersprüche” charakterisiert, stellt Ihab Hassan einen Gegensatz zwischen der von ihm als „autoritär” und „aristokratisch” definierten Moderne und einer „subversiven” und „anarchischen” Postmoderne her. (...) Geht man von François Lyotards bekannter Definition der Postmoderne aus, stellt man alsbald fest, dass nicht nur die Dekonstruktion, sondern auch die Kritische Theorie und Autoren wie Kafka, Musil, Gide und Italo Svevo als postmodern einzustufen sind. (...) Um eine Klärung dieses Problems bemüht sich Wolfgang Welsch, der die These vertritt, „dass die Postmoderne die Moderne fortsetzt, ja in radikalisierter Form einlöst”. Er konkretisiert Lyotards Darstellung, wenn er schreibt, dass moderne Autoren den Verlust der Ganzheit (der Metaerzählung) beklagen, während die Vertreter der Postmoderne sie begrüßen. (...) Umberto Eco hingegen relegiert die Avantgarden in die Moderne(...).9
Der hier von Zima ebenfalls gewürdigte Lyotard, der einen entscheidenden Anstoß für die Postmoderne-Debatte geliefert hat, sieht hauptsächlich drei mit dem Terminus „Postmoderne” verbundene Probleme.
Da ist „[z]uerst der Gegensatz von Postmodernismus und Modernismus bzw. der modernen Bewegung (1910-1945) in der Architektur”10. Dabei zitiert er zwei Konzepte eines postmodernen Bruches: Zum einen die der euklidischen Geometrie eingeräumten Hegemonie (Portoghesi) und zum anderen die Auflösung der engen Bindung von architektonischen Projekten und progressiver sozialer und individueller Emanzipation (Gregotti). Für den postmodernen Menschen, resp. Architekt, bietet sich so kein Horizont an. Die Folge ist eine Ansammlung architektonischer Zitate, eine „Bricolage”11. Das, so Lyotard, ist aber die Folge einer chronologischen Sichtweise der Postmoderne – und „[d]iese Idee einer geradlinigen Chronologie ist nun aber vollkommen ‚modern‘”12.
Das zweite Problem liegt in der unbedingten Fortschrittsgläubigkeit in der Entwicklung der Künste, der Technologien, der Erkenntnis und der Freiheiten für die Menschheit der letzten Jahrzehnte, die er mit einem wachsenden Unbehagen einhergehen sieht. Sowohl die materiellen als auch die intellektuellen und mentalen Resultate betreffend sieht er die Entwicklung der Techno-Wissenschaften als ein Mittel, dieses Unbehagen noch zu vergrößern. Er kritisiert ihre von uns unabhängige Kraft und Motorik und kommt zu dem Resultat: „Wir können diese Entwicklung nicht mehr Fortschritt nennen.”13 Damit sieht er aber auch einen wichtigen Punkt der Moderne als gescheitert an.
Besonders der dritte Punkt ist ihm ein Anliegen. Es geht um die „Ausdrucksweisen des Denkens: Kunst, Literatur, Philosophie, Politik”14. Es geht ihm um den Prozess des Avantgardismus, den er als lange, verbissene und höchst verantwortungsvolle Arbeit auf der Suche nach den in der Moderne enthaltenen Prinzipien sieht. Parallel zu den Theorien der Psychoanalyse sieht er die Strategien entsprechender Künstler als ein Durcharbeiten der Moderne auf der Suche nach ihrem eigenen Sinn.
Gibt man eine derartige Verantwortung auf, ist man mit Sicherheit dazu verurteilt, die „moderne Neurose” – als Quelle des Unglücks, das wir zwei Jahre lang erfahren haben –, die abendländische Schizophrenie und Paranoia usw. ohne jede Verschiebung zu wiederholen.
Du wirst verstehen, dass das „post-”’ von „postmodern” – so verstanden – keine Bewegung des come back, flash back, feed back, das heißt der Wiederholung bedeutet, sondern einen „Ana”-Prozess der Analyse, Anamnese, Anagonie und Anamorphose, der das „ursprüngliche Vergessen” abarbeitet.15
Was aber ist die Postmoderne, die er an dieser Stelle einführt? In seinem Essay Beantwortung der Frage: Was ist Postmodern?16 versucht er eine Antwort zu geben.
Interessanterweise setzt er sie nicht in die Nachfolge einer Moderne, sondern meint vielmehr, sie ginge immer der Moderne voraus. Jedes Kunstwerk, so Lyotard, ist nur dann modern, wenn es vorher auch postmodern war. Postmodernismus sei nicht der Tod des Modernismus, sondern dessen permanente Geburt. Damit stellt er den Begriff des Postmodernismus neben den der Avantgarde, für ihn ein Kernbegriff der Moderne, an der sie sich in Sinn und Inhalt maßgeblich manifestiert. Eine solche Geburt entwickelt sich im Verhältnis der beiden Modi von Darstellbaren und Denkbaren, entweder mit dem Akzent auf der Ohnmacht des Darstellungsvermögens, also dem Versuch, sich einer Ausdrucksmöglichkeit zu nähern, die bisher unerreichbar scheint und somit neue Wege verlangt, oder dem Akzent auf dem Denkvermögen, auf dem Weg zu potentiell neuen Erkenntnissen, wobei die Schwierigkeit hauptsächlich in der Diskrepanz zwischen ihr und andererseits Sinnlichkeit und Einbildungskraft, die den Künsten oberflächlich zugeordnet und sogar zugrunde gelegt werden, besteht. Im Rahmen dieser Akzente liegt aber gerade eine Möglichkeit für die Postmoderne.
Es mögen verschwindende Nuancen sein, die diese beiden Modi voneinander trennen, oft genug sind beide in ein und demselben Werk zugegen und nahezu ununterscheidbar, und dennoch zeugen sie von einer Differenz, in der sich seit langem das Schicksal des Denkens ereignet und ereignen wird, der Differenz zwischen Trauer und Wagnis.17
Auch wenn der hier von Lyotard gebrauchte Begriff der Differenz nicht absolut deckungsgleich ist mit dem Begriff der Différance, wie Jacques Derrida ihn benutzt, und Derrida dem Begriff Postmoderne äußerst kritisch gegenüber steht, treffen sich beide hier doch inhaltlich weitgehend.18
Derrida versteht unter der Différance eine Verschiebung zwischen Gedachtem und dem Denken des Gedachten, anders ausgedrückt zwischen Signifikant und Signifikat. Nach Derrida stellt sich automatisch eine Verzögerung zwischen dem Auftreten von etwas zu erkennendem und der Erkenntnis darüber ein. X muss sich erst als existent erkennbar machen, bevor es als X erkannt werden kann. Hier besteht eine Verschiebung mit sowohl zeitlichen als auch räumlichen Charakter. Diese Verschiebung bedingt, dass beide, X und die Erkenntnis von X, nicht als identisch betrachtet werden können. Hierin besteht die Différance, die sich als „das Spiel der Spur (...), die keinen Sinn hat und nicht ist”19 zeigt. Die Verschiebung bringt aber auch mit sich, dass die Différance nicht systematisch fassbar ist, also auch nicht systematisch benannt werden kann und immer wieder neu gedacht werden muss. Sie ist immer wieder aufgeschoben und macht sich in einer Kette von Supplementen bemerkbar, in einer Kette deshalb, weil sie immer wieder neu gedacht wird, also auch immer in Bewegung bleibt. Damit aber ist in der Vorwärtsbewegung (zeitlich und räumlich) gleichzeitig auch eine Auslöschung durch die Überschreibung mitgedacht.
Lyotard ist nicht allzu weit davon entfernt, wenn er seinen Begriff des Widerstreits (im französischen Original: Le différend) folgendermaßen zu definieren versucht:
Der Widerstreit ist der unstabile Zustand und der Moment der Sprache, in dem etwas, das in Sätze gebracht werden können muss, noch wartet. Dieser Zustand enthält das Schweigen als einen negativen Satz, aber er appelliert auch an prinzipiell mögliche Sätze. Was diesen Zustand anzeigt, nennt man normalerweise Gefühl. „Man findet keine Worte” usw. Es bedarf einer angestrengten Suche, um die neuen Formations- und Verkettungsregeln für die Sätze aufzuspüren, die dem Widerstreit, der sich im Gefühl zu erkennen gibt, Ausdruck verleihen können, wenn auch vermeiden will, dass dieser Widerstreit sogleich von einem Rechtsstreit erstickt wird und der Alarmruf des Gefühls nutzlos war. Für eine Literatur, eine Philosophie und vielleicht sogar eine Politik geht es darum, den Widerstreit auszudrücken, indem man ihm entsprechende Idiome verschafft.20
Dieser Zustand und Moment der Sprache, in dem etwas noch nicht formuliert wurde, noch in Sätze gebracht werden muss, deckt sich mit der Différance. Auch hier besteht eine Verzeitlichung und durch den noch zu manifestierenden Satz, also einem, der noch gegenständlich gemacht werden muss, auch eine Verräumlichung. Die Verschiebung, von der Derrida ausgeht, ist hier spürbar als Schweigen, im Warten auf den Satz oder als negativer Satz, wie Lyotard es bezeichnet, als Noch-nicht-Artikulation. Die Wahrnehmungsebene ist das Gefühl. Die neuen Formations- und Verkettungsregeln ergeben ein Instrumentarium, das durch die darin implizierte Interpretation Supplemente schafft.
Interessant ist, dass Lyotard im Widerstreit eine Aufgabe sieht, nämlich wenigstens für Literatur und Philosophie die passenden Idiome zu finden, mit deren Hilfe der Widerstreit ausgedrückt werden kann. Betrachtet man Widerstreit und Différance als verwandte Begriffe, muss sich für die Différance das gleiche sagen lassen. Wenn wiederum Verräumlichung und Verzeitlichung als Momente der Différance und in oben beschriebener Form also auch für den Widerstreit eine Rolle spielen, muss auch weiter gelten, dass diese für Literatur und Philosophie von grundlegender Bedeutung sind.
Tatsächlich schlägt auch Derrida immer wieder eine Brücke zwischen Literatur und Philosophie. Oftmals entwickelt er seine Gedankengänge aus literarischen Einstiegen heraus oder überprüft diese exemplarisch an Texten aus der Literatur.21 Einen eigenen Versuch, sich Literatur als solcher zu nähern unternimmt er in Was ist Dichtung?22
Er vergleicht hier Literatur mit einem Igel23, der sich auf der Straße zusammenrollt, um sich vor den heranrasenden Autos zu schützen, und den man in die Hände nehmen, verstehen und bei sich behalten möchte. Dieses Einigeln sieht er auf ähnliche Weise in der „unendlichen Widerstand gegen die Übertragung des Buchstaben24 in der Literatur, insbesondere bei Gedichten, gegeben. Für das Gedicht gilt dabei das gleiche wie für den Igel. Die Sicherheit, die erreicht werden soll, ist trügerisch, und es ist daher „in seinem Rückzug gefährdeter denn je: Es glaubt dann, dass es sich wehrt und gibt sich preis.”25 Indem man nun das Gedicht wie den zusammengerollten Igel in die Hand nehmen und schützen möchte, nähert man sich sowohl dem Unmöglichen als auch der eigenen poematischen Erfahrung. Beide, der Igel und das Gedicht, müssen, so Derrida, um sich ihnen nähern zu können, ins Herz geschlossen und auswendig gelernt26 werden. Damit wird das Gedicht zur direkten persönlichen Erfahrung. Indem sie auswendig gelernt wird, dringt sie wie ein Stachel in das Herz ein und macht damit auch verletzlich. Es existiert also „[k]ein Gedicht ohne Unfall, kein Gedicht, das sich nicht wie eine Wunde öffnet, keines aber auch, das nicht ebenfalls verletzt. Als Gedicht wirst du ein Beschwören bezeichnen, welches das Schweigen bricht; die stimmlose Wunde, die ich von dir, die ich durch dich auswendig lernen möchte.”27 Was ein Gedicht ist, versucht Derrida darauf aufbauend folgendermaßen zu definieren:
Herz zu bedeuten scheint und was ich in meiner Sprache schlecht von dem Wort cœur - Herz – zu unterscheiden vermag. Cœur, das Herz in dem Gedicht <apprendre par cœur> (lerne es auswendig; à apprendre par cœur), nennt nicht mehr bloß die reine Innerlichkeit, die unabhängige Spontanität, die Freiheit, sich selbst zu affizieren, indem man die geliebte Spur reproduziert. Das Gedächtnis des <par cœur> vertraut sich wie ein Gebet, wie eine Bitte einer bestimmten Äußerlichkeit des Automaten an – so ist es sicherer –; es vertraut sich den Gesetzen der Mnemotechnik an; jener Liturgie, die oberflächlich betrachtet die Technik nachahmt; dem Automobil, das deine Leidenschaft, deine Passion überrascht und wie aus dem Außen über dich hineinbricht: auswendig, <par cœur> auf Deutsch. (...) In einer einzigen Chiffre versiegelt das Gedicht (...) den Sinn und den Buchstaben, einem Rhythmus gleich, der die Zeit verräumlicht.28
Allerdings möchte Derrida seine Betrachtungen nicht auf Gedichte beschränkt wissen. Zwar versucht er eine Antwort auf die Frage Was ist Dichtung? im Rahmen seines Textes vor allem für Gedichte, möchte aber dieses Unterfangen erweitert wissen, wenn er seine Ausführungen abschließt mit: „Indem sie das, was so ist, wie es ist, ankündigt, begrüßt eine Frage die Geburt der Prosa.”29