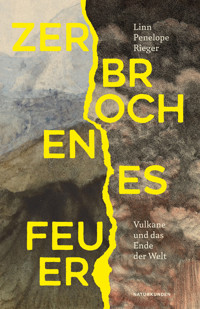
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Magma bildet den Glutkern unseres Planeten, und ohne die Eruptionen in Urzeiten gäbe es weder Kontinente noch Berge, weder Lebensräume noch Leben. Und doch sind Vulkane bedrohlich, nicht zuletzt, weil sich ihr Ausbruch selbst mit den modernsten Messgeräten weder räumlich noch zeitlich exakt vorhersagen lässt. So gehört der Vulkanismus zu jenen Naturphänomenen, deren unberechenbare geologische Gewalt immer neue Geschichten entfesselt hat. Darin geht es um menschliche Hybris, Furcht und Schönheit des Erhabenen und die allerletzten Fragen: Woher kommen wir, und wohin geht diese Welt? Lanzarote, Indonesien, Martinique oder Italien: Linn Penelope Rieger verfolgt die mannigfaltigen Spuren und Abgründe zahlreicher erzitternder Schauplätze von enormen, manchmal tödlichen, aber auch fruchtbaren Eruptionen in den bildreichen und wortgewaltigen Schilderungen der Literatur – mit pochendem Herzen, mit Lust an der Angst und mit unerschrockenen Fragen nach dem Ursprung von Leben und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen pyroklastischen Sohn
NATURKUNDEN No.119
herausgegeben von Judith Schalansky bei Matthes & Seitz Berlin
Inhalt
Höhlenmensch werden
Die Seltsamkeit der Bilder
Von der anderen Seite
Bergzeichen
Die Poesie der Asche
Magma Mater
Ich danke
Verwendete und weiterführende Literatur
Abbildungsverzeichnis
»Alles Leben auf der Erde beschränkt sich auf das Herz in meiner Brust, das in einer entvölkerten, entseelten Welt alleine schlägt. Jahreszeiten und Klima existieren nicht mehr. Die Eigenwärme unseres Planeten steigt ständig und übertrifft bald die Wärme des strahlenden Sterns, den sie umkreist.«
JULES VERNE,
Reise zum Mittelpunkt der Erde
Höhlenmensch werden
Vermutlich hat jeder Mensch auf seine eigene Art Angst vor dem Ende der Welt. Eine diffuse, zunächst tief in den Körper zurückgezogene Furcht begann Anfang des Jahres 2022 in mir aufzusteigen. Ich lief durch kahle Wälder und die immer gleichen Fragen begleiteten meine Schritte: Was wäre, wenn in diesem Jahr kein Frühling käme? Wenn die Temperaturen zwar stiegen, aber nichts wachsen, nichts blühen würde? Welche Versorgungsketten würden als Erstes reißen? Wann würde die Politik reagieren? Gäbe es Aufstände? Ich dachte viele Wochen darüber nach – bis die ersten Knospen aufgingen und sich meine dystopischen Ängste in Luft aufzulösen schienen.
Mit der Hitze des einbrechenden Frühsommers kehrte die Angst wieder zurück und begann konkret zu werden, als ich merkte, dass die Bäume im Leipziger Auwald anders raschelten als in den Jahren zuvor. Sie waren so trocken, dass sich ihr Klang verändert hatte. Das fremde Rauschen schien mir nicht länger Vorbote eines drohenden Sterbens, es war bereits Teil davon. Ab diesem Moment, während ich auf die mit Trockenrissen durchzogene Erde blickte, begann ich, das Ende der Landschaften in ihnen zu sehen, legte über jeden Raum, den ich durchschritt, die Folie des endgültigen Zerfalls. Die Zukunft hauchte mich sengend an und ich fragte mich, ob es eine Zeit geben würde, in der ich nicht länger fähig wäre, zu frieren. Meine Angst war genau genommen also keine vor dem Ende der Welt, sondern vor dem Ende der Welt, wie ich sie kannte.
Dass meine Ängste zunahmen, lag sicher auch daran, dass der Sommer immer die herausforderndste Jahreszeit für mich gewesen ist. In der Hitze spüre ich meinen Körper schlecht, wo er aufhört, wo er beginnt. Wenn meine Haut feucht ist vom Schweiß, bekomme ich Ausschläge, die nur in kühler Dunkelheit heilen können.
Nun waren die Temperaturen über Nacht um zehn Grad gestiegen. Mir war heiß, und ich fürchtete mich. Ich lief durch die Landschaft meiner Kindheit, den Thüringer Wald, das Schortetal, in dem meine Großeltern ihre Kinder in einer Mühle hatten heranwachsen sehen, die lange nicht mehr stand. Zählte die Berge, die keinen Kahlschlag aufwiesen, an einer Hand ab. Ich ging Waldwege entlang, die keine mehr waren, erkannte die Umgebung nicht mehr, war orientierungslos. Blickte schließlich beim Gehen nicht länger nach vorn, sondern zu Boden.
Etwas in mir hatte begonnen, nach Trost Ausschau zu halten. Mein Bedürfnis danach schien mir übermächtig, ich spürte ihn überall auf. Auch in meinen sich verändernden Lebensräumen fand ich ihn, las ihn in Gestalt unzähliger Steine vom Boden auf und schleppte ihn nach Hause. In gewisser Weise errichtete ich mir in meiner Leipziger Wohnung eine Laube aus Stein, eine Kammer des äußersten Rückzugs, faltete mich ein, glitt zwischen die Steine, baute eine Höhle, in der ich hockte, und trug, wenn ich sie verließ, Teile davon in meinen Taschen mit mir. Schleppte den Trost mit mir herum, sehnte mich nach unter Tage, wo die Veränderungen so langsam vonstattengehen, dass ein Leben nicht ausreichen würde, um sie zu bemerken.
Ich lebte nach einem strengen Kalender, eingeteilt in Jahre, Monate, Wochen, Tage und Stunden, sodass die von Hand geschriebenen Aufgaben, was zu tun sei, mir alle sechzig Minuten zuverlässig Halt gaben. Da hockte ich nun, versuchte mich in meiner Höhle einzulagern wie eine vergessene Kastanie aus dem letzten Jahr, die langsam versteinert.
Doch die Ruhe, die ich unter Tage zu finden suchte, gab es nicht, hatte es nie gegeben. Der Waldboden unter meinen Füßen war schon einmal von Rissen durchzogen, lange bevor es meine Füße gegeben hat. Seine Trockenheit war kein Ausdruck des Sterbens gewesen, sondern das lebendige Pulsieren einer Landschaft im Entstehen. Vor dreihundert Millionen Jahren erstreckte sich hier eine karge, flache Ebene ohne Flüsse. Die Erdkruste dehnte, die Spannung entlud sich, Zentraleuropa kollabierte. Zahllose Spalteneruptionen zerschnitten das Land, Magma füllte die Gräben, trat dann über die Ufer und verbarg die Erde unter langsam auskühlenden Lavadecken.
Ich führte mein Leben auf den Überresten einer unvorstellbaren Katastrophe, die kein Ende zu kennen schien. Ich ging den Weg des Magmas mit meinen Fingern, tipp-tipp-tipp über digitale Karten. Das Netz der vulkanischen Aktivitäten, die Lavaströme, Gase und Aschen, die den Planeten überzogen – eine unüberschaubare Ausdehnung in Raum und Zeit, jede Grenze unterwandernd oder überspülend. Mein Zeitverständnis war zu beschränkt gewesen, als dass ich das Ausmaß der terrestrischen Bewegung hätte wahrnehmen können.
Doch nun versuchte ich mich selbst zu provozieren, indem ich mir einredete, mit geschlossenen Augen und genügend Konzentration irgendwann die Bewegungen der eurasischen Kontinentalplatte wahrnehmen zu können. Der Erdboden, den ich in meinem Bedürfnis nach Trost für ewig gehalten hatte, war so beweglich geworden, dass mir schwindelte. Was wusste ich schon über diesen Planeten und seine Bedürfnisse. Ich betrachtete Kiesel, winzige Steinchen, Sand und kam mir lächerlich vor. All das war auf eine Art und Weise Teil der Erde, wie ich es niemals würde sein können.
Ich starrte nächtelang auf die ausbrechenden Vulkane in Werner Herzogs In den Tiefen des Infernos. Die Hitze des Magmas auf dem Bildschirm wurde zum Spiegel meiner Ängste vor den Veränderungen meines Lebensraums. Und der Vulkan wurde zum Portal, durch das das Innerste an die Oberfläche gelangt. Der Berg an sich ist keine Verletzung des Erdmantels, sondern nur eine Form, in die er sich an einer bestimmten Stelle begibt. Der Vulkan hingegen ist die ewige Wunde – dort, wo die Verwundbarkeit und das ewige Aufbrechen der Kruste zum Prinzip werden, hieße zu heilen zu erlöschen. Wenn ich nicht selbst zu Stein werden wollte ob der Veränderungen meines Lebensraumes, musste ich vulkanisch werden, Wunde bleiben. Meine Höhle war ein Transitraum geworden. Noch bevor ich mich ganz in ihr eingerichtet hatte, verließ ich sie Richtung Erdmittelpunkt, durchschritt das Portal, ging dem Feuer entgegen. Neigte mich zu Boden und bat mit klopfendem Herzen um Einlass.
Lanzarote ist eine karge vulkanische Insel, an der sich der ohnehin geringe Niederschlag kaum abzuregnen vermag. Sechsunddreißig Millionen Jahre ist es her, dass die Kanaren durch unterseeische Ausbrüche zu wachsen begannen. Lanzarote durchstieß die Wasseroberfläche vor etwas mehr als fünfzehn Millionen Jahren. Seitdem streiten Wellen und Wind um das Land. Abseits touristischer Hotspots herrscht noch immer der Vulkanismus. Staubige Krater und Hügel bilden eine Landschaft zwischen Mars und Mond, die Besonderheiten des Bodens füllen zahlreiche Reiseführer. 1730 öffneten sich im westlichen Teil Lanzarotes verzweigte Eruptionsspalten, die sechs Jahre lang ausbrechen sollten. Beinahe ein Viertel der Insel wurde von Lavaströmen überzogen. Die dünnflüssige Lava floss in flachen Rinnen über das Land und erkaltete zuerst an der Oberfläche, sodass der Eindruck entstand, der Boden wäre bereits erstarrt. Doch die Lava rann in ihren Spalten weiter zum Meer, bis ihre Quellen versiegten und ein Hohlraum zurückblieb.
Zwischen 1968 und 1988 bewohnte César Manrique fünf solcher Höhlen, die durch Tunnel verbunden waren. Dieses Erdgeschoss aus schwarzem Basalt beherbergte auch sein Atelier. Seine Malereien wie aus der Erde geschnitten: Sie zeigen vulkanische Böden, durchzogen von Mineral- und Gesteinsbruchstücken, schwarze Lavaadern oder noch rot leuchtende Flüsse eben eruptierten Magmas. Darin eingeschlossen die Abdrücke und Überreste skelettierter, fremdartiger Körperteile.
In einem Film von Wolfgang Kwiattek sieht man Manrique an der Küste Lanzarotes umherstreifen, schwarzes Gestein stapeln, Kiesel ins Meer werfen, Felsen berühren. Manrique spricht von Lanzarote als Meisterin, die ihn das Sehen lehrt. Das genaue Hinschauen, die Lebendigkeit einer vermeintlich kargen Landschaft entdecken. Vielleicht sogar die Lebendigkeit eines Steins erkennen, denke ich, irgendwann. Ödnis ist keine Eigenschaft der Umgebung, es ist eine Zuschreibung des Auges, das verlernt hat, zu sehen, sagt Manrique. Als in den 1970er- und 80er-Jahren immer mehr Hotels gebaut wurden, sah Manrique sich mit einer Zukunft konfrontiert, in der er nicht leben wollte.
Er kam gerade aus New York, war mittlerweile überall bekannt und sehr erfolgreich. Seine Beziehungen in die Politik, die Beteiligung bei Protesten, seine Kunst selbst, die aus Lanzarote gemacht war und für sie, zeigten Wirkung. Manrique hatte das Unsichtbare sichtbar gemacht, den Boden geöffnet, und in seinen Klangspielen verriet sich die Gestalt des Passatwindes, der über die Insel streift. Er wohnte nicht nur in Lavahöhlen, er transformierte sie auch. Den Jameos del Agua verwandelte er von einer unterirdischen Müllhalde in einen Garten unter der Erde, mit einem Restaurant und einer Tanzfläche. Einige Meter entfernt eine weitere Höhle, ausgestattet mit dreihundert Stühlen – ein Konzertsaal. In der Cueva de los Verdes, nur einen Kilometer weiter, liegt der Eingang zu einem sieben Kilometer langen Lavatunnel, entstanden bei einem Ausbruch des Monte Corona vor dreibis fünftausend Jahren, der als einer der längsten Lavatunnel weltweit gilt und sich bis ins Meer erstreckt. Bei stündlichen Führungen lässt sich dieser Ort betreten, der früher als Fluchttunnel die Lanzaroteños verbarg, wenn Piraten und Plünderer die Insel überfielen.
Und noch etwas liegt unter der Erde Lanzarotes, leidlich mit dem Staub der Jahrhunderte bedeckt. Das Schicksal der Majos, der Ureinwohner der Insel. Menschen, deren Spuren zurückreichen ins 10. Jahrhundert vor unserer Zeit und die nach dem Abbruch der Beziehungen mit Nordafrika etwa tausend Jahre lang ohne Kontakt zur Außenwelt lebten. Vom Königreich Kastilien wurden die Majos und ihre Kultur im 15. Jahrhundert ausgelöscht. Nur wenige Funde gibt es, die heute Aufschluss über dieses Volk liefern könnten. Was Archäologen fanden: halb in die Erde gegrabene Wohngruben, die casas hondas – tiefe Häuser –, und den Sitz des Königs Luis de Guardafía, des letzten Herrschers der Majos, in einer Höhle.
1992, im Jahr seines Todes, dem Jahr meiner Geburt, malte Manrique Calor de la Tierra, »Erdwärme«, ein Dyptichon. Die Farbpalette reicht von blassrosa Ocker hin zu tiefrotem Magma. Rot war, neben dem Schwarz der Vulkanasche und dem Kalkweiß der traditionellen Häuser Lanzarotes, seine liebste Farbe.
Erst mit dem zweiten, dritten Lebensmonat entwickelt sich bei Babys die Fähigkeit, Farben zu unterscheiden. Aber wenn ich zeigen wollte, wie sich Geborgenheit anfühlt, würde ich auf Calor de la Tierra deuten und sagen, dass es Manriques Erinnerung ist an den Mutterleib: Rot wie die Wärme der Erde und die der Sonne. Nur eines kann der Druck mir nicht vermitteln, die Texturen seiner Malereien, die er mit einem Gemisch aus Holzleim, Sägespänen und Acrylfarbe erzeugte, durch das er die Strukturen der Erde und des Vulkangesteins auf die Leinwände brachte.
»Ich liebe das Leben sehr«, sagte er kurz vor seinem Tod. Ein Jahr nach seinem Autounfall wurde Lanzarote als weltweit erste Insel zum UNESCO-Biosphärenreservat ernannt. Neben dem Schutz der Landschaft steht die Nachhaltigkeit des Zusammenlebens der Menschen, Tiere und Pflanzen mit ihrem Lebensraum im Fokus dieser Regionen. Gerade dort, wo der Tourismus das Land zu stören droht, werden seltene endemische Arten langfristig geschützt. Allein die Flechte, die das Lavagestein als Erste besiedelt, zählt 180 verschiedene Arten. Und auch die künstlerische Arbeit in und an der Landschaft ist Teil dessen, was Lanzarote als Biosphärenreservat besonders macht. Dank César Manrique sind Werbeplakate und Strommasten verboten. Und in meiner Höhle aus Stein scheint mir Lanzarote, die steinerne Insel, wie das letzte Paradies.
Im Drama Fjalla-Eyvindur – etwa zu übersetzen mit »Eyvind aus den Bergen« – des großen isländischen Dramatikers Jóhann Sigurjónsson wird die Höhle, sobald sie von Menschen bewohnt wird, zur Hölle. Die zugrunde liegende Geschichte beruht auf wahren Ereignissen rund um den Ausgestoßenen Eyvindur Jónsson, der sich zwischen 1760 und 1780 mit seiner Frau Halla auf dem Lavafeld Ódáðahraun in Island versteckt haben soll, um seiner Strafe wegen eines ihm angelasteten Diebstahls zu entgehen. In Sigurjónssons Stück von 1911 wird der ortsfremde Eyvind unter dem Namen Kari als Aufseher auf einer Farm bei der wohlhabenden Witwe Halla angestellt. Doch der Bruder ihres verstorbenen Mannes enthüllt Karis Vergangenheit als gesuchter Verbrecher.
Die eigentliche Protagonistin in diesem Text ist jedoch die Landschaft. In dem um die fünfzig Kilometer langen, von kahlen Hügeln und zerklüfteten Tunneln durchzogenen Lavafeld – entstanden durch die großflächigen Ausbrüche des Vulkans Hveravellir – gibt es zahlreiche warme Quellen, Fumarolen, Solfataren, Geysire. Das in Boden und Gestein lagernde Wasser tritt entweder kochend oder als Dampf an die Oberfläche, manchmal durchsetzt von Schwefelgas oder als Fontänen, die in den Himmel stieben. Die Landschaft zeugt von lebendigen Felsen, von Hügeln, die ihre alte Einsamkeit vermissen, die zwischen Gletschern einen grünen Flecken Land umschließen und Menschen dort nicht dulden. Erst schicken die Hügel Sturm und Frost, dann Hunger, und schließlich ist die Not so groß, dass die Liebe zwischen den Menschen zu schwinden beginnt.
Eyvind mag eine literarische Figur sein, doch diese abgelegenen Lavalandschaften Islands sind für Ausgestoßene und Vogelfreie zum Lebensraum geworden. Die Lavahöhlen boten Schutz vor Wind und Wetter, in den zum Teil gänzlich unerforschten weitläufigen Lavatunneln konnte sich ein Mensch problemlos vor seinen Häschern verbergen. Und doch will Eyvind nicht leugnen, wie es um das Leben in den Lavafeldern bestellt ist.
Ich habe dir gesagt, wie schön es in den Hügeln sein kann, aber all die Schrecken habe ich dir nicht erzählt – die Sandstürme, wenn die ganze Ebene zu brennen scheint, die Nächte, die so lang sind wie ein ganzer Winter, und der Hunger, der sich wie ein böser Nebel an dich heranschleicht.
Halla und Eyvind fliehen nach der Enthüllung, richten sich ein in einer halb eingestürzten, fünf Meter hohen Lavahöhle, in der sie eine kleine Laube aus Stein errichten. Dahinter wird ein Bach von einem Gletscher gespeist, schlängelt sich durch eine Schlucht bis hin zur Höhle, wo er als Wasserfall ein ewiges Rauschen erzeugt. Es ist ein Leben in und aus Stein, für das vor allem Halla einen hohen Preis zahlt. Ihr erstes Kind, geboren auf der Flucht, hat sie im Eis zurücklassen müssen, als es kein Essen mehr gab und ihr der schnelle Tod gnädiger schien als das langsame Sterben. Sicher sind sie nie, weder vor Hunger noch vor Kälte oder vor den Männern, die ihnen auf der Spur sind, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.
Nach Jahren werden sie schließlich aufgespürt in ihrem steinernen Versteck – und aus Angst übergibt Halla auch ihr zweites Kind dem Tod. Als die Männer ihre Höhle stürmen, wirft sie das kleine Mädchen in den Abgrund einer nahen Klippe. Das Kind, das kaum gesprochen hat und dessen einzige Eigenschaft die Stille und das Sammeln kleiner Kiesel war.
Der letzte Akt des Dramas erzählt das Ende von Eyvind und Halla. Die beiden hausen allein in einer Hütte zwischen Felsen, es stürmt tagelang, und der Hunger und die Trauer um die verlorenen Kinder treiben einen Keil zwischen die Liebenden. Bis schließlich Halla zu gehen beschließt und in den Schneesturm hinaustritt. Der Sturm ist noch heute Teil des Ódáðahraun genannten Lavafelds, und viele Orte dort sind nach Eyvind benannt. Ein Hügel, eine Quelle, eine eingefallene Hütte und eine Höhle. Sein ganzer Lebensraum.
Die Verfilmung des Dramas aus dem Jahr 1918 ist bekannt für ihre beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Der Film wurde allerdings in Schweden gedreht, was sich spätestens in der Szene verrät, in der Eyvind von einer Klippe stürzt und für einige Augenblicke an ein paar Äste geklammert in der Luft hängt. Unter ihm eine baumbestandene Ebene bis zum Horizont.
Schon vor dem Mittelalter war das in weiten Teilen bewaldete Island großflächig brachgelegt. Was mit den Wikingern im 9. Jahrhundert begann, erfährt erst jetzt, da nur noch wenige Prozent Bewaldung vorhanden sind, eine Umkehrung. Die FAZ berichtet im Oktober 2023 von den Maßnahmen, Island seine Bäume zurückzugeben. Doch die karge Landschaft ist zum Aushängeschild der Insel geworden und zieht jedes Jahr beinahe zwei Millionen Touristen an. Island ist das Beispiel für Vulkanismus schlechthin, es gibt regelrechte Pilgerreisen zu den kleineren und weniger gefährlichen Eruptionen, in den Nachrichten wird immer wieder von Ausbrüchen berichtet, man sieht Menschen, Einheimische und Reisende in die Glut starren. Die Dualität von Feuer und Eis in der Edda-Dichtung ist den vulkanischen Gegebenheiten Islands zu verdanken, und so haben diese Naturereignisse Vorstellungen von Mythos und Identität entzündet.
Bei den zahllosen Ausbrüchen jedes Jahr scheint es, als wäre Island noch immer am Entstehen, als bilde es sich unentwegt neu. Dabei sitzt es auf zwei auseinandertreibenden Kontinentalplatten. Dass Island nicht langsam zerbricht, liegt an immer neuem magmatischen Material, das Richtung Oberfläche steigt.
Diese Zufluchtslandschaft Eyvinds kreuzte im Jahr 1908 auch die Schriftstellerin Ina von Grumbkow. Ihr Ziel war Ódáðahraun, das Lavafeld, in dem Eyvind sich verbarg, und das daraus aufragende Bergmassiv Dyngjufjöll – ein verschachteltes Vulkansystem, die Askja mit ihren Calderen, drei kesselförmigen vulkanischen Vertiefungen, die durch den Einsturz nah an der Oberfläche liegender Magmakammern oder infolge explosiver Eruptionen entstanden sind und sich mit Wasser gefüllt haben.
Ihre Reisebeschreibungen hatten in mir eine Gier nach der zeitlosen Kargheit Islands entfacht:
Nebel senkte sich, bald zu Regen verdichtet, auf uns herab. Rechts die stolzragende Felsenburg des Herdubreið schaute majestätisch auf uns nieder, in ihrer machtvollen Schönheit lockend, noch länger an ihrem Fuß zu ruhen. Auch von Süden sieht der Berg völlig uneinnehmbar aus, ein wundervolles Motiv für »Walhalls leuchtende Burg« einer Weltenbühne, auf der die Helden der Edda diese hehre Einsamkeit zu beleben scheinen. Träumen gleich umschweben sie uns hier, wo die Zeit seit Jahrhunderten stille zu stehen scheint.
Im Sommer zuvor war ihr Verlobter, der Geologe und Vulkanologe Walther von Knebel, im Kratersee des Askja verschollen. Mit dem Studenten Hans Spethmann und dem Maler Max Rudloff hatte er eine Forschungsreise angetreten. Von den drei Männern war nur Hans Spethmann zurückgekehrt, nachdem er das Lager verlassen gefunden hatte. Ein Jahr später wollten von Grumbkow und ihr Begleiter, der Geologe Hans Reck, Klarheit über die Todesursache gewinnen.
Weit wandern die Gedanken über Raum und Zeit, wenn der Körper in regelmäßiger Reitbewegung fast ohne eigene Anstrengung sich forttragen läßt und das Auge immer das gleiche Bild vor sich sieht, das durch keinen frischen Ton umstimmt. Und immer wieder kehren sie zurück zu der wilden Berglandschaft der Dyngjufjöll, die dort östlich fern von uns aus der Ódáðahraun emporragen. Sie arbeiten an dem Rätsel wie ein ernstes Schicksal sich erfüllte an jenen Beiden, von denen wir suchen, was noch zu finden sein könnte, und hoffen, bis die letzte Hoffnung versagt, die schon so matt wurde als sie Islands Weiten und Unmöglichkeiten zuerst erblickte.
Die Trauer schärfte ihre ohnehin beeindruckend klare Beobachtungsgabe. Vermutlich hätte Manrique seine helle Freude an von Grumbkows Beschreibungen der Solfataren von Reykjanes gehabt.
Das zersetzte Gestein und mineralische Niederschläge bilden mit ihren verschiedenartigsten Tönen wundervolle Muster, wie jene verblichener alter Seidenbrokate. Die tiefsten, wärmsten und die zartesten duftigsten Töne vereinigen sich in natürlichster Harmonie; Carmin, Preußisch Blau, Schieferfarben, Gelbrot, Zinnober, alle Ockertöne, Lichtgelb des Schwefels und helles Blaugrau der kochenden Schlammpfuhle schaffen mit wenig kurzem Gras und smaragdgrünem Moos, der einzigen Vegetation, aus dieser Einöde ein Paradies für das Auge.
Die Landschaft wirkt in ihrer reichen Kargheit tröstlich auf die Schriftstellerin. Nachdem mich der Anblick der entwaldeten Berghänge Thüringens so bestürzt hatte, fand auch ich Trost in einer Schilderung von Grumbkows, die mich besänftigte und mir den Verlust zur Aufgabe umformte:
Wenn das völlige Fehlen der Bäume nicht so überraschend auffiel, wie man erwarten dürfte, mag es seinen Grund darin haben, daß das Auge im Genuss unendlicher Fernsichten, welche die klare Luft Islands immer auf Meilen bietet, vollkommen Ersatz fand für diesen in den Einzelbildern der Nähe fehlenden Faktor. Hier fesselte das stundenlang sichtbare Ziel mehr als der Weg.





























