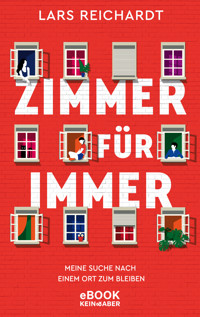
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klingt eigentlich idyllisch: kleines Häuschen am Münchner Stadtrand, sogar mit eigenem Garten. Dort wohnt Lars Reichardt mit wechselnden schrulligen Bewohnern in einer Zweck-WG: Birgit ist Insektenforscherin, Li ein junger modebewusster Chinese, Rudi ein in Österreich prominenter Rockvideoproduzent.
Welche Wohnkonzepte gäbe es noch für jemanden, der nicht in der Kleinfamilie oder als Single leben will? Diese Frage stellen sich heute viele Menschen angesichts überteuerter Mieten und zunehmender Vereinzelung. Lars Reichardt inspiziert verschiedene Modelle: eine in die Jahre gekommene deutsche Kommune in Italien, ein Mehrgenerationenhaus, ein Selbstversorgerdorf, das sozial gerecht und ökologisch nachhaltig wirtschaftet, eine Jesuiten-Kommunität, eine multikulturelle Wohnungsbaugenossenschaft, eine Zwei-Frauen-WG, die eint, dass beide mit demselben Mann verheiratet waren. Er spricht mit einem Architekten und mit einem Immobilienentwickler – all das, um sich und uns auf neue Ideen zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Lars Reichardt studierte Philosophie und arbeitet beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. 2018 erschien sein erstes Buch Barbara. Das sonderbare Leben meiner Mutter Barbara Valentin. Er lebt in München.
ÜBER DAS BUCH
Alles außer Sex – So lautet die Devise mancher Wohngemeinschaften, die in diesem Buch die Hauptrolle spielen.
Geschichten vom Zusammenleben jenseits vom Paar-, Familien- und Single-Dasein. Über Lebensabschnitts-Symbiosen, gemeinsames Alleinsein, Hippie-Kommunen, Witwen-WGs – und die hohe Kunst, gemeinsam Nudeln zu kochen. Ein inspirierender Ausflug in zukunftsweisende Wohnmodelle.
Für C. K.
1 KLEINSTER GEMEINSAMER NENNER
Meine Zweck-WG mit Astrid, Li und Mike
Ich lebe in einer Zweck-WG. In einem kleinen Reihenhaus im Münchner Süden mit einem winzigen Garten, ruhig nach hinten raus. Die Frau weg, Kinder aus dem Haus, mit der neuen Freundin lieber nicht zusammenziehen, die Unkosten teilen, und außerdem war ich an den Wochenenden ohnehin meist bei der Freundin oder auf Reisen für den Job – es sind pragmatische Gründe, die für eine Zweck-WG sprechen. Andere wären denkbar: zum Beispiel die Distanz, die man wahren kann. Man muss nicht sprechen in einer Zweck-WG, sich erklären, sich kümmern, sich sorgen, sich helfen. Man darf, wenn man will. Eine Zweck-WG ist eine modernere Version des Wohnheims.
Es gab Jan, meinen Freund und Kollegen bei der Zeitung, er rückte mit seiner Bettdecke und zwei Koffern an, als er die Streitereien mit seiner Freundin nicht mehr aushalten wollte. Er blieb ein Jahr, es war ein gutes WG-Jahr, das beste so weit. Wir kochten füreinander, wir kümmerten uns sogar eine Zeit lang gemeinsam um den verwilderten Garten. Wir redeten, wir schwiegen, Freunde eben. Jan ließ sich nach Berlin versetzen, zu seiner Tochter, er wollte nicht mehr pendeln. Er sagt, er vermisst mich. Ich ihn noch viel mehr. Das Wohnen mit Jan war eine Freundschafts-WG inmitten einer Zweck-WG.
Dann gab es Mike, einen Versicherungsagenten, seine Eltern stammten aus Togo. Als er vor der Tür stand, entdeckte ich den Rassisten in mir, der sich kurz fragte, was wohl die Nachbarn nebenan sagen würden. Niemand sagte später irgendetwas. Mike hatte einen Bandscheibenvorfall, arbeitete mehrere Monate nicht, und begann während seiner Krankschreibung eine Fortbildung. Er ging jeden Sonntag zur Kirche, arbeitete ehrenamtlich mit behinderten Kindern, aber wenn es um Astrid ging, kannte er kein Pardon, ihr verzieh er nichts. Astrid zog ein paar Monate nach ihm ein, sie veranstalte in der Küche angeblich bis spät nachts einen Heidenlärm. Er sagte: Mit der kann kein Mensch auskommen. Sie oder ich. Ich sagte: Mike, warum hast du sie nicht gebeten, leise zu sein? Er: Hab ich. Aber sie ist rücksichtslos. Wegen ihr bin ich bei meiner Prüfung durchgefallen. Ich: Das kannst du ihr doch nicht in die Schuhe schieben? Er: Doch. Drei Nächte habe ich wegen ihr kein Auge zugemacht. Ich kann es beweisen, dass sie der Grund ist. Und dann schickte er mir ein Foto seines Prüfungszeugnisses mit einer Sechs drauf.
Ich sollte vermitteln. Das Haus gehört mir, oder besser gesagt, mir und der Bank und der Ex-Frau, deren Anteil ich abstottere, aber das hieß nicht, dass ich hier den Friedensrichter spielen wollte, der zwischen verfeindeten Parteien vermittelte. Ich tat es trotzdem: Astrid, könntest du Mike nicht fragen, ob es ihm gerade passt, wenn du Obst in der Küche einkochst? Mike, könntest du nicht Astrid fragen, wenn du Pizza machen musst? Ich hatte keinen Erfolg. Mike schickte weiterhin Beweisfotos vom Chaos, das Astrid seiner Meinung nach in der Küche oder im Garten hinterließ. Einmal ging die Waschmaschine nicht mehr, Astrid baute sie auseinander, entdeckte irgendein Teil, das den Abfluss verstopft hatte, wusste aber nicht, wie man die Waschmaschine wieder zusammenbauen könnte. Mike schickte mir tagelang Fotos mit hasserfüllten Bildunterschriften, weil er nicht waschen konnte. Irgendwann erbarmte sich Jan, und baute die Einzelteile so ein, dass die Maschine wieder ging.
Nach der Waschmaschinenaffäre sprachen Mike und Astrid nicht mehr miteinander, sie grüßten sich nicht mehr und mieden einander in der Küche. Ich sagte, das ginge nicht, ich fände das unsozial, es war ihnen beiden egal.
Solche Geschichten kennt jede WG, manche versuchen Konflikte mit einer eigenen Hausordnung zu lösen, aber oft gibt irgendjemand auf und zieht aus. In diesem Fall war es Mike.
Ich hatte mich gegen das Gefühl von Jan und Mike für Astrid entschieden, als sie kam und sich vorstellte. Ich wüsste bis heute kein besseres Kriterium bei der Auswahl eines Mitbewohners als das Bauchgefühl. Es gibt Wohngemeinschaften, die mehrere Bewerber kennenlernen wollen, bei einem Abendessen, in einem Vorstellungsgespräch, um anschließend per Abstimmung zu entscheiden, einstimmig oder per Mehrheitsentscheid. So etwas erinnert mich an Bewerbungsgespräche beim Kindergarten. Ich wollte unbedingt, dass meine Kinder genommen würden, verstellte mich und gab sogar vor, es super zu finden, einmal im Jahr mit allen Kindern samt Kindergarteneltern ein Wochenende auf dem Bauernhof zu verbringen. Die Anspannung bei Vorstellungsterminen verhindert, dass man offen zeigt, wer man ist und für was man sich wirklich interessiert. Das erfährt man mitunter auch nicht nach Monaten des Zusammenlebens.
Ich entscheide jetzt immer nach meinem Bauchgefühl. Das stellt sich nach wenigen Sekunden ein, ich warte dann noch ein paar Minuten ab, bevor ich einem Bewerber zusage. Mein Bauchgefühl hat mich in Sachen Mitbewohner noch nie gänzlich getäuscht, auch wenn es später einige kleinere Reibereien mit Mike oder Astrid gab.
Mike wollte erst keine Miete mehr zahlen – »das sind asoziale Zustände hier« – und suchte sich bald darauf eine Wohnung mit seiner Freundin. Ich war erleichtert, Astrid ohnehin. Mikes Freundin war zuletzt jedes Wochenende zu Gast, es wurde einfach zu eng. Vor allem, als er noch eine andere Bekannte im Keller einquartierte, die zwar einen Job in München gefunden hatte, aber partout kein Zimmer. Drei Monate waren wir zu fünft plus Mikes Freundin. Fünf Leute lebten in fünf Zimmern, wenn man den Keller ohne Heizung als Zimmer bezeichnen darf, mit einem einzigen kleinen Bad und kleiner Küche. Für Notfälle gibt es in der Waschküche im Keller noch ein Klo.
Ich sage allen, ich wisse nicht, was ich mit dem Haus vorhätte, was ich mit meinem Leben vorhätte. Es könne sein, dass ich verkaufen wolle oder müsse. Ich würde ihnen mindestens drei Monate im Voraus Bescheid geben, falls sie ausziehen müssten. Ich bat, dass sie mich vier Wochen im Voraus wissen lassen würden, falls sie ausziehen wollten. Einen Monat Kaution verlangte ich anfangs. Nach sechs Monaten bat Astrid, doch die Kaution für die anstehende Miete einzubehalten, sie sei gerade knapp bei Kasse. Mike meinte bei Einzug, er könne das Geld gerade nicht aufbringen. Li, der nach Jan einzog, habe ich schon gar nicht mehr um eine Kaution gebeten.
Es gab noch jemanden, dessen Namen ich inzwischen vergessen habe. Er hatte sechs Monate Umgangsverbot mit seinem Sohn, der bei der Mutter aufwuchs, die ihn für einen Islamisten verlassen hatte. Weil er den Sohn nach einem Wochenende nicht pünktlich zurückbrachte und anschließend laut wurde. Er blieb fünf Monate und hinterließ einen Fleck auf dem Parkett, der von einem Sack verfaulter Kartoffeln stammte. Am Monatsende kündigte er fristlos und zog am nächsten Tag aus, um einen Job in der Schweiz anzunehmen, den er nicht antreten konnte, weil er an der Grenze bemerkte, dass man einen gültigen Ausweis braucht, um in die Schweiz zu reisen. Selbst auf diesen Mitbewohner blicke ich nicht im Zorn zurück.
Zu mir waren alle immer höflich und ich kam mit allen klar. Ich kann aber nie sicher sein, ob sie mich wirklich mögen oder ob das nur dem Umstand geschuldet ist, dass ich ihr Vermieter bin. Ich habe auch das größte und abgelegenste Zimmer im Haus, ich höre die anderen nicht, mich stört keiner.
Im Augenblick sind wir zu dritt. Li, Astrid und ich. Astrid kocht in einer bayerischen Kneipe. Aber sie kocht nicht für uns. Sie isst selten zu Hause, sondern meist in der Arbeit. Dafür mistete sie im ersten Jahr den Keller aus, fuhr alte Kinderklamotten in die weit entfernte Kirchengemeinde. Räumte den Werkzeugschrank auf. Ich bin ihr heute noch dankbar dafür, auch wenn sie den neu gewonnenen Stauraum gleich mit ihrem Zeugs auffüllte.
Astrid erzählte an einem der ersten Abende, dass sie mit dem Motorrad einmal quer durch die USA gefahren sei, immer wieder habe sie gestoppt und als Köchin gejobt, wenn ihr das Geld auszugehen drohte. Sie hat immer noch einige Freunde aus dieser Zeit, und manchmal telefoniert sie stundenlang mit ihnen. Sie kommt aus dem Umland von Bremen. Ihre Eltern besucht sie regelmäßig. Ich habe sie nie nach ihrem Alter gefragt, ich fürchtete, das könnte lange dauern, denn Astrid erzählt aussschweifend. Sie wird irgendwas zwischen Ende dreißig und Mitte vierzig sein. Es gibt zwei Männer in ihrem Leben: eine Jugendliebe im Norden und einen Motorradfahrer in den USA. Sie wusste nicht, für welchen sie sich entscheiden sollte, deswegen ist sie nach München gekommen. Sie wollte von beiden entfernt sein, um zu erfahren, wen sie mehr vermissen würde. Sie spricht mit beiden. Nach den Telefonaten ist sie oft so aufgekratzt, dass sie mit einem Glas Bourbon die Küche belagert und Kuchen bäckt, die sie auf ihrem Motorrad frühmorgens in die Kneipe bringt. Oder sie setzt Knochen für Suppen auf, das riecht dann im ganzen Haus. Ich hoffe für sie und uns, dass sie sich irgendwann mal entscheiden kann.
Astrid ist durch und durch öko, sie mixt ihr eigenes Waschpulver und auch eines für die Spülmaschine, das Mike und ich irgendwann nicht mehr verwendeten, weil das Geschirr schmutzig blieb. Sie kocht ein, Äpfel und Pflaumen aus dem Garten. Oder Schlehen und Hagebutten, die sie am See sammelt. Sie sammelt auch unseren Plastikabfall und entsorgt ihn gewissenhaft. Sie wirft so gut wie nichts weg, sondern verkauft unser kaputtes Zeug lieber bei eBay, verschenkt oder repariert es, wann immer möglich. Ich mag das an ihr, auch wenn es manchmal anstrengend wird, wenn sie über den Winter Dutzende leere Plastikbehälter und Marmeladengläser zum Einkochen für den Sommer sammelt und sie überall stapelt.
Dann ist da noch Li. Chinese, aufgewachsen in einer südlichen Provinz an der Grenze zu Vietnam, schwul. Hübscher Kerl, fast so groß wie ich, über 1,80, Anfang dreißig, Fashion-Opfer mit sicher einem Dutzend Sneaker, liebt Blumen. Nach Deutschland gekommen wegen seines Masterstudiengangs, den er in Leipzig absolviert hat, und weil er seinem Freund nahe sein wollte, einem Italiener aus Mailand. Aber das ist wohl vorbei, lange Wochenenden verbringt er inzwischen lieber in Berlin statt Mailand, und während Corona legte er Homeofficewochen in Sofia oder Leipzig oder Madrid ein. Er spricht nach vier Jahren in Deutschland immer noch kein einziges Wort Deutsch. Im Job redet er Englisch. Behördentelefonate übernehme im Zweifel ich für ihn.
Li ist ungefähr das Gegenteil von Astrid. Sie redet wie ein Wasserfall und ist genügsam. Er ist schweigsam, verschwenderisch, großzügig, selbstsicher und legt viel Wert auf sein Äußeres. Macht sich hübsch vor dem Ausgehen, kauft regelmäßig neue Klamotten, hat keine Bedenken vor Chemie, schluckt irgendwelche Muskelaufbaupräparate, geht ins Fitnessstudio, stemmt seit Corona Gewichte auf seinem Zimmer. Sie trägt ihre Lederjacke im Sommer wie im Winter und schminkt sich nie. Er trennt seinen Müll nicht, wenn er den Abfall überhaupt wegwirft, dann mit Sicherheit in den verkehrten Eimer. Obwohl er gut und leidenschaftlich gern kocht, holt er sich häufig eine Pizza. Er hat viele Freunde und Bekannte, Besuch bekommt auch er selten. Den Wäscheständer belegt er oft eine oder zwei Wochen lang, ohne sich je zu fragen, wo wir unsere Wäsche währenddessen aufhängen könnten. Nachts lässt er das Licht im Gang brennen. Er hat keine Angst vor Corona, meinte aber während des Lockdowns einmal, wenn der noch länger andauere, würde er sich umbringen.
Li und Astrid verstehen sich, natürlich, möchte ich fast sagen, nicht gut. Neulich kam sie aus dem Zimmer gestürzt und rief im Kommandoton, dass man in Deutschland nicht nach zehn Uhr dusche, sie müsse schließlich morgens um fünf raus. Es war halb elf und Li schrie zurück, woher er das wissen solle. Ich wurde auch laut und rief: »In diesem Haus darf grundsätzlich jederzeit geduscht werden.« Li sagte später: »Zuletzt hat mich meine Mutter so rumkommandiert. Da war ich fünf. Und im Internat war so ein Ton auch üblich.« Li und Astrid werden keine Freunde mehr. Dabei hat sie ihn gefunden, über einen Aushang in ihrer Kneipe. Sie hat ihn vorgeschlagen, ich habe nur zugestimmt. Ihr Irrtum.
Astrid vermutet, Li habe Aids und hätte uns das sagen müssen, sie will verräterische Tabletten in der Küche entdeckt haben. Aber sie fragt ihn nicht, ob ihre Vermutung stimmt. Ihr Englisch ist gut, aber sie hat nach der Duschaffäre die Lust verloren, mit Li zu reden. Ich denke, eine HIV-Infektion wäre allein Lis Sache und habe ihn bis heute nicht auf Astrids Verdacht angesprochen. Wenn überhaupt, werden es wohl ohnehin sogenannte Prep-Medikamente gewesen sein, mit denen man sich vor einer HIV-Infektion schützen kann.
In einer Zweck-WG muss man sich nichts Persönliches erzählen, und wir tun das auch kaum. Li war allerdings mal sechs Wochen zwischen zwei Jobs ohne Arbeit. Da putzte er das Haus und kochte für uns beide. Einmal sogar chinesische Teigtaschen, die machen eine unglaubliche Arbeit. Beim Essen erzählte er mir seine Geschichte: Einzelkind. Die Eltern bauen Obst und Gemüse selbst an, haben Hühner im Garten, sind längst in Rente. Einmal im Jahr versucht er sie zu besuchen, aber wegen Corona hat er sie nun zweieinhalb Jahre nicht gesehen. Die Mutter sagt, ein Besuch koste ihn doch so viel, das sei nicht nötig, er solle sich lieber um seine Karriere kümmern. Lis Mutter ahnt, dass er schwul ist, und fragt nicht mehr, wann er endlich heiraten wolle. Sie macht sich Vorwürfe, dass Li keine Freundin gefunden hat. Sein Vater weiß angeblich von nichts, Li hat nie mit ihm darüber gesprochen. Als Teenager ist Li auf eine Boarding School geschickt worden, hat dort unter der Woche geschlafen. Zum Studium ging er in die Provinzhauptstadt, seinen ersten Job bekam er in Peking. Marketing. Keinen Tag arbeitete er unter zehn, zwölf Stunden, der Sonntag wenigstens blieb frei. Er verliebte sich in einen italienischen Architekten, der für seine Firma nach Peking geschickt wurde. Als der nach Italien zurückbeordert wurde, wollte Li ihm nahe sein, zog nach Leipzig und machte seinen Master. Anschließend kam er nach München, erst für ein halbjähriges Praktikum, dann nahm er eine Anstellung im Marketing für ein Unternehmen an, das Luxus-Fahrradanhänger für bis zu 3000 Euro verkauft, Li sollte den Online-Auftritt aufmöbeln. Man spricht Englisch in der Firma. München ist ein Stück näher an Mailand, wo sein Freund lebte. Ein weiteres Plus der Stadt in seinen Augen: In der Isar schwimmen bunte Mandarin-Enten, die sich ein Leben lang treu bleiben und in China als Symbol der ewigen Liebe gelten. Der gemeine deutsche Erpel sei dagegen ein Vergewaltiger.
Der Freund ist vierzig Jahre alt, acht Jahre älter als Li. Seit zehn Jahren seien sie zusammen, aber Sex hätten sie schon lange nicht mehr. Meiner Freundin erzähle ich, wie romantisch ich es fände, dass sie sich treu blieben, obwohl sie keinen Sex miteinander hätten und sich so selten sehen könnten. Meine Freundin hält mich grundsätzlich für naiv. Ich halte meine Freundin für misstrauisch und leicht misanthropisch. Aber ein Jahr später bekomme ich von Li eine E-Mail, die ihr recht zu geben scheint: »Lieber Lars, ich schaffe es nicht, den Duschkopf zu wechseln. Kann es sein, dass er sich gar nicht abschrauben lässt? Das ruiniert mein Sexleben. Ich möchte nicht in die Details gehen, aber ich bin das, was man bei Schwulen Bottom nennt, im Deutschen sagt man dazu passiv. Ich bin darauf angewiesen, mich gründlich zu reinigen, dafür besitze ich einen eigenen Duschkopf, den ich anschrauben möchte. Was können wir tun?«
Ich mag meine Mitbewohner, auch wenn man vor solchen intimen Nachrichten nicht gefeit ist. Ich zähle sie nicht zu meinen Freunden, ich möchte ihnen auch nicht näher sein, als ich es bin, aber ich mag sie. Sie haben liebenswerte Schrullen und erträgliche Macken. Ich bin sicherlich auch nicht einfach.
Ich habe die Zweck-WG nicht nur wegen der geteilten Kosten gegründet. Ein Haus braucht Menschen, die öfter zu Hause sind als ich. Die den Briefkasten leeren und sich kümmern, wenn es irgendwo reinregnet. Wir vertrauen uns, keine Tür ist verschlossen. Ich weiß, die Miete kommt, auch wenn Li manchmal sechs Wochen lang vergisst, sie zu überweisen. Jeder putzt ein wenig, wir machen das ohne strengen Plan, und es funktioniert einigermaßen. Astrid putzt am meisten, ohne sich groß zu beklagen. Li hat freiwillig den Toilettenjob übernommen. Er ist sehr penibel beim Putzen. Ich habe ihm schon mehrmals angeboten, mit ihm zu tauschen. Er hat abgelehnt. Ich vermute, alles ist ihm lieber, als sich mit Astrid absprechen zu müssen.
Wir können uns in einem engen Rahmen aufeinander verlassen. Niemand bringt Liebhaber oder Liebhaberinnen unangemeldet mit, seit Jans Auszug ist das innerhäusliche Sozialleben auf ein Minimum heruntergefahren, so gut wie nie essen wir miteinander, in der Regel bleibt jeder für sich. Bisweilen lade ich Freunde oder Kollegen zum Essen ein. Li und Astrid tun das nie.
Niemand belästigt den anderen über die Maßen. Jeder verfügt über genügend Raum für sich. Eine Zweck-WG ist gar nicht so schlecht, meine Wohnsituation ist komfortabel, aber sie besitzt keine Perspektive. Wie lange werden Li und Astrid bleiben?
2 SYMMETRISCHE UND ASYMMETRISCHE BEDÜRFNISSE
Paare mit getrennten Betten
Vor einiger Zeit hörte ich die sonderbare Geschichte vom Freund einer guten Freundin, seit vierundzwanzig Jahren lebt seine Lebensgefährtin in einer anderen Stadt irgendwo in Deutschland. Er sagt, sie hätten nie ernsthaft daran gedacht zusammenzuziehen, auch kaum darüber geredet. Trotz drei Stunden Fahrt. Besuche in unregelmäßigem Wechsel, er öfter bei ihr als umgekehrt. Nicht immer nur am Wochenende, weil er frei arbeitet und flexibel ist. Meistens unangekündigt, er hat einen Schlüssel von ihrer Wohnung, sie von seiner. Er hat einen Stapel Klamotten zum Wechseln bei ihr, sie nicht bei ihm. Bei ihr sei das schwieriger, erzählt er, sie lege mehr Wert auf ihre Garderobe und brauche mehr.
Hört sich ganz ähnlich wie meine Geschichte an, nur dass ich nicht so weit von meiner Freundin entfernt wohnte – und dass es nicht so lange ging.
Vor Kurzem kam er in ihre Stadt, aber auch nach vierundzwanzig Jahren zogen sie nicht zusammen. Beide haben zuvor die Erfahrung gemacht, wie es sein kann, wenn man mit einem Partner zusammenlebt, bei ihm ging die Beziehung gleich in die Brüche. Er mag sich nicht erinnern, was genau damals der Grund gewesen sein könnte. Sie hat es ein paar Jahre lang ausgehalten, bis der aktuelle Freund kam und sie dem Vorgänger ausspannte. Jetzt sind beide überzeugte Anhänger des Nichtzusammenziehens.
Ihre Wohnung, sagt er, sei groß, geradezu riesig, biete aber keinen Rückzugsraum für eine zweite Person. Wenn einer fernsieht, hört der andere unweigerlich mit. Und sie wollen keinen Alltag teilen. Er will nicht mit ihr einkaufen gehen, will nicht warten, bis sie alle Tomaten auf dem Markt gründlich begutachtet hat, um sich endlich für eine zu entscheiden. Nein. Er isst gern, was sie kocht, sie kocht ja toll, aber das gemeinsame Einkaufen ist nicht seine Sache. Wenn sie sich streiten, dann geht es um solche Alltagsdinge, Blödsinn, Kleinigkeiten. Muss nicht sein. Er nahm die Wohnung im Stockwerk unter ihr. Das ist beiden nah genug. Sie wollten sich auch in Zukunft nicht jeden Tag sehen.
Eine irritierende Geschichte, wenn man – so wie ich eigentlich – findet, dass man mit einem geliebten Menschen selbstverständlich zusammenwohnen sollte. Diese Vorstellung mag altmodisch sein. Man hört jedenfalls immer öfter von Paaren, die nicht zusammenwohnen. Aus Überzeugung.
Im Grunde spricht ja auch alles gegen das Zusammenziehen: Die Marotten, die sich jeder im Laufe des Lebens zugelegt hat, man erträgt es einfach nicht, wenn der Partner das Besteck falsch rum in die Spülmaschine stellt oder den Rest Hühnerfrikassee vom Vortag frühstückt. Ein anderer Ordnungssinn, ein unterschiedlicher Musikgeschmack, nicht vereinbare Vorstellungen von Sauberkeit, unüberbrückbare Divergenzen bei der Suche nach einer gemeinsamen Einrichtung. Morgenmuffel wollen nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich das Reden vor dem ersten Kaffee verbitten. Meine Freundin stört sich daran, dass sie von mir die Zeitung nicht sauber gefaltet und in der richtigen Seitenabfolge überreicht bekommt. Im Alltagstrott ginge die Erotik flöten, ist eine weit verbreitete Befürchtung. Meine Freundin teilt die. Zuletzt Corona: Virologen und Soziologen äußerten die Vermutung, Deutschland sei auch deswegen vergleichsweise gut durch die erste Welle der Pandemie gekommen, weil es hierzulande mehr Einpersonenhaushalte als in den Nachbarländern gebe – und deswegen auch weniger Ansteckungsmöglichkeiten.
Die Erwägung, ob man zusammenzieht oder nicht, ist natürlich ein Wohlstandsphänomen. Alleinewohnen steht überhaupt nur ohne gemeinsame Kinder ernsthaft zur Debatte, und wenn beide Partner sich eine eigene Wohnung leisten können oder wollen. In Großstädten wie München oder Berlin ist das nur wenigen möglich. Andererseits macht der ständig komplizierter werdende Wohnungsmarkt das Zusammenziehen in einer gemeinsam gesuchten Wohnung zu einem unkalkulierbaren Risiko, im Falle einer Trennung haben beide das Nachsehen, wenn ein Einzelner sich die größere Wohnung allein nicht leisten kann und beide ausziehen müssen.
Unter der Woche allein wohnen und den Partner abrufbereit fürs Wochenende und die Freizeit zu wissen, liegt offenbar im Trend. Das ist ein neues Phänomen. Zumindest bei Beziehungen, die mehr sein wollen als eine lockere Affäre. Aber warum? Sind wir schwieriger geworden? Egoistischer? Haben wir mehr Macken bekommen und tun uns deswegen heutzutage schwerer mit dem Zusammenwohnen?
Ein Anruf bei Wolfgang Schmidbauer, dem bedeutenden und erfahrenen Paartherapeuten in München, der mit 80 Jahren schon von allen denkbaren Formen des Zusammmenlebens gehört haben muss. Seine eher beruhigende Antwort: »Ich würde nicht sagen, dass wir schwieriger geworden sind, aber individualisierter«, sagt er. »Und von Anfang an durch eigene Räume verwöhnt. Dass ein Kind ab einer gewissen sozialen Schicht ganz selbstverständlich ein eigenes Zimmer besitzt, das gab es früher überhaupt nicht. Früher hat man auch nicht im Hotel, sondern im Wirtshaus auf dem Matratzenlager geschlafen.«
Schmidbauer hält dieses Verlangen nach mehr Platz für kein Zeichen von zunehmendem Narzissmus. »Seit über narzisstische Störungen geforscht wird, zeigt sich kein sonderlicher Ausschlag nach oben. Von einem narzisstischen Zeitalter zu sprechen, halte ich für maßlos übertrieben.«
Okay. Alleinewohnen ist also ein Luxus, den man sich ohne schlechtes Gewissen leisten darf, wenn man ihn sich leisten kann.
Auch er sieht den triftigsten Grund für gemeinsames Wohnen von Paaren im Kinderwunsch: »Ihre Versorgung ist für einen einzelnen Erwachsenen zu stressig, zu zweit funktioniert das viel besser.«
Zu ihm kamen schon oft Paare ohne Kinderwunsch in die Therapie, die nach Jahren funktionierender Fernbeziehung zusammenzogen, aber ein halbes Jahr später nicht mehr miteinander klarkamen, wegen Streits über unterschiedliche Erwartungen oder weil der Sex litt.
Schmidbauers Erfahrung nach fällt älteren Paaren das Zusammenziehen tendenziell noch schwerer, weil sie nicht gut von alten Gewohnheiten lassen könnten und sich nicht mehr so viele Illusionen machten: »Das Schöne an Verliebtheit ist ja diese Idee, dass viel Zusammen auch viel Liebe ist. Früher konnte man den Grad der Verliebtheit an der Höhe der Telefonrechnung ablesen. Aber die symbiotischen Bedürfnisse sind selten symmetrisch: Einer will immer mehr zusammensein, und wie das Paar mit diesen unterschiedlich großen Bedürfnissen nach Freiraum umgeht, ist bei getrennten Wohnungen leichter regulierbar. Dabei bedeutet es ja nicht, dass einer weniger verliebt ist, nur weil er seine eigene Decke im Bett behalten will. Grundsätzlich gilt, dass Zusammmenziehen erst mal Konflikt bedeutet, und diesen Konflikt kann man leichter dadurch vermeiden, Montag früh in den ICE zu steigen, und sich unter der Woche wieder zu regenerieren und auf das Wiedersehen mit dem anderen zu freuen.«
Therapeuten raten Paaren eher nicht zu einer Entscheidung, sondern versuchen, Situationen zu klären, und hoffen, dass ihre Patienten selbst die Entscheidungen treffen, die für sie passen. »Beides hat seine Vor- und Nachteile, das Getrenntleben wie das Zusammenziehen«, sagt Schmidbauer. »Wenn ein Paar keine Kinder will und seine Unabhängigkeit bewahren will, dann finde ich es eine gute Idee, nicht zusammenzuziehen – gut im Sinne von brauchbar. Das Wichtige ist natürlich, dass beide das glauben. Wenn der eine unglücklich mit der räumlichen Trennung ist, weil er denkt, das zeige ja, dass man nicht wirklich verbunden sei, dann sollte man sich im Interesse der Beziehung überlegen, ob man es nicht zumindest einmal ausprobiert.«
Schmidbauer lebt seit fast vierzig Jahren mit seiner Partnerin zusammen; die beiden hatten aber nie ein gemeinsames Wohnzimmer, das ist ihr Trick: »Wir besuchen uns eben in der Wohnung, aber jeder hat sein eigenes Revier. Es ist ja auch schön, wenn man nicht die Umstände hat, sich erst ins Auto oder in den Zug zu setzen oder überhaupt erst ausgehfertig machen muss, um einander zu sehen«, sagt er.
Neulich erzählte jemand im Radio, dass jüdisch-orthodoxe Ehefrauen sich während der Menstruation in ihr eigenes Schlafzimmer zurückzögen. Der Beziehung einen regelmäßigen Rhythmus von Rückzug und erneuter Begegnung zu geben – und natürlich nicht nur sexueller –, ist eine schöne Idee. Gegenseitiges Bemühen und gemeinsam gefundene Rituale erschweren das Abdriften in gedankenlose Routine.
Das Paar mit den zwei Wohnungen übereinander hat die zweite Wohnung nach dem Umzug übrigens kaum benutzt. Er hätte jederzeit runtergehen und die Tür hinter sich zumachen können, allein das Wissen darum genügte den beiden wohl als Rückversicherung.
Ich bin eigentlich immer fürs Zusammenwohnen gewesen. Mit Frauen (wobei ich es erst mit einer versucht habe), mit Freunden, mit Kindern, eigenen und fremden. Nicht weil ich einen gemeinsamen Haushalt praktisch fände, das auch, nicht weil ich nicht allein sein wollte oder könnte, ich muss, immer wieder, aber ich kann das auch mit schreienden Kindern um mich herum, behaupte ich jetzt mal, denn es ist schon eine Weile her. Sondern wahrscheinlich, weil ich eben doch ein altmodischer Familienmensch bin, der seine Liebsten um sich herum wissen will, und tendenziell eher an Viel-zusammen-ist-gleich-viel-Liebe glaube. Aber meine Freundin wollte nicht, und inzwischen weiß ich nicht mehr, ob ich mich jetzt überhaupt noch trauen würde.
Muss es nicht mehr Möglichkeiten des Zusammenlebens außerhalb der klassischen Kleinfamilie oder einer Zweck-WG geben?
3 SONNTAGABEND BIS DONNERSTAGFRÜH
Möbliertes Zimmer bei Henno
Ich weiß gar nicht genau, warum ich zu Henno gezogen bin, Dankbarkeit ihm und seinen Kindern gegenüber war vielleicht ein Motiv, aber es war wohl vor allem eine Mischung aus Neugier und Trotz gegen all die Warner unter meinen Freunden. Auch meine Freundin, die zwar nicht mit mir zusammenziehen wollte, die mich aber in meiner aktuellen WG so gut wie nie besuchte, war sich sicher, dass es nicht gutgehen könne, wenn ich zu einem alten Mann zöge. Dabei mochte sie Henno.
Henno war damals 81 Jahre alt, herzkrank und schnell außer Atem, aber völlig klar im Kopf, als er seine drei Kinder fragte, was sie mit dem großen Haus anstellen wollten, sobald er irgendwann sterben würde. Das Haus liegt am Englischen Garten, in einer der wahrscheinlich teuersten Straßen Münchens, mit einem Garten rundherum. Alle Kinderzimmer im ersten Stock sehen eigentlich noch so aus, wie sie vor mehr als dreißig Jahren verlassen wurden, inklusive Setzkasten mit Nippes an der Wand, überfüllten Schreibtischschubladen, Strahlern an der Decke, wie sie vielleicht einmal in den Siebzigerjahren modern waren. Die Kinder – zwei Töchter, ein Sohn, Welf, mein Schulfreund – waren schon vor langer Zeit aus- und auch aus der Stadt weggezogen. Ich kannte die Familie, seitdem ich vor vierzig Jahren nach München gekommen war und Welf am Gymnasium kennengelernt hatte. Welf lebt heute seit über fünfundzwanzig Jahren in New York, als Musiker, er spielt Saxophon, hat zwei Bands, mit denen er in Clubs, aber auch in der U-Bahn spielt. Ich besuche ihn jedes Jahr. Genauer gesagt: Ich darf bei ihm wohnen, wenn ich für den Job dorthin muss. Wir sind heute bessere Freunde als zu Schulzeiten. Auch zu seinen Schwestern hatte ich immer wieder losen Kontakt, Babette lebt in Berlin, Julia in Tübingen.





























