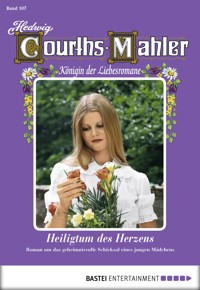0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der verwitwete Fürst Botho von Rastenberg bangt um das Wohlergehen seines einzigen Sohnes und Erben. Prinz Herbert ist ein zartes, anfälliges Kind, dessen Gesundheit stets große Sorge bereitet. Umso glücklicher ist der Fürst, als Schwester Maria auf Schloss Lehnsdorf eintrifft und sich fortan als Pflegerin um das Wohl des Prinzen kümmert.
Doch Schwester Maria plagt ein schwerer Schicksalsschlag. Erst kürzlich sind ihr Mann und ihre Tochter bei einem Schiffsunglück verschollen. Froh darüber, sich ablenken zu können, nimmt Maria sich des jungen Prinzen an als sei es ihr eigenes Kind. Das beeindruckt nicht nur ihren Pflegling, auch der Fürst selbst sieht in Maria mehr als eine Krankenschwester. Aber der Standesunterschied der beiden bereitet Maria große Sorge. Wenn sie doch nur wüsste, was das Schicksal für sie auf Schloss Lehnsdorf in den kommenden Jahren bereithält...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
ZUR LINKEN HAND GETRAUT
Copyright
First published in 1920
Copyright © 2019 Classica Libris
Zur linken Hand getraut
Schwester Maria hatte ihren Pflegling zur Ruhe gebracht. Sie neigte sich mit liebevollem Lächeln über das Bett des dreizehnjährigen Prinzen Herbert von Rastenberg und rückte ihm die Kissen zurecht. Er lächelte zu ihr auf und sagte: „Ich bin so froh, Schwester Maria, dass ich wieder gesund bin und mit Papa ausreiten darf! Das danken wir nur dir, Schwester Maria! Das sagt Papa auch.“
Er sah mit glücklichen Augen zu seiner Pflegerin auf, die noch einmal glättend über die Daunendecke strich.
Im selben Augenblick wurde die Tür geöffnet, und der Vater des Prinzen, Botho Fürst von Rastenberg, trat ein. Als sein Blick Schwester Maria traf, die von Prinz Herberts Lager zurücktrat, leuchteten seine Augen seltsam auf. Dann wandte er sich seinem Sohn zu und fasste mit warmem Druck die feste Knabenhand.
Der junge Prinz richtete sich in seinem Bett empor und fragte mit schmeichelnder Stimme: „Darf ich morgen Emir wieder reiten, Papa?“
Ein Freudenstrahl blitzte in den Augen des Fürsten auf.
„Gewiss! Und wenn du dich wieder so tapfer hältst wie heute, soll er dein Eigentum sein.“
„Oh, dann gehört er mir! Sieh, meine Hand, sie ist hart wie Stahl!“
Der Fürst umschloss die Knabenhand wieder mit der seinen. Und dann wandte er sich nach der Schwester um, die bescheiden zurückgetreten war.
„Haben Sie das gehört, Schwester Maria? Hart wie Stahl ist Herberts Hand.“
„Ja, Durchlaucht“, antwortete sie scheinbar ruhig. Aber ihre Lippen zuckten wie in verhaltener Erregung.
Der Fürst war bei der letzten Frage auf Schwester Maria zugetreten. Sein Blick heftete sich mit leuchtendem Ausdruck auf ihr schönes, stilles Gesicht.
„Sie haben ja teil an meinem Sohn, haben ihn mir neu geschenkt. Ohne Sie wäre er mir verloren gewesen“, sagte er, und tiefe Bewegung zitterte in seiner Stimme.
Ihr Blick senkte sich vor seinen strahlenden Augen.
„Durchlaucht bewerten meine Hilfe zu hoch“, wehrte sie bescheiden ab.
„Immer weisen Sie meinen Dank zurück“, sagte der Fürst mit leisem Vorwurf.
„Auch von mir lässt sich Schwester Maria keinen Dank gefallen, Papa!“, rief Herbert. „Aber wir zwei wissen genau, was sie für uns getan hat, nicht wahr?“
Der Fürst nickte seinem Sohn freundlich zu.
„Ja, Herbert, wir wissen es und werden es nie vergessen! Und je weniger sich Schwester Maria diesen Dank gefallen lässt, desto tiefer stehen wir in ihrer Schuld. Aber nun still, mein Sohn, Schwester Maria sieht mahnend nach der Uhr, es ist Schlafenszeit für dich. Gute Nacht, mein Sohn, schlafe gut!“
Er trat wieder an das Lager seines Sohnes zurück und beugte sich nieder, um ihn zu küssen.
Seit zwei Jahren schon weilte Schwester Maria auf Schloss Lehnsdorf. Die verstorbene Fürstin Rastenberg, Herberts Mutter, war eine geborene Gräfin Lehnsdorf gewesen, und durch die eheliche Verbindung mit ihr war Fürst Rastenberg Besitzer der reichen Grafschaft und dieses herrlichen Schlosses geworden.
Prinz Herbert war der einzige Erbe des Fürsten, und als solchem würden ihm einst nicht nur die Lehnsdorfschen Güter gehören, sondern er würde später auch Herr über die in Österreich gelegenen fürstlichen Besitzungen seines Vaters sein.
Fürst Rastenberg lebte schon seit Jahren fast ausschließlich auf Schloss Lehnsdorf. Er ging nur jedes Jahr einige Wochen nach Rastenberg, um dort nach dem Rechten zu sehen.
Seit fünf Jahren war Fürst Rastenberg verwitwet. Seine Gemahlin, eine zarte Erscheinung, war rasch an einer Lungenentzündung gestorben, die sie sich in Wien nach einem Hofball zugezogen hatte.
Auch Prinz Herbert war von Geburt an ein zartes, anfälliges Kind gewesen, dessen Gesundheit dem Fürsten stets große Sorge gemacht hatte. Als er im zehnten Lebensjahr stand – damals war die Fürstin bereits nicht mehr am Leben – begann Prinz Herbert zu kränkeln. Ohne dass man den Sitz des Leidens ergründen konnte, wurde er von Woche zu Woche matter und kraftloser. Die Ärzte waren ratlos und Botho Fürst von Rastenberg lebte in fortgesetzter Besorgnis, seinen Erben zu verlieren.
Auf den Rat eines Freundes berief er den berühmten Professor Bernd an das Krankenlager seines Sohnes.
Professor Bernd kam aus der herzoglichen Residenz nach Lehnsdorf und brachte gleichzeitig eine Krankenschwester mit, Schwester Maria.
Ihr vertraute er die Pflege und Beobachtung des Prinzen für die ersten Tage an, bis er in der Lage war, seine Diagnose mit Sicherheit zu stellen. Schwester Maria arbeitete schon längere Zeit in seiner Klinik, und er wusste, dass er sich unbedingt auf sie verlassen konnte.
Nach acht Tagen erklärte Professor Bernd, dass nur eines Prinz Herbert die Gesundheit wiedergeben könnte: eine Bluttransfusion.
Botho Fürst von Rastenberg hatte unbedingtes Vertrauen zu Professor Bernd. Sofort erklärte er sich bereit, sich selbst zur Verfügung zu stellen. Aber nach kurzem Überlegen schüttelte der Professor den Kopf. Er brauchte einen jugendlichen, lebenskräftigen Organismus.
Da sagte Schwester Maria: „Ich bin jung und kräftig und gern bereit, mich zur Verfügung zu stellen.“
Der Professor hatte sie prüfend, der Fürst zwischen Hoffen und Fürchten schwankend angesehen. Eine Weile herrschte Schweigen.
Der Professor musterte die jugendkräftige Gestalt der Schwester.
„Wollen Sie es wirklich tun, Schwester Maria?“ fragte er.
„Ja, Herr Professor.“
„Gut, Schwester, ich bin einverstanden – die Erlaubnis des Fürsten vorausgesetzt.“
Die Bluttransfusion wurde kurze Zeit darauf vorgenommen.
Zwei Jahre waren seitdem verflossen. Prinz Herbert war ein kräftiger, gesunder Knabe geworden, der sich mit jedem Atemzug des neu geschenkten Lebens freute. Schwester Maria wurde, nachdem sie sich von dem Blutverlust erholt hatte, die Pflege des jungen Prinzen übergeben.
Voll Hingebung, jeden Dank zurückweisend, pflegte sie den Prinzen, und dieser hing bald mit rührender Liebe an der schönen, sanften Freundin, die ihn so unermüdlich umsorgte. Und als er dann endlich das Bett verlassen konnte, wollte er nichts davon hören, dass Schwester Maria wieder von ihm ging.
Fürst Rastenberg selbst wünschte, seinen Sohn auch fernerhin der Obhut der bewährten Pflegerin anzuvertrauen, die ja für seinen Sohn mehr als eine Pflegerin geworden war und an dem verwaisten Knaben wirklich Mutterstelle vertrat.
„Du und ich, wir gehören zusammen! Du bist mir wie eine zweite Mutter geworden, und du darfst nie wieder fortgehen von mir“, hatte der junge Prinz damals gesagt, und über das schöne Gesicht seiner Pflegerin war ein halb wehmütiges, halb glückliches Lächeln geglitten.
Dieses Lächeln lag auch jetzt auf ihrem Gesicht, als sie am Fenster ihres Zimmers stand und in den alten Schlosspark hinaussah, über dem der Mond stand. Aber unvermittelt verschwand das Lächeln und machte einem traurigen Ausdruck Platz. Wie ein tiefes, namenloses Leid lag es jetzt auf ihren Zügen.
Ein schmerzlicher Seufzer hob ihre Brust.
„Ich muss fort – ich darf nicht länger hier bleiben“, sagte sie vor sich hin. Und in einen Sessel sinkend, barg sie das Gesicht in den Händen.
Sie gedachte der Vergangenheit, die ihr so vieles schuldig geblieben war und ihr auch das genommen hatte, was sie als Glück empfunden und besessen hatte. Sie dachte daran, wie sie mit müder, wunder Seele zu Professor Bernd gekommen war, nur noch mit dem einzigen Bestreben, ihr Leben dem Dienst der Kranken zu weihen. Langsam hatte sie den Frieden wiedergefunden.
Und dann kam sie nach Lehnsdorf.
Neben der mütterlichen Liebe zu Prinz Herbert zog da langsam ein ungewolltes und doch so mächtiges Gefühl in ihre Seele. Im täglichen Verkehr mit Botho Fürst von Rastenberg lernte sie diesen zuerst verehren in seiner menschlichen Güte und seiner vornehmen, großzügigen Art. Seine aufopfernde Liebe für seinen Sohn rührte sie, seine ritterliche Gesinnung bestrickte sie. Und so sehr sie sich dagegen wehrte – eines Tages erkannte sie, dass sie den Fürsten liebte.
Aber diese Erkenntnis machte sie nicht froh, sie schaffte ihr nur Pein. Wie ein Unrecht erschien ihr diese tiefe Zuneigung, sie verstand sich selbst nicht, verstand nicht, dass ihr Herz noch fähig war, Liebe zu empfinden nach allem, was sie durchlebt und durchlitten hatte. Und wohin hatte sich diese neue, gewaltig auf sie eindringende Liebe verirrt? Fürst Rastenberg stand unerreichbar über ihr, so weit wie da draußen die bleiche Mondsichel über dem Park. Was sollte ihr diese Liebe? Hatte sie nicht schon Schmerzen genug durchlitten?
Wie zum Schutz gegen diese Liebe beschwor sie die Vergangenheit herauf. Nach einer Weile sprang sie wieder empor und streckte die Hände wie abwehrend aus.
Ich muss fort aus diesem Haus, wo mich das Leben so freundlich und verlockend anlacht. Ich darf nicht mehr bleiben, darf mich nicht in diesen süßen Frieden einlullen lassen. Hinaus in Kampf und Arbeit muss ich wieder, damit ich vergessen lerne!
So dachte sie, ruhelos auf und ab gehend. Plötzlich blieb sie stehen und sah starr vor sich hin.
Morgen Vormittag rede ich mit dem Fürsten und sage ihm, dass ich zu Professor Bernd zurückgehe.
Dieser Entschluss machte sie endlich ruhiger. Langsam nahm sie die weiße Haube ab, sodass ihre starken goldbraunen Haare sichtbar wurden.
Aufatmend strich sie über die Stirn und öffnete das Fenster, um die heiße Stirn von dem würzigen Frühlingswind kühlen zu lassen. Vom Licht hell beleuchtet, stand sie im Rahmen des geöffneten Fensters.
Sie ahnte nicht, dass unter ihrem Fenster im Schatten der Bäume Fürst Rastenberg auf und ab ging und nun, durch das Öffnen des Fensters aufmerksam gemacht, zu ihr empor sah.
Er blieb stehen und ließ seine Augen auf der hübschen Erscheinung ruhen.
Wie schön war sie doch! Schön und gut, mutig und opferfreudig, und dabei doch so stolz in ihrer Bescheidenheit! Er liebte sie, ja er liebte sie! Er, der gereifte Mann! Würde sie auch seine Hand ausschlagen, ruhig und bestimmt, wie sie jedes seiner Dankesworte abwehrte? Was sein Sohn Herbert wohl sagen würde? Oh, der würde sie mit Freuden Mutter nennen, denn sie war ihm eine Mutter gewesen in all der Zeit. „Nicht Schwester Maria – Mutter Maria müsste sie heißen“, hatte Herbert eines Tages zum Fürsten gesagt. Seit jener Stunde wusste er, dass er sie liebte.
Am nächsten Vormittag ließ Schwester Maria den Fürsten um eine Unterredung bitten. Er empfing sie sofort in seinem Arbeitszimmer. Als sie eintrat, schob er ihr sogleich einen Sessel zurecht.
„Bitte, nehmen Sie Platz, Schwester Maria, und sagen Sie mir, was mir das seltene Vergnügen verschafft“, sagte er freundlich.
Als sie sich niedergesetzt hatte, nahm er ihr gegenüber Platz.
Sie schlang die Hände zusammen und holte tief Atem. Dann sagte sie, ohne die Augen zu heben: „Durchlaucht gestatten mir wohl, dass ich nun wieder zu Professor Bernd in meine frühere Tätigkeit zurückkehre? Prinz Herbert ist gottlob wieder so kräftig, dass er meiner Pflege nicht mehr bedarf und ich hier überflüssig bin.“
Fürst Rastenberg hatte Mühe seine Ruhe zu bewahren. Der Wunsch Schwester Marias, Schloss Lehnsdorf zu verlassen, traf ihn völlig unvorbereitet.
„Nein, nein, Schwester Maria! Das kann, das darf Ihr Wunsch nicht sein!“, erklärte er entschieden. „Was ist denn geschehen, dass Sie von Lehnsdorf fort verlangen? Fehlt es Ihnen an irgendetwas? Haben Sie irgendwelche Wünsche? Sagen Sie es mir, sie sollen sofort erfüllt werden.“
Es zitterte eine verhaltene Erregung in seiner Stimme, die Maria nicht entging. Sie hob abwehrend die Hand und schüttelte den Kopf.
„O nein“, sagte sie dann, „mir bleibt hier nichts, gar nichts zu wünschen übrig. Durchlaucht sind sehr gütig. Mir fehlt hier nichts als die Gewissheit, dass ich wirklich noch nötig bin, dass meine Hilfe gebraucht wird. Das ist aber nicht der Fall. Ich hätte schon viel früher in meinen alten Pflichtenkreis zurückkehren müssen, aber – ich gestehe offen – ich habe mich davor gefürchtet. Der Entschluss, mich von Prinz Herbert trennen zu wollen, wurde mir schwer.“
Die letzten Worte sprach sie sehr leise. Fürst Rastenberg hatte sich erhoben und ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Dann blieb er am Kamin stehen und stützte den Arm auf den Sims. Seine Augen suchten das Antlitz Marias. Nie war sie ihm schöner, nie begehrenswerter erschienen wie in diesem Augenblick. Er atmete tief auf, und in seiner Stimme klang eine tiefe Erregung, als er begann: „Sie sagen, Ihnen fehle nichts als die Gewissheit, dass Ihre Anwesenheit hier noch nötig ist. Haben Sie diese Gewissheit wirklich nicht mehr, Schwester Maria? Wissen Sie nicht, dass Sie hier in Lehnsdorf walten wie ein guter Engel? Ich kann mir unser Leben ohne Sie nicht mehr denken.“
Sie schlang die Hände fest ineinander, als brauche sie einen Halt. „Durchlaucht messen meiner Anwesenheit auf Schloss Lehnsdorf eine allzu hohe Bedeutung bei. Wenn ich fortgegangen bin, wird es sich bald genug zeigen, dass ich keinerlei Lücke hinterlassen habe.“
Der Fürst schüttelte den Kopf.
„Das können Sie selbst nicht glauben! Seit dem Tag, da Sie Professor Bernd nach Lehnsdorf brachte, ist es wie ein stiller Segen von Ihnen ausgegangen. Sie schenkten mir meinen einzigen Sohn, meinen Erben, neu, durch Ihre aufopfernde Tat! Ich weiß es wohl, Sie wollen nichts davon hören. Aber einmal lassen Sie es mich aussprechen! Seit jenem Tag sind Sie mir so nahe gerückt wie kein anderer Mensch auf Erden außer meinem Sohn. Ich kann es nicht fassen, dass Sie an eine Trennung denken. Fühlen Sie nicht, dass Sie zu uns gehören? Ich glaubte immer, Ihre Liebe zu Herbert – ich weiß doch, dass Sie ihn lieb gewonnen haben wie eine Mutter – würde Sie hier festhalten. Und nun kommen Sie und sprechen von Trennung! Haben Sie dabei gar nicht an Herbert gedacht?“
Schwester Marias Gesicht war bleich geworden.
„Durchlaucht sollten mich nicht so quälen – mir die Trennung noch schwerer machen, als sie ohnehin schon ist“, sagte sie tonlos. „Gewiss gehe ich nur blutenden Herzens von meinem Pflegling. Aber einmal muss es doch geschehen, und darum ist es besser, es geschieht jetzt – so bald wie möglich!“
Sie schwieg wie erschöpft.
Wieder schritt der Fürst erregt einige Male im Zimmer auf und ab. Mit einem plötzlichen Entschluss blieb er vor ihr stehen.
„Schwester Maria“, sagte er mit mühsam beherrschter Stimme. „Sie dürfen nicht von uns gehen, es darf nicht sein!“
Sie sah mit seltsam glanzlosen Augen in sein erregtes Gesicht.
„Es muss sein, Durchlaucht“, erwiderte sie dann klanglos.
„Nein, es muss nicht sein“, fuhr er fort, „es muss nicht sein, wenn Sie es nicht wollen. Bleiben Sie, Maria – bleiben Sie bei uns, bei Herbert und mir. Nicht nur für meinen Sohn bitte ich, ich bitte auch für mich selbst. Ich habe Sie lieb gewonnen, Maria, mit der ganzen Innigkeit und Tiefe des gereiften Mannes. Bleiben Sie bei uns als Herberts zweite Mutter – als meine Gattin!“
Schwester Maria sprang auf. Ihre Hände streckten sich aus, als suchten sie nach einem Halt, und sanken dann kraftlos herab.
„Durchlaucht, es kann, es darf nicht sein!“, stieß sie hervor.
„Warum nicht, Maria? Gewiss, ich bin in Ihren Augen ein alter Mann – und dennoch, dennoch hoffe ich, mir Ihre Liebe erringen zu können.“
Sie sah ihn mit einem Blick an, der sein Herz lauter schlagen ließ.
„Durchlaucht, ich will ganz offen sein in dieser Stunde. Es soll auch nicht der Schatten einer Unwahrheit zwischen uns stehen“, sagte sie mit vor Erregung zitternder Stimme. „Deshalb will ich ehrlich bekennen, dass ich von Lehnsdorf fort will, weil mein Herz sich einer tiefen, starken Liebe erschlossen hat – zu Eurer Durchlaucht – allen Vernunftgründen zum Trotz, und weil ich mit dieser Liebe im Herzen nicht länger in Lehnsdorf bleiben darf, ohne mich selbst zu verlieren.“
Der Fürst trat mit aufleuchtendem Blick auf sie zu und wollte sie an sich ziehen. Sie aber schüttelte traurig den Kopf und trat einen Schritt zurück.
„Durchlaucht, es darf nicht sein!“, sagte sie leise.
„Es darf nicht sein? Und Sie sagen doch selbst, was mich namenlos beglückt, dass Sie mich lieben.“ „Durchlaucht vergessen den großen Standesunterschied.“
Der Fürst machte eine abwehrende Bewegung: „Danach frage ich nicht. Ich bin gottlob ein Fürst ohne Thron, ich bin mein freier Herr und habe auch niemanden zu fragen. Herberts Mutter, die ich ehrlich lieb hatte, ist mir zu früh genommen worden. Aber sie hat mir den Erben geschenkt, den die Tradition meines Hauses fordert. Das macht mich frei, ganz nach meinem Herzen eine zweite Gattin zu wählen. Und meine Wahl fällt auf Sie.“
„Durchlaucht, Sie wissen ja so wenig von mir.“
Ein Lächeln glitt über sein Gesicht.
„Genug, um Ihnen meine Hand anzubieten.“
„Durchlaucht wissen nicht, dass ich schon einmal verheiratet war, dass ich Witwe bin.“
Er sah sie betroffen an. „Verheiratet! Sie waren verheiratet? Nein, Maria, das wusste ich nicht.“
„Nach zweijähriger Ehe habe ich meinen Mann verloren – zugleich mit meiner kleinen Tochter. Denn ich war auch Mutter.“
Maria war sehr bleich geworden, als sie das sagte, dann sank sie kraftlos in ihren Sessel zurück.
Der Fürst sah sie voll inniger Teilnahme an. „Sie scheinen Schweres erlitten zu haben, bitte, vertrauen Sie mir, sagen Sie mir alles!“, bat er herzlich.
Sie strich sich über die Augen.
„Ja, Durchlaucht sollen meine ganze Vergangenheit erfahren.“
Voll aufrichtiger Teilnahme lauschte Fürst Rastenberg Schwester Maria, als sie aus ihrem Leben zu erzählen begann. Schon in früher Jugend hatte sie beide Eltern verloren. Da sie ohne alle Mittel dastand, sah sie sich vor die Aufgabe gestellt, früher als andere Mädchen sich durch Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen. In Professor Bernd, einen Freund ihres verstorbenen Vaters, hatte Schwester Maria einen väterlichen Berater gefunden, der es ihr ermöglichte, den Beruf einer Krankenpflegerin zu ergreifen.
„Kurz ehe ich in der Klinik Professor Bernds fest angestellt werden sollte, kreuzte ein alter Jugendfreund von mir meinen Lebensweg. Joseph Raimund, so hieß er, war nach Vollendung seiner Studien für ein paar Jahre ins Ausland gegangen, wo er als Ingenieur tätig gewesen war, und nun kehrte er zurück, um mich zu fragen, ob ich hinfort sein Leben mit ihm teilen wolle. Er hatte in Florida ein Engagement unter anscheinend günstigen Verhältnissen gefunden und konnte nun einen eigenen Hausstand gründen.
Meine Freude war groß, als ich ihn wiedersah, und als er die Frage an mich stellte, ob ich gewillt sei, mit ihm in die Fremde zu ziehen, da überlegte ich nicht lange, sondern reichte ihm frohen Herzens meine Hand zum Bund fürs Leben. Ich war damals zwanzig Jahre alt und voll glückseliger Hoffnungen.
Aber die Sorge ließ nicht lange auf sich warten. Denn von den glänzenden Versprechungen, die meinem Mann gemacht worden waren, gingen nur wenige in Erfüllung, so dass wir in den beiden Jahren unserer Ehe schwer zu kämpfen hatten. Aber was bedeutet das für zwei junge Menschenkinder, die in Liebe einander zugetan sind? Wir hofften auf eine bessere Zukunft, und ich entsinne mich noch heute des Tages, als mein Mann mit der frohen Nachricht heimkehrte, er habe in Kanada bei einem großen Unternehmen eine Stellung gefunden, die uns aller Not entheben würde.“
Schwester Maria hielt einen Augenblick inne und strich, in Gedanken verloren, mit der Hand über die Stirn, dann fuhr sie fort:
„Als mein Mann und ich mit un [...]