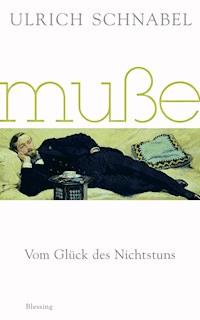16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gemeinsinn – die Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts
Klimawandel, Pandemien und Verschwörungsdenken stellen unsere Gesellschaft vor eine enorme Zerreißprobe. Um sie zu meistern, braucht es nicht mehr Technik oder Wettbewerb, sondern die Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts: Gemeinsinn. Diese vergessene Tugend ist in uns allen angelegt, wie sich in psychologischen Experimenten oder dem Beispiel von Stammesvölkern zeigt. Doch es braucht den richtigen politischen Rahmen, um sie wieder zu stärken. Bestseller-Autor Ulrich Schnabel verwebt Erkenntnisse aus Anthropologie und Sozialpsychologie, Ökologie und Ökonomie – und zeigt, warum Gemeinschaft Leben verlängert, wie Kooperation gelingt und warum individuelle Freiheit nur in Gesellschaften gedeihen kann, die einen gemeinsamen Konsens finden.
„Ulrich Schnabel ist ein großer Wurf gelungen – berührend und klug, analytisch und anschaulich liefert er Antworten auf die Zukunftsfrage der Menschheit: Wie gelingt die kollektive Krisenbewältigung im Geist der Freiheit und wie die Kooperation ohne Zwang?“ Bernhard Pörksen, Autor von »Die Kunst des Miteinander-Redens«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Unzählige Ratgeber verkünden die Botschaft der Selbstoptimierung, geben Tipps für individuelle Stärke, Kreativität oder Gelassenheit – ganz so, als ließen sich solche Eigenschaften unabhängig vom sozialen Umfeld verwirklichen. Dabei ist es gerade die Fähigkeit zum sozialen Miteinander und zur Kooperation, die den Erfolg der Spezies Mensch ausmacht. Nicht umsonst lässt sich der sensus communis (lat.) ebenso als »Sinn für die Gemeinschaft« übersetzen wie auch als »gesunder Menschenverstand« (common sense).
An diesem Gemeinsinn fehlt es heute vielfach: Die westlichen Demokratien kämpfen mit gesellschaftlicher Polarisierung, mit populistischen Strömungen und mit abnehmendem Zusammenhalt. Doch Krisen wie die Corona-Pandemie, der Klimawandel oder der Ukraine-Krieg führen uns immer wieder vor Augen, wie sehr wir alle zusammenhängen und dass wir solche Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen können.
Dieses Buch plädiert daher für eine Wiederentdeckung des Gemeinsinns. Ulrich Schnabel fragt nach den Bedingungen, die ihn fördern, beschreibt den Unterschied zwischen Schwarmdummheit und -intelligenz und erklärt, warum gerade die Idee des freien Individuums zwingend auf Demokratie und eine stabile Gemeinschaft angewiesen ist. Dabei finden sich im Buch immer wieder leichtfüßige Zwischenspiele, die originelle Ideen vorstellen oder konkrete Tipps und Anregungen für das eigene Verhalten bereithalten.
Über Ulrich Schnabel
Ulrich Schnabel, geboren 1962, arbeitet seit vielen Jahren für DIE ZEIT als Wissenschaftsredakteur. Er studierte Physik und Publizistik in Karlsruhe und Berlin und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet; etwa mit dem »Georg von Holtzbrinck-Preis« für Wissenschaftsjournalismus und dem »Werner und Inge Grüter-Preis« für Wissenschaftsvermittlung. Sein Buch »Die Vermessung des Glaubens« wurde als »Wissenschaftsbuch des Jahres 2009« prämiert. Weitere Bücher wie »Muße. Vom Glück des Nichtstuns« (2010) oder »Zuversicht. Die Kraft der inneren Freiheit« (2018) wurden Best- und Longseller. Der Autor lebt mit seiner Familie in Hamburg.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrich Schnabel
Zusammen
Wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Selbsttest: Welcher Lesetyp bin ich?
Einleitung: Was wir von den Mammutbäumen lernen können
Eine Meditation für »Ich-Länder«
Kapitel 1: Wie Unmögliches möglich wird — Von der erstaunlichen Kraft der sozialen Energie
Der Mut des Wir
Ein Medikament namens Zuneigung
Die soziale Energie
Warum man sich selbst nicht kitzeln kann
Die Weisheit der Vielen
Schwarmintelligent oder schwarmdumm?
Der Mythos vom einsamen Genie
Die Kraft der großen Sache
Das Konversationsdinner
Vorschlag für ein Fragenmenü
Kapitel 2: Von Feuer- und Wasserwesen — Was moderner Gemeinsinn heute bedeutet
Im Zeitalter der Krisen und Katastrophen
Das Boot mit den 193 Kabinen
Das vergiftete Erbe der Nazis
Der erodierende Grundkonsens
Wie man einen Begriff entstaubt
Wie man emotionale Konflikte löst
Ein Gespräch mit dem Schweizer Konfliktberater Daniel Remigius Auf der Mauer
Kapitel 3: Zwischen Egoismus und Hilfsbereitschaft — Wovon gemeinschaftliches Handeln abhängt
Das Missverständnis der Eigensüchtigkeit
Die paradoxe Wirkung von Katastrophen
Was im Superdome wirklich geschah
Maria und Josef im Ghetto des Geldes
Das gemeinsinnigste Volk der Welt
Wo ist mein Platz im Schwarm?
Kapitel 4: Unsere »ultrasoziale« Natur — Wie man am Du zum Ich wird.
Der Mittelpunkt des Universums
Das Tier, das »Wir« sagt
Warum Affen nicht kochen
Kaspar Hausers Geschwister
Die Wirkung der Isolation
Die Angst vor dem Abgeschnittensein
Die offene Schleife
Sozialer Schmerz – und was dagegen hilft
Wir Gesellschaftsindividuen
Vom Glück des Alleinseins
Kapitel 5: Das Ich und die Anderen — Wie Identität entsteht und warum sie so umkämpft ist
Der innere Kosmos
Die Suche nach dem »wahren« Gesicht
Welcher Typ bin ich?
Der Eignungstest der Offiziersanwärter
Das Zusammenleben der Stachelschweine
Innen- und außengeleitete Typen
Warum das Gendersternchen so polarisiert
Die Erfindung der Identitätskrise
Das ist meine Musik!
Das Ich in Bewegung
Wie man den eigenen Kompass ausrichtet
Kapitel 6: Die Gefahren der Gemeinschaft — Konformismus, »Groupthink« – und wie man ihnen begegnet
Wie brave Bürger zu Mördern werden
Konformität im Experiment
Die Gefahr des »Groupthink«
Warum wir anderen folgen
Die emotionale Ansteckung
Onkel Walters Schande
Die Macht des Mainstreams
Wie man Gruppendruck widersteht
Vom »Bystander« zum »Upstander«
Kapitel 7: Die Kraft von Netzwerken — Warum wir mehr bewirken, als wir denken
Der Hippie, der die Welt veränderte
Wie wird aus einem Funken ein Feuer?
Zeitgeist und gesellschaftliche Regimes
Warum Kinderkriegen ansteckend ist
Die Verbreitung des Glücks
Wie Veränderungen gelingen
Die Theorie der Kipp-Punkte
Die Kette unserer Kontakte
Schwache und starke Bindungen
Warum man keine Mehrheit braucht
Mein persönliches Netzwerk
Kapitel 8: Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit — Vom der Spaltung der Gesellschaft und wie man sie verhindert
Welches Spiel sehen Sie?
Die Seuche der Infodemie
Der Scheinwahrheitseffekt und andere Denkfehler
Was Buchdruck und Internet gemein haben
Die Armee der Internet-Trolle
Wie man mit Fake News umgeht
Die »neutralen« Meinungsmacher
Was tun gegen digitale Abhängigkeit?
Leuchttürme des Vertrauens
Wie man Fake News und Verschwörungstheorien kontert
10 Tipps zum Umgang mit Desinformation
Kapitel 9: Eine Ökonomie des Gemeinwohls — Was sind wir uns gegenseitig wert?
Der arme Millionär
Die Wut auf »die da oben«
Lasst mich mehr Steuern zahlen!
Der Glaube an den eigenen Verdienst
Von Würde und Anerkennung
Was man ökonomisch tun könnte
Eine Wirtschaft mit Sinn
Wie hilft mein Geld am meisten?
Kapitel 10: Vom kleinen Wir zum großen Wir — Für eine neue Politik des Gemeinsinns
Der Gartenzwerg als nationales Problem
Die rettende Nachbarin
Vom »nahen Bauern« zum digitalen Nachbarn
Wie »soziales Kapital« vermehrt wird
Wer vertraut – und wer misstraut
Warum Gemeinsinn in der Kita beginnt
Paläste für das Volk
Die Negativspirale umkehren
Die Tragik der Allmende
Warum es auf uns alle ankommt
Himmel und Hölle
DANK
Anmerkungen
Einleitung
1. Wie Unmögliches möglich wird
2. Von Feuer- und Wasserwesen
3. Zwischen Egoismus und Hilfsbereitschaft
4. Unsere »ultrasoziale« Natur
5. Das Ich und die Anderen
6. Die Gefahren der Gemeinschaft
7. Die Kraft von Netzwerken
8. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit
9. Die Ökonomie des Gemeinwohls
10. Vom kleinen Wir zum großen Wir
Erläuterungen
Impressum
Selbsttest: Welcher Lesetyp bin ich?
Gemeinsinn hat viele Seiten, und vielleicht fragen Sie sich, welche davon für Sie am wichtigsten ist. Denn es ist nicht leicht zu entscheiden, welche Aspekte des sozialen Zusammenlebens haupt- oder nebensächlich sind. Alles ist miteinander verwoben – auch in diesem Buch. Die Kapitel beinhalten ständig Bezüge und Querverweise, und ihre Reihenfolge ist nicht zwingend vorgegeben. Sie können im Prinzip überall beginnen und nach Belieben hin und her springen. Falls Sie jedoch gerne eine Empfehlung hätten, welches Kapitel am ehesten Ihren Interessen entspricht, hilft der folgende Test:
»Ich bin Individualist und habe das Gefühl, dass ich dieses Buch eigentlich gar nicht brauche. Warum sollte ich es lesen?
Die Antwort finden Sie in Kapitel 5.
»Ich bin Gruppenmensch. In Gemeinschaft erlebe ich eine ganz besondere Energie. Wie kommt das? Antworten gibt es in Kapitel 1.
»Ich brauche erst einmal eine klare Orientierung. Was ist mit »Gemeinsinn« überhaupt gemeint? Beginnen Sie mit Kapitel 2.
»Gutmenschengesülze geht mir auf die Nerven! Wohin das Ideal der »Volksgemeinschaft« führt, wissen wir seit der Nazizeit. Wie begegnet man den Gefahren des Kollektivs? Lesen Sie Kapitel 6.
»Ich brauche hard facts. Mich überzeugen nur wissenschaftliche Belege und Studien. Gibt es die zum Thema »Gemeinsinn« überhaupt?
Sie finden sie in Kapitel 3.
»Ich will vor allem eindrückliche Geschichten und berührende Beispiele lesen. Die geben mir mehr als wissenschaftliche Studien.
Da empfiehlt sich Kapitel 7.
»Gibt es in diesem Buch auch praktische Tipps? Am Ende zählt doch vor allem die Frage: Was kann ich tun?
Lesen Sie die kleinen Zwischenkapitel.
Natürlich können Sie auch ganz normal von vorn beginnen …
Für uns alle
Einleitung: Was wir von den Mammutbäumen lernen können
Das Erstaunlichste an Mammutbäumen ist nicht ihr Ehrfurcht einflößendes Alter und auch nicht ihre schiere Größe. Zwar können sie mehrere Tausend Jahre alt und über 100 Meter hoch werden; den Weltrekord mit 115 Metern hält derzeit der Küsten-Mammutbaum Hyperion im Redwood-Nationalpark in Kalifornien. Doch das eigentliche Mysterium dieser Riesen liegt unter der Erde. Denn die Redwoods bilden, anders als man erwarten würde, keine tiefen Wurzeln. Als Flachwurzler treiben sie ihre unterirdischen Ausläufer nur etwa einen Meter in die Tiefe. Wie schaffen es die Giganten dennoch, ihre gewaltige Masse und Größe auszubalancieren und über Jahrhunderte hinweg so stabil zu stehen, dass ihnen selbst Erdbeben und starke Stürme nichts anhaben?
Das Geheimnis lautet: Kooperation. Unter der Erdoberfläche strecken die Bäume ihre Wurzeln so weit aus, bis sie die Wurzeln benachbarter Redwoods erreichen.1 Haben sie sich gefunden, verbinden sie ihr Wurzelwerk dauerhaft miteinander. Sie haken sich gewissermaßen unter, stützen und stabilisieren sich gegenseitig und können so gemeinsam die größten Stürme überstehen. Selbst kleine Mammutbäume werden auf diese Weise ins Wurzel-Netzwerk aufgenommen und gehalten. Die wahre Stärke dieser Riesen entspringt also ihrem (unsichtbaren) Zusammenhalt, sie hängt an ihrer Fähigkeit, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen.
Was uns die Bäume demonstrieren, ist nichts anderes als die Kraft des Gemeinsinns: die Fähigkeit, sich als Teil eines großen Netzwerkes zu begreifen und sich darauf auszurichten. Das heißt, nicht nur das eigene Wohl, sondern auch das der anderen im Blick zu haben – was letztlich alle stärker macht. Klingt nach einer einfachen Lektion. Die aber scheint in der heutigen Zeit leicht in Vergessenheit zu geraten.
Denn in westlichen Gesellschaften halten wir nicht die Verbundenheit hoch, sondern die persönliche Freiheit. Das moderne Individuum versteht sich weniger als Teil eines Netzwerks denn als Solitär; es sucht sein Glück tendenziell auf eigene Faust, statt gemeinsam mit anderen. Unzählige Ratgeber verkünden die Botschaft der Selbstoptimierung, geben Tipps zum individuellen Aufbau von Stärke, Kreativität oder Gelassenheit – ganz so, als ließen sich solche Fähigkeiten unabhängig vom sozialen Umfeld verwirklichen. Und in der Regel lernt man schon in der Schule, sich im Konkurrenzkampf zu behaupten; denn in der modernen Leistungsgesellschaft gelten diejenigen als erfolgreich, die die Nase vorn haben und exorbitante Gewinne einstreichen – was zu sozialer Ungleichheit und langfristig zur Zersetzung des demokratischen Zusammenhalts führt.
Kurzum: Der Gemeinsinn ist in der Krise. Die Bereitschaft, sich für das gemeinsame Wohl aller einzusetzen, scheint bei vielen Menschen heute weniger ausgeprägt zu sein als bei einem Mammutbaum. Nahezu alle westlichen Demokratien erleben das Bröckeln des Zusammenhalts und kämpfen mit gesellschaftlicher Polarisierung. Länder wie die USA, die als weltweite Demokratie-Vorbilder galten, sind mittlerweile innerlich so zerrissen, dass sich politische Parteien und ganze Bevölkerungsgruppen spinnefeind gegenüberstehen – was eine konstruktive Politik unmöglich macht und letztlich allen schadet.
Auch in Deutschland macht sich eine zunehmende Tendenz zur Polarisierung bemerkbar; einst stabilisierende Institutionen – wie die großen Volksparteien, Kirchen oder Gewerkschaften – verlieren stetig an Mitgliedern. Dafür erleben wir den Aufstieg radikaler Kräfte, die mit teils kruden Anschauungen und Argumenten den bisherigen gesellschaftlichen Konsens infrage stellen.
Zugleich sehen wir uns immer neuen Krisen und Katastrophen gegenüber, die uns zum gemeinsamen Handeln geradezu zwingen: der Klimawandel, die Corona-Pandemie, der Krieg gegen die Ukraine – lauter Herausforderungen, die niemand allein bewältigen kann und die deutlich machen, wie unauflöslich wir miteinander verbunden sind, im nahen wie im fernen Umfeld.
Dabei ist die behagliche Distanz früherer Zeiten unwiderruflich passé. »Wenn hinten, weit, in der Türkei / Die Völker aufeinander schlagen«, so kümmerte das im 18. oder 19. Jahrhundert kaum jemand. »Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus / Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; Dann kehrt man abends froh nach Haus / Und segnet Fried und Friedenszeiten«, so legte es Goethe im Faust einem braven Bürger in den Mund, worauf ein zweiter antwortet. »Ach ja Herr Nachbar, ja, so laß ichs auch geschehn: Sie mögen sich die Köpfe spalten, / mag alles durcheinandergehn: Doch nur zu Hause bleibs beim alten!«2
Heute aber bleibt zu Hause nichts beim Alten. Ein ferner Krieg wie etwa in der Ukraine hat in der globalisierten Welt unmittelbare Auswirkungen auf Energie- und Lebensmittelpreise, auf Lieferketten und Migrationspolitik. Eine ähnliche Lektion in Sachen Verbundenheit erteilte uns die Corona-Pandemie: Ein scheinbar weit entfernter Ausbruch im chinesischen Wuhan stellte binnen Kurzem das gewohnte Leben hierzulande auf den Kopf. Und selbst eingefleischte Individualisten, die den Mainstream verachten und das Kollektiv ablehnen, mussten plötzlich erleben, wie wenig sie sich vom allgemeinen Geschehen abkoppeln können, wie sehr ihre persönliche Freiheit von der Virenlast und dem Verhalten ihrer Mitbürger abhing – und dass eine Pandemie sich am Ende nur gemeinsam bekämpfen lässt.
Die Corona-Krise hat dabei nicht nur allerlei bürokratische und technische Schwächen offengelegt, sondern noch etwas viel Tiefliegenderes: Sie hat den naiven Glauben an unsere Unabhängigkeit erschüttert, an die gängige Überzeugung, wir seien ausschließlich selbst zuständig für das Schmieden unseres Glückes. Spätestens in der Krise, so haben wir gemerkt, hämmern viele Schmiede mit an unserem Glück, hängt unser Schicksal mit dem unserer Mitmenschen unauflöslich zusammen. Nicht umsonst leitet sich der Begriff »Gemeinsinn« vom lateinischen sensus communis ab, was sich als »Sinn für die Gemeinschaft« übersetzen lässt, aber auch als »gesunder Menschenverstand« (englisch common sense).
Gut möglich, dass spätere Generationen den Doppelschock von Pandemie und Ukraine-Krieg als Zäsur einstufen: als jene historische Phase, in der ein übersteigerter Individualismus an sein Ende gelangte und jene verschüttete Fähigkeit wiederentdeckt wurde, die mit dem schönen alten Wort Gemeinsinn beschrieben wird. Denn diese Fähigkeit, auch das werden künftige Generationen im Rückblick sagen, hat sich als zentrale Kompetenz zur Bewältigung der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erwiesen: Weil sich Viren, Umweltprobleme und Klimawandel nicht an Landesgrenzen hielten, erforderte ihre Bewältigung eine nie da gewesene Form weltweiter Kooperation; weil politische Spannungen die Welt an den Abgrund eines Atomkriegs führten, mussten zähneknirschend Friedensverhandlungen geführt werden; und weil Energie- und Rohstoffressourcen sich als endlich herausstellten, war irgendwann die Erkenntnis unausweichlich, dass die Menschheit gemeinsam mit diesem Planeten haushalten muss – wenn sie denn überleben will.
Klingt zu schön, um wahr zu sein? Nur ein naiver Traum von einer besseren Welt, der im realen Klein-Klein der Tagespolitik gnadenlos geschreddert wird? Sicher, momentan scheint eine solche Vision von globalem Gemeinsinn weit entfernt; ähnlich unrealistisch, wie, sagen wir, im 18. Jahrhundert die Abschaffung der Sklaverei oder – Gott behüte! – im 19. Jahrhundert die verrückte Idee, dass Frauen eines Tages gleichberechtigt sein könnten und selbst wählen dürften. All diese Visionen wurden anfangs verlacht, für unrealistisch oder gar für Naturgesetz-widrig erklärt – bis sie schließlich eines Tages doch Wirklichkeit und allmählich zu Selbstverständlichkeiten wurden.
Die Wende zu einer gemeinsinnigeren Gesellschaft könnte sogar schneller gehen, als viele sich heute vorzustellen vermögen. Denn der Druck der Herausforderungen wird uns kaum eine andere Wahl lassen, als alle Kräfte zu mobilisieren, derer wir als menschliche Gemeinschaft fähig sind. Selbst wenn die Corona-Krise oder der Ukraine-Krieg eines Tages nur noch ungute Erinnerungen sein werden, wird die Liste der Krisen und Katastrophen nicht abreißen. Zu groß sind die Instabilitäten im politischen, ökonomischen und ökologischen System, als dass wir auf eine baldige Rückkehr zu entspannten Zuständen hoffen dürften. Eher sollten wir uns darauf einstellen, dass sich die Auswirkungen von Klima- und Umweltproblemen verschärfen, dass die weltpolitischen Spannungen andauern, dass die komplexer werdende (digitale) Technik unsere Infrastruktur anfällig für Störungen macht – und dass uns zusätzlich auch immer wieder jene Krisenszenarien überraschen werden, die der Statistik-Philosoph Nassim Nicholas Taleb »Schwarze Schwäne« genannt hat:3 Geschehnisse jenseits des Erwartungshorizonts, deren Auftreten wir für undenkbar halten, bis wir plötzlich mit ihrer Existenz konfrontiert werden; etwa ein Erdbeben unter einer Millionenstadt wie San Francisco, ein Reaktorunfall mit Kernschmelze, ein auf die Erde zurasender Asteroid … »Es gibt vermutlich«, sagt der Risikoforscher Ortwin Renn, »eine Million extrem seltener Ereignisse mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million; das heißt, dass jedes Jahr mindestens eines davon eintritt. Wir wissen nur nicht, welches.«4
Auf solche Unwägbarkeiten kann man sich natürlich vorbereiten, indem man den Vorratskeller (falls vorhanden) auffüllt, einen Notfallkoffer packt und all die anderen Dinge berücksichtigt, die einschlägige Behörden empfehlen.5 In Ländern wie den USA tendieren viele auch dazu, sich zu bewaffnen, um Haus und Hof mit Gewalt zu verteidigen. Die bessere Vorsorge aber ist die Stärkung des Gemeinsinns, sowohl im eigenen nachbarschaftlichen Umfeld (denn das sind jene Menschen, die einem im Notfall zuerst helfen können) als auch in der Gesellschaft insgesamt (weil das die Gefahr gesellschaftlicher Konflikte am ehesten minimiert). Anders gesagt: Was einem in Krisenzeiten wirklich hilft, sind soziale Beziehungen. Diese in ruhigen Zeiten aufzubauen und zu pflegen, ist, so gesehen, die beste denkbare Investition.
Dieses Buch spürt deshalb den verschiedenen Aspekten des Gemeinsinns nach, fragt nach den Bedingungen, die ihn fördern oder beeinträchtigen, beschreibt den Unterschied zwischen Schwarmintelligenz und Schwarmdummheit und erklärt, warum gerade die Idee des freien Individuums zwingend auf eine stabile Gemeinschaft und demokratische Strukturen angewiesen ist. Dabei finden sich neben den großen, inhaltsschwereren Kapiteln immer wieder kurze Zwischenkapitel, die eher leichtfüßig sind, originelle Ideen vorstellen oder konkrete Tipps und Anregungen für das eigene Verhalten bereithalten.
Ein besseres Verständnis des common sense hilft uns nicht nur in Krisenzeiten, sondern bereichert auch unseren Alltag. Viele Tätigkeiten machen schlicht mehr Freude, wenn wir sie gemeinsam mit anderen Menschen unternehmen – das gilt für das Arbeiten ebenso wie fürs Essen, miteinander Reden oder Feiern. Denn als soziales Wesen braucht der Mensch kaum etwas so sehr wie andere Menschen. Doch ein solch positives Zugehörigkeitsgefühl fehlt heute vielen. Als Nebenwirkung des Individualismus erleben wir eine regelrechte Epidemie der Einsamkeit. Das zeigt, dass unser Glück nicht nur von finanziellem Wohlstand abhängt, sondern mehr noch von ideellen Faktoren: von Beziehungsreichtum, Zeitwohlstand, Erfahrungen von Liebe und Sinn – alles Dinge, die mittel- oder unmittelbar mit dem Erleben von Gemeinsinn und gegenseitiger Verbundenheit einhergehen.
Es wird Zeit, sich ein Beispiel an den Mammutbäumen zu nehmen.
Eine Meditation für »Ich-Länder«
»Kein Mensch ist eine Insel, begrenzt in sich selbst …«
Rund 400 Jahre alt sind diese Zeilen, doch sie hallen bis heute nach. Der englische Dichter John Donne, ein Zeitgenosse Shakespeares, schrieb sie 1623 in seinen Andachten über auftauchende Gelegenheiten.6 Er musste damals eine schwere Krankheit bewältigen und verfasste regelmäßig schriftliche »Meditationen«, in denen er unter anderem den Gemeinsinn mit der poetischen Insel-Metapher umschrieb. Der wahre Zauber dieser Formulierung entgeht einem allerdings in der deutschen Sprache: Im englischen Original des 17. Jahrhunderts schrieb sich das Wort Island – Eiland, Insel – nämlich noch als »iland«.7 Und dadurch entsteht ein genialer Doppelsinn: Die Zeile »No man is an iland« lässt sich dann auch lesen als: »Kein Mensch ist ein Ich-Land«.
Das passt geradezu prophetisch zur Moderne der iPhones, iClouds und i‑Irgendwas: In einer Zeit des radikal vermarkteten Wunsches nach Einzigartigkeit erinnert uns John Donne aus der Tiefe der Zeit daran, dass wir alle zusammenhängen und niemand nur im »Ich-Land« lebt.
Kein Mensch ist eine Insel, begrenzt in sich selbst;
jeder Mensch ist ein Stück vom Kontinent, ein Teil aus dem Ganzen;
Wird ein Erdkloß weggewaschen vom Meer,
so ist Europa kleiner, wie wenn’s ein Vorgebirge wäre,
wie wenn’s das Haus deiner Freunde wäre oder dein eigenes;
jedermanns Tod macht mich geringer,
denn ich bin verstrickt ins Schicksal aller.1
Kapitel 1: Wie Unmögliches möglich wird
Von der erstaunlichen Kraft der sozialen Energie
Stellen Sie sich eine Organisation vor, die rund um den Globus aktiv ist – aber keinerlei wirtschaftliche Ziele verfolgt; der es weder um Profitmaximierung geht noch um politischen Einfluss; auch religiöse Ansichten sind ihr einerlei: Atheisten sind bei ihr ebenso willkommen wie Christen, Buddhisten, Zoroaster oder die Mitglieder irgendwelcher Sekten. Einziges Kriterium zur Teilnahme ist der aufrichtige Wunsch, seine Erfahrungen mit anderen zu teilen und sich offen auszutauschen. Niemand verpflichtet die Mitglieder zu irgendetwas, dennoch empfinden sie ihre Teilnahme an den regelmäßigen Treffen als extrem wertvoll. Ach ja, und kostenlos ist das Ganze auch noch.
So etwas gibt es nicht, sagen Sie? Eine wirklichkeitsfremde Utopie? Keineswegs. Die Organisation existiert seit fast neunzig Jahren. Sie ist derzeit in 180 Ländern aktiv, hat über 118 000 Filialen, einige Millionen Mitglieder und ist das vielleicht beste Beispiel für die enorme Kraft, die aus der Begegnung mit anderen Gleichgesinnten entstehen kann. Ihr Name: Anonyme Alkoholiker (AA).
Vielleicht zucken Sie jetzt zurück: Warum beginnt ein Buch über Gemeinsinn ausgerechnet mit den Anonymen Alkoholikern? Weil ihre Bewegung in verschiedener Hinsicht höchst bemerkenswert ist. Zum einen existiert sie, ohne dass es eine feste Institution mit Chefs und Hierarchie gibt; nahezu alle Tätigkeiten werden ehrenamtlich übernommen und niemand profiliert sich in der Öffentlichkeit als oberster AA‑Vertreter (was auch mit dem Stigma dieser Suchtkrankheit zu tun hat). Dass das Prinzip dennoch seit fast einem Jahrhundert funktioniert, kann man als Beweis werten, dass der anarchistische Traum einer selbstbestimmten, hierarchiefreien Gemeinschaft möglich ist, wenn das Anliegen allen Mitgliedern nur wichtig genug ist.
Zum anderen ist die AA‑Bewegung ein starkes Beispiel für die Kraft der sozialen Unterstützung: Denn das wirksamste Therapeutikum im Kampf gegen den Alkohol ist die Gemeinschaft der Alkoholkranken selbst; auch fern der Heimat, im Urlaub oder auf Reisen, findet sich in nahezu jeder größeren Stadt eine AA‑Gruppe, zu der »Zugehörige« zwanglos dazustoßen können. Die Erfahrung, dass andere mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und die Tatsache, dass man sich in den Gruppen ehrlich und ungeschminkt offenbaren kann, jenseits aller Rollen und Hierarchien – was normalerweise in Gesellschaft kaum möglich ist –, hat eine enorm unterstützende Wirkung. Dabei entsteht nicht nur ein Verbundenheitsgefühl unter Menschen, die sich sonst oft als Außenseiter erfahren; zugleich wird aus einer scheinbar individuellen Suchtkrankheit eine gemeinschaftliche Herausforderung.
Denn das Zwölf-Schritte-Programm, nach dem sich alle AA‑Gruppen richten,1 beginnt mit dem Eingeständnis, »dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind – und unser Leben nicht mehr meistern konnten«; danach formuliert es den Glauben, »dass eine Macht, größer als wir selbst, uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann«. Wie genau diese Macht aussieht, wird gar nicht näher beschrieben. Zwar ist teilweise von »Gott« die Rede, allerdings immer mit dem Zusatz »wie wir Ihn verstehen«. Wer mag, kann sich darunter auch eine kosmische Lebensenergie, die buddhistische Leerheit, die Natur oder was auch immer vorstellen – irgendeine Kraft, die »größer als wir selbst« ist; und ihren sichtbarsten Ausdruck findet diese Kraft im Zusammenkommen in der Gruppe.
Das hat wissenschaftlich nachweisbare Wirkung: Obwohl in den AA‑Gruppen keine Therapeuten sitzen und die Mitglieder sich im Wesentlichen nur gegenseitig von ihren Erfahrungen erzählen, ist die Teilnahme an solchen Gruppen effektiver als eine professionelle Psychotherapie. Zu diesem Ergebnis kommt eine Übersichtsarbeit der Stanford University, die das Programm der AA‑Gruppen mit entsprechenden Therapieangeboten verglich. Darin wurden insgesamt 27 Studien mit 10 565 Teilnehmern ausgewertet. Ergebnis: ein Jahr nach Absolvierung des 12-Schritte-Programms waren 42 Prozent der Teilnehmer der AA abstinent, während es ein Jahr nach einer professionellen Therapie (etwa einer kognitiven Verhaltenstherapie) nur 35 Prozent waren. Aus Sicht der Forscher ist der Effekt vor allem darauf zurückzuführen, dass die Anonymen Alkoholiker weiter an den Treffen der AA‑Gruppen teilnehmen, während die Wirkung einer Psychotherapie nach deren Abschluss immer mehr verblasst.2 Und weil es so effektiv ist, arbeiten mittlerweile viele andere Suchtabhängige nach dem AA‑Prinzip, von den »Anonymen Spielern« über die »Anonymen Sexsüchtigen« bis zu den »Anonymen Arbeitssüchtigen«.
Der Mut des Wir
Wieso kann sich sozialer Kontakt als so hilfreich erweisen? Weshalb kann man sich, um ein afrikanisches Sprichwort zu zitieren, das helfende Wort nicht selbst sagen? Warum braucht es die Gemeinschaft anderer, um uns jene Kraft zu geben, die wir allein nicht aufbringen würden?
Solche Fragen sind nicht nur für Alkoholiker essenziell, sondern für alle, die vor scheinbar unüberwindlichen Herausforderungen stehen. Wieso wirken Bedrohungen schwächer, wenn wir ihnen gemeinschaftlich begegnen, erscheinen Berge kleiner, wenn wir sie zusammen mit anderen besteigen? Weshalb empfinden wir Schmerzen als geringer, wenn wir sozialen Beistand haben? Und warum kommen wir gemeinsam mit anderen auf kreative Lösungen, die uns allein nie einfallen würden?
Diese Fragen führen ins Zentrum unseres gemeinschaftlichen Daseins. Denn keine andere Spezies zeichnet sich so sehr durch ihren sozialen Sinn aus wie die Gattung Homo sapiens; wir sind, wie Verhaltensforscher sagen, »ultrasoziale Wesen«, die ihren evolutionären Erfolg vor allem ihrer herausragenden Fähigkeit zur gemeinschaftlichen Intelligenz und zum kooperativen Denken verdanken (siehe Kapitel 4). Auch wenn man im Alltag mitunter an der sozialen Kompetenz seiner Mitmenschen zweifelt, steckt uns diese Ultrasozialität doch tief in den Genen. Selbst als moderne Individuen, denen viel daran liegt, sich von anderen abzuheben, treibt uns der Wunsch nach Interaktion und Gemeinschaftserlebnissen – etwa im Fußballstadion, in dem wir die Verbundenheit zu Tausenden anderen Fans spüren, im Konzertsaal, in dem wir die gehörte Musik anders empfinden als zu Hause vor dem Radio, oder auch beim gemeinsamen Essen, Singen oder Tanzen, weil all diese Tätigkeiten in einer Gruppe eine andere Kraft entfalten, als wenn wir sie allein praktizierten.
Zahlreiche medizinische Untersuchungen belegen inzwischen, dass das Zusammensein mit anderen regelrecht heilsam sein kann; das gilt nicht nur für die Anonymen Alkoholiker, sondern bei jedweder Krise oder Krankheit. In einer Studie wurden zum Beispiel Männer mittleren Alters untersucht, die innerhalb eines Jahres drei oder mehr starke Stress-Situationen zu bewältigen hatten (Entlassung, Scheidung, finanzielle Probleme o. Ä.). Bei alleinlebenden Männern, die keine Unterstützung durch Familie oder Freunde hatten, verdreifachte sich danach die Todesrate! Bei denjenigen, die ihre Sorgen mit anderen teilen konnte, war dagegen kein Anstieg zu verzeichnen. Fazit der Forscher: »Männer mit adäquater emotionaler Unterstützung scheinen geschützt«.3
Was als »adäquate« emotionale Unterstützung erfahren wird, kann dabei natürlich individuell stark variieren. Die eine braucht dazu ihre Großfamilie um sich, dem anderen genügt es, alle paar Tage mit einem Freund zu telefonieren. Entscheidend ist das subjektive Gefühl: Wer sich selbst als sozial gut eingebunden erlebt, ist zum Beispiel weniger anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für bestimmte Krebsarten4 oder Infektionen. Und wer doch krank wird, hat bessere Heilungschancen: Wer intensiven Beistand von Partnern oder Freunden hat, kommt mit Krebserkrankungen besser klar und benötigt nach Operationen im Schnitt weniger Schmerzmittel.5
Einer, der diese Kraft des sozialen Miteinander hautnah erlebte, ist der Fernsehproduzent Jörg Hoppe, der vor einigen Jahren an Krebs erkrankte. »Während der Therapie hatte ich eine schlimme Krise«, berichtet Hoppe. »Ich fühlte mich total zerschossen, hatte keine Kraft mehr, weiterzumachen. Lieber noch die fünf einigermaßen guten Monate, die mir prognostiziert waren, mit dem Krebs verbringen und dann sterben, als mich weiter behandeln zu lassen.« Doch dann hätten ihn Familie und Freunde dazu gebracht, nicht aufzugeben. »Sie sagten: ›Wir schaffen das.‹ Nicht ›Du schaffst das‹ oder ›Es wird schon wieder‹, sondern ›Wir schaffen das.‹ Dieses ›Wir‹ hat mir den Mut gegeben, weiterzumachen.«6
Auch über die sozialen Medien spürte Hoppe diesen Beistand, was ihn dazu brachte, selbst aktiv zu werden. Mittlerweile hat er mit anderen das Netzwerk yeswecan!cer für Krebskranke und ihre Angehörigen gegründet.7 Denn viel zu häufig führe Krebs in die soziale Isolation, sagt Hoppe. »Es ist eine Tabu-Krankheit. Das ist auch deshalb schlimm, weil wir aus vielen Studien wissen, dass Kommunikation die Heilung fördert. Unser Claim bringt auf den Punkt, was wir erreichen wollen: ›Du bist nicht allein.‹«
Ein Medikament namens Zuneigung
Einsamkeit dagegen kann im wahrsten Sinne des Wortes krankmachen, wie die Forschung zeigt.8 Nicht nur, dass Singles ein höheres Herzinfarkt-Risiko haben als Menschen in einer Beziehung.9 Auch im Hinblick auf viele andere Faktoren wirkt sich Einsamkeit negativ aus: Einsame Menschen leiden in der Regel häufiger unter Depressionen, Schlafstörungen, schnellerem Gehirnabbau, Kreislaufproblemen, Störungen des Immunsystems etc. pp.10 Das Gefühl, nicht dazuzugehören, löst im Gehirn sogar ähnliche Aktivitätsmuster aus wie ein körperlicher Schmerz.11
Dagegen gibt es kaum ein besseres Mittel als die Verbundenheit mit anderen. In einer großen Meta-Analyse verglichen Forscher 148 Studien und gelangten zu dem Schluss, gute Sozialkontakte und das Gefühl der Zugehörigkeit reduzierten das Sterblichkeitsrisiko durchschnittlich um 50 Prozent. Damit ist der positive Einfluss menschlicher Nähe deutlich größer als jener, der durch sportliche Aktivität oder das Einhalten eines gesunden Gewichts erreicht wird, und entspricht etwa jenem Gesundheitseffekt, den ein starker Raucher erzielt, wenn er seine Nikotinsucht aufgibt.12
Angesichts all dieser Resultate müssten Mediziner eigentlich »Zuwendung« als hocheffektives Therapeutikum verschreiben. Vielen Ärztinnen und Ärzten ist das auch bewusst; bei alleinstehenden älteren Leuten ist die effektivste medizinische Maßnahme oft nicht das verordnete Medikament, sondern das verständnisvolle Gespräch und die Anteilnahme im Sprechzimmer, die dem Ausstellen eines Rezeptes vorausgeht. Leider wird der heilsame Effekt von Beziehungen im üblichen »schulmedizinischen« System viel zu wenig honoriert (was nicht zuletzt den Zulauf zu Heilpraktikern, Homöopathen und anderen Alternativmedizinern erklärt; egal auf welche Methode die »Alternativen« schwören: Die meisten nehmen sich viel Zeit für ihre Patienten, was für diese oft schon heilsam ist).
Die soziale Energie
Der Einfluss unserer Mitmenschen geht allerdings weit über den biologisch-medizinischen Bereich hinaus (auch wenn er dort am klarsten wissenschaftlich nachweisbar ist). Auch Gedanken, Gefühle und nicht zuletzt unsere Kreativität hängen vom sozialen Umfeld ab, können durch andere entweder angeregt oder gedämpft werden.
In dieser Hinsicht stellte die Zeit der Corona-Pandemie ein einzigartiges soziales Großexperiment dar: Durch das verordnete »social distancing« und andere Maßnahmen konnte man plötzlich am eigenen Leib erleben, wie sich eine Veränderung des sozialen Umfelds auswirkt. Während Familien mit kleinen Kindern die Zeiten des »Lockdowns« oder der Quarantäne als verdichteten Sozialstress erlebten und das ständige Zusammensein auf engem Raum vielfach die Nerven zersägte, stellte sich bei anderen der gegenteilige Effekt ein: Mit einem Mal brachen fast alle üblichen Kontakte weg. Statt die Kollegen im Büro zu treffen, saß man allein im Homeoffice; Treffen in der Kantine oder an der Kaffeemaschine entfielen; auch auf Theater- oder Konzertabende musste man verzichten, ebenso wie auf Besuche in Clubs, Schwimmbädern, Museen oder Kirchen; und statt mit anderen im Stadion zu jubeln, mussten sich Fußballfans zu Hause allein »Geisterspiele« ansehen.
Anfangs empfanden manche die unerwartete Entschleunigung sogar als wohltuend; endlich Zeit, die guten Bücher zu lesen, die man schon immer lesen wollte, ausführlich zu kochen oder Brot zu backen! Doch je länger die Corona-Zeit dauerte, umso weniger konnte man sie genießen. Während die gestressten Familienmenschen einfach nur enorm erschöpft waren, machte sich bei vielen Alleinlebenden eine seltsame Ermüdung breit, eine Art von Lethargie, die weniger mit körperlicher Erschöpfung zu tun hatte als mit einer Form geistiger Antriebslosigkeit. Viele fühlten sich, so diagnostizierte der Soziologe Hartmut Rosa, »auf eine unbestimmte Weise müde und träge« und »als überziehe eine Art Mehltau ihre Wahrnehmungen«. Sie hatten den Eindruck, »nicht mehr zu schaffen, was sie eigentlich schaffen müssten oder was sie gern tun würden«.13 Aus Sicht des Soziologen war das »nicht einfach etwas Individuelles oder nur in der persönlichen Erfahrung Liegendes«, sondern ein soziales Phänomen, denn »dieser Mehltau überzieht ja die Gesellschaft insgesamt.«
Und weil es an klaren Konzepten und Theorien für so einen Zustand fehlt, hat Rosa seine Beobachtungen auf den Begriff der »sozialen Energie« gebracht. Damit knüpft er an den US‑amerikanischen Soziologen Randall Collins an, der schon 1993 von »emotionaler Energie« als treibender sozialer Kraft sprach.14 »Wir haben immer geglaubt, Energie sei eine individuelle und psychische Eigenschaft«, erläuterte Rosa in einem Interview: »Inzwischen glaube ich: Die Energie, die wir haben und in soziale Interaktion umsetzen, kommt aus der dichten Interaktion selber. Auch aus der irritierenden Interaktion, wenn mich zum Beispiel jemand anrempelt.« Das gelte für körperliche Begegnungen ebenso wie für geistige. Auch gedanklich brauche man »das Irritierende, das Überraschende, die erfreuliche oder unerfreuliche soziale Interaktion«, und zwar, »um aus unseren Routinen, auch den gedanklichen, herauskommen zu können.«15
Vieles davon sei in der Corona-Zeit weggefallen, und genau das habe die Mehltau-Stimmung verursacht, glaubt Rosa. Der verstärkte digitale Austausch habe da nur bedingt geholfen: Der sei zwar gut, um schnell Informationen auszutauschen – ersetze aber nicht die konkrete Begegnung mit anderen, die auf vielen Ebenen stattfinde und auch zufällige oder irritierende Momente enthalte. »Ohne sie laufen wir emotional, psychosozial und sogar intellektuell in den immer gleichen Bahnen. Und zwar in denen, die wir kennen.«
Warum man sich selbst nicht kitzeln kann
Vielleicht kann man das Wesen der sozialen Energie mit einer Analogie illustrieren: mit der Frage nämlich, warum man sich selbst nicht kitzeln kann. Rein körperlich ist der Reiz ja derselbe, ob man selbst Hand anlegt oder ob es jemand anderes tut. Doch das emotionale Erleben ist völlig unterschiedlich: Beim Kitzeln durch einen anderen schwingt immer ein Moment der Überraschung mit, des Unverfügbaren – und genau dies macht den Reiz aus.
Auch die Hirnforschung (die bekanntlich vor keinem Rätsel zurückschreckt) hat sich des Themas Fremd- und Selbstkitzeln angenommen. Ergebnis: Von außen kommende Reize aktivieren das Gehirn viel stärker als selbst erzeugte Reize (wie die Berührung des Körpers mit der eigenen Hand).16 Berliner Forscher haben sogar Ratten gekitzelt (und eine Vorrichtung ersonnen, mit der diese sich selbst kitzeln können), um der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei zeigte sich, dass Selbstberührungen eine »inhibitorische Bremse« im somatosensorischen Kortex aktivieren.17 Anders gesagt: Wenn man die Aktion selbst initiiert, weiß das Gehirn schon, was kommt und schaltet weitgehend ab.
Vermutlich lässt sich auf diese Weise die energetisierende Wirkung sozialer Begegnungen erklären (auch wenn dafür die definitiven neurophysiologischen Belege noch fehlen): Ähnlich wie beim Kitzeln weiß man im Gespräch mit anderen nie so genau, was kommt und wohin sich der Austausch entwickelt. Und genau diese Offenheit und Unberechenbarkeit aktiviert das Gehirn auf eine völlig andere Weise, als wenn man gedanklich nur um sich selbst kreist.
In der Corona-Pandemie, als viele Kontakte wegbrachen, konnte man diesen Unterschied gut spüren. Der Journalist Peter Unfried hat seine Erfahrung im Gespräch mit Hartmut Rosa so formuliert: »Ich habe jetzt Zeit zum neu Denken, aber ich denke nur das, was ich immer denke. Ich denke dann, Mensch, jetzt denk doch mal was anderes. Geht aber nicht. Es geht erst, wenn ich Leute anrufe, die mich intellektuell irritieren.« Oder, wie Unfried es drastisch auf den Punkt brachte: »Im Corona-Exil fehlen einem auch die Arschlöcher.«18
Tatsächlich können selbst Irritationen und Meinungsverschiedenheiten inspirierend sein, weil sie helfen, den eigenen Standpunkt zu bestimmen und sich der eigenen Argumente zu vergewissern. Gerade die Unberechenbarkeit menschlicher Interaktionen macht ihre Lebendigkeit aus. Denn dadurch erst öffnet sich der Raum für Hoffnungen, Wünsche, Ängste, Zuneigung und alle möglichen anderen Gefühle.
Emotionen nämlich sind gleichsam die »Alarmanlagen« des Organismus: Sie werden vor allem dann ausgelöst, wenn etwas Wichtiges, Neues oder Überraschendes geschieht. Deshalb erzeugt eine neue Liebe (oder ein plötzliches Unglück) vor allem am Anfang starke Gefühle; mit der Zeit aber nimmt die Emotionsdichte jeweils ab.2 Denn der Ablauf des vorhersehbar Immergleichen erfordert keine mentale Aktivität und lässt jede emotionale Spannung aus dem Geschehen entweichen. Auch deshalb fühlten sich die abwechslungsarmen Tage des Pandemie-Lockdowns (oder der Quarantäne in den eigenen vier Wänden) nach einiger Zeit so öde und leblos an.
»Soziale Energie« gehört für Hartmut Rosa daher – wie Vertrauen – zu jenen sozialen Ressourcen, die durch den Gebrauch wachsen und nicht weniger werden wie fossile Ressourcen. »Der Wunsch und die Kraft zu sozialem Kontakt entsteht durch sozialen Kontakt«, sagt Rosa. »Und wo dieser Kontakt fehlt, nimmt erstaunlicherweise der Wunsch ab.«
Die Weisheit der Vielen
Auch wenn die Theorie der sozialen Energie noch nicht fertig ausgearbeitet ist – das entsprechende Buch ist bei Hartmut Rosa derzeit in Arbeit –, ist doch bereits die Perspektive bemerkenswert: die Beschreibung positiver Wirkungen von sozialen Interaktionen und größeren Menschenansammlungen war in der Forschung nämlich lange Zeit eher die Ausnahme als die Regel. Im Fokus des wissenschaftlichen Interesses standen oft mehr die negativen Aspekte der Gruppendynamik, etwa der Drang zu Konformismus und Herdenverhalten und die irrationalen Verhaltensweisen, zu denen Menschen in der Masse fähig sind (siehe Kapitel 6).
Diese Sichtweise verdanken wir nicht zuletzt Gustave Le Bon, dem Begründer der Massenpsychologie. Der französische Arzt und Anthropologe prägte lange Zeit das moderne Bild der Masse als barbarischem Gemeinschaftswesen, das vor allem zu Dummheit und Irrationalität neige. »Allein durch die Tatsache, Glied einer Masse zu sein, steigt der Mensch mehrere Stufen von der Leiter der Kultur hinab. Als Einzelner war er vielleicht ein gebildetes Individuum, in der Masse ist er ein Triebwesen, also ein Barbar«, postulierte Le Bon 1895 in seinem Hauptwerk Psychologie der Massen. Ihn besorgte vor allem die moderne Tendenz der Gleichmacherei, die zu einer Einebnung der Standesunterschiede führte. Früher seien »die Kulturen von einer kleinen, intellektuellen Aristokratie geschaffen und geleitet« worden, klagte Le Bon, »niemals von den Massen«. Eine demokratische Herrschaft des Volkes konnte er sich nicht vorstellen. Die Massen hätten »nur Kraft zur Zerstörung. Ihre Herrschaft bedeutet stets eine Stufe der Auflösung.«19
Kein halbes Jahrhundert nach dieser Veröffentlichung schienen die Nationalsozialisten – die Le Bon genau gelesen hatten – seine Thesen von der Barbarei des Kollektivs aufs Fürchterlichste zu bestätigen. Kein Wunder, dass danach die Masse einen miserablen Ruf hatte, insbesondere in Deutschland. Es dauerte lange, bis Forscher auch die positiven Aspekte von großen Gruppen zu thematisieren wagten. Dabei konnten sie an einen Mann anknüpfen, der zur selben Zeit wie Le Bon lebte, aber ganz andere Ideen vertrat: Sir Francis Galton, ein britischer Universalgelehrter, der mathematische, psychologische und genetische Studien betrieb, sich aber auch als Geograph, Meteorologe, Anthropologe oder Erfinder hervortrat.
Galton verdanken wir nicht nur die Idee des Fingerabdrucks; auf ihn geht auch der Begriff der »Weisheit der Vielen« zurück, die ihren modernen Ausdruck in der »Schwarmintelligenz« findet. Der vielseitige Forscher beobachtete 1906 beim Besuch einer Nutztiermesse im englischen Plymouth, wie die Besucher das Gewicht eines Ochsen schätzen sollten. Das war damals eine beliebte Wette, die dem Sieger ein Preisgeld einbrachte. Allerdings lagen die Angaben der Besucher zum Teil weit daneben, niemand erriet das Gewicht genau. Als Galton jedoch den Mittelwert aller 787 Schätzungen bildete, traf dieser nahezu exakt ins Schwarze. Daraus folgerte Galton: Wenn man die kollektive Weisheit gut zu nutzen weiß, sind Menschen gemeinsam viel klüger als allein.
Schwarmintelligent oder schwarmdumm?
Der Witz liegt allerdings in den unscheinbaren Wörtchen »gut zu nutzen«. Denn längst nicht jede Menschenmenge ist automatisch intelligent, manchmal überwiegt eher die »Schwarmdummheit«.20 Die »Weisheit der Vielen« funktioniert nur, wenn jede und jeder seine Meinung oder Prognose unbeeinflusst und unabhängig von den anderen äußert – und erst danach ein Mittelwert gebildet wird.
In vielen Gruppen, Unternehmen oder Parteien hingegen läuft es umgekehrt: Dort geben häufig Wortführer einen bestimmten Ton vor und ermutigen damit jene, die derselben Ansicht sind, während andere mit abweichender Meinung eher hinter dem Berg halten – was in die berühmte Schweigespirale führt. Dieser Prozess bringt nicht Weisheit hervor, sondern Konformismus. Ähnliches passiert, wenn sich die Mitglieder eines »Schwarms« untereinander absprechen oder alle Anhänger derselben Theorie sind; das führt eher zur Verzerrung der gemeinsamen Intelligenz – was zum Beispiel auf dem Aktienmarkt, im politischen Betrieb oder auch in der medialen Berichterstattung immer wieder zu beobachten ist: Weil einer sich am anderen orientiert, statt auf sein eigenes Urteil zu vertrauen, kann sich ein Aktienkurs, eine politische Frage oder ein mediales Thema enorm aufschaukeln und jeglichen Kontakt zur Realität verlieren.
Die Weisheit der Vielen hängt also gerade an der Eigenständigkeit der einzelnen »Vielen«. Auch Patienten, die bei einem medizinischen Problem eine zweite oder dritte Meinung einholen, tun gut daran, auf die Unabhängigkeit der Ärzte zu achten. Wenn alle sich am selben Chefarzt orientieren, entsteht aus den einzelnen Meinungen keine übergeordnete Weisheit.
Wie geschaffen für die Weisheit der Vielen schien das digitale Netz. Gemeinschaftsprojekte wie Wikipedia nährten anfangs die Hoffnung, im Internet entstehe die »Schwarmintelligenz« quasi automatisch. Inzwischen weiß man, dass die digitalen »Vielen« längst nicht immer größere Intelligenz hervorbringen und das Netz auch ein Ort des primitivsten Herdentriebs sein kann (siehe Kapitel 8). Doch es gibt durchaus Beispiele für digitale Schwarmintelligenz: Sogenannte Wahlbörsen etwa prognostizieren den Ausgang von politischen Wahlen meist besser und genauer als klassische Meinungsumfragen.21 Auf ähnliche Weise lassen Firmen wie Media Predict eine möglichst große Anzahl von Menschen auf den Erfolg von Kinofilmen oder Büchern wetten – um damit genauere Vorhersagen zu erstellen.3
Dass die Menge oft klüger als der Einzelne ist, bewies vor einigen Jahren auch der »Netflix-Preis«. Ausgelobt hatte ihn der Videodienst Netflix, der seinen Kunden Filme und Serien vorschlägt. Um dafür einen besseren Empfehlungs-Algorithmus zu finden, bot er eine Million Dollar Preisgeld. Viele Teams machten mit, keines erreichte die geforderte Verbesserung. Schließlich verfiel einer der Entwickler auf die Idee, mehrere Lösungen unterschiedlicher Teams zu kombinieren – und räumte den Preis ab. Das zeigt: Nicht der einzelne Geniestreich, sondern Vielfalt siegt.
Der Mythos vom einsamen Genie
Dennoch hält sich in vielen Bereichen immer noch die Idee vom einsamen Genie, das im Alleingang den Lauf der Welt verändert. Das klassische Vorbild dafür ist Albert Einstein, der als junger, unbekannter Physiker quasi im Handstreich seine Wissenschaft revolutionierte und mit der Relativitätstheorie das damalige Weltbild auf den Kopf stellte. Doch das romantische Bild des zerzausten Einzelgängers ist eher von nostalgischem Wert. (Selbst bei Einstein stimmt der Mythos nicht wirklich: Zum einen baute er auf der Arbeit anderer Physiker wie Henri Poincaré und Hendrik Lorentz auf; zum anderen entwickelte er viele Ideen im Gespräch mit seinen Freunden der »Akademie Olympia«. Auch Einsteins Genialität entstand in Interaktion.22