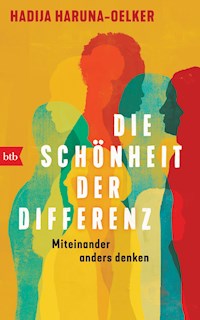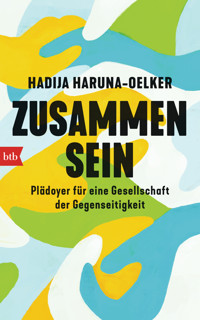
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie können wir Inklusion endlich umsetzen? Eine so persönliche wie politische Geschichte.
2016 wird Hadija Haruna-Oelker Mutter eines behinderten Kindes. Immer wieder trifft sie auf Barrieren und trennende Systeme, die seit Jahrzehnten bekannt sind: Bürokratie, pseudoinklusive Schulen oder unhinterfragte Diskriminierungen und Abwertungen im Alltag. Warum fehlt es an umfassender Teilhabe und Teilgabe für behinderte Menschen? Und wie treten wir dem Erstarken sozialdarwinistischer Vorstellungen in unserer Gesellschaft entgegen?
Aus einer Schwarzen, intersektionalen Perspektive spürt die Journalistin und Politikwissenschaftlerin nichterzählten Geschichten, verdrängten Verbrechen in der Vergangenheit und starken Stimmen der Gegenwart nach. Auf ihren heranwachsenden Sohn blickt sie in der Überzeugung, dass in Kindheiten die Kraft liegt, Trennungen zu überwinden und Ungesagtes auszusprechen. In ihrer so persönlichen wie politischen Geschichte zeigt sie, wie Inklusion konkret umgesetzt werden kann. Sie plädiert für ein umfassendes gesellschaftspolitisches Nachdenken, einen Perspektivwechsel und ein Verständnis für Menschenrechte. Und nicht zuletzt für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit, in der alle selbstbestimmt leben können.
Mit Kapitelzusammenfassungen in Einfacher Sprache. Übersetzt von Laura Heidrich und Kori Klima.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt:
2016 wird Hadija Haruna-Oelker Mutter eines behinderten Kindes. Immer wieder trifft sie auf Barrieren und trennende Systeme, die seit Jahrzehnten bekannt sind: Bürokratie, pseudoinklusive Schulen oder unhinterfragte Diskriminierungen und Abwertungen im Alltag. Warum fehlt es an umfassender Teilhabe und Teilgabe für behinderte Menschen? Und wie treten wir dem Erstarken sozialdarwinistischer Vorstellungen in unserer Gesellschaft entgegen?
Aus einer Schwarzen, intersektionalen Perspektive spürt die Journalistin und Politikwissenschaftlerin nichterzählten Geschichten, verdrängten Verbrechen in der Vergangenheit und starken Stimmen der Gegenwart nach. Auf ihren heranwachsenden Sohn blickt sie in der Überzeugung, dass in Kindheiten die Kraft liegt, Trennungen zu überwinden und Ungesagtes auszusprechen. In ihrer so persönlichen wie politischen Geschichte zeigt sie, wie Inklusion konkret umgesetzt werden kann. Sie plädiert für ein umfassendes gesellschaftspolitisches Nachdenken, einen Perspektivwechsel und ein Verständnis für Menschenrechte. Und nicht zuletzt für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit, in der alle selbstbestimmt leben können.
Autorin:
Die Politikwissenschaftlerin Hadija Haruna-Oelker lebt und arbeitet als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich ist sie für den Hessischen Rundfunk tätig. Sie moderiert die Römerberggespräche in Frankfurt, das Debattenformat »StreitBar« in der Bildungsstätte Anne Frank und die feministische Presserunde der Heinrich-Böll-Stiftung. In der Frankfurter Rundschau schreibt sie eine monatliche Kolumne. Außerdem ist sie zusammen mit Max Czollek Host des Erinnerungspodcasts »Trauer & Turnschuh«. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Jugend und Soziales, Rassismus- und Diversitätsforschung. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem ARD-Hörfunkpreis Kurt Magnus 2015 oder dem Medienspiegel-Sonderpreis für transparenten Journalismus 2021. Anfang 2022 erschien ihr erstes Buch »Die Schönheit der Differenz – Miteinander anders denken«, das für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war.
HADIJA HARUNA-OELKER
ZUSAMMENSEIN
Plädoyer für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die den Kapiteln vorangestellten Zitate können als Destillat des jeweils nachfolgenden Kapitels gelesen werden.
Copyright © 2024 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign | München unter Verwendung eines Motivs von © Ruth Botzenhardt
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28099-4V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Dich, M., mein größtes Geschenk
Der Entstehungsprozess dieses Buches wurde redaktionell von der Journalistin Judyta Smykowski begleitet und von Bildungsaktivist Ash(@Ashducation) politisch lektoriert.
Kori Klima und Laura Heidrich haben Teile des Buches in Einfache Sprache übersetzt. Die Zusammenfassungen am Ende des Buches sollen dazu beitragen, dass der Text so vielen Menschen wie möglich zugänglich wird. Die Komplettübersetzung des Buches war aus Platz- und Finanzierungsgründen leider nicht möglich.
Einige Begriffe, die im Originaltext in machtkritischem Sprachgebrauch verfasst sind, wurden in der Übersetzung im Sinne der Verständlichkeit nicht aufgegriffen. Zum Beispiel wird Schwarz nicht großgeschrieben und weiß nicht kursiv.
Die Zusammenfassungen sind jeweils mit Halbkreisen am Seitenrand markiert, damit sie schnell auffindbar sind.
Inhalt
Vorweg …
Deutsche Zustände
Ein Plädoyer für Menschenrechte
Kindheiten
Harylin Rousso
Einsortieren. Wie du wirst, was du bist
Behindert. Was du kannst
Ableismus. Was andere aus dir machen
Differenz. Was du über dich lernst
Aufwachsen. Welche Rechte du hast
Inselhopping
Vincent Hesse
Getrennte Welten
Nix inklusive
Von Gehirnen und Leistung
Von der frühen Segregation
Deutschland hat ein schlechtes Zeugnis
Bildung anders denken
… und Arbeit auch
Aufarbeiten
Emilie Rau
Inklusion versus rechts und der Nationalsozialismus
Ausgelöscht: Eine verschwiegene Geschichte
Luise Habel
Deutschland sozial. Was war nach 1945?
Verdrängt und nicht aufgearbeitet
Segregation 1.0
Von wegen Fürsorge
Who cares?!
Martina Puschke
Sich kümmern …
… und Schatten
Kinder kriegen
Judy Gummich
»Das Risiko nichtbehinderte Eltern zu bekommen«
Widerworte & Widerstand
Rebecca Maskos
»We have always resisted!« Worauf gebaut wird
Ende der Dankbarkeit – Betrachtungen einer deutschen Emanzipation
Behindert und stolz dazu
Lose Enden
Gemeinsam Denken von Judyta Smykowski
Verletzlichkeit als politische Praxis
Gesellschaft der Gegenseitigkeit
Zusammen & Sein
Zusammengefasst in einfacher Sprache
Vorweg … – Einfach zusammengefasst
Kindheiten – Einfach zusammengefasst
Inselhopping – Einfach zusammengefasst
Aufarbeiten – Einfach zusammengefasst
Who cares?! – Einfach zusammengefasst
Widerworte & Widerstand – Einfach zusammengefasst
Lose Enden – Einfach zusammengefasst
Mitwirkende dieses Buches
Worte des Dankes
Quellenverzeichnis
Vorweg …
Dieses Buch ist eines, das ich gebraucht hätte, als ich Mutter und zur Verbündeten meines Kindes wurde. Es ist politisch, weil ich Kindern darin Platz mache und glaube, dass in diesem gesellschaftlichen System nur etwas bewegt werden kann, wenn Menschen bewegt werden.
Deutsche Zustände
Du kannst auf nichts hinarbeiten,wenn du nicht weißt,dass es existiert.
– James LeBrecht
Es war 2016, als wir zu einer Veranstaltung für behinderte und chronisch kranke Kinder eingeladen waren. Die Dream Night im Zoo in Frankfurt am Main, eine Art geschützter Raum, der mit Rahmenprogramm bespielt wurde. Dieser Besuch war für mich eine so schöne wie schmerzhafte Erfahrung. Denn als mein Mann und ich unser damals noch nicht ein Jahr altes Kind im Buggy durch die Anlage schieben, sehe ich sie alle zum ersten Mal an einem öffentlichen Ort versammelt. All die jungen Menschen, die aus unserem Alltag verdrängt und von klein auf ausgesondert werden, mit denen viele nichtbehinderte Menschen nur selten in Kontakt kommen. Es sind Kinder aller Unterschiede. Eine Vielfalt, die in den meisten Medien, in Büchern und öffentlichen Räumen fehlt und bis heute nur in bestimmten Blasen wahrnehmbar wird. Kinder, die ein unterschiedliches Merkmal verbindet und deren Geschichten so verschieden sind. Die zu einer Gruppe gezählt werden und doch keine sind, weil kein Kind, kein Mensch sich nur durch ein Merkmal auszeichnet, das ihm von außen als Erstes dominant zugeschrieben wird.
Seit diesem Abend beschäftigt mich die Frage nach dem »Warum«. Warum die Trennung? Warum fehlt ein Miteinander von nichtbehinderten und behinderten Menschen in unserem Alltag? Kein Kontakt, keine Öffnung, kein Zusammensein. Warum gibt es diese Leere, eine Lücke zwischen uns? Und warum wird einer so großen, heterogenen Gruppe in Deutschland ein gleichberechtigtes Leben verwehrt?
Für mich ist klar, dass ich es so nicht für mein Kind und kein anderes möchte. Nicht für uns als Familien, die wir in Deutschland Teil einer Gemeinschaft sind, die wenig wahrgenommen, der aber viel Pauschalisierendes zugeschrieben wird. Zum jetzigen Zeitpunkt dieses Buch über Behinderung zu schreiben, ist für mich ein privater wie politischer Akt. So wie es für mich politisch ist, Schwarz zu sein. Ein theoretisches Wissen darüber musste ich mir in beiden Fällen erarbeiten und auf unterschiedliche, reale Weise erleben und miterleben. Texte lesen, in Gesprächen mit Menschen sein, die es betrifft, in mich hineinhören, beobachten, nachdenken und immer bereit bleiben, weiter zu lernen über Lebenserfahrungen, die nicht in eine Schublade gepackt werden können. Und gleichzeitig ist dieses Buch mehr für mich. Es ist ein dringendes und drängendes und bei aller Rationalität, gesellschaftlicher Analyse und wissenschaftlicher Erkenntnis mit einer starken Emotion verbunden. Weil es mir um etwas geht: um das Kostbarste, das ich habe. Mein Kind. Für das ich der Rückenwind sein will, den es sich im Laufe seines Lebens wünscht. Und hoffe, dass es in einer Weite über sich zu denken lernt, in der Fremdbestimmung keinen Platz hat.
Für das eigene Kind gegen Ungerechtigkeit anzuschreiben, legt eine andere Energie ins Fühlen, Denken und Formulieren. Daraus mache ich keinen Hehl, daraus schöpfe ich Kraft. Die gemeinsame Zeit mit meinem Kind hat mich mehr als alles andere dazu aufgefordert, stark und laut zu bleiben, so wie ich es bereits als Kind für mich selbst sein musste. Und so ziehe ich weiter auf meinem Weg der Emanzipation und zeige auf dieser Reise mein Wachsen und Werden in einer politisch-bewussten und machtkritischen Elternschaft. Ich setze damit fort, was ich in meinem ersten Buch Die Schönheit der Differenz begonnen habe. Das eine Einladung war, die ich erneut ausspreche. Dieses Mal, um sich mit der Frage des Zusammenseins in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen, in der Menschen ausgeschlossen werden. Dabei plädiere ich für eine kritische Auseinandersetzung, wie sie die Literaturwissenschaftlerin bell hooks in Teaching Critical Thinking empfahl. Also nicht nur vordergründige Wahrheiten verstehen zu wollen, sondern fragend unter die Oberfläche zu gelangen. Und dabei das eigene Leben und die Welt um sich herum zu betrachten und Situationen zu hinterfragen, die für selbstverständlich gehalten werden.
Kritisches Denken ermöglicht, die Perspektive zu wechseln und sich der eigenen Vorurteile und Involviertheit innerhalb von Ungleichheitsverhältnissen bewusst zu werden. In diesem Zusammenhang hielt hooks junge Menschen für die geborenen kritischen Denker*innen, weil sie ihren Platz in unserer Welt erst noch finden müssen. Kinder erschließen sich die Welt durch Antworten auf ihre Fragen. Sie wollen das Wer und Wie, das Was und Wo, das Wann und Warum des Lebens verstehen. Und ich glaube, dass erwachsene Menschen, während sie Kinder begleiten oder beobachten, mit und von ihnen lernen können. Denn durch sie lässt sich verstehen, wie unsere Sozialisation und Prägung im erwachsenen Alter auf uns wirkt. Kinder laden uns ein, darüber zu reflektieren, was uns selbst in unserer Kindheit vorenthalten oder an fälschlichen Vorstellungen in uns geprägt wurde. Schließlich waren wir alle einmal jung und standen mit dem Zeitpunkt unserer Geburt auf der gleichen Startlinie, um dann aber unterschiedlich weiterzukommen.
An Kindheiten lässt sich ablesen, wie wir werden und was andere aus uns machen. Sie zeigen uns, wo wir als Gesellschaft stehen. Darum nehme ich sie zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Zumal auch Kinder für die Zukunft eine Idee davon brauchen, was ein Zusammensein unterschiedlicher Menschen bedeutet, damit es selbstverständlich für sie wird. Dabei verstehe ich meine Worte als eine Momentaufnahme aktueller Zustände in Deutschland. Wo die Lebensbedingungen noch nie für alle Menschen gerecht waren, aber es vielen in Zukunft schlechter gehen wird. Kriege, Flucht- und Migrationsbewegungen, die Klimakrise mit Stürmen, Hitze und Wassermangel, Artensterben und andere planetare Herausforderungen. Rund 72 Prozent der Weltbevölkerung leben unter autokratischen Regierungen. Und seit der Coronapandemie, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der humanitären Kriegskatastrophe in Gaza nach dem terroristischen Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den immer größeren Erfolgen rechter Kräfte und ihrer Parteien haben sich nicht nur die politischen Debatten hierzulande spürbar verschärft. Überall lassen sich gesellschaftliche Brüche beobachten, die ein Gefühl der Spaltung verstärken und den Eindruck vermitteln, dass es ein »Wir« nicht gibt.
Darum ist es kein Wunder, dass der Wunsch nach Diversität weniger spürbar ist, dass er sich sogar ins Gegenteil verkehrt. Wir Zeiten erleben, in denen es für viele nur eine Perspektive, Wahrheit und Richtlinie gibt. In denen ein Kulturkampf Menschenrechte abschätzig als woke Debatte adressiert und sich wenige differenziert mit dem Prinzip einer politischen Achtsamkeit auseinandersetzen.
Das Sündenbockprinzip ist und bleibt erfolgreich, weil die Abwertung anderer es Menschen schon immer leicht gemacht hat, sich vom Wesentlichen abzulenken. Zumal immer alle mitdenken zu wollen, ein hehrer Vorsatz ist, der vielen auch zu viel ist. Da ist keine Zeit, Kraft oder Verständnis, sich auch noch um die Anliegen marginalisierter Menschen zu kümmern. Insgesamt ist die Mitte unserer Gesellschaft schon lange nicht mehr stabil. Sie galt zunächst als fragil, dann als gefordert und zuletzt als »distanzierte Mitte«, die geschrumpft und insgesamt nach rechts gerückt ist, wie die gleichnamige Langzeitstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung erklärt.
Klar ist jetzt, dass sich Menschen schon lange in wachsender Zahl antidemokratischen Bewegungen zuwenden. Und nicht wenige sich dabei nostalgisch auf den Wert einer diffusen Vergangenheit beziehen, in der nicht alle vorkommen. Das erklärt ein Wiedererstarken sozialdarwinistischer Ansichten, die Sozialhilfeempfänger*innen, wohnungslose oder behinderte Menschen als »minderwertig« und überflüssig bezeichnen. Was Erinnerungen an eine nationalsozialistische Vergangenheit weckt, die in so vielen Punkten, wie dem Massenmord an behinderten und kranken Menschen, nicht gut aufgearbeitet ist. Weshalb es nicht nur für jüdische, queere, Schwarze Menschen und Sinti*zze und Rom*nja, sondern auch für sie keinen »Schlussstrich« in der Geschichte gibt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es Jahrzehnte gedauert, bis eine umfassende Aufarbeitung der Verbrechen an den etwa 300000 behinderten und kranken Menschen und den rund 400000 zwangssterilisierten Personen in Deutschland begonnen hat. Heute ist es eine traurige Tatsache in Deutschland, dass trotz Grundgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 gilt, Ausgrenzung, Anfeindungen und Entmündigungen eine allgegenwärtige Erfahrung für sie ist. Eine, die sich in alltäglichen Situationen zeigt: in der Sprache, in Vorstellungen, Denkmustern und Haltungen. Aber auch in Debatten über Pränatal- oder Präimplantationsdiagnostik, in der Forschung an nicht einwilligungsfähigen Menschen, der Sterbehilfe und in tabuisierten Praxen, in der sogenannten Behindertenhilfe, die ein Netz aus Institutionen, Behörden, Ämtern und formellen Vorgaben stützt, an denen Fachleute aus Medizin, Pädagogik, Psychologie und sozialer Arbeit beteiligt sind. Aber eben auch in der Gewalt an behinderten Menschen und dem Mangel an Maßnahmen zu ihrem Schutz.
»Wir werden nicht als Behinderte geboren, wir werden zu Behinderten gemacht«, schrieb Rebecca Maskos schon vor über einem Jahrzehnt in Anlehnung an die bekannte Formulierung von Simone de Beauvoir über die Konstruktion des Frauseins. Maskos kämpft mit anderen behindertenrechtsbewegten Menschen dafür, Behinderung nicht nur auf medizinische Fragen und Defizitdenken zu reduzieren. Weil Körper eben nicht nur Körper sind, sondern diese gesellschaftlich konstruiert und bewertet werden. Und behinderte Körper werden dabei meistens abgewertet und ausgeschlossen.
Schwarz sein. Queer sein. Jüdisch sein. Behindert sein. So lassen sich im Konkreten zwar die Erfahrungen nicht vergleichen, aber es lassen sich Verbindungen herstellen. Und diese stelle ich auch zwischen meinem Kind und mir her. Nicht nur, weil ich als Mutter eine besondere Bindung zu ihm habe, sondern weil sich unsere Merkmale und damit Erfahrungen überschneiden. Mein Kind ist nicht nur ein behindertes Kind, sondern auch eines of color, und ich bin seine Schwarze Mutter. In unserer Geschichte verbirgt sich also eine gemeinsame intersektionale Erfahrung und damit ein Verständnis, das marginalisierte Menschen in der Gleichzeitigkeit ihrer biografischen Merkmale und gesellschaftlichen Positionen begreift. Aus diesem Verständnis heraus entwickle ich meine Gedanken, begegne Menschen, habe mir in Bündnisarbeiten Klarheit verschafft und analysiere die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit. Mein Zugang zu den Erfahrungen von Menschen sind Perspektivwechsel, meine Texte sind das Ergebnis meiner eigenen Subjektivität und Ausdruck meiner Lernerfahrungen. Ich schreibe dieses Buch aus der Position einer light-skinned1 Schwarzen, cis, hetero, normschönen und nichtbehinderten Frau, Mutter, Ehefrau, Journalistin, Autorin und Feministin heraus, die mit einer chronischen Erkrankung lebt. Als Arbeiter*innen- und Angestelltenkind der sogenannten unteren Mittelschicht, das studiert und einen sozialen und Bildungsaufstieg erlebt und in Westdeutschland als Kind einer weißen Mutter und eines Schwarzen Vaters sozialisiert wurde, bin ich Teil einer globalen Geschichte der Unterdrückenden und Unterdrückten. In dieser Erzählung kommt im Besonderen die gemeinsame Erfahrung einer Mutter mit ihrem Kind dazu. Die wir zusammen eins sind auch im kollektiven und inklusiven Sinne der südafrikanischen Philosophie des Ubuntu, also eines größeren Ganzen. Simunye, wie es in Zulu heißt. Meine Geschichte, seine Geschichte und unsere Geschichte in dieser Gesellschaft. »Ich bin, weil wir sind.« Und dabei bewegt mich die Frage, wie ich mein Kind begleiten kann, wenn sich diese Gesellschaft nicht zum Besseren verändert. Darum denke ich darüber nach, wie wir weiterleben und stabil bleiben können. Deshalb dieses Buch. Weil die Zeiten schwierig sind und das jetzt so ist, unser Zuhause. Aber wie die Geschichte zeigt, es gerade Krisen sind, die ein unvorhersehbares Potenzial für Emanzipation in sich bergen.
1 Light-skinned und dark-skinned Schwarz sind zwei Begriffe, bei denen es nicht explizit um die Hautschattierung geht, sondern darum, die Erfahrungen von anti-Schwarzem Rassismus weiter auszudifferenzieren und das rassistische Prinzip eines sogenannten Colorism zu erklären. Bei diesem werden Menschen nach dem Grad ihrer Hautschattierung (ab-)gewertet. Light-skinned Schwarze Menschen werden dabei bevorzugt, erfahren aber trotzdem Rassismus.
Ein Plädoyer für Menschenrechte
Kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind.
Aber kämpfe so,
dass sich dir andere anschließen wollen.
– Ruth Bader Ginsburg
Es war ein intensiver Weg, bis ich mein journalistisches Handwerk mit meiner Expertise und meinem Stil in ein – nennen wir es – öffentlich anerkanntes Verhältnis stellen konnte. Weil ich mich in einer Zeit als Journalistin etablieren musste, in der eine vermeintlich neutrale und objektive Berichterstattung über Diskriminierung nur denjenigen zugesprochen wurde, die sie selbst nicht erlebten. Ein in mehrerer Hinsicht unlogischer Schluss. Zum einen, weil kein Mensch absolut objektiv ist, ein Sachverhalt immer aus der Perspektive der berichtenden Person erzählt wird und damit im Kontext von Diskriminierung die Wahrnehmung eines vermeintlich Unbeteiligten nicht fundierter ist als die eines Menschen, der sie erfährt. Zum anderen: Wer ist schon unbeteiligt bei Themen, die unsere Differenz betreffen?
Vielmehr machen ein Wissen darüber und die Reflexion der eigenen Position das aus, was einen transparenten, verantwortungsbewussten und, wie ich es nenne, menschenrechtsbasierten Journalismus auszeichnet. Und darum geht es mir in meiner Arbeit und beim Schreiben. Weil ich glaube, dass die Einsicht, nicht unbeteiligt zu sein, dabei hilft, die Zustände unserer Gesellschaft und die Grundrechte von Menschen ehrlicher zu analysieren.
Wer versteht und fühlt unsere Menschenrechte, ihr Gewicht und ihre Geschichte? Die Erinnerung an die Vergangenheit und die Errungenschaft, dass sie nach einem großen Unrecht an so vielen Menschen formuliert wurden. Dieses Buch handelt von ebendiesen Menschenrechten, die wirkmächtig sind, weil sie nicht so leicht infrage gestellt und instrumentalisiert werden können. Es geht um Gleichbehandlung, die in unserer Hand liegt. In einer Zeit, in der Deutschland zwar 75 Jahre Grundgesetz feiert, aber die Würde des Menschen antastbar und unsere Demokratie nicht sicher ist. In der die Antwort zu vieler Menschen auf die Krisen ist, sich politisch nach rechts zu orientieren. Aber eine andere Richtung ist möglich.
Dieser Weg beginnt damit, die Gründe für den gewachsenen gesellschaftlichen Dissens seit 1945 zu verstehen. Mit einem umfassenden Erinnern, um daraus Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu entwickeln. Unsere Gesellschaft ist jetzt herausgefordert, ihre Vergangenheit und ihre gängige Kultur des Erinnerns noch einmal aufzurollen, zu überarbeiten und neu zu verhandeln. Und in diesen Prozess schreibe ich mich ein. Als Teil unserer sogenannten superdiversen Gesellschaft, die sich aus Menschen zusammensetzt, deren Biografien und Beziehungen zu diesem Land sich unterscheiden und die dazu noch unterschiedlich sind in ihrem Menschsein. Weshalb die Frage von Zusammensein und Menschenrechten auch eine nach Identität ist, die uns alle ausmacht. Ich meine damit individuelle persönliche Selbstfindungsprozesse. Also die Geschichte, die Menschen über sich selbst und ihre Leben erzählen, gespiegelt an der Erzählung, die es in der Gesellschaft über sie gibt. In diesem Zusammenspiel in Zeiten des Umbruchs wird die Suche nach dem »wahren Ich« im Sinne des Soziologen Hartmut Rosa zu einer aufreibenden Dauerbeschäftigung. Vor allem, weil dabei im Gegenzug rechte Kräfte ihre Vorstellung von Identität als etwas Starres und Unwandelbares verstehen, das vor einem Außen geschützt werden muss.
Darum gilt es im Sinne und für den Erhalt der Demokratie, eine gemeinsame Geschichte zu finden, die alle miteinschließt. Versorgen wir uns darum mit Wissen, wie der Philosoph Theodor W. Adorno in seinem Plädoyer für Vernunft und Aufklärung appellierte. Weil sich Menschen nur, wenn sie ausreichend Wissen hätten, nicht von Propaganda und Faschismus täuschen ließen. Es ist eine Forderung, die nicht an Wichtigkeit verloren hat. Denn was wir wissen und über uns lernen, bleibt die Basis für die politische Bildung und ein demokratisches Denken. Es ist eines, das (ein-)geübt, aber auch gefühlt werden will. Das eines Eintretens für Menschenrechte bedarf, und Inklusion ist ein Teil dieser Rechte. Sie ist eine Vision, Utopie und politische Leitidee, ein gesellschaftliches Korrektiv, pädagogisches Ziel und Lernprozess. Inklusion ist das Prinzip und Großprojekt für unser Zusammensein, das auf die Abschlusserklärung der UNESCO-Weltkonferenz zur Gerechtigkeit in der Bildung 1994 zurückgeht. Sie besagt, dass niemand ausgeschlossen werden darf und sich anpassen muss, sondern alle einbezogen werden, wie sie sind.
Inklusion ist ein starker Begriff, weil sie das soziale Selbstverständnis der Gesellschaft hinterfragt und zu einem neuen Miteinander verändert, wenn sie wirklich umgesetzt würde. Denn wo von ihr die Rede ist, da geht es um menschliche Freiheit, weil Inklusion auch Zugänglichkeit und Zugehörigkeit bedeutet. Darum sollten wir gemeinsam an ihrem unvollendeten Projekt arbeiten. An einer Gesellschaft, in der Kümmern der Kern von Gemeinschaft ist, eine »Caring Community« im Sinne einer Gegenseitigkeit ohne Hierarchie. In der gilt: Wenn Menschen sich umeinander und die Bedürfnisse aller kümmern, sich folglich auch um sich selbst sorgen. Weil es ohne Care-Arbeit weder Kultur noch Ökonomie noch politische Organisationen gibt, wie es die US-amerikanische Philosophin Nancy Fraser in ihrem Aufsatz »Who cares« einmal schrieb.
Inklusion ist nur zusammen zu schaffen, und sie bereitet den Weg zu einer Gesellschaft der Gegenseitigkeit. Um eine solche zu werden und den Weg dorthin zu finden, braucht es den persönlichen und politischen Willen. Und dieses Buch ist mein Nachdenken darüber. Über Menschenrechte, auf die sich gerne berufen wird, weil sie einen revolutionären Charakter haben, die aber davon abhängig sind, wie Staaten sie interpretieren. Die gesetzlich verankert werden müssen, damit sie umgesetzt werden können. Darum besteht die politische Arbeit aller sozialen Bewegungen seit Jahrzehnten darin, ein menschenrechtliches Verständnis in der Gesellschaft zu verstetigen. Darum sang einst der US-Sänger James Brown über die Selbstbefreiung Schwarzer Menschen: »Say it loud – I’m black and proud.« Also darüber, wie es ist, Schwarz und stolz darauf zu sein.
Ähnlich folgen diesem selbstbestärkenden Prinzip seit Jahrzehnten die unterschiedlichen sozialen Bewegungen marginalisierter und damit auch behinderter Menschen. Heute wird in neuen Formen an ihre Errungenschaften angeknüpft: offline auf den Straßen sowie online in den sozialen Medien. Der Wissenstransfer hat sich geweitet. Er ist internationaler geworden, globaler und schon lange transnational. Insofern ist dieses Buch ein öffentlicher Reflexionsprozess, bei dem ich den Kampf um die Gleichberechtigung behinderter Menschen aus meiner Perspektive wahrnehmbarer machen möchte. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf eine bestärkende Geschichte ihrer Bewegung, die seit den 70er Jahren auf unterschiedliche Weise in Deutschland ihren Weg geht. Geblieben ist ihr Wunsch nach Gleichbehandlung und Gerechtigkeit. Nach einer positiven Sicht auf das eigene Sein, das Ende der Anpassung. Das Recht darauf, selbst und mitzubestimmen: Nothing about us without us! Nichts über uns, ohne uns. Das ist das Leitmotiv. Und: We have always resisted. Wir haben uns immer gewehrt. Ungerechtigkeit verstehe ich dabei in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, der uns alle betrifft. Weshalb es egal ist, in welcher biografischen Position wir uns befinden, um für Gerechtigkeit einzustehen. In einer Gesellschaft der Gegenseitigkeit geht es darum, sich zu verbinden und zu verbünden, Verantwortung zu übernehmen und mehr Menschen heraus- und aufzufordern, das ebenfalls zu tun. In den aktuellen Zeiten bedeutet das auch, mutig zu sein. Es ist der unbequemere, aber ehrlichere und dazu ein heilsamer Weg. Zumal kein Mensch unbeteiligt daran sein wird, wie es mit unserer Gemeinschaft und Demokratie in Zukunft weitergehen wird.
Kindheiten
Was macht eine Kindheit aus? Wer erinnert sich an die eigene? Das Aufwachsen von Kindern vollzieht sich in einem komplexen, nicht stetigen gesellschaftlichen Zusammenspiel. Es wird an Erwartungen geknüpft. Aber Kinder sind verschieden. Genau wie ihre Kindheiten es sind. Sie gelten als unschuldig und bedürftig. Es heißt, Kinder seien zu achten und müssten gefördert werden, aber gemessen wird zu oft ihre Leistung. Sind ihre Leben heute selbstständiger und angstfreier als früher? Wer nimmt Kinder so wahr, wie sie wirklich sind? Fest steht: Von ihnen hängt die Zukunft ab.
Harylin Rousso
Harylin Rousso ist fünf Jahre alt, als sie mit ihren Eltern und Geschwistern in ein neues Zuhause zieht. Auf Bildern aus dieser Zeit Anfang der 50er Jahre trägt sie einen Pixie-Haarschnitt und ein gewinnendes Lächeln. Ihre Beine und Zehen sind nach innen gerichtet. Ihre Sprache ist verständlich und klingt, wie sie sagt, je nach Perspektive betrunken oder verschlafen. Gedanken über sich selbst macht sie sich wenige als Kind. Ihre Zerebralparese ist nicht ihr Thema. Es ist das der anderen.
Am Tag ihres Einzugs werden sie und ihre Familie von sechs Nachbarskindern beobachtet, die gegenüber am Straßenrand sitzen. Eines der Mädchen beginnt zu kichern und flüstert ihrer Freundin etwas zu, als sie auf Harylins klobige, hohe Stiefel mit den schweren Spitzen deutet. Ein anderes Mädchen kommt über die Straße auf sie zu: »Ich werde deine Freundin sein, die anderen werden das aber nicht sein wollen, weil du verkrü***** bist.«
»Nein danke«, erwidert Harylin.
64 Jahre später wird sie über dieses Erlebnis, dem Mädchen mit einem Gefühl der Sicherheit gekontert zu haben, schreiben. »Ich wusste damals, dass ich ungeschickt laufe, aber so bin ich seit meiner Geburt. Meine Beine haben mich überallhin gebracht. Ich habe damit auf meine Weise Ball gespielt. Und Schokoladeneis und Cola geliebt wie all die anderen Kinder. Warum haben sie mich angestarrt?«
Nach diesem Vorfall kommt es Harylin nicht in den Sinn, ins Haus zu gehen. Wäre sie jedoch hineingegangen, hätte ihre Mutter sie umarmt und wieder hinausgeschickt. »Sie dachte, ich kann damit klarkommen, also tat ich es«, sagt Harylin. Die heute Kampfnarben vom Beobachtetwerden trägt, die sie über ihr Leben hinweg gesammelt hat.
»Was stimmt mit dir nicht, warum läufst du so?«
»Ich wurde so geboren.«
»Aber warum? Ist es ansteckend?«
»Ich war in Eile, als ich geboren wurde, aber der Arzt war nicht bereit, und die Krankenschwestern haben versucht, mich zu stoppen, und dabei mein Gehirn verletzt. Aber sie haben es nicht geschafft, und hier bin ich. Und nein, es ist nicht ansteckend.«
»Oh! Okay.«
Es sind Gespräche, die Kinder ähnlich, in anderer Form heute immer noch führen – führen müssen. Die oft anstrengend und verunsichernd sind. Harylin findet einen Weg, setzt sich durch. Auch nach ihrer Kindheit ist sie mit Kämpfen beschäftigt. Immer wieder sieht sie sich mit unwillkommenen Kommentaren konfrontiert, die ihr sagen, dass ihre Zeit noch nicht gekommen sei. Nicht ihre Zeit, um Psychologin zu werden, die sie trotzdem werden wird. Dazu ist sie Behindertenrechtsaktivistin und Künstlerin, die ein Netzwerk für behinderte Frauen und Mädchen gründet und 1995 für die vierte Internationale Frauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking arbeitet. Die dafür Preise erhält.
Für Harylin wird die Erzählung von ihrer Beharrlichkeit am Tag ihrer Geburt und das Bild vom Kratzen und Beißen ihrer Mutter, die sich gegen die falsche Behandlung der Pflegekräfte wehrt, ein positiver Treiber sein. Don’t call me inspirational – Nenn mich nicht inspirierend, wird sie mit knapp 62 Jahren ihr Buch nennen, das 2013 erscheint. In dem sie diese und andere Geschichten über sich erzählt, die ich mit meinen Worten übersetzt habe. Auszüge ihrer Geschichte sind auch im für den Oscar nominierten Dokumentarfilm Sommer der Krüppelbewegung(Crip Camp) zu sehen. Der vom 1971 erstmals stattgefundenen Sommercamp Jened handelt, das für viele junge Menschen über Jahre zu einem sicheren Ort wird, weil sie dort eine bestärkende und diskriminierungssensible Zeit erleben. Viele der Teilnehmenden werden die dort erfahrene Selbstbestärkung nutzen, um später politische Veränderung in den USA zu fordern und zu erreichen. Auch Harylin ist Teil dieser sozialen Bewegung, die den Status behinderter Menschen als Bürger*innen zweiter Klasse in den USA nicht länger hinnimmt. So wie es in der 70er Jahren in der Zeit der »Bürgerrechtsbewegung« auch Schwarze, queere und andere marginalisierte Menschen tun und damit auch in Deutschland zum Vorbild für die politische Bewegung behinderter Menschen werden. Der Krüppelbewegung.
Einsortieren. Wie du wirst, was du bist
Keine Erfahrung einer Behinderung
ist die Erfahrung einer Behinderung.
– Elsa Sjunneson-Henry und Dominik Parisien
Wie ist dein Kind? Welche Behinderung hat es? Wenn ich nebenbei erwähne, dass ich ein behindertes Kind habe, dann spüre ich oft Neugier. Den Wunsch meines Gegenübers zu fragen, »was es hat«. Ich spreche offen über Behinderung, da es mir um die damit zusammenhängenden sozialen und politischen Fragen geht, aber nicht um medizinische Diagnostik. Weil ich über unser alltägliches Leben so reden möchte, wie andere es auch tun. Darum verheimliche ich unser Leben nicht, aber ich hänge es auch nicht an die große Glocke. Doch fühle ich mich manchmal wie ein wandelndes Reflexionsangebot.
Behindert. Es ist ein vielbehaftetes Wort, das zugleich eine Erfahrung und ein neutrales Merkmal beschreibt. Es ist ein Wort, das keine Hierarchien zwischen den unterschiedlichen Behinderungen kennt. Es ist eines, das in abwertender Verwendung stigmatisieren soll und gleichzeitig eine Ausgrenzungserfahrung beschreibt, die auch andere marginalisierte Gruppen machen. Es ist ein politischer Begriff, wie Schwarz sein es auch ist. »Voll b********«, rufen Kinder und manche Erwachsene. Andere schauen peinlich berührt zu Boden. Das Sprechen über Behinderung kennt kein Maß. Und als Schimpfwort funktioniert es bestens in einer Gesellschaft, die Behinderung mit Schwäche und Peinlichkeit assoziiert, schreibt Rebecca Maskos. Weshalb Erwachsene auch oft versuchen, das Wort zu vermeiden.
»Wie behindert ist mein Kind?« Ich stelle mir vor, dass sich einige Lesende spätestens jetzt diese Frage stellen. Denn auch diese kenne ich. Ich bin immer wieder herausgefordert, Dinge über uns zu erzählen. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, in diesem Buch über uns zu schreiben. Vorab also dazu. In meinem Alltag fühle ich schnell, ob mein Gegenüber ein echtes Interesse am Leben meines Kindes hat oder es darum geht, seinen Entwicklungsstand in Vergleich zu den eigenen Norm- und damit gepaarten Leistungsvorstellungen zu setzen. Ich spreche von »awkward« Situationen, wenn ich in meinem Gegenüber diese ambivalenten Gefühle spüre, wenn es beispielsweise unsicher ist, was es sagen soll, wenn ich über unseren Alltag spreche. Dadurch habe ich feine Antennen entwickelt, um schnell reagieren zu können. Darum gehe ich distanzlosen Fragen aus dem Weg, blocke sie ab und antworte strategisch. Ich mag keine Gespräche über medizinische Hintergründe kurz nach dem Kennenlernen, und ich entziehe mich bestimmten Gesprächen, wenn mein Kind dabei ist, zuhört oder nicht eingebunden wird. Neu ist, dass ich mir jetzt öfter als früher erlaube auszusprechen, wenn mich die Aussage meines Gegenübers irritiert. Ich sage, was ich denke. Denn ich fühle mich verantwortlich, weil ich mein Kind begleite, dessen Lebenserfahrung ich in vielen Punkten nur mitfühlen kann. Und die Autonomie meines Kindes ist für mich der Grund, nicht gedankenlos, sondern mit Bedacht über es zu sprechen und auch hier zu schreiben.
Behinderte Menschen haben ein Recht auf Privatsphäre, denn was sagt ihre Behinderung oder chronische Erkrankung über sie aus? Die Autorin des Buches Behinderung und Ableismus, Andrea Schöne, schreibt: »Lernst du einen behinderten Menschen kennen, hast du sicher viele Fragen zur jeweiligen Behinderung, und das ist auch in Ordnung, da du die Behinderung nicht ignorierst. Es gibt jedoch Fragen, die unangenehm sind. Besonders im Erstkontakt oder falls du einen Menschen noch nicht kennst.« Behinderung ist also Privatsache. Darum frage ich mein Gegenüber auch zurück, warum es wichtig ist zu wissen, mit welcher Behinderung mein Kind lebt. Zu welcher Erkenntnis oder Einordnung das führt. Mich erinnert die Frage an das Prinzip einer anderen, die mir gern wieder und wieder gestellt wird: »Woher kommst du?« Mit der die Fragenden zwar meistens ihr Interesse oder ihre Neugier bekunden wollen, aber die Tragweite dieses politischen »Herkunftsdialogs« nicht verstehen, nicht nachvollziehen können oder wollen. Weil es darum geht, darüber nachzudenken, was für ein Gefühl es auslöst, mit dieser Frage immer wieder aus Deutschland ausgebürgert zu werden – als könnten Menschen wie mein Kind oder ich nicht »von hier« kommen.
»Ändere die Art und Weise, wie du diese einfache Frage stellst, und du wirst in der Lage sein, eine viel echtere Beziehung aufzubauen«, erklärte die Autorin Taiye Selasi in einem TED Talk – und sie hat recht. Es bringt uns nicht zusammen, die Identität unseres Gegenübers durch die Vorstellung einer geografischen Herkunft definieren zu wollen. Genauso wenig nutzt eine medizinische Diagnose, die viele behinderte Menschen oft nicht einmal haben. Was nicht heißt, dass es in engeren Freundschaften nicht auch wichtig sein kann, die Details einer Behinderung zu teilen, damit die Lebenswelt des anderen besser nachvollzogen werden kann. Aber unter diesen Umständen ist auch die Frage eine andere. Nämlich, was ein behinderter Mensch braucht, und nicht, was die Person hat. Es gibt Wege auszudrücken, dass man sein Gegenüber und dessen Bedürfnisse wahrnimmt und ein achtsames Zusammensein ermöglichen will. Darum entscheide ich auch bewusst, was ich aus unserem Leben erzähle. Und das hat sich über die Zeit verändert. Es ist politischer geworden. Weil ich heute meine Kritik an unseren gesellschaftlichen Strukturen klar und konkret formulieren kann, und das unabhängig von unserem Privatleben.
Halten wir fest. Es geht nicht darum, Behinderung nicht zu thematisieren, sondern darum, wie wir sie thematisieren. Die Journalistin Amy Zayed schreibt, dass sie nicht viel von Taktgefühl halte, besonders, wenn es mit Rücksichtnahme, Verständnis, Empathie oder Respekt verwechselt wird. »Taktgefühl ist für mich dieses Wort, was wir gern nutzen, um unsere eigene Unsicherheit zu tarnen, weil wir nicht ehrlich sein können, oder die Angst, dass jemand das, was wir zu sagen haben, nicht verkraften kann.« Man könne niemandem »taktvoll« beibringen, dass er gefeuert sei, ohne wie ein Heuchler zu klingen. Darum gilt für Zayed: Man kann und sollte Fragen stellen, aber es muss respektvoll geschehen. »Fragt Euch als weiße Nicht-Behinderte, warum es Euch eigentlich interessiert, woher jemand kommt oder warum jemand eine Behinderung hat«, so Zayed weiter. Es geht ihr um ein Nachdenken, keine immer gültige Handlungsanweisung, weil es das beidseitige Bedürfnis gibt, über Behinderung zu sprechen, aber auch das Recht, dies selbstbestimmt zu tun. Schlussendlich geht es um Akzeptanz, wie wir sie zum Beispiel auf dem Social-Media-Kanal Barrierebrecher sehen, für den sich Bianca Hammerschmidt, Sebastian Teichner, Marcel Schäfer, Helmut Wieser und Michael Stadler zusammengetan haben. In kurzen Videos stellen sie sich selbst und weitere ganz unterschiedliche Menschen vor und beantworten immer dieselbe Frage: »Was ist deine Behinderung, und was wünschst du dir von deinen Mitmenschen?«
Der Kanal, der eigentlich nur für den Landkreis Günzburg in Bayern gedacht war, erreicht seit seinem Start 2022 heute allein auf Instagram knapp 50000 Follower und damit viel mehr Menschen als ursprünglich geplant. Unter den Posts lassen sich viele bestärkende Kommentare für dieses Konzept lesen, bei dem behinderte Menschen selbst zu Wort kommen. Jeden Donnerstag gibt es einen neuen Clip, der von den Macher*innen gefilmt, geschnitten, mit Untertiteln versehen und auf den Plattformen moderiert wird. Immer wieder geht es in den Kommentaren um Selbstbezeichnungen und Selbstverständlichkeiten im Miteinander. Wer sich durch die Videos klickt, erfährt nicht nur, wie viele verschiedene Formen von Behinderungen es gibt, sondern auch, dass unterschiedlich darüber gesprochen wird. Und in den Wünschen an nichtbehinderte Menschen zeigt sich, dass der Kontakt zu ihnen fehlt und warum das auf gesellschaftliche Zustände zurückzuführen ist, die auch vom Sprechen über und dem gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung bestimmt sind. Sie zeigen, auf welch vielfältige Weise behinderte Menschen Abwertung und damit Ableismus im Alltag erleben, auf den ich in einem späteren Kapitel eingehen werde. Es sind Erfahrungen, mit denen ich mich viel auseinandersetze, so wie ich es auch mit Rassismus tue.
Aber zurück zur Frage nach meinem Kind. Ich erinnere mich an Situationen mit Menschen, in denen ich mich gefragt habe, ob ich mein Gegenüber mit meinem offenen Sprechen dazu einlade, die Frage zu stellen, was es hat. Was für ein Signal setze ich, wenn ich über Behinderung wie über Schwarzsein als politische Kategorie spreche und ein Gespräch plötzlich in medizinische Fragen abdriftet, die ich nicht beantworten möchte? Ich bin mir inzwischen sicher, dass das passiert, weil nichtbehinderte und gesunde Körper die gesellschaftliche Norm darstellen, an der sich alles orientiert. Das ist es, was mich in diesem Moment vor Herausforderungen stellt. Weil ich »das Funktionieren« eines Körpers als wertfrei betrachte – wie eine Haarfarbe. Und mein Kind nicht in seiner körperlichen Funktion beschreiben möchte, sondern über seine Erlebnisse, kindlichen Aktionen, seinen Charakter oder eben die alltäglichen Herausforderungen sprechen will, die eine fehlende Inklusion an sein und unser Leben stellt. So wie ich auch übers Schwarzsein rede und es mir dabei nicht um Hautschattierungen geht, sondern um Lebenserfahrungen, die sich von denen weißer Menschen unterscheiden.
Und so verpacke ich meine Kritik an Kommentaren oder Vorstellungen meistens freundlich und begegne gängigen Abwehrmechanismen, indem ich sie anspreche. Ich benenne abwertende Erfahrungen, damit ich sie nicht in mir vergrabe. Und manchmal macht es mich traurig, ein anderes Mal wütend, dass so viele nichtbehinderte Menschen sich so wenig Wissen angeeignet oder einfach kein oder wenig Feingefühl haben. Dass sie, wie es der Bibliothekar und Behindertenrechtsaktivist Udo Sierck bereits in den 80er Jahren erklärte, behindert sein nicht als eine von vielen Lebensformen akzeptieren.
Darum fließt inzwischen der Wunsch, sich als Schwarzer Mensch zu schützen und nicht in eine Schublade gesteckt werden zu wollen, in mein Verständnis, über Behinderung zu sprechen, mit ein. Es gibt Parallelen. Zumal sich rassistische und ableistische Zuschreibungen oft vermischen und ähnlich funktionieren, wie ich von Schwarzen behinderten Menschen weiß, die ich kennengelernt habe und von denen ich lernen durfte. Beide beziehen sich über das Herstellen der Differenz von Menschen auf die Logik angeblicher Fähigkeiten von Menschen, wie der Soziologe und Gründer des Netzwerks Intersectional Disability Studies Robel Afeworki Abay schreibt. Die Frage ist also, wer kann was und wer angeblich nicht und warum wird das so bewertet?
Halten wir damit als Antwort auf mögliche Fragen zu meinem Kind also fest: Es ist wie viele Kinder. Herzlich, aufgeschlossen, lustig und neugierig. Dazu ein offener Typ Mensch mit warmherzigem Einfühlungsvermögen. Mein Kind ist normschön, wird von den meisten männlich gelesen, hat glattes mittelbraunes Haar, ist behindert und light-skinned Schwarz, weshalb Menschen es fragen werden: »Woher kommst du?« Und damit ist mein Kind wie ich in seiner Summe komplex. Aber welcher Mensch ist das nicht? Und wer wünscht sich nicht, in der eigenen Gesamtheit wahrgenommen zu werden? Das ist der Grund, warum ich mir mehr Selbstverständlichkeit für unsere unterschiedlichen Leben wünsche. Dass es keine Scham für etwas gibt, das nicht beschämend ist. Denn diese verhindert, sich nahezukommen, und vergrößert die Distanz zwischen nichtbehinderten und behinderten Menschen. Sie ist der große Stillmacher, schreibt die Lyrikerin Lea Schneider. Und gleichzeitig zeigt sie uns, an welchen Stellen etwas zu ändern, neu zu denken und umzuverteilen ist. Wo uns die Worte für eine konstruktive Auseinandersetzung und ein gemeinsames Aushandeln fehlen. Sie zeigt, wie der dadurch entstandenen Ohnmacht etwas entgegensetzt werden kann. Und für mich bedeutet das, so zu handeln, wie ich es mir früher von meinen Eltern gewünscht hätte, wenn sie es besser gewusst hätten. Dann stelle ich mir vor, wie mein Kind irgendwann diese Zeilen liest, und hoffe, dass es dann nickt und sagt: Ja, so war es okay, Mama.
Behindert. Was du kannst
Kennst du Kim?
Kim ist auch nichtbehindert.
Sorry, wenn ich euch verwechselt habe,
aber ihr seht euch echt ähnlich.
– Raúl Krauthausen
Was kann dein Kind (schon)? Es gibt da diese naive Vorstellung vom »perfekten Baby«, das nach Zeittabelle krabbeln, sitzen und laufen soll. Das irgendwann in der Schule gut mitkommt, gute Noten schreibt und dann selbstständig von zu Hause auszieht und im besten Fall die Karriere macht, die sich die Eltern für es wünschen. Es ist der Wettbewerb unserer Leistungsgesellschaft, der Kindern von klein auf bewertende Muster überstülpt. Was dazu führt, dass Eltern schon im Kleinkindalter ihrer Kinder dazu neigen, sie mit anderen zu vergleichen.
Was aber, wenn alles ganz anders läuft, als Eltern es geplant haben? An dieser Stelle wird es kompliziert, und das nicht nur, weil Kinder sowieso ihre eigenen Vorstellungen vom Leben haben. Sondern auch, weil der Wunsch nach einem gesunden Kind oder einem Kind ohne Behinderung zwar nachzuvollziehen ist, aber es eben nicht der Realität aller Kinder entspricht, nichtbehindert oder chronisch gesund zu sein. Auch wenn Normvorstellungen uns das vorgaukeln.
Diese Tatsache gilt es zu verstehen, um nachzuvollziehen, dass es da eine verzerrte Vorstellung vom Leben gibt, die den gemeinsamen Start für nichtbehinderte Eltern mit behinderten Kindern oft erschwert. Auch für mich war es schwierig, denn obwohl ich ein Wissen über den gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung hatte, fühlte ich mich nach der Geburt ahnungslos dieser Welt ausgeliefert. Mein erstes Kind, mein Baby, die Angst, es nicht vor dem da draußen schützen zu können. Ich hatte mich auf mein Kind im Geiste vorbereitet, war später als meine engsten Freundinnen Mutter geworden und auf mögliche Rassismuserfahrungen eingestellt. Da ahnte ich, was auf uns zukommen könnte. Schlussendlich war ich aber auf nichts vorbereitet.
Heute blicke ich zurück und denke, dass es schön war, mit meinem absoluten Wunschkind im Bauch schwanger gewesen zu sein. Als ich nichts außer Vorfreude und Übelkeit verspürte. Ich erkenne aber auch, wie naiv ich war, weil in unserer Gesellschaft Schwangerschaft und Geburten nicht ehrlich verhandelt werden. Und so fielen mein Mann und ich hinein in die Situation, mit frühen Entscheidungen für unser Kind klarkommen zu müssen. Damals hängte ich das Wochenbett an den Nagel, um die anfängliche Angst um mein Kind irgendwann später zu verarbeiten. Dieser Kontrollverlust war nicht einfach für mich, und außerdem war da dieser Druck in mir, möglichst alles schnell richtig einordnen zu können. Ich wollte emotional, privat, politisch alles durchdrungen haben, um den Menschen, die uns da draußen in Schubladen denken, nicht ausgeliefert zu sein. Es hat gedauert, mein Gefühl der Ohnmacht zu verlieren, und diese Zeit hat mich verändert. Sie hat mich kritischer werden lassen.
Ich bemerke, wie behinderte und chronisch kranke Kinder viel zu oft in einem Umfeld aufwachsen, in dem Vorstellungen von Elternschaft mit nichtbehinderten und chronisch gesunden Kindern dominieren. Es sind Vorstellungen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, weil sie einem Streben nach Perfektion und Effizienz entsprechen. Als ob Behinderung etwas wäre, das man vermeiden könnte, und sie nicht schon immer Teil des Kinderkriegens war. Aber Tatsache ist: Alle Kinder sind unterschiedlich. Es ist wichtig, sie zunächst in ihrem Wesen, ihrem Sein kennenzulernen und reifen zu lassen. Und ihr Potenzial fördern zu wollen und sich über ihre Erfolge zu freuen, ist dabei immer etwas Schönes. Das gilt für alle Kinder, nur eben auf unterschiedliche Weise. Es sollte keine Norm, kein oberes Ziel geben und vor allen Dingen nicht die Vorstellung, dass wer das Ziel nicht erreicht, scheitert.
Es ist das Problem einer gesellschaftlichen Bewertung von »Nichtkönnen«, das Kinder und später Erwachsene in einen Besser-und-schlechter-Vergleich setzt, um sie zu sortieren und im schlimmsten Fall im Bildungs- oder auf dem Arbeitsmarkt auszusondern. Genau dieses verbreitete, kategorisierende Denken nach Leistung erklärt, warum behinderte Eltern in der Vorstellung von vielen Menschen gar nicht vorkommen oder ihnen – ähnlich wie nichtbehinderten Eltern behinderter Kinder – wahlweise mal unendliche Kraft oder wenig Freude im Leben zugeschrieben wird. Warum es diesen gängigen Glauben gibt, dass eine Behinderung etwas Trauriges, eine Last, etwas Unschönes oder gar Schlechtes sei. Machtkritische Eltern widersprechen hier, wehren sich dagegen, sich von auf Optimierung ausgelegten Bildungsplänen und Erziehungskonzepten regieren zu lassen. Machtkritisch bedeutet, sich mit den historisch gewachsenen Ungleichverhältnissen, aber auch der eigenen Verstrickung auszukennen. Und zu erkennen, dass die gesellschaftlichen Optimierungsversuche keinem Kind guttun, aber im Leben von marginalisierten Kindern besonders massive Folgen haben können, weil sie ihr Wachsen und Werden beeinflussen. Es ist ein Grund, warum diese Kinder nicht selten glauben, dass angeblich etwas falsch an ihnen ist oder etwas fehlt. Wobei es meist erwachsene Menschen sind, die ihnen dieses Gefühl geben. Die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Tanja Kollodzieyski schreibt, dass das Benennen abwertender Muster behinderten Menschen oft schwerfällt, weil das Erleben solcher Muster zu allgegenwärtig und umfassend ist, um die Strukturen dahinter überhaupt zu erkennen. Sie glaubt, dass dies insbesondere auf Menschen zutrifft, die seit Beginn ihres Lebens mit einer Behinderung leben so wie mein Kind.
1992 veröffentlichten Swantje Köbsell und Theresia Degener das Buch Hauptsache, es ist gesund? Weibliche Selbstbestimmung unter humangenetischer Kontrolle. Es gilt als Standardwerk der feministischen behindertenpolitischen Meinungsfindung, weil sie darin versuchen, die Kritik an pränatalen Untersuchungen mit dem gemeinsamen Befreiungsanspruch von Frauen zu vereinen. Es geht ihnen um die Suche nach einer feministischen Ethik und um das Verhältnis von Individuum und Kollektiv. Darum, dass erst wenn Behinderung und Nichtbehinderung als gleichwertige neutrale Zustände gedacht würden, behinderte Menschen nicht mehr nur als »Auch-Menschen« gelten würden, sondern als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft.
Diese Ungleichheit zu überwinden, ist demnach ein altes Anliegen und auch das meines Buches. Es möchte das gängige Denken, etwas sei normal, infrage stellen. Denn was ist dieses Normal, und wer hat es definiert? Diesen so häufig verwendeten wie schwierigen Begriff, den der Duden als »vorschriftsmäßig so [beschaffen, geartet] zu sein, wie es sich die allgemeine Meinung als das Übliche, Richtige vorstellt« beschreibt. Eine gesellschaftlich idealisierte Norm erklärt, was als Körper erstrebenswert ist und was behinderten Körpern fehlt. Das nichtbehinderte Normal ist also eine Wirklichkeit, die wir vermittelt bekommen haben und bei der unsere Sozialisierung eine maßgebliche Rolle gespielt hat: das Elternhaus, die Schule oder der Sportverein. »Normal ist bei uns, der funktionstüchtig ist, dem Schönheitsideal entspricht und sich unauffällig und angepasst verhält«, schrieb bereits 1982 Barbara Lister in ihrem Sammelband Briefe an die heile Welt. Behinderte schreiben an (sogenannte) Nichtbehinderte. Und knapp 40 Jahre später fragt Hannah Wahl in Radikale Inklusion, wie ein Körper im Kapitalismus aussehen soll. Und gibt die Antwort, dass er leistungsfähig und belastbar sein müsse. Weshalb es bis heute alle schwer haben, die dieser Norm nicht entsprechen. Es sind neben behinderten Menschen auch dick_fette und nichtweiße Menschen, die eine ähnliche Art der Ablehnung erfahren. Auch hier verschränken sich biografische Merkmale.
Die Journalistin Rebecca Maskos beschreibt, wie Behinderung sozial konstruiert wird, also dadurch entsteht, dass Menschen und ihre Körper kulturell und gesellschaftlich bewertet werden. Das Forschungsfeld der Disability Studies2 differenziert diese Tatsache weiter aus und erklärt zum Beispiel den Unterschied zwischen den Begriffen Behinderung und Beeinträchtigung, die fälschlicherweise synonym verwendet werden. Weil Beeinträchtigung die körperliche Seite der Behinderung darstellt, also das verkürzte Bein, die eingeschränkte Sehkraft oder die chronische Krankheit – einen anatomischen Zustand. Während Behinderung die soziale Dimension beschreibt, also jene, die eine Beeinträchtigung überhaupt erst zum Problem macht.
In den Sozialwissenschaften wird Behinderung mit unterschiedlichen Modellen erklärt. Es gibt das soziale, das kulturelle und das menschenrechtliche Modell. Ersteres wurde in den 70er Jahren von behinderten Menschen in Großbritannien entwickelt und dort sowohl in der Behindertenbewegung als auch in den Disability Studies angewandt. Es versteht Behinderung als einen von der Gesellschaft hergestellten Prozess, der Menschen mit bestimmten Merkmalen die gesellschaftliche Teilhabe, Anerkennung und den Respekt abspricht, der nichtbehinderten Menschen zugestanden wird. Heißt: Nicht die behinderten Menschen sind das Problem, sondern die Gesellschaft, in der sie leben. Damit stellt das soziale Modell die gesellschaftlichen Barrieren in den Mittelpunkt: Ausgrenzung, strukturelle Diskriminierungen durch Gesetze und fehlende Möglichkeiten auf Teilhabe. Bei der es beispielsweise um den Zugang zu barrierefreien Verkehrsmitteln, mehr Informationen in Leichter Sprache, in Brailleschrift oder Untertitel im Fernsehen geht. Im Podcast Rampe? Reicht! erklären die Hosts SchwarzRund und simo_tier das soziale Modell und Teilhabe am Beispiel einer Küche mit einer Arbeitsplatte auf einer Höhe, die gut zum 1,78 Meter großen, nichtbehinderten Herbert passt. Teilhabe bedeutet in dieser Küche nicht, dass alle und nicht nur Herbert sie benutzen dürfen, sondern ein Bewusstsein dafür zu haben, dass diese Küche nicht für kleinere oder größere Personen oder Menschen im Rollstuhl geeignet ist, und darum beim Bau über die Höhe der Arbeitsplatte und den Platz darunter nachzudenken und sie entsprechend so zu bauen, dass es eine Küche gibt, die alle gut nutzen können.
Die Professorin für Disability Studies Swantje Köbsell beschreibt, wie die Tatsache, permanent auf Barrieren wie in diesem Küchenbeispiel aufmerksam zu machen und einen Gegenentwurf zum gängigen, defizitorientierten Behindertenbild zu präsentieren, dazu geführt hat, dass es in der Behindertenbewegung jahrelang verpönt war, im politischen Kampf um Teilhabe und Gleichberechtigung auch über persönliche Probleme oder Schmerzen zu sprechen. Wie also der Wunsch, kein Klischee zu sein, den Blick auf die eigene körperliche Erfahrung verschob. Weshalb im letzten Jahrzehnt an einer Perspektive gearbeitet wurde, die gleichzeitig die ausgrenzenden gesellschaftlichen Bedingungen für Behinderung und die individuellen Beeinträchtigungen in den Blick nimmt, ohne stigmatisierend zu sein. Zumal Beeinträchtigungen fast alle Menschen kennen oder spätestens im Alter damit leben werden. Nicht umsonst nennt die US-Behindertenrechtsbewegung nichtbehinderte Menschen auch TAB, temporarily able-bodied, also vorübergehend nichtbehindert, wie Maskos schreibt.
Und so wurde aus einer kritischen Betrachtung des sozialen Modells das kulturelle Modell entwickelt, das Behinderung äquivalent zu Merkmalen wie race3 oder Geschlecht als eine soziale Konstruktion versteht und die Frage stellt, warum es überhaupt eine marginalisierte Gruppe wie die der behinderten Menschen gibt. Wie wird sie historisch, sozial und kulturell erklärt? Daran anknüpfend entwickelte sich mit der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 noch ein weiteres Modell: das menschenrechtliche. Das beschreibt, wie der Ausschluss behinderter Menschen durch vorenthaltene Rechte passiert. Demnach stehen der Staat und die Gesellschaft in der Pflicht, Menschenrechte zu achten und Diskriminierung und strukturelle Benachteiligung zu verhindern.
Sowohl das kulturelle als auch das menschenrechtliche Modell machen sich dafür stark, dass Menschen ihre Leben unterschiedlich leben können und alle Körper mitgedacht und in ihrer Individualität und Fähigkeiten anerkannt werden. Deshalb sollte Behinderung auch nicht als eindeutige Kategorie verstanden werden, sondern als ein Oberbegriff für unterschiedliche Erfahrungen von Menschen innerhalb dieser zugeschriebenen Gruppe. So wie auch Schwarz sein für light- oder dark-skinned Personen steht. Es geht also um eine von außen konstruierte Hierarchiebildung, die sich in allen marginalisierten Gruppen finden lässt. Um den Unterschied, der einen Unterschied macht. Es gibt demnach keine homogenen Gruppen, und wer sich dem Thema Behinderung widmen möchte, sollte sich auch mit den heterogenen Leben behinderter und chronisch kranker Menschen auseinandersetzen. So beeinträchtigt mich beispielsweise meine chronische Darmerkrankung im Leben, ist aber für andere nicht wahrnehmbar, weswegen sie mich auch nicht behindert. Es ist ein Beispiel dafür, warum behindert und krank zu sein, nicht das Gleiche bedeutet. Menschen können behindert sein und krank, und manche Beeinträchtigungen werden durch akute Erkrankungen ausgelöst, können aber auch temporär sein. Das Gegenteil von Behinderung ist demnach nicht »gesund«, sondern nichtbehindert. Und die Komplexität dieser Betrachtung einer gleichzeitigen Selbstbezeichnung nimmt weiter zu, wenn in die körperliche Wahrnehmung von Menschen zusätzlich ihr Geist, ihre Psyche und neurologische Merkmale einbezogen werden. Das Stichwort dazu: Neurodiversität.
Ich erinnere mich noch gut an eine Unterhaltung im Urlaub mit Freund*innen und Eltern eines autistischen Kindes, in dem wir das gesellschaftliche Wissen über einen Begriff besprachen, der jene Menschen betrifft, die neurologisch betrachtet nicht in das neurotypische Raster passen. Die darum oft als neurodivergent bezeichnet werden. Neurodiversität unterstreicht wiederum auf selbstverständliche Weise die Verschiedenheit unserer Gehirne und damit eine Vielzahl neurologischer Varianten, die uns ausmachen. Ziel dieses Begriffs ist die Weitung des Verständnisses für die unsichtbaren Bausteine unseres Wahrnehmens, Verhaltens und Erlebens. Es geht darum, diese Tatsache nicht als Krankheit oder Störung zu verstehen, sondern als alternative Möglichkeit, die Welt zu betrachten und mit ihr zu interagieren. Diese Tatsache bezieht sich auf Menschen, die ein Leben mit Autismus, ADS und ADHS, Koordinations- und Entwicklungsunterschieden, Legasthenie und Dyskalkulie (Lese-, Schreib- und Rechenabweichungen), Epilepsie oder Lernschwierigkeiten führen.
Insbesondere in den sozialen Medien und einigen Büchern, die in den letzten Jahren erschienen sind, lässt sich mehr über die Wahrnehmungs- und Gefühlswelt im neurodiversen Spektrum erfahren. Das gesteigerte Interesse für dieses Thema zeigt, wie viele Menschen es gibt, die, wenn überhaupt, erst nach schwierigen und mühsamen Kindheiten im Erwachsenenalter ein Selbstverständnis für ihre Wahrnehmung und ihr Sein entwickeln. So beschreibt der Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen in einem persönlichen Text, wie er vor 30 Jahren als Arzt in der Kinderpsychiatrie ADHS