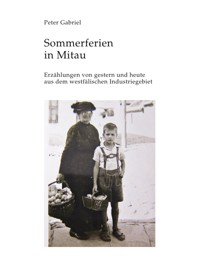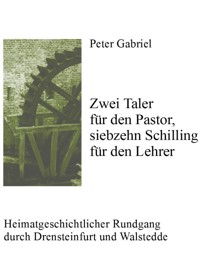
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das beschauliche Leben im westfälischen Provinzstädtchen Drensteinfurt in der beginnenden Neuzeit: eine schöne Vorstellung, aber so war es nicht nur. Wie überall sonst auch lebten die Menschen mal friedlich zusammen, mal stritten sie sich: Während sie eben noch gemeinsam Schützenfest gefeiert hatten, beschwerten sich schon im nächsten Augenblick die Alteingesessenen über die rauen Sitten der zugezogenen Bergleute. Und natürlich stand die Stadt mitten in den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Stürmen der Zeit: Die kurze Blüte des Strontianitbergbaus, die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Gemeinde im Dritten Reich und die Aufnahme schlesischer Vertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg veränderten Drensteinfurt jedesmal aufs Neue. Seit über 40 Jahren wohnt Peter Gabriel in Drensteinfurt und Walstedde und beschäftigt sich seitdem mit der faszinierenden Lokalgeschichte seines Heimatorts. In diesem Buch hat er eine Reihe seiner Veröffentlichungen über Drensteinfurt und seine heutigen Ortsteile Walstedde, Mersch und Ameke zusammengestellt. Wandern Sie mit von der Loreto-Kapelle über die Alte Post bis hin zur ehemaligen jüdischen Synagoge und gewinnen Sie einen Eindruck vom früheren Leben in der westfälischen Provinz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Gabriel: Zwei Taler für den Pastor, siebzehn Schilling für den Lehrer. Heimatgeschichtlicher Rundgang durch Drensteinfurt und Walstedde Copyright © 2006: Peter Gabriel, Drensteinfurt Alle Rechte vorbehalten 2. Auflage 2016 Foto „Lageplan Haus Steinfurt“: Peter Gabriel, Drensteinfurt Titel und Satz: Peter Gabriel, Berlin Titelfoto: Kerstin Greusing, Berlin Verlag: epubli, Berlin ISBN: 978-3-7418-0550-9 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Eine Loreto-Kapelle in Westfalen
Französische Emigranten in Drensteinfurt
Gemächer ohne Licht und Luft
Das hochadelige Gut Steinfurt
Die Regina-Kirche in Drensteinfurt
Die gemeinen Marken
Elektrisches Licht für das Postamt Drensteinfurt
Schwarzfahren in der Postkutschenzeit
Städtchens Verkehr
Ein neues Haus für den Küster
Wo so manche deutsche Lokomotive pfeift
Fertigmachen, Karten lösen, Achtung geben
Die Spur der silbernen Steine
Amtmann mit sechsundzwanzig Jahren
Reichsfreiherr Ignatz von Landsberg-Velen
Schloss Landsberg
Karl Wagenfelds Kindheit in Drensteinfurt
Schulverhältnisse im Amt Drensteinfurt
Die Synagoge in Drensteinfurt
Aus der Liste der Privatschulen gestrichen
Führerbild und Kruzifix
Nur Handgepäck durfte mitgenommen werden
Kleiner Rundgang durch Drensteinfurt
Lehrer und Küster in Walstedde
Siebzehn Schilling für den Herrn Lehrer
Gehorsamster Diener, Lehrer Plettenberg
Ich ging durch das arme Dörfchen auf und ab
Schützenfest und Tanzvergnügen
Großbrände am Kirchplatz in Walstedde
Die neue Chaussee Herbern–Drensteinfurt–Walstedde
Walstedde vor dem Ersten Weltkrieg
Der Kirchplatz in Walstedde
Quellennachweis
Vorwort
Das beschauliche Leben im westfälischen Provinzstädtchen Drensteinfurt in der beginnenden Neuzeit – eine schöne Vorstellung, aber so war es nicht nur. Wie überall sonst auch lebten die Menschen mal friedlich zusammen, mal stritten sie sich: Während sie eben noch gemeinsam Schützenfest gefeiert hatten, beschwerten sich schon im nächsten Augenblick die Alteingesessenen über die rauen Sitten der zugezogenen Bergleute.
Und natürlich stand die Stadt mitten in den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Stürmen der Zeit: Die kurze Blüte des Strontianitbergbaus, die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Gemeinde im Dritten Reich und die Aufnahme schlesischer Vertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg veränderten Drensteinfurt jedesmal aufs Neue.
Seit 40 Jahren wohne ich in Drensteinfurt und Walstedde und beschäftige mich seitdem mit der faszinierenden Lokalgeschichte meines Heimatorts. In diesem Buch habe ich eine Reihe meiner Veröffentlichungen über Drensteinfurt und seine heutigen Ortsteile Walstedde, Mersch und Ameke zusammengestellt. Ich lade Sie ein, mich auf den folgenden Seiten auf einem heimatgeschichtlichen Rundgang durch Drensteinfurt und Walstedde zu begleiten. Wandern Sie mit mir von der Loreto-Kapelle über die Alte Post bis hin zur ehemaligen jüdischen Synagoge und gewinnen Sie einen Eindruck vom früheren Leben in der westfälischen Provinz.
Drensteinfurt, im Februar 2006
Eine Loreto-Kapelle in Westfalen
Engel sollen das Geburtshaus der Maria im Jahre 1291 vor der Zerstörung durch die Mohammedaner gerettet haben. Sie brachten es von Nazareth nach Rijeka, ins heutige Jugoslawien. Drei Jahre und sieben Monate danach, erzählt die Legende weiter, trugen die Engel das Haus wieder fort, diesmal über das Adriatische Meer zur Ostküste Italiens. Dort fand es zunächst bei Recanati und schließlich im benachbarten Loreto seinen Platz. Der Ort lag auf einem Hügelrücken und hieß nach den Lorbeerbäumen, die auf ihm wuchsen, Lauretum, der Lorbeerhain.
Später wurde das Haus kostbar mit Marmor verkleidet und von einer Basilika umbaut. Loreto entwickelte sich rasch zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte Italiens. Berühmt war der Reichtum seiner Schatzkammer, wo die Weihgeschenke von Kaisern, Königen, Päpsten und Bischöfen aufbewahrt wurden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts plünderten französische Soldaten Kapelle und Schatzkammer. Das aus Zedernholz geschnitzte Madonnenbild wurde nach Frankreich verschleppt, bald darauf aber wieder zurückgegeben.
Da die Pilgerfahrten ins Ausland weit und beschwerlich waren, entstanden Nachbildungen der Casa Santa außerhalb Italiens, zu ihnen gehört die Loreto-Kapelle in Drensteinfurt. Johann Matthias von der Reck ließ sie 1726 an der Grenze seines Gerichts, der „Herrlichkeit Steinfurt“, erbauen. Architekt war Lambert Friedrich von Corfey, von dem auch das Schloss in Drensteinfurt stammt. Nah bei der Kapelle wurde ein Fachwerkhaus errichtet, dessen Bewohner den Küsterdienst zu versehen hatten.
Die Wallfahrt zur Loreto-Kapelle fand solchen Anklang, dass zwei Franziskaner aus Münster die Geistlichkeit Drensteinfurts in den Jahren von 1730 bis 1779 unterstützen mussten. Da der Raum in der Kapelle beengt war, hielt man Beichten und Messen für die Pilger in der Pfarrkirche St. Regina ab. Als diese Kirche wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste, unterbrach man die Wallfahrt. Sicher war vorgesehen, sie nach Fertigstellung der neuen Kirche wieder aufleben zu lassen. Die Bauarbeiten zogen sich aber bis 1790 hin. Es scheint finanzielle Schwierigkeiten gegeben zu haben. Ein Jahr zuvor war die Französische Revolution ausgebrochen, ein neuer Zeitgeist rüttelte an den überlieferten Ordnungen. Wahrscheinlich ist ihm die Wallfahrt nach Drensteinfurt zum Opfer gefallen. Seitdem hat die Kapelle nur noch örtliche Bedeutung.
Heute führt eine asphaltierte Straße, die sich vor dem Ortsausgang Drensteinfurt gabelt, an der Loreto-Kapelle vorbei. Früher verließ man die befestigte Stadt durch das Münstertor, überquerte die Wersebrücke und benutzte ein Stück der alten münsterischen Landstraße. Sie war zum Damm aufgeschüttet worden, da sie im Überschwemmungsgebiet der Werse lag. Der Weg führte an Lömkes Kotten und den Fischteichen des Schlossherrn vorbei; er mündete in den Heubrink, wie das dreieckige Stück Land zwischen Sendenhorster und Albersloher Straße genannt wurde. Hier stand die Loreto-Kapelle auf einer kleinen Erhebung des Geländes, ein Ziegelsteinbau von 5 × 15 m Grundfläche, mit einer Vorhalle und einem Glockentürmchen als Dachreiter.
Den Weg zum Heubrink war auch der Jesuitenmörder Johann Slömer, humpelnd und auf Krücken, gegangen. Ein Leineweber hatte ihm bei der Festnahme durchs Knie geschossen. Am Eingang der Lindenallee, wo heute das Kreuz steht, wurde Slömer enthauptet, sein Körper aufs Rad geflochten. Dies geschah vor 1712, als auf dem Heubrink noch eine Vorgängerin der Loreto-Kapelle stand. Auch zu ihr hatte es schon eine Wallfahrt gegeben. Mitte des 17. Jahrhunderts war sie erbaut worden; in den zeitgenössischen Quellen wird sie „sacellum prope Leprosorium“ genannt, die Kapelle beim Aussätzigenhaus. Drensteinfurt besaß auf dem Heubrink also einen Leprosenhof. Obwohl die unheilbar Kranken aus der menschlichen Gesellschaft verstoßen waren und isoliert lebten, hielt man Gottesdienst für sie in der Kapelle und reichte ihnen die Sakramente. Der Dienst an den Aussätzigen gehörte zu den Pflichten des Drensteinfurter Vikars. Als erster wird Franz Melschede genannt, die Fundation der Vikarie war bereits 1426 erfolgt.
Man betritt die Vorhalle der Loreto-Kapelle durch ein blau gestrichenes Holztor. Kräftige, hohe Bögen öffnen das Mauerwerk nach drei Seiten; eine Fensterreihe in der vierten Seite erlaubt den Blick in den Innenraum, wo ein paar Bänke und der schmucklose Altar stehen. In den Feldern der gemalten Kassettendecke leuchten goldene Sterne auf blauem Grund. Sechs Sterne sind in die Sandsteinplatten des Fußbodens eingelassen. Nach Drensteinfurter Überlieferung liegen hier sechs Mönche begraben. Rechts in der Wand ist ein imitierter Mauerriss zu sehen, den ein Blitz verursacht haben soll, als das Vorbild der Kapelle übers Meer getragen wurde. Abgeteilt durch den Altar und ein weißes Gitter liegt im hintersten Teil des Raumes die Sakristei, dort befindet sich die Küche des heiligen Hauses mit Feuerstelle und Brunnen.
Von der Kanonenkugel unter der Decke heißt es, sie habe auf wundersame Weise Papst Julius II. im Jahr 1511 bei der Belagerung einer Stadt verfehlt. Die Madonna in einer Nische hinter dem Altar und die anderen Plastiken gehören nicht zur ursprünglichen Ausstattung. Wegen Diebstahlsgefahr wird das alte Wallfahrtsbild, die Mutter Gottes von Drensteinfurt, nicht mehr in der Kapelle aufbewahrt. Das Gleiche gilt für den armen Lazarus, dem zwei Hunde die Wunden lecken. Die eindrucksvolle Holzfigur stammt noch aus der Leprosenkapelle und erinnert an die Kranken, deren Schutzpatron Lazarus war.
Vorzügliche Bildhauerarbeiten sind die Reliefs über den Türen beider Außenwände. Sie werden Johann Wilhelm Gröninger zugeschrieben. Plastisch und mit bewegten Umrissen heben sich die Figuren vom flachen Hintergrund ab. Das eine Relief stellt die Verkündigung Marias, das andere die Überführung ihres Hauses nach Loreto, translata 1291, dar. Unbefangen und realistisch hat Gröninger die Legende illustriert: Drei Engel tragen das Haus, das die Gestalt einer Kapelle hat, übers Meer. Auf dem Dach sitzt Maria mit dem Jesuskind. Unten am linken Bildrand sieht man eine von Mauern umgebene Stadt; mit geblähten Segeln fährt ein Schiff zum gegenüberliegenden Ufer, wo sich ein Baum vor dem heranschwebenden Haus verneigt. Unmittelbar an die Loreto-Kapelle ließ Engelbert von Landsberg im Jahr 1863 eine Familiengruft anbauen, die später erweitert wurde. Ihre Mauern ruhen auf einem bossierten Sockel. Wie bei der Kapelle sind die Wände durch Blendpfeiler gegliedert. Über dem Eingang hängen ein Kreuz und das Landsberger Wappen.
Am 2. November 1915 wurde hier der Reichsfreiherr Ignatz von Landsberg-Velen beigesetzt. Es war Landrat des Altkreises Lüdinghausen, Mitglied des Herrenhauses und des Reichstags in Berlin gewesen. Als er während des Kulturkampfes Stellung für seine Kirche bezog, versetzte man ihn in den einstweiligen Ruhestand. Landsbergs Beisetzung fand weit über die Grenzen des Münsterlandes hinaus Beachtung. Die Abschiedsstimmung des grauen Novembermorgens scheint das Ende des zweiten deutschen Kaiserreichs vorwegzunehmen. Drei Jahre später brach es, ebenfalls im November, nach dem verlorenen Weltkrieg zusammen.
Den heutigen Besucher der Loreto-Kapelle und der Landsberggruft bewegen Eindrücke ganz anderer Art. Im Sommer duftet es stark nach der Lindenblüte; gelegentlich rauschen Autos an den hoch gewachsenen Alleebäumen und dem Wäldchen vorbei, in dem sich Kapelle und Gruft verstecken. Besorgt schaut jemand vom renovierten Küsterhaus herüber, das wenige Schritte entfernt liegt. Fast scheint es, als seien Besucher hier nicht willkommen. Aber der Eindruck täuscht. Die Sorge gilt ungebetenen Gästen. Mehrfach drangen sie gewaltsam in die Kapelle ein. Beim letzten Mal versuchten Halbwüchsige sogar, von der Sakristei aus in die Gruft zu gelangen, scheiterten jedoch an den dicken Mauern.
Französische Emigranten in Drensteinfurt
Am 14. Juli 1789 wurde in Paris die Bastille, das berüchtigte Staatsgefängnis, von einer aufgebrachten Menschenmenge gestürmt; zwei Jahre später starb Ludwig XVI. unter dem Fallbeil, es folgte die Schreckensherrschaft Robespierres. Die französische Revolution löste eine Massenflucht in die Nachbarländer aus; der Prinz von Artois, ein Bruder des Königs fand mit seinem Gefolge Unterkunft im westfälischen Hamm; etwa 2000 Geistlichen, die sich geweigert hatten, den Eid auf die Verfassung zu schwören, gewährte das Fürstbistum Münster Unterschlupf. Unter dem Schutz des Generalvikars Franz von Fürstenberg hielten sich die Emigranten in Städten und Dörfern auf; Drensteinfurt, Walstedde und Rinkerode wurden vorübergehend Heimat für 30 Flüchtlinge.
Eine Liste gibt Aufschluss über Namen, Stand, Herkunft und Aufenthaltsort. In der Reihe Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen behandelt Peter Veddeler das Thema Französische Emigranten in Westfalen und führt ausgewählte Quellen an. In Drensteinfurt werden 30 Geistliche aufgeführt, je drei davon in Walstedde und Rinkerode. Außer Rang, Herkunftsland und Aufenthaltsort bleiben die meisten anonym, nur bei ganz wenigen erfährt man Näheres über die Art und Weise, wie sie aufgenommen und behandelt wurden. Eine Ausnahme ist der Kanoniker Denis Robelot, der im Schloss von Drensteinfurt mehrere Jahre gewohnt hat. Nachdem in Frankreich wieder geregelte Verhältnisse eingekehrt waren, kehrten die meisten Flüchtlinge in ihre Heimat zurück. Zu ihnen gehörte Robelot, seine Dankesschuld gegenüber dem Gastgeber Baron von Landsberg trägt er in zwei Zeichnungen von „Drensteinfort“ ab. Dargestellt ist der kleine Ort um das Jahr 1800, noch steht das Hammer Tor, ist die Reginakirche einschiffig, der Ort von einem Wall, mit Büschen und Sträucher bepflanzt, umgeben. Schloss und Kirche überragen die Häuser, zu den auffallendsten zählt die Alte Post.
Da es in Wiesmanns Chronik von Drensteinfurt auch einen Stadtplan gibt, der die Situation im Jahre 1800 zeigt, gehört Drensteinfurt zu den wenigen Orten des Münsterlandes, das solchermaßen in Bild und Plan der Nachwelt überliefert ist. Während die Wiesmannsche Chronik im Schloss sorgfältig aufbewahrt wird, sind die beiden Zeichnungen nur noch in Fotokopien vorhanden.
Gemächer ohne Licht und Luft
Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts war Drensteinfurt Sitz eines Patrimonialgerichts, dessen Einflussbereich ursprünglich durch vier, später durch sieben Pfähle begrenzt wurde. 1808, zur Zeit des Großherzogtums Berg, wurde dieses Gericht aufgelöst, die zwei Gefängnisse im Hammer Tor und im Spritzenhaus am Kirchplatz nutzte man aber weiter. Wie Häftlinge dort untergebracht waren, geht aus der Acta betreffend die Polizeigefängnis-Anstalten im Kreis Lüdinghausen hervor.
Auf Anfrage der Königlich-Preußischen Regierung in Münster fertigte Bürgermeister Essing am 12. Januar 1834 eine recht positive Bestandsaufnahme des Drensteinfurter Gefängniswesens an. Der günstigen Verkehrsverhältnisse wegen war die Stadt Zwischenstation für Gefangenentransporte, die länger als einen Tag dauerten. Eine Zelle im Hammer Tor, das zur Stadtbefestigung gehört hatte, war für „Durchkommende und hier übernachtende männliche Gefangene aller Art“, die andere für ebensolche weibliche Gefangene bestimmt. Im Anbau des Spritzenhauses wurden Eingesessene wegen kleinerer Vergehen in „gelinden Gewahrsam“ genommen. Beide Gefängnisse befanden sich laut Essing in einem guten Zustand und „können dieselben auch von einem benachbarten Locale her geheizt werden; jenes sub C (im Spritzenhaus) ist zwar auch gut eingerichtet, kann indeß nicht geheizt werden.“
Für Polizeiarrestanten aus Drensteinfurt wurde ein Verpflegungssatz von 3 ½ bis 4 Silbergroschen und 8 Pfennigen berechnet. Fremden gestand man nur einen Betrag von 2 ½ bis 3 ½ Silbergroschen zu, obwohl diese Unkosten von der Regierung zurückerstattet wurden. Da die meisten Gefangenen nur eine Nacht blieben, verzichtete man darauf, sie mit Arbeiten zu beschäftigen. Die Aufsicht über die Gefängnisse in Drensteinfurt hatte der im Hammer Tor wohnende Gefangenenwärter Sundrup. Seine Kost war von hinreichender Qualität und guter Beschaffenheit. Nahezu ausgeschlossen schien Bürgermeister Essing die „Entspringung“ eines Strafgefangenen zu sein, deshalb brauchten seiner Meinung nach auch keine Veränderungen an den Gebäuden vorgenommen zu werden.
Nachdem sich die Regierung durch eine gründliche Revision vom Zustand der Gefängnisanstalten im Münsterland überzeugt hatte, stellte sie 1836 Richtlinien über Ausstattung und Beschaffenheit solcher Einrichtungen auf. Vorhanden sein mussten: Gute Belüftungsmöglichkeiten und Bettgestelle oder Pritschen mit einer ausreichenden Zahl von Strohmatratzen. Von Zeit zu Zeit war das Stroh zu lüften und durch neues zu ersetzen. Jeder Gefangene sollte eine wollene Decke erhalten, sie hatte stets sauber zu sein und musste in Abständen gewaschen, nötigenfalls auch gewalkt werden. Zum Inventar einer Gefängniszelle gehörten – je nach Bedürfnis – Schemel, Tisch, Wasser-, Trink- und Essgeschirr, außerdem eine Lampe, falls diese so hoch aufgehängt werden konnte, dass ein auf dem Tisch stehender Mann nicht an sie herankam.
Großer Wert wurde auf das Reinigen der Zellen gelegt, vorzugsweise das weibliche Geschlecht sollte zu solchen Arbeiten herangezogen werden. Eine genügende Anzahl von Waschgeschirren und Handtüchern war bereitzustellen, damit sich alle Insassen regelmäßig waschen konnten. Für die Notdurft waren verdeckte Kübel oder sonst passende Gefäße vorgeschrieben, die unmittelbar nach dem Gebrauch sauberzumachen waren. Sorge zu tragen hatte man für die Beheizung der Zellen in den „sechs kalten Monaten“, die vom 15. Oktober bis zum 15. April reichten. Grundsätzlich getrennt unterzubringen waren weibliche und männliche Insassen. Falls ein Gefangener erkrankte und ärztliche Hilfe benötigte, musste sie ihm gewährt werden. Ein Schlusssatz galt der Bekämpfung von Ungeziefer; wo man es bei Gefangenen feststellte, war eine sofortige Säuberung zu veranlassen.
Obwohl alle Gemeinden eine Abschrift der Richtlinien erhielten, scheint man das, was sie beinhalteten, nicht sonderlich ernst genommen zu haben. Als am 25. August 1837 ein Departement-Rat in Drensteinfurt nach dem Rechten sah, fand er sowohl im Hammer Tor als auch im Spritzenhaus „Gemächer ohne Licht und Luft“ vor. In beiden fehlten die vorgeschriebenen Einrichtungsgegenstände. Nicht besser sah es in den Gefängnissen anderer Ort aus, sofern es dort überhaupt welche gab. Der Bürgermeister von Senden musste im Bedarfsfalle erst ein Lokal mieten oder Häftlinge in seiner eigenen Wohnung unterbringen. In Olfen wurde ein altes Schilderhaus als Bett verwandt; ein Stück Leinen diente zum Zudecken. Ganz allgemein herrschten in den Gefängnissen noch mittelalterliche Zustände; es war schwer, Verbesserungen durchzusetzen.
Für seinen Bericht war Bürgermeister Lindgens, Essings Nachfolger, eine Frist von zwei Monaten gesetzt worden. Mit vierzehntägiger Verspätung schrieb er am 9. November 1837, dass in Drensteinfurt jetzt alles in Ordnung sei. „Die erforderlichen Ventils (Luftöffnungen) sind fertig und mit eisernen Stäben versehen.“ Drei neue Decken zum Schutz der Gefangenen gegen Kälte waren auch angeschafft worden. Trotz solcher Erfolgsmeldungen stellte die Regierung weitere Nachforschungen an. Auf gezielte Fragen musste Lindgens einräumen, dass in den Zellen des Hammer Tores und des Spritzenhauses weder Tisch, noch Schemel, noch Lampen vorhanden waren. Es fehlte zwar auch an Trink-, Ess- und Waschgeschirr, aber dazu bestand nach Lindgens keine Notwendigkeit. Diese Gegenstände wurden vom Gefangenenwärter ausgeliehen, „so dass es besonderer Anschaffung nicht bedarf.“
1853 beschwerten sich mehrere Häftlinge, die von Drensteinfurt nach Lüdinghausen gebracht worden waren, über die schlechte Beschaffenheit der Drensteinfurter Gefängnisse. Die Räume waren voller Ungeziefer gewesen, in Lüdinghausen hatte man sämtliche Kleidungsstücke entlausen, das heißt, in Seifenwasser desinfizieren müssen. Amtmann Winkler wurde vom Sekretär des Kreisgerichts ersucht, die fraglichen Räume mit einem neuen Anstrich versehen zu lassen, für sauberes Stroh und Bettläden (Bettgestelle) zu sorgen. Nach Auskunft der Gefangenen hatten die Strohsäcke auf dem Fußboden gelegen. „Überdieß sollen die Fenster an den Gefängnissen so klein sein, dass die Eingesperrten beim Mangel an Lüftung beängstigt wurden. Einer gefälligen Äußerung über diese Mittheilung, und ob den angeblichen Mängeln abgeholfen werden könne, sehen wir entgegen.“
Als nach etwa sechs Wochen immer noch keine Antwort aus Drensteinfurt vorlag, verständigte das Kreisgericht den Landrat. Er reagierte prompt und heftig. Die schlechte Beschaffenheit der Gefängnisse seien ihm schon lange bekannt. Die Gemeinden Stadt und Kirchspiel weigerten sich aber, Abhilfe durch einen Neubau zu schaffen, dabei könne man an den alten Gebäuden keine Veränderungen vornehmen. Er habe jetzt ein Machtwort gesprochen und veranlasst, dass ein neues Gefängnis errichtet werde. Im nächsten Jahr sei mit der Fertigstellung zu rechnen.
Leider geben die Akten im Staatsarchiv Münster keine Auskunft darüber, ob sich der Landrat den widerborstigen Stadtvätern gegenüber hat durchsetzen können. Amtmann Winkler bekam eine schriftliche Rüge: „Euer Wohlgeboren muss ich aufgeben, wenn es noch nicht geschehen, unverzüglich die Unreinlichkeit und das Ungeziefer aus den dortigen Gefängnisse fortschaffen zu lassen, worüber das hiesige Kreisgericht unterm 4. August Beschwerde geführt hat und binnen 6 Tagen Ihren Bericht erwarten, dass vollständige Reinlichkeit hergestellt ist. Ich muss dringend wünschen, dass sich zu einer ähnlichen Beschwerde nicht wieder Anlaß findet.“
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts besserten sich die Zustände in den Gefängnissen des Münsterlandes. Der abnehmende Schriftverkehr zwischen Regierung, Landratsämtern und Gemeinden ist ein sicheres Indiz dafür. Hinzu kam, dass immer mehr kleinere Einrichtungen durch die Zentralisierung der Gefängnisse in den Gerichtsorten ihre Bedeutung verloren. Wie lange das Hammer Tor noch als Polizeigefängnis-Anstalt gedient hat, ist ebenso unbekannt, wie der genaue Zeitpunkt seines Abbruchs.
Das hochadelige Gut Steinfurt
Das Staatsarchiv Münster besitzt nur wenige alte Karten von Drensteinfurt, eine davon ist der General Plan der Gebäude und Gärtens des Hochadligen Guths Steinfurt. Bei der 70 × 50 cm großen, kolorierten Federzeichnung handelt es sich um eine Kopie, die der Landmesser Johann Heinrich Berteling, ohne den Verfasser zu nennen, angefertigt hat. Da die Herstellung von Karten sehr aufwendig und teuer war, wurden Originale früher häufig kopiert oder als Vorlage benutzt.