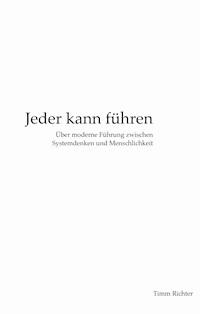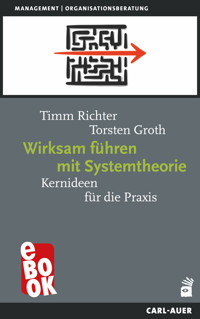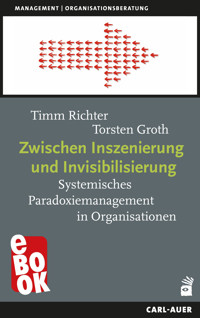
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Management
- Sprache: Deutsch
Hinschauen oder verschleiern? Die Welt der Organisationen ist voller Paradoxien: Wir wollen höchste Qualität, aber niedrige Preise; Kreativität ist uns wichtig, aber Regelbefolgung auch. Wer erst einmal die Paradoxiebrille aufgesetzt hat, blickt grundlegend anders auf den Organisationsalltag und auf die Bemühungen um Planbarkeit, Klarheit und Widerspruchsfreiheit. Timm Richter und Torsten Groth verstehen Paradoxien als erkenntnisfördende Phänomene, die Organisationen helfen, ihr Überleben zu sichern. Die erfahrenen Organisationsberater stellen ein breites Repertoire an Modellen, Techniken und Werkzeugen vor, mit denen typische Paradoxien des Führens und Organisierens identifiziert, aktiv genutzt oder auch kreativ bearbeitet werden können. Das Buch liefert neben klaren Begrifflichkeiten und einem soliden theoretischen Fundament auch handfeste Impulse für die Führung und die Beratung. Zusammenfassende Gebote laden zu einem spielerisch-kreativen Umgang mit Paradoxien ein, der Führungskräfte und Teams (wieder) handlungsfähig macht und ihre Organisation überlebensfähig hält. Die Autoren: Timm Richter, Diplom-Mathematiker, MBA an der MIT Sloan School of Management; geschäftsführender Gesellschafter Simon Weber Friends (gemeinsam mit Torsten Groth) und NEO Culture; vormals Vorstand der XING SE und Geschäftsführer bzw. leitende Führungskraft in verschiedenen Unternehmen. Torsten Groth, Dipl.-Soz.-Wiss., selbstständiger Organisationsberater, Referent und Trainer; Gastgeber des Club-Systemtheorie; geschäftsführender Gesellschafter von Simon Weber Friends (gemeinsam mit Timm Richter). Beratungsschwerpunkte: Strategie und Führung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, Begleitung von Veränderungsprozessen. Veröffentlichungen u. a. "Mehr-Generationen-Familienunternehmen. Erfolgsgeheimnisse von Oetker, Merck, Haniel u. a." (3. Aufl. 2017, zus. mit F. B. Simon und R. Wimmer), "66 Gebote systemischen Denkens und Handelns in Management und Beratung" (4. Aufl. 2022).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Reihe Management / Organisationsberatung
Die heutige Gesellschaft ist eine organisierte Gesellschaft. Man muss schon lange suchen, um überhaupt noch Bereiche zu finden, die nicht von Organisationen geprägt sind. Unternehmen jedweder Größe und Eigentumsform, Verwaltungen, Schulen, Gerichte, Krankenhäuser, Universitäten, Kirchen, Verbände, Parteien, Vereine etc. – allesamt übernehmen sie gesellschaftliche Funktionen und bestimmen unser Leben. Die Fülle an Aufgaben, die unter den Bedingungen zunehmender Globalisierung und Digitalisierung gleichzeitig zu erfüllen sind, wie auch die Bandbreite an Organisationskonzepten und Führungsansätzen, mit denen der komplexe Alltag bewältigt werden soll, stecken das Feld ab, in dem Management und Beratung mehr oder weniger wirksam werden.
Die Zeiten, in denen es einfache Antworten auf die vielfältigen Fragen zur Überlebenssicherung einer Organisation und auch zur Steuerung tagtäglicher Entscheidungsprozesse gab, sind seit Langem vorüber. Der Komplexität, mit der heute alle konfrontiert sind, die in verantwortlichen Funktionen in und mit Organisationen arbeiten – Führungskräfte, Manager und Organisationsberater etc. –, wird man mit Rezeptwissen nicht mehr gerecht. Hier setzen die neuere Systemtheorie und mit ihr die Reihe Management/Organisationsberatung im Carl-Auer Verlag an. Beide liefern Konzepte und »Landkarten«, die auch im unübersichtlichen Terrain von Wirtschaft und Organisation Orientierung ermöglichen und Handlungsfähigkeit sicherstellen.
Das Ziel der Reihe ist es, empirisch gehaltvolle Forschungen über die Prozesse des Organisierens wie auch theoretisch angemessene Führungs- und Beratungsansätze zu präsentieren. Zugleich sollen bewährte Methoden einer system- und lösungsorientierten Praxis im Kontext von Organisationen überprüft und neue Ansätze entwickelt werden.
Torsten Groth Herausgeber der Reihe Management/Organisationsberatung
Timm Richter / Torsten Groth
Zwischen Inszenierung und Invisibilisierung
Systemisches Paradoxiemanagement in Organisationen
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe »Management und Organisationsberatung« hrsg. von Torsten Groth
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagmotiv und Illustrationen: © Britta Ulrich, www.vizworks.de
Redaktion: Alexander Eckerlin
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0579-4 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8522-2 (ePUB)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Vorwort und Einleitung
1 Das kann doch nicht wahr sein! – Begriffsklärung Paradoxie
1.1 Die logische Paradoxie
1.2 Die pragmatische Paradoxie
2 Beständige Begleiter – Über die Unvermeidbarkeit von Paradoxien in Erkenntnisprozessen
2.1 Landkarten und Modelle identifizieren (verwechseln) Verschiedenes als gleich
2.2 Komplexitätsreduktion verpackt Endloses in endliche Form
2.3 Ein Beobachter hat nur Zugang zu seiner subjektiven Objektivität
2.4 Sprache verspricht Eindeutigkeit, die sie nicht liefern kann
2.5 Beobachten erzeugt eine Einheit einer Differenz
3 Wir haben keine Chance, die sollten wir nutzen – Funktion und Folgen von Erkenntnisparadoxien
3.1 Paradoxien schaffen kontaktlosen Kontakt mit der Wirklichkeit
3.2 Der größte Unterschied: Paradoxien akzeptieren!
3.3 Die Möglichkeit: Kreativ werden!
Kontext erweitern oder ausblenden
Beobachterposition ändern
Verwendete Unterschiede variieren
3.4 Freiheit und Notwendigkeit: Übernahme von persönlicher Verantwortung
4 Als ob man richtig entscheiden könnte – Entscheidungen
4.1 Entscheidungen binden Zukunft und ersetzen Information
4.2 Entfaltungen der Entscheidungsparadoxie
4.3 Ein paradoxiebewusster Umgang mit Entscheidungen
5 Aus zwei mach vier – Die praktische Entfaltung von Paradoxien
5.1 Die Erweiterung eines paradoxen Dilemmas in ein Tetralemma
5.2 Mehr Lösungsmöglichkeiten durch die Unterscheidung von Action und Talk
5.3 Typische Problemmuster sozialer Dynamiken bei der Bearbeitung von Paradoxien und der Umgang mit ihnen
Pseudo-Harmonie-Muster
Splitting- bzw. Boom/Bust-Muster
Chaos-Muster
6 Womit entscheidend zu rechnen ist – Grundparadoxien in Organisationen
6.1 Organisation des Überlebens
System (Innen) und Umwelt (Außen): Das Außen wird innen erzeugt
Dynamik (Ereignisse) und Stabilität (Erwartungsstrukturen): Das Stabile wird dynamisch erzeugt
Vergangenheit und Zukunft: Zeiten werden in der Gegenwart erzeugt
6.2 Kopplung an relevante Umwelten
Markt- und Wettbewerbsumfeld: Exploitation – Exploration
Mitglieder: Rolle (Rollenanforderungen) – Person (Individualbedürfnisse)
Teilsysteme: Differenzierung – Integration
6.3 Einbindung von Teams
7 Paradoxien praktisch am Wickel – (Meta-)Werkzeuge zur Paradoxiebearbeitung
7.1 Arbeit an Unterschiedsbildung
7.2 Arbeit mit dem Paradoxiezirkel
8 Es bleibt paradox: Gebote des Paradoxiemanagements, die das Problem nicht lösen und genau deswegen brauchbar sind
Unterscheide Landkarte (Modell) und Landschaft (Modelliertes)!
Sei dir bewusst, dass in der Unterscheidung von Landkarte und Landschaft immer Paradoxien schlummern!
Betrachte auftauchende Probleme als Hinweis, dass eine Landkarte nicht zur Landschaft passt!
Erkunde die Paradoxien hinter den Problemen!
Akzeptiere, dass Paradoxien unlösbar sind!
Identifiziere das Gute und den Preis aller Paradoxien!
Bewundere den Status quo!
Verflüssige Wirklichkeitskonstruktionen!
Habe explizit implizite Kontexte im Blick!
Suche nach funktionalen Äquivalenten!
Schätze provisorische Lösungen!
Betreibe Invisibilisierung oder Visibilisierung von Paradoxien mit Bedacht!
Bewahre dir eine spielerische Leichtigkeit!
Literatur
Über die Autoren
Vorwort und Einleitung
»Wenn das soziale Leben selbst nicht logisch sauber arbeitet, läßt sich auch eine Theorie des Sozialen nicht logisch widerspruchsfrei formulieren.«
Luhmann (1984), S. 491
Wer dieses Buch in den Händen hält, wird sich vielleicht die Frage stellen, für welches Problem Paradoxiemanagement die Lösung ist. Mehr noch: Wird hier nicht zwar ein wichtiges, aber doch sehr spezielles Problem des Organisierens behandelt?
Unsere These, die wir im Verlauf des Buches entwickeln werden, lautet: Alle komplexen Entscheidungsprobleme des Lebens- und Organisationsalltags wie auch deren erfolgreichen Lösungsversuche lassen sich im Kern auf die Handhabung von Paradoxien zurückführen. Damit wird schon deutlich, dass wir uns in diesem Grundlagenbuch nicht mit einem Spezialthema beschäftigen. Im Gegenteil: Lebensglück wie Lebensunglück und vor allem auch Organisationserfolge wie -misserfolge lassen sich auf passendere oder weniger passende Formen des Paradoxiemanagements zurückführen. Auch wenn sich viele Ideen zur Handhabung von Paradoxien prinzipiell auf alle Lebensbereiche anwenden lassen, so werden wir uns auf Organisations-, Führungs- und Beratungsphänomene fokussieren.
Wenn unsere These stimmt, dass Erfolg wie Misserfolg von Organisationen aufs Engste mit der Handhabung von Paradoxien verknüpft sind, dann ist das Buch für alle Leserinnen und Leser relevant, die über einen »Generalschlüssel« Zugang zum Phänomen Organisation erlangen möchten – aus welchen Motiven auch immer, z. B., um wirksame Führungsimpulse zu setzen, um Beratungsprozesse intelligent zu gestalten oder auch um ganz allgemein den organisationalen Alltag besser zu verstehen. Doch Achtung, dieser »Generalschlüssel« ist lediglich als paradoxe Lösung zu verstehen. Denn Paradoxien, die uns die komplexen Probleme bescheren, sind prinzipiell unlösbar. Wenn, wie wir anhand vieler Grundfragen und Beispiele zeigen werden, in vielen Situationen etwas zugleich als »richtig« und »falsch« bewertet wird, hilft auch das Schema »Problem und Lösung« nicht mehr. Probleme, die auch Lösungen sind, und Lösungen, die auch Probleme sind, können lediglich so verschoben werden, dass sie weniger stören. Aber in dieser Erkenntnis der unlösbaren Verstrickung von Problem und Lösung ist, so werden wir argumentieren, die »Lösung« für den Umgang mit komplexen Problemen versteckt. Ein aktives, bewusstes Paradoxiemanagement hilft dabei, die Spielfähigkeit in und von Organisationen und damit die Überlebensfähigkeit zu stärken.
Mit dem Begriff des Paradoxiemanagements ist also – darauf möchten wir gleich am Anfang hinweisen – nicht gemeint, dass man alles unter Kontrolle oder im Griff hat. Bescheidener aber gleichwohl wirkungsvoll geht es darum, in Alltagssituationen und Organisationsfragen Dinge angemessen gut geregelt zu bekommen. Paradoxiemanagement ist für uns keine Wissenschaft, sondern eine theoretisch informierte Praxis zwischen Kunst und Handwerk.
Wie nahe das Überleben einer Organisation mit dem Paradoxiemanagement und wie tragisch nahe wiederum dieses mit Leben und Tod von Menschen zu tun haben kann, zeigt der Fall Boeing, der seit Jahren von der US-Aufsichtsbehörde und in diversen Ausschüssen untersucht wird:
»Neue brisante E-Mails könnten dem kriselnden US-Flugzeugbauer Boeing mit seinem Unglücksflieger 737 Max weiteren Ärger einbringen. Der Konzern habe gegenüber der Luftfahrtaufsicht FAA interne Nachrichten zur 737 Max offengelegt, die ein ›sehr verstörendes Bild‹ zeichneten, teilte der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses laut Medienberichten vom Donnerstag mit.
In den Aufzeichnungen hätten einige Boeing-Mitarbeiter Bedenken geäußert, dass der Hersteller die Sicherheit vernachlässige, während andere darauf drängten, dass Produktionspläne eingehalten werden.« (Stern.de 2019)
»Sicherheit« und »Einhaltung der Produktionspläne« erweisen sich in diesem Fall – wie man im Jahr 2024 noch viel deutlicher erkennen konnte – als ein paradoxes Dilemma: Auf höhere Sicherheit zu setzen hätte bedeutet, eine kritische Überprüfung bis hin zur aufwendigen Neuprogrammierung der Sicherheitssoftware durchzuführen. Kurz: Es hätte mehr Zeit und Geld benötigt und damit wäre zwangsläufig eine Nichteinhaltung der Pläne und ein Verfehlen der ökonomischen Vorgaben eingetreten. Die Einhaltung der Pläne wiederum führte dazu, dass das Flugzeug mit einer Software ausgeliefert wurde, die in bestimmten Situationen das Flugzeug zum Absturz bringt. Boeing hat also zum Teil flugunfähige Maschinen ausgeliefert. Es ist paradox: Mehr (technische) Sicherheit führt zu (kommerzieller) Unsicherheit und die Einhaltung von Produktionsplänen (in der Gegenwart) führt zur Nichteinhaltung von Produktionsplänen (in der Zukunft).
Am Beispiel von Boeing lässt sich eindrücklich erkennen, dass es beim Umgang mit paradoxen Handlungsaufforderungen um mehr geht als um achselzuckend hinzunehmende Spannungsfelder, kosmetische Verbesserungen oder um Ausnahmesituationen, in die Einzelne geraten können. Es geht im vorliegenden Buch um fundamentale Fragestellungen:
Wie kann ein Unternehmen Erkenntnis über die Welt erlangen, wenn das Weltbild – wie wir sehen werden – lediglich intern erzeugt wird?
Wie werden Entscheidungen getroffen vor dem Hintergrund, dass es immer wählbare Alternativen gibt und man vor einer Entscheidung nicht weiß, welche Alternative die bessere ist?
Wie soll man eine Organisation strukturieren, wenn es vielfältige Anforderungen an die Struktur gibt, die für sich genommen sinnvoll sind, aber nicht zusammenpassen, z. B. zentral gesteuerte Synergien vs. unternehmerische dezentrale Autonomie?
Wie kann Wandel gelingen, der die Stärken der Organisation erhält und Neuerungen einführt?
Aus der Behandlung paradoxer Grundfragen des Organisierens lassen sich sodann Verknüpfungen herstellen zu allen möglichen Praxisfragen, die nicht zufällig als unlösbar erscheinen und die dauerhafte Konflikte in Unternehmen befeuern oder Verantwortungsträgern schlaflose Nächte bereiten: Wie können wir das Silodenken verhindern, Post-Merger-Probleme beseitigen, Kulturkämpfe befrieden, Innovations- und Strategiedefizite ausgleichen, Kernkompetenzen entwickeln, neue Kunden oder auch Fachkräfte gewinnen, die Digitalisierung vorantreiben, das Unternehmen agiler gestalten usw.?
In diesem Grundlagenbuch werden wir den Mehrwert aufzeigen, die paradoxe Fundierung einer selbsterzeugten Welt anzunehmen. Immer wenn – so unser Angebot – ein Konflikt oder auch ein Problem dauerhaft nicht gelöst werden kann, ist es ratsam zu vermuten, dass Paradoxien wirken, die nicht gesehen werden. Und dass Paradoxien oft nicht gesehen werden, hat – so viel sei bereits verraten – mit ihrer zweischneidigen Seinsqualität zu tun. Es gibt sie nicht und es gibt sie doch. Sie finden sich nirgendwo und sind allgegenwärtig. Sie sind nicht mehr, aber auch nicht weniger als Beobachterphänomene. Als Beobachterphänomene sind sie imaginäre Konstrukte, aber als Konstrukte real, wenn sie bei der Beobachtung ernst genommen werden. Hier wie auch sonst gilt: Wer erfindet, der findet! Paradoxien sind Erfindungen, die in der Praxis – im Beobachten und im Erklären sozialer Situationen – einen großen Unterschied machen können.
Wir laden – salopp formuliert – dazu ein, eine Paradoxiebrille aufzusetzen. Denn Organisationen entwickeln einerseits bewundernswerte Praktiken, Paradoxien nicht in Erscheinung treten zu lassen, sie zu invisibilisieren und latent zu nutzen, und andererseits Inszenierungstechniken, die die übergeordnete Funktion haben, so zu tun, alles hätte man alles im Griff, als stecke hinter allem eine rationale Idee, ein guter Plan. Eine Paradoxiebrille deckt die Invisibilisierungs- und Inszenierungspraktiken auf und hilft, die (relevantesten) Paradoxien in Organisationen zu beobachten und gelingende Praxis im Umgang mit ihnen zu stärken. Wenn diese Praktiken allerdings nicht mehr passen, werden Paradoxien problematisch. In diesen Fällen erkennt man sie mit der Paradoxiebrille nicht als störende Irritation, sondern als Möglichkeit, den Alltag brauchbar anders zu verstehen und darüber nicht »verrückt«, sondern »kreativ« zu werden (vgl. Bateson et al. 1956). Für unsere Schwerpunktthemen Führung und Beratung von Organisationen erhöht die Paradoxiebrille die Wahrscheinlichkeit, an relevanten Stellen auf eine produktive Art zu intervenieren, um komplexe Probleme zu bearbeiten und die Resilienz von Organisationen zu erhöhen.
Das Buch lässt sich grob in drei Abschnitte unterteilen: Die Kapitel 1 bis 3 bieten eine Einführung zur Idee der Paradoxie und erste allgemeine Ansatzpunkte für Interventionen. Sie sorgen für ein festes begriffliches Fundament und einen theoretischen Bezugsrahmen für das Paradoxiemanagement. Die Kapitel 4 bis 6 wenden die Paradoxietheorie konkret auf Organisationen an und erläutern, welche Paradoxien in Organisationen auftreten und wie ein guter Umgang mit ihnen gelingen kann. Wer direkt praktisch einsteigen will, kann die Kapitel 1 bis 3 erstmal überspringen. Jedes der Kapitel 1 bis 7 enthält am Ende eine Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse und Hinweise, wie man paradoxiebewusst neu agieren könnte. In Kapitel 7 und 8 wird dieser Praxisbezug noch erhöht: Es werden Werkzeuge, v. a. der »Paradoxiezirkel«, vorgestellt und Gebote zum Paradoxiemanagement formuliert.
Was erwartet die Leserin, den Leser im Einzelnen? Im ersten Kapitel machen wir einen Vorschlag, wie man die Begriffsvielfalt ordnen und aufeinander beziehen kann, um eine abgestimmte begriffliche Basis zu schaffen. Es wird außerdem herausgearbeitet, warum pragmatische Paradoxien für den Organisationsalltag so wichtig sind. Das zweite Kapitel zeigt auf, dass alle Beobachter sich unweigerlich in Paradoxien verstricken, wenn sie Landkarten bzw. Modelle von der Landschaft bzw. der Wirklichkeit erstellen. Somit wird die Tragweite sichtbar, die Paradoxien für unser Erkennen und Agieren in komplexen Umwelten haben. Wir – und auch Organisationen – können mit der Realität nicht direkt in Kontakt kommen, deswegen wird mit einem »als ob« gearbeitet … als ob unsere Wirklichkeitskonstruktionen die Realität repräsentieren könnten. In diesem zweiten Kapitel geben wir schon erste Hinweise, worauf man im Umgang mit Paradoxien achten sollte und welche Unterschiedsbildungen in Wirklichkeitskonstruktionen relevant sind. Daran anschließend leiten wir im dritten Kapitel ab, dass selbsterzeugte Wirklichkeitskonstruktionen nützlich und risikoreich zugleich sind. Nützlich, weil sie einen nicht möglichen Realitätskontakt ersetzen; risikoreich, da eine fehlende Stimmigkeit mit der Realität überlebensbedrohend (für Organisationen) sein kann. Kurz gesagt: Die Funktion von Paradoxien ist zweigeteilt. Sie ermöglichen zum einen überhaupt erst Erkenntnis; und zum anderen weisen Paradoxien, die stören und auffallen, darauf hin, dass etwas mit den eigenen Wirklichkeitskonstruktionen nicht stimmig ist.
Der zweite Teil des Buches beginnt im vierten Kapitel mit Entscheidungen. Entscheidungen sind der »Stoff«, aus dem Organisationen gewebt sind. Und sie sind – wie könnte es anders sein – paradox. Wir zeigen auf, mit welchen Formen und mit welcher Kunstfertigkeit Organisationen diese basale Paradoxie bearbeiten. Und danach werden wir herleiten, dass die Rationalität von Entscheidungen gar nicht in der »Richtigkeit« der Wahl, sondern im Prozess des Entscheidens liegt. Im fünften Kapitel stellen wir grundsätzliche Strategien und ein wesentliches Werkzeug – das Tetralemma – vor, mit denen man ein gelingendes Paradoxiemanagement gestalten kann. Mit dem Tetralemma kann man Entscheidungsoptionen, Kommunikationsformen und auch Grundmuster von organisationalen Konflikten erklären und bearbeiten – ein Schweizer Taschenmesser für die Paradoxiearbeit.
Neben Entscheidungsparadoxien gibt es andere grundlegende Paradoxien in Organisationen, über die eine Organisation sich selbst erzeugt und Kopplungen mit relevanten Umwelten herstellt, z. B. Märkten, Mitarbeitenden, Beratungen etc. Wer die Resilienz von Organisationen erhöhen und auftretende Probleme in komplexen Situationen wirksam bearbeiten möchte, der wendet seinen Blick auf genau diese Paradoxien, die wir im sechsten Kapitel ausführlich vorstellen. Damit hat man auch eine Checkliste, um neuralgische Punkte im Organisationsalltag zu identifizieren.
Und wie man handwerklich störende Paradoxien identifiziert und zu Entfaltungen kommt, die die Paradoxie an eine weniger störende Stelle schieben, davon ist im siebten Kapitel die Rede. In diesem stellen wir als Meta-Tool den »Paradoxiezirkel« vor mit seinen drei Prozessschritten und ergänzenden Werkzeugen. Zum Abschluss gibt es Gebote, die noch einmal die wesentlichen Handlungsempfehlungen aus allen Kapiteln kondensieren. Wobei wir darauf hinweisen möchten: Die Gebote sind lediglich Fingerzeige, die ein gelingendes Paradoxiemanagement in der Praxis wahrscheinlicher machen.
Dieses Buch ist im Kontext von Simon Weber Friends (swf) entstanden, und dieser Kontext wiederum ist stark vom Gründer Fritz B. Simon geprägt. Als Teil der Heidelberger Gruppe der Familientherapie hat er sich schon früh mit der Relevanz von Paradoxien beschäftigt – zunächst eher in therapeutischen Kontexten und später vermehrt in seinen Arbeiten zur Organisationstheorie oder zur Theorie des Familienunternehmens. Ihm zuvorderst haben wir zu danken für viele grundlegende Ideen, die in swf-Ausbildungen gelehrt werden und die mit in das Manuskript eingeflossen sind. Viele unserer Gedankengänge und Ideen sind co-kreativ mit den Kollegen Stefan Günther und Gerhard Krejci entstanden in unseren zahlreichen, gemeinsam durchgeführten Seminaren und Beratungen. Beide haben uns wertvolle Hinweise zur Verbesserung des Manuskriptes gegeben, wie auch Nele Schön, Dietmar Nolting, Dirk Baecker, Franziska Stiegler, Patrick Sailer und Fritz B. Simon. Ihnen allen danken wir herzlich wie auch unserer Grafikerin Britta Ulrich und Detlef Pollack für die titelgebende Figur der Inszenierung und Invisibilisierung. Zu guter Letzt sind wir dem Carl-Auer Verlag zu großem Dank verpflichtet, ein Verlag, der wie kein zweiter dafür sorgt, dass systemisches und systemtheoretischen Denken vermittelt wird, und der das Projekt, insbesondere durch das umsichtige Lektorat von Alexander Eckerlin, wie gewohnt professionell begleitet hat.
Timm Richter und Torsten Groth
Hamburg/Münster, im Herbst 2024
1 Das kann doch nicht wahr sein! – Begriffsklärung Paradoxie
»Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.«
Heinz von Foerster
Der Näherungsversuch an den Begriff der Paradoxie gestaltet sich paradox. Je genauer man hinschaut, um Klarheit zu gewinnen, desto verworrener wird es: Warum Paradoxie und nicht Widerspruch, warum pragmatische Paradoxie und nicht logische …? Mindestens seit der Antike – als Epimenides der Kreter sagte: »Alle Kreter sind Lügner« – beschäftigt sich die Philosophie mit Paradoxien und Fragestellungen, in denen die Logik nicht nur nicht hilft, sondern einen immer weiter verstrickt. Wenn die Aussage richtig ist, dann ist Epimenides ein Lügner, was bedeutet, dass seine Aussage doch nicht stimmt, also sagt er die Wahrheit … Dieses wertvolle Wissen und auch der Begriff der Paradoxie wurden über Jahrhunderte vergessen oder von dem berühmten Mathematiker Russell in seiner Typenlehre verboten (Russell 1903). Erst seit wenigen Jahrzehnten erfährt der Begriff eine (kleine) Renaissance, zunächst in der Familientherapie in Form eines »Doublebind« (Bateson et al. 1956) oder als »paradoxe Intervention« (Selvini-Palazzoli et al. 1977) und vor allem mit Luhmanns Arbeiten zur Organisationstheorie. Das schillernde Phänomen der Paradoxie hat eine Vielzahl von unterschiedlichen Interpretationen in unterschiedlichen Disziplinen hervorgebracht. In diesem ersten Kapitel wollen wir zunächst einen Begriffsrahmen schaffen, der uns brauchbar für die Arbeit mit Paradoxien im Organisationskontext erscheint. Dazu unterscheiden wir – kurz und knapp – logische und pragmatische Paradoxien.
1.1 Die logische Paradoxie
Eine logische Paradoxie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man durch logisches Schließen keine abschließende Lösung findet, denn es gibt keine richtige Lösung. Schauen wir uns hierzu zwei oft zitierte logische Paradoxien an:
a)
Dieser Satz ist nicht wahr.
b)
Der Barbier rasiert alle Männer, die sich nicht selbst rasieren. Wer rasiert den Barbier?
Wenn Satz a) wahr ist, dann besagt er selbst, dass er falsch ist. Ist der Satz aber falsch, dann folgt aus der Behauptung »Dieser Satz ist nicht wahr« gerade, dass der Satz wahr ist. Die Behauptung lässt durch den Selbstbezug nur den logischen Schluss zu, dass sie zugleich wahr und falsch sein muss. Paradox! Ähnlich beim Barbier: Wenn er sich nicht selbst rasiert, dann gehört er zu den Menschen, die von ihm rasiert werden. Aber wenn er sich deswegen selbst rasiert, dann gehört er gerade nicht zu den Menschen, die er rasiert?! In beiden Beispielen führt ein selbsterzeugter Widerspruch – nämlich dass sowohl A als auch nicht-A gelten soll (der Satz scheint wahr und nicht wahr zu sein; der Barbier rasiert sich und er rasiert sich nicht) – zu der nicht endenden Oszillation: Weil die Position A gilt, folgt daraus logisch nicht-A … und umgekehrt. Und in der Logik muss eben entweder A oder aber nicht-A gelten, etwas anderes gibt es nicht. Logische Paradoxien stören Logiker, da die Paradoxien durch logisches Schließen sich selbst erzeugen und sie stören Praktiker, da sie keine anwendbare Lösung finden; wie so oft versteht es Luhmann, alles kurz und knapp auf den Punkt zu bringen:
»Unter Paradoxie verstehen wir einen Gegenstand einer Beobachtung, die den Beobachter zum endlosen Oszillieren zwischen zwei Positionen zwingt.« (Luhmann 2017, S. 34)
Verknüpft mit dieser Idee des dauerhaften Oszillierens, auf die wir immer wieder zu sprechen kommen werden, steckt in den zitierten Beispielen mehr drin als ein nettes, aber eigentlich für die Praxis irrelevantes Gedankenspiel. Denn Anlässe zum endlosen Oszillieren tauchen im (Organisations-)Alltag immer auf – oft sichtbar, zuweilen auch verdeckt. Auch dazu einige Beispiele, die sicherlich vertraut wirken:
In einem offenen Konflikt, z. B. bei internen Auseinandersetzungen oder in einem Preiswettbewerb, kommt es zu einer Oszillation zwischen Symmetrie und Asymmetrie. Typischerweise folgt der Streit dem Muster, der jeweils andere habe angefangen, man selbst hingegen reagiere nur, um diese Ungleichheit zu beenden … und der Konflikt setzt sich fort. Beide Parteien folgen der Logik »Auge um Auge, Zahn um Zahn«, meinen also, Symmetrie anzustreben. Weil sie aber der jeweils anderen Seite einen asymmetrischen »Vorsprung« unterstellen (die andere Partei hat angefangen), ergreifen sie selbst eine asymmetrische Maßnahme (sie reagieren), was eine ähnliche Reaktion der anderen Partei (mit derselben Begründung: »wir reagieren nur«) zur Folge hat. Über diese abwechselnde Asymmetrie ergibt sich in Summe eine dynamisch erzeugte, stabile Symmetrie des sich fortsetzenden Konflikts. Eine paradoxe Situation.
Aktuell wollen viele Organisationen hierarchiefreies Arbeiten einführen. Doch wie kann eine Geschäftsführung hierarchiefreies Arbeiten nicht-hierarchisch einführen bzw. sicherstellen? Wenn sie hierarchiefreies Arbeiten hierarchisch verordnet, ist es nicht hierarchiefrei. Und wenn manche Mitarbeitende sich (untereinander und der Geschäftsführung gegenüber) hierarchisch verhalten, kann sie dies nicht nicht-hierarchisch unterbinden. Mit Logik ist auch diese Situation nicht zu klären und nicht zufällig dreht sich in der oft problematischen Praxis vieles um die Gleichzeitigkeit von Hierarchie und Hierarchiefreiheit.
Agile Methoden arbeiten mit der Idee einer fest programmierten Flexibilität. Die Verfasser des agilen Manifestes haben (zu Recht) bemängelt, dass die Entwicklung von Software mit der Wasserfallmethode (in manchen Kontexten) zu unflexibel ist. Deswegen haben sie Empfehlungen gegeben, mit welchen anderen Methoden man Flexibilität erreichen kann. Streng logisch ist das paradox: Wenn man (volle) Flexibilität möchte, kann man nicht (fixiert) vorschreiben, wie gearbeitet werden soll. Soll hingegen verlässlich Flexibilität entstehen, muss man das Vorgehen – in unserem Fall durch agile Methoden – programmieren.
Man bekommt schon bei diesen Beispielen eine Idee davon, dass sich der Blick auf beobachtete Phänomene ändert, sobald man sie mit einer Paradoxie erklärt. Wie genau das geht und wie man Paradoxien nutzen kann, werden wir in den folgenden Kapiteln ausführen.
1.2 Die pragmatische Paradoxie
Bei allen bisherigen Beispielen zu logischen Paradoxien wurden Sachverhalte betrachtet, zu denen es zwei widersprüchliche Positionen gibt, zwischen denen man durch logische Schlussfolgerungen oszilliert. Etwas ist wahr, weil es falsch ist, begrenzt weil unbegrenzt, symmetrisch weil asymmetrisch, usw. Es drehte sich um Aussagen über die Welt. Bei pragmatischen Paradoxien kommt der Aspekt der Handlungsaufforderung hinzu. Ein Beispiel findet sich in Abbildung 1. Schilder im Straßenverkehr fordern uns auf, beachtet zu werden, aber wenn man dieses Schild beachtet, erfährt man, dass man es nicht beachten soll. Diese beiden Handlungsaufforderungen passen offensichtlich nicht zusammen. Weitere Beispiele für paradoxe Handlungsaufforderungen dieser Art sind:
Sei spontan!
Mache etwas freiwillig!
Wolle, was du sollst z. B. bei Kindern das Zimmer aufräumen, in Liebesbeziehungen interessiert sein, …)!
Abb.
1:
Eine paradoxe Handlungsaufforderung