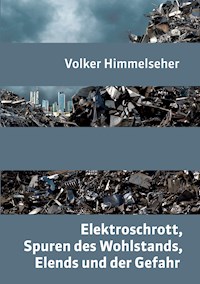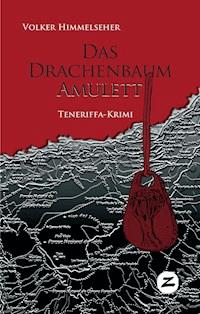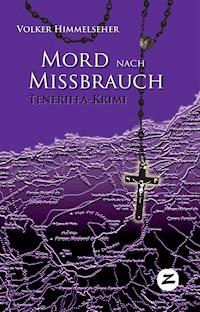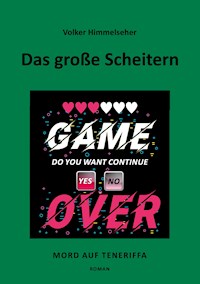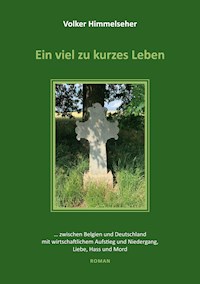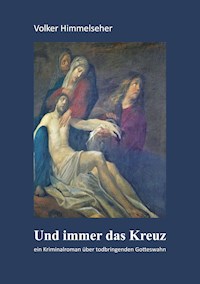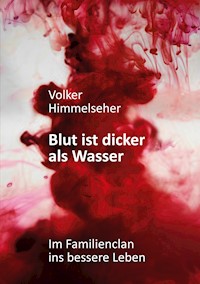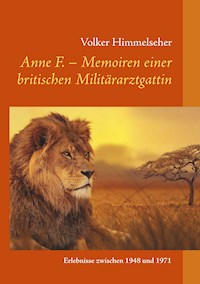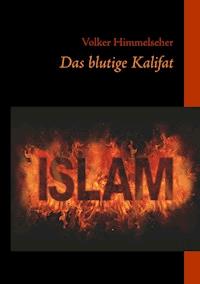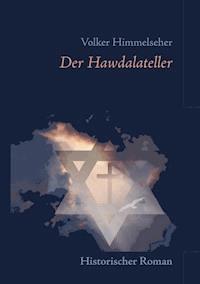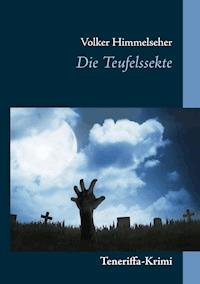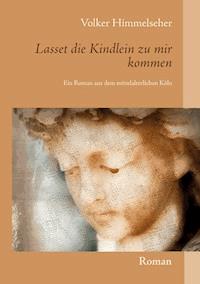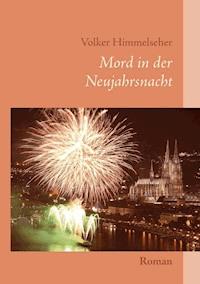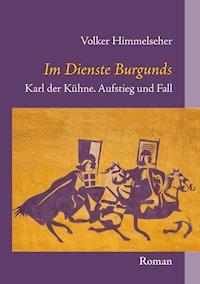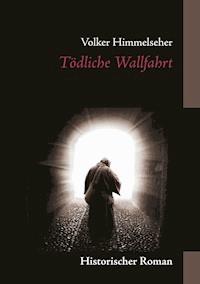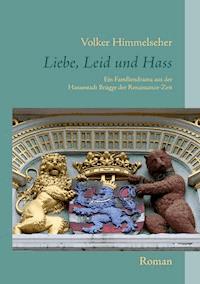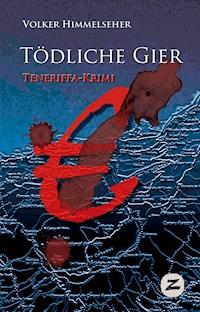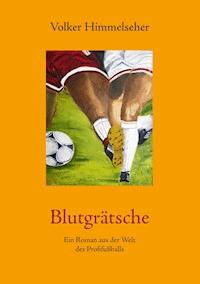
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Profifußball wird immer mehr vom Streben nach großem Geld und politischen Überlegungen bestimmt. Er muss Gewinne generieren und Nationalstolz befriedigen. Immer neue Attraktionen müssen her. Dazu werden auch „Kinderkicker“ entdeckt, gedrillt, um eine unbeschwerte Jugend betrogen und so früh wie möglich zu Ausnahmespielern geformt. Alles geschieht unter dem Deckmantel der Fürsorge und mit dem Versprechen, den Lebensstandard zu verbessern. Doch was passiert, wenn ein Hoffnungskind erkrankt oder verunfallt? Wer interessiert sich dann noch für sein Schicksal? Die Antwort ist grausam: Wo gehobelt wird, fallen Späne! Am Schicksal eines jungen Afrikaners wird die Tragik eines solchen Lebensweges geschildert. Dr. Volker Himmelseher ist Kaufmann und führte ein großes Unternehmen in Köln. Am Beginn seines Ruhestandes begann er historische Romane und Kriminalromane zu schreiben. Dies ist sein erster Roman aus der Welt des Sports.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Autors
Raum Frankfurt
Doha in Katar
Raum Frankfurt
Stippvisite in Doha
Raum Frankfurt
Douala
Nelsons Einzug in Doha
Marseille, Stadt des Durchbruchs für Nelson?
Zurück in Deutschland
Vorwort des Autors
Fußball erweckt große Emotionen, hat dabei aber auch eine dunkle Seite. Wo Flutlicht strahlt, findet sich eben Schatten!
Die Helden der Geschichte sehen zunächst wie Sieger aus.
Sie durchleiden aber auch manches Jammertal, oder enden gar darin.
In einem Roman ist alles nur Fiktion. Selbst Personen des öffentlichen Lebens, die in ihm auftreten, spielen in fiktiven Szenen. Viele davon haben jedoch wirklich irgendwo oder irgendwann stattgefunden. Sie prägten, wie in diesem Roman, das Leben von Menschen. Deren Leben unterlag durch sie der Veränderung.
Veränderung ist Leben, oft Leben bis zum traurigen Ende.
Ein Satz des Autors und Fußballexperten Nick Hornby gibt dieser düsteren Sicht auf die Dinge eine tröstliche Note:
Das Leben schlägt den Fußball, wenn es um Trauer geht; selbst für uns ist eine Niederlage nicht so schlimm wie ein Todesfall. Aber Fußball schlägt das Leben, wenn es um Glück geht.
Raum Frankfurt
Richard Finz hörte im Halbschlaf, wie die Vorhänge und das Fenster geöffnet wurden. Ein greller Strahl der Morgensonne schaffte den Weg bis unter seine Bettdecke, die er nicht ganz blickdicht über den Kopf gezogen hatte. Er fühlte einen leichten Windzug. Der Wind seufzt in den Bäumen, oder seufze etwa ich?, fragte er sich und presste seine Augen zusammen. Er wollte weder vollends aufwachen noch aufstehen. Dann hörte er leichte Schritte auf sein Bett zukommen und Miras Stimme direkt über sich: »Richie, der Kaffee ist fertig.«
Er brummte unwillig. Als sie den Satz mit seidiger Stimme wiederholte und »Richie, aufstehen« hinzufügte, schaute er mürrisch unter der Decke hervor. Ein Sonnenstrahl traf seine Augen; sie flackerten wie ein schlechtes Fernsehbild.
»Jetzt schon?«, brachte er mit müder Stimme hervor. »Ich kann heute zuhause bleiben, muss nicht zum Olympiastützpunkt nach Frankfurt. Ich will ein neues Konzept für die Mittelbeschaffung erarbeiten, und dafür brauche ich Ruhe.«
Mira ließ sie ihm nicht: »Aber ich muss in die Hufe kommen. Ich bin schließlich selbstständig und meine Patienten haben feste Termine bei mir.«
Mira Stein hatte sich als Physiotherapeutin im Keller des Hauses eine Praxis eingerichtet. Die lief gut. Kronberg im Taunus war eine Kleinstadt mit vielen alten Leuten, und die hatten Wehwehchen, die behandelt werden mussten. Außerdem konnte Richie ihr viele Sportler zuführen, mit denen er täglich zu tun hatte. Sie zeigten sich nicht so dankbar wie die Alten. Sie waren oft wehleidig, ihre Verletzungen mussten sofort behoben sein, und selbst wenn das gelang, gab es keinen Dank.
Richie kämpfte mit sich, ob er Mira nochmals Kontra geben sollte. Du hast doch keinen weiten Weg, kannst im Haus bleiben, lag ihm auf der Zunge.
Mira hatte sich in ihrem weißen Seidenpyjama über ihn gebeugt, und aus dem Ausschnitt sahen ihm die kleinen spitzen Jungmädchenbrüste entgegen, die ihr auch als erwachsene Frau geblieben waren. Er fühlte, wie Erregung in ihm aufstieg, und entschied sich, auf eine Antwort zu verzichten. Er ließ lieber »die Einsicht« auf sich wirken.
Mira registrierte das mit ihren großen hellblauen Augen, und auf ihrem sinnlichen Mund zeigte sich ein Grinsen.
Wie konnte sich mein Geschmack nur so ändern?, dachte Richie. Während meiner Zeit als Spielerscout in Afrika hatte ich die prallen Busen der schwarzen Frauen als Ideal. Mit Wehmut dachte er an die spannende Zeit zurück.
Das Muttermal in ihrem Nacken faszinierte ihn immer wieder. Es hatte die Kontur seines Lieblingskontinents Afrika.
Mira war sich sicher, dass sie ihn nun an der Angel hatte. Sie drehte sich um und ging mit ihren schönen langen Beinen aufreizend Richtung Zimmertür.
Auch ihr Gang blieb bei Richie nicht ohne Wirkung. »Du hast schöne Beine. Ich sollte das eine Samstag und das andere Sonntag nennen und dich fragen, ob ich zwischen den Tagen mal reinkommen darf!«, rief er ihr hinterher. Es war nur ein Satz körperlicher Begierde, ohne Zärtlichkeit und Gefühl, ertappte er sich.
»Heute ist erst Mittwoch, du Spinner«, antwortete sie mit einem gurrenden Lachen und war aus der Tür.
Aus der Küche hörte er das Klappern von Geschirr. Er machte sich frisch, rasierte sich jedoch noch nicht. Anders als Mira mochte er seinen morgendlichen Stoppelbart. Schön männlich fand er ihn, und Schmusen war nach der verordneten Eile kaum angesagt.
Als er den gedeckten Frühstückstisch betrachtete, schauten ihn lauter gesunde Sachen an: Grünzeug, Körner, Orangensaft, keine Wurst! Mira wollte ihn wieder auf ihren Gesundheitstrip mitnehmen. Nicht, dass ihm von diesen Nahrungsmitteln schlecht wurde, aber er war schließlich kein Kaninchen.
Neben Miras Gedeck lag aufgeschlagen die Zeitschrift »Physiotherapie«. Sie würde darin blättern und ihn wenig beachten. Das kam ihm jetzt schon sauer auf. Was hatte es mit dem gemeinsamen Frühstück noch auf sich? Sie waren nun 3 Jahre zusammen, 3 schöne Jahre, doch immer mehr Dinge fand er, die es zu bemäkeln galt: Mira war ihm zu häuslich geworden. Im Gegensatz zu ihm kannte sie kein Fernweh. Ihr beider Sexleben hatte viel von seiner anfänglichen Spontanität verloren. Das Schlimmste war jedoch, dass Mira ihn andauernd verändern wollte, seine Essgewohnheiten, seinen Tagesrhythmus, seinen Freundeskreis. Sie merkte nicht einmal, wie er das verabscheute. Vielleicht war er selbst ein bisschen schuld an dieser Entwicklung. Mira war eine schöne, begehrenswerte Frau, und es war so bequem, sich, trotz dieser Beanstandungen, ihrer zu besinnen, wenn ihm danach war. Deshalb war sie sich seiner so sicher geworden. Zu Unrecht, dachte er.
Als Mira hinter der Zeitung verschwand, konnte er das nicht unkommentiert lassen: »Dominanz in der Kommunikation erreicht man wohl am ehesten durch Schweigen?«
Mira guckte verständnislos hinter dem Journal hervor. »Ich dachte, du bist ein Morgenmuffel und Schweigen ist Gold!«
Touché! Er fühlte sich getroffen, hatte auf dem falschen Bein Hurra geschrien. Er wollte schnell das Thema wechseln, aber Mira biss sich fest: »Wehr dich!«
»Nein, ich wehre mich nicht, weil ich keine Frauen schlage.« Sein flapsiger Satz zog nicht.
Sie stand auf, blickte ihn mit Verachtung an und antwortete: »Ich gehe zuerst ins Badezimmer.« Mit einem flüchtigen Kuss auf seine Haare sendete sie ein kleines Friedenszeichen.
Ich habe eine fantastische Frau, leider gewöhnt man sich daran, dachte er erneut vor sich hin. Ein Tag wie jeder andere in der letzten Zeit hatte begonnen.
Die Arbeit rief Richie an den Schreibtisch. Auf ihm lag liniertes Papier. Zahlen und Worte hatte er gestern schon daraufgekritzelt, war aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Bei dem derzeit schlechten finanziellen Umfeld des Olympia-Stützpunkts war das Erstellen eines Plans für weitere Mittelbeschaffung eine Notwendigkeit, aber undankbar. Denn die Möglichkeiten, für den Stützpunkt tätig zu werden, waren limitiert. Er klopfte noch einmal alles gedanklich ab: Trikotwerbung stand anderen zu. Bandenwerbung brachte mangels Zuschauer am Stützpunkt kaum etwas. Sie hatten sogar Firmen Fesselballons mit Werbeaufdruck über dem Gelände als Werbemöglichkeit angeboten, aber keine Interessenten gefunden. Merchandising, der Verkauf von Fanartikeln, fiel ebenfalls nicht unter ihre Zuständigkeit. Regionale Verbände und Firmen hatten sie schon mehrfach angebettelt. Als lokale Größen konnten sie sich einer gewissen Förderung nicht verweigern, aber das war es dann auch.
Er musste neue Ansätze finden. Dafür rekapitulierte er seine bisherigen Überlegungen: Sponsoren erwarteten heutzutage für Fördererbeiträge erhebliche Gegenleistungen. Die Möglichkeiten, sie zu erbringen, waren aber begrenzt. Trainer und Manager wachten mit Argusaugen darüber, dass die Athleten nur in geringem Umfang für Werbeeinsätze zur Verfügung stehen mussten. Die Sportler selbst hatten auch Vorbehalte, die respektiert werden mussten. Schließlich waren nur fitte und zufriedene Athleten Garanten für Erfolg, und der war die Voraussetzung für Sponsoreninteresse.
Eine Idee war ihm gestern gekommen, und auf ihr wollte er aufbauen: Die Zeiten waren schnelllebiger geworden. Man musste sich dieser Schnelligkeit anpassen. Den neuen Leistungstypus konnte man mit dem Slogan »Schnelle Menschen für schnelle Zeiten« beschreiben. Diese Menschen musste man schnell erreichen, sie wollten schnell entscheiden, ihr finanzielles Engagement würde dann schnell kommen, aber auch schnell wieder ein Ende nehmen. Schnell würden sie etwas Neues suchen, was sie rational oder emotional reizen konnte.
Richie schwebte vor, unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen, Einzelpersonen anzusprechen. Von ihnen konnte man zwar nicht vergleichbare Fördererbeträge wie von Firmen generieren, dafür gab es aber eine größere Anzahl von ihnen, und Kleinvieh machte bekanntlich auch Mist. Er musste etwas finden, was sie schnell ansprach und wenigstens kurzzeitig spenden ließ. »Kleinspende Sportler des Monats« schrieb er sich als Merkposten auf. Eine aktuelle sportliche Höchstleistung eines Athleten schien ihm durchaus geeignet, um von Sportinteressierten einen Beitrag einzuwerben. Nun sprudelte seine Fantasie: Ein solcher Betrag konnte über eine App auf dem Mobiltelefon getätigt und innerhalb der Telefonrechnung bezahlt werden. Sie konnte dabei mit einem Banner beworben werden. Die regionale Telefongesellschaft gehörte zu den Förderern des Stützpunkts. Bestimmt ließ sie über eine kostenfreie Dienstleistung für das Inkasso und die begleitende Bannerwerbung mit sich reden. Das brachte ihr schließlich durch positive Kundenkontakte ebenfalls einen Werbewert. Er wollte sie von einer Win-win-Situation überzeugen.
Je länger er darüber nachdachte, umso mehr gefiel ihm die Idee. Sie musste einfach ausprobiert werden.
Auf einem Bein sollte sein Konzept jedoch nicht stehen, eine zweite Maßnahme musste her. Für ihre Verwirklichung besann er sich auf ein Gespräch, das kürzlich in seinem Elternhaus geführt worden war: Zurzeit standen große Vermögen vor dem Erbfall. Generationenwechsel war das Stichwort. Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig gewesen, dass es nicht immer sinnvoll wäre, nur die eigenen Abkömmlinge zu bedenken. In anderen Ländern, wie in den USA, war es üblicher als in Deutschland, größere Teile des Vermögens zu Gunsten der Allgemeinheit zu stiften. Sportförderung als Stiftungszweck war dabei gang und gäbe. In Deutschland war es leider immer noch notwendig, einen potentiellen Spender für diese Möglichkeit zu erwärmen. Hierfür konnte man Sympathieträger nutzen. Wer war dafür besser geeignet als ein erfolgreicher Sportler, durchaus ein ehemaliger?
Sie hatten über Fundraising geredet. Viele soziale Einrichtungen wie UNICEF hatten dies schon lange für sich entdeckt. Warum sollte der Sport nicht Gleiches tun? Dabei ließen sich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der Schenker konnte die Zustiftung ab einem gewissen Betrag dauerhaft mit seinem Namen verbinden und steuerlich absetzen. Dem Werber durfte man aus dem Spendenbetrag eine Provision zahlen. Eine beachtliche Zusatzversorgung war damit möglich. Der überwiegende Betrag ging natürlich in den Topf des Olympiastützpunktes.
Richie war mit dem Ergebnis seines Brainstormings zufrieden. Er brauchte nun eine Pause, bevor er die Entscheidungsvorlagen ausformulierte. Er wollte seine Annahmen noch mit einigen Statistiken belegen. Dazu musste er googeln.
Er schaute aus dem Fenster und sah, dass ihre Terrasse voll in der Sonne lag. Standortwechsel war angesagt! Er hinterfragte seine Gedanken nochmals in der Sonne: Seine erste Idee benutzte den Sport nicht als Kommunikationsplattform mit dem Ziel der Imagebildung, dem Aufbau einer Marke oder der Steigerung des Bekanntheitsgrades. Bei ihr war die sportliche Leistung selbst Anreiz für die Förderung.
Beim zweiten Ansatz war die Sympathie für den Sport ursächlich für eine Vermögensübertragung. Er nahm seinen Laptop und begann zu formulieren.
Begierig zog er dabei die Luft ein, sie war seidig, wie es sich in einem Luftkurort gehörte. Er und Mira wohnten in der Mitte des Burgbergs mit Blick auf die Altstadt und Weitsicht auf Frankfurt. Diesen Blick nannten die Einheimischen gerne Malerblick. In dieser schönen Umgebung brachte er seine Arbeit erfolgreich zu Ende.
Auch wenn er fürs Erste zufrieden war, galt es noch viel zu tun: Nun musste er die Gremien von seinen Vorschlägen überzeugen. In ihnen würde alles durchdekliniert und leider oftmals auch zerredet. Wie er das hasste! Versonnen schaute er auf das Panorama von Frankfurt, doch seine Gedanken schwebten in die Ferne. Da war sein Arbeiten in Afrika doch ganz anders gewesen! Er war frei gewesen und konnte selbst entscheiden. Er war der Macher gewesen. Da hatte es keine Diskussionen mit gewichtigen oder übergewichtigen Funktionären gegeben. Was hatte Max Merkel über Fußballfunktionäre gesagt? »Die wissen nicht einmal, dass im Ball Luft ist. Die glauben doch, der springt, weil ein Frosch drin ist.« Richie musste grinsen und gestand sich ein, dass ihm trotzdem die Beschäftigung mit Fußball hundertmal besser gefallen hatte als die Tätigkeit am Olympiastützpunkt, wo Fußball nicht vorkam.
Seine Gedanken gingen nach Afrika. Die Menschen waren dort viel freier und offener gewesen. Ihnen hatte er Motivation und Hoffnung bringen können. Ihr Dank und ihr Vertrauen wurden für ihn fortwährender Ansporn. Fernweh erfasste ihn, und es bedrückte ihn, dass dies weder Mira noch seine Chefs verstanden. Für ihn jedenfalls stand bald fest: Es gab kein Leben danach. Man musste alles vorher erledigen.
Doha in Katar
Katar liegt an der Ostküste der Arabischen Halbinsel und wird von einer absolutistischen Monarchie regiert. Die Hauptstadt ist Doha, die Staatsreligion der Islam und die Grundlage der Gesetzgebung die Scharia. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist Katar eines der reichsten Länder der Erde. Seine Erdgasvorräte und das Erdöl reichen noch mehr als 100 Jahre. Entsalzungsanlagen sorgen für genügend Wasser und ermöglichen, besonders in der Hauptstadt, eine hypermoderne Infrastruktur. Die Herrscherfamilie investierte viele Milliarden aus dem Staatsvermögen in der ganzen Welt. Sie hält Banken-, Dienstleistungs- und Industriebeteiligungen an Weltfirmen, um den Wohlstand des Landes auch für die Zeit nach Gas und Öl zu sichern.
Während andere Herrscher Kunst sammeln, Shopping Malls bauen sowie Prachtbauten entstehen lassen, träumt die Herrscherfamilie davon, das Land in eine führende Sportnation umzuwandeln. Scheich Tamim bin Hamad al- Thani, der dem Nationalen Olympischen Komitee vorstand, ging so weit, zu behaupten, es wäre wichtiger, dem IOC anzugehören als der UNO. Er beweihräucherte sich auch selbst ein wenig: »Wer wie ich kraft Geburt Macht, Prestige und Reichtum besitzt, muss versuchen, sich für sein Land nützlich zu machen. Wer das nicht tut, gibt ein schwaches Bild ab.«
Unter seiner Protektion entstanden modernste Sportanlagen wie das »Laptopstadion«, das zu zwei Dritteln unter der Erde liegt und mit der Haupttribüne wie ein offener Laptop herausragt. Der Aspire Dome wurde das bisher markanteste Beispiel für die herrschaftlichen Ambitionen. Schon 2004 realisierte man mit dem Dome eine der weltweit größten Trainings- und Wettkampfstätten für Spitzensportler.
Eine Milliarde Dollar hatte die Anlage in etwa gekostet. Über dreihundert ausländische Experten sollen darin nun die Katarer an die Weltspitze führen. Das fällt schwer, weil kaum mehr als zweihunderttausend der Einwohner die katarische Staatsbürgerschaft haben. Der Fundus für Weltklasseathleten ist also sehr klein. Man hat vieles versucht, um trotzdem erfolgreich zu sein, nahm aber vermehrt die Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen, um das Land zu repräsentieren: Seit 1993 finanziert Doha ein Tennisturnier der ATP-Tour, ein Frauenturnier der WTA kam dazu. Bei den Katar-Masters spielen die Golfprofis der European Tour seit 1998 um zweieinhalb Millionen Dollar Preisgeld. Als 2006 in Doha die Asienspiele ausgetragen wurden, hatte der Emir drei Milliarden Dollar in deren Gelingen investiert. Vergeblich bewarb sich das Land um die Olympischen Spiele 2016. Dafür erhielt man aber durch das positive Votum der FIFA-Exekutive die Fußballweltmeisterschaft 2022. Es hielten sich aber zäh Gerüchte über gekaufte Stimmen.
Nach der Vergabe der WM wurde die Sportförderung überwiegend auf Fußball gelenkt. Sie ging natürlich zu einem Großteil in den Bau der von der FIFA geforderten Stadien. Nachdem die Veranstaltung aus den Hitzemonaten in die Winterzeit verlegt worden ist, spielt die Kühlung der Stadien kostenmäßig nur noch eine untergeordnete Rolle.
Die Zahl der Stadien würde für das kleine Katar am Ende des Turniers überdimensioniert sein. Angeblich rückbaubare Stadien gehörten deshalb als ambitiöses Vorhaben schon zum Bieterkonzept. Man wollte eine Weltmeisterschaft der Innovationen präsentieren.
Mit anderen Fördermaßnahmen zahlte man hingegen enormes Lehrgeld. Jugendliche Talente wurden mit großem finanziellem Aufwand zur Ausbildung in europäische Vereine geschickt. Das brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Mit internationalen Altstars versuchte man das Niveau der lokalen Liga zu heben. Mario Basler, Stefan Effenberg, aber auch die Brasilianer Ailton und Dede wurden unter Vertrag genommen. Man bot ihnen sogar gegen Bezahlung die Staatsbürgerschaft an. Das steigerte jedoch nur kurzfristig das Publikumsinteresse. Eine dauerhafte Qualitätsverbesserung des Spielbetriebs blieb aus.
Der Spanier Josep Colomer, einer der unter Vertrag genommenen Spezialisten, hatte eine weitergehende Idee. Er hatte an der französischen Fußballeliteschule Clairefontaine gearbeitet und war danach seit 2006 in der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona beschäftigt, bevor Katar ihn abwarb. Colomer hat den Emir und dessen Mitarbeiter überzeugt, für die eigene Akademie weltweit minderjährige Talente zu suchen. Er predigte vom Humankapital von morgen. Spielerscouts besuchten daraufhin Qualifikationsturniere in Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika. Sie suchten in den dortigen Vereinen nach hoffnungsvollen Spielern. Colomer reiste selbst an 250 Tagen des Jahres durch die Länder und organisierte die Talentsuche. An fast 1000 Orten wurden Ausscheidungsspiele veranstaltet und von unzähligen Freiwilligen betreut. Der Etat dafür war von schwindelerregender Höhe. Viele Millionen hat der Emir freigegeben, um aus einer halben Million minderjähriger Fußballer die besten 25 herauszusieben! Diese Castingshow kostete nicht nur viel, sondern brachte unschöne Nebenerscheinungen mit sich. Die kleinen Fußballer mussten aus abgelegenen Orten zusammengeholt werden. Korrupte Funktionäre manipulierten die Beurteilung ihrer Fähigkeiten, um an ihrer Verpflichtung mitzuverdienen. Kidnapper sahen die Möglichkeit, die Kinder abzufangen und mit Lösegeldforderungen zu Geld zu kommen. Morddrohungen gegen Colomer gingen einher mit tatsächlichen Morden an jungen Spielern. Das hielt die nicht ab, weiter zu den Spielorten zu strömen. Der Spanier hatte die Gefahren befürchtet. Er sah den Satz bestätigt: In Europa spielen die Kinder Fußball zum Spaß, in Afrika um ihr Leben. Bei den Katarern gewann Skepsis die Oberhand, ob sie wirklich auf diese kostspielige Weise ihr Nationalteam zu einem Dreamteam des Weltfußballs machen konnten. So teure Aktionen wollten selbst sie nicht ständig wiederholen. Es wuchs der Wunsch, in Doha eine Struktur aufzubauen, die kostengünstiger zum gewünschten Ziel führte.
Unter den Scouts war ein Deutscher besonders aufgefallen. Der fünfunddreißigjährige ausgebildete Sportmanager Frank Schaaf sprach neben Deutsch fließend Englisch, Französisch und ein wenig Spanisch. In Katar wurde das Deutschsein an sich schon mit bestimmten Gütesiegeln verbunden: Gründlichkeit, Pünktlichkeit, Korrektheit und Erfolg, besonders im Fußball.
Diese Eigenschaften paarten sich in Frank Schaaf mit Weltoffenheit und Toleranz. Die Herren des Wüstenstaats suchten mit ihm das Gespräch. Der Deutsche trat selbstbewusst auf. Er ließ Durchsetzungsvermögen erkennen und wartete mit neuen Ideen auf. Er war bald erste Wahl. Sein Konzept sollte nach seiner Vorstellung unbedingt mehrere Dinge berücksichtigen: Er wollte von der Spielersuche bei teuren Sichtungsturnieren zu der Suche durch einzelne, gut ausgebildete Spielerscouts übergehen.
»Von Massensichtung halte ich nichts. Talente gibt es nicht inflationär. Die muss man einzeln entdecken.«
Wie man mit den Spielerscouts umgehen sollte, stand ebenfalls für ihn fest: »Die erhalten Auslagenersatz und feste Bezüge mit einem Erfolgsanteil obendrauf und sollen auf ihre individuelle Art talentierte Fußballkinder finden, die wir dann fördern.«
Das Training der Kinder wollte er durch Einstellung fortschrittlicher Trainer revolutionieren. Er hatte dabei nichts Neues im Sinn, sondern schlug die Form der Nachwuchsausbildung vor, die sich in der Jugendakademie des FC Barcelona, La Masia, bewährt und zeitweilig bis zu
10 Spieler ins Profiteam geführt hatte. »Weltspieler wie Lionel Messi, Andrés Iniesta und Xavi gehören dazu«, zählte er auf und fuhr fort: »Dort wird den Kindern bis zum sechzehnten Lebensjahr jegliches Krafttraining verboten, genauso wie stumpfsinnige Dauerläufe und Zirkeltraining. Sie dürfen nur an den Ball denken. Am Ball verbessern sie dann wie von selbst alles, Technik, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer.«
Frank Schaaf postulierte das berühmte Tiki-Taka, das geordnete Kurzpassspiel: »Dabei wird nur ein Drittel des Fußballfeldes benutzt. 20 Spieler auf diesem engen Raum! In der Profiliga wird es später auch nicht viel anders sein.« Dieser bewährte »Barça«-Stil verzichtete auch auf das Suchen von Spielern für bestimmte Positionen. »Das beruht auf der Erkenntnis, dass allgemein technisch ausgebildete Spieler mit Drang zur Offensive später noch zu flinken, technisch versierten Abwehrspielern umgeschult werden können«, dozierte Schaaf.
Seine Gesprächspartner waren beeindruckt und ließen ihn fortfahren: »Die jungen Spieler werden gezielt gefördert: Man behütet sie wie Muscheln in einer Perlenzucht. Nur so entdeckt man die wertvollen Perlen. Die müssen sich in einer B-Mannschaft der Profis bewähren. Wer sich dort als besonders begabt herauskristallisiert, wird langsam der ersten Mannschaft zugeführt.«
»Wir sollten dabei um eine Komplettausbildung bemüht sein. Diese Kinder haben in allen Bereichen Defizite, wenn sie zu uns kommen. Das ist mein Zukunftsvorschlag mit drei Säulen: individuelle Entdeckung der jungen Spieler, modernes Trainingskonzept, ganzheitliche Ausbildung!«, endete er schlicht.
Das Konzept überzeugte die Wüstenherrscher. Es war logisch aufgebaut, erschien machbar und ließ einen ähnlichen Erfolg wie bei »Barça« erhoffen.
Frank Schaaf wurde der neue Leiter der Sektion Fußballentwicklung im Aspire Dome und bezog ein Jahressalär von 400 Tausend Dollar zuzüglich üppiger Tantieme und Erfolgshonorare. Er ging mit Optimismus an die Arbeit und wollte schnellstmöglich Erfolge vorweisen.
Frank Schaaf saß in seinem Büroraum im Aspire Dome.
Der Raum war angenehm heruntergekühlt, denn draußen herrschten knapp 50 °C. Es war Sommerzeit in Katar. Schaaf trug ein weißes Poloshirt von Adidas, sehr körperbetont, das konnte er sich erlauben. Dazu trug er eine helle Leinenhose und helle Sportschuhe. Alles war der hohen Temperatur draußen angepasst. Sein Büro war sehr sachlich eingerichtet. Es strotzte vor Geräten der neuen Medien. Ein großer Flachbildfernseher neuester Bauart hing an der Wand, auf dem riesigen Schreibtisch war eine moderne Telefonanlage mit Freisprecher platziert, ein Laptop mit zusätzlichem großem Bildschirm und ein Projektor für Filme, Fotos und Tabellen standen daneben. An den weiß getünchten Wänden kündeten gerahmte Fotos davon, wie sehr Ausnahmefußballer eine Rolle in Schaafs Berufsleben gespielt hatten. Dort sah man Pele, Messi, Ronaldo, Xavi, Eto’o und viele andere Spieler, die Furore gemacht hatten.
»Wir alle brauchen doch irgendwie Mythen und Helden, an denen wir uns festhalten können. Ich möchte nicht zum Verwalter trister Realität verkümmern. Nur Mitreißen und Begeisterung bringen uns weiter«, erklärte Frank Besuchern seine Philosophie.
Er arbeitete am Aufbau seines Kompetenzzentrums. Im Moment war er dabei, die richtigen Spielerscouts zu finden. Er wollte zunächst mit einem beginnen.
Die Zukunft ist vernetzt, wusste er, aber er wollte dabei auf eine klassische Headhunteragentur verzichten und sein eigenes Netzwerk strapazieren.
Schon einige Tage hatte er versucht, einen Kollegen und Freund aus früheren Tagen ausfindig zu machen, mit dem er zusammen in Afrika junge Spieler gesucht hatte. Heute war seine Nachforschung endlich von Erfolg gekrönt worden. Richard Finz wohnte derzeit in der Nähe von Frankfurt und arbeitete am Olympiastützpunkt. Die Arbeitsstätte überraschte Frank, er hatte herausgefunden, dass dort keine Fußballaktivitäten betreut wurden, und das passte nicht zu Richie. Der war immer ein Fußballverrückter gewesen und dabei ein hochtalentierter Spielerscout. Er konnte an diesem Arbeitsplatz kaum glücklich sein. Frank musste zu ihm unbedingt Kontakt aufnehmen. Richie war der richtige Mann für seine Pläne und für ein Pilotprojekt. Er suchte Telefonkontakt.
Er wartete ungeduldig darauf, dass die Zentrale das Gespräch zu Richie durchstellte.
Sein Warten wurde belohnt. Richard Finz war in der Leitung.
»Richie, hier ist Frank, Frank Schaaf. Es ist schön, dich an der Strippe zu haben.«
Es trat einen Moment Stille ein. Richie war perplex. In seinem Hals stauten sich Frösche, und er musste sich räuspern. Erst dann fühlte er sich in der Lage, zu antworten: »Frank, du, das ist eine Überraschung! Wie komme ich nach so langer Zeit zu dieser Ehre? Für mich war unsere gemeinsame Zeit irgendwie abgehakt. Aus den Augen, aus dem Sinn, meine ich.«
Frank Schaaf lachte gequält. »Nun, ich bin weder schreibfreudig, noch klebe ich an alten Zeiten. Dafür läuft mein Leben einfach zu schnell. Aber gute Typen vergisst man nicht. Man erinnert sich besonders an sie, wenn man etwas zu bieten hat. Und das habe ich.«
»Das ist mehr, als man erwarten kann«, antwortete Richie trocken. »Also, was kann ich tun?«
Frank berichtete so kurz wie möglich von seiner Aufgabe und schloss nahtlos daran an, welche Rolle Richie in seinen Plänen spielen sollte. »Dass du in einem Olympiastützpunkt ohne Fußball arbeitest, spricht nicht dafür, dass du noch der gleiche Fußballverrückte wie früher bist. Du warst doch auf den Ball so hungrig wie ein Säugling auf die Titten seiner Mutter. Wie ist es zu der Änderung gekommen? Hat dich eine schöne Frau sesshaft gemacht?«
Richie fühlte sich von den Neuigkeiten und Fragen überrumpelt. Es war schon komisch, dass gerade in dem Moment, wo er selbst mit seiner Situation haderte, solche Vorschläge kamen. Er antwortete zuerst auf die letzte Frage: »An die Leine habe ich mich noch nicht legen lassen. Ich stehe eher davor, eine zart gewachsene Bindung wieder zu kappen. Nun zur ersten Frage: Mein Job war der beste, den ich hier kriegen konnte. Vom Fußball bin ich trotzdem nicht geheilt. Ich schiele schon länger nach einer interessanten Alternative. Du kommst in keinem ungünstigen Moment.«
»Dann lass uns gleich Nägel mit Köpfen machen, bei mir ist Eile geboten. Man erwartet schnellen Erfolg von mir. Hast du noch ein paar Tage Urlaub? Wenn ja, komm her und schau dir alles mal an. Dann können wir auch Details bereden. Allein, sich dieses Land einmal anzuschauen, lohnt sich. Das ist nicht Afrika, Richie. Dir werden die Augen übergehen. Deine Aufwendungen gehen natürlich zu unseren Lasten …«
»Achtung, Überfall!«, tönte Richie ins Telefon und lachte. Aber das war keine Absage, er dachte schon krampfhaft darüber nach, wie er diesem Vorschlag folgen könnte. »Frank, ich bin interessiert. Gib mir einen Tag, um alles zu überdenken. Dann hörst du von mir.«
»Das hört sich gut an. Gib dir einen Ruck, ich brauche dich und würde mich freuen, dich bald wiederzusehen.« Danach war nichts mehr zu sagen. Die Freunde beendeten nach dürren Grußworten das Gespräch.
Raum Frankfurt
Richie Finz saß gedankenverloren in seinem Büro. Es war längst nicht so komfortabel eingerichtet wie das von Frank Schaaf. Seine grauen Zellen arbeiteten unentwegt. Das Gespräch mit Frank hatte ihn aufgewühlt.
Er hatte Schmetterlinge im Bauch und Blut geleckt. Seine Arbeitssituation ließ ihm die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen. Das Finanzkonzept war fertiggestellt und vorgelegt. Es ging nun seinen Gang. Die Gremien, die darüber befinden mussten, tagten nur sporadisch, die Entscheidung würde also auf sich warten lassen. Richie hatte auch genügend Urlaubstage angesammelt, um die Reise anzutreten. Ein kurzer Anruf in der Personalabteilung bestätigte seine Einschätzung. Die Ampel stand auf Grün.
Nun dachte er an zuhause. Mira würde vielleicht Stress machen. Sie erwartete von ihm, dass er seine freien Tage für gemeinsame Urlaube mit ihr aufsparte, als Liebesbeweis quasi. Mit ihr zu diskutieren konnte wie russisches Roulette ablaufen, Roulette mit vollem Magazin! Er wusste, dass er irgendwann nicht mehr darum herumkam, Klarheit über seine Gefühle und seine Zukunftspläne zu suchen. Er wollte ein solches Gespräch aber noch hinauszögern. Ihm war zurzeit nicht nach Konflikten, er suchte nach Ausflüchten.
Richie hatte sich dafür bald eine Geschichte zusammengereimt, die vorzeigbar erschien: Ein früherer Kollege leitet in Katar ein großes Sportförderprogramm. Darüber soll ein Symposium stattfinden. Ich bin dazu wegen meiner Kenntnisse eingeladen, und zwar bei Übernahme aller Kosten. Der Olympiastützpunkt begrüßt meine Teilnahme.
Richie war schon länger aus dem Fußballbereich ausgestiegen. In dieser schnelllebigen Zeit musste er sich deshalb kundig machen, auf welche Rahmenbedingungen er heute beim Scouting treffen würde. Er war so heiß auf die Reise, dass er sofort mit Recherchen begann. Und wirklich, die FIFA hatte restriktive Richtlinien für unter achtzehnjährige Fußballer in Kraft gesetzt. Richie analysierte sie und fand heraus, welcher Spielraum blieb. Nach § 19 des Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern konnte ein Transfer in ein anderes Land stattfinden, wenn die Eltern des Jungen, aus Gründen, die nichts mit Fußball zu tun hatten, dorthin einen Wohnsitzwechsel vornahmen. Dies ließ ihm auf den ersten Blick keine Möglichkeit für sein Vorhaben. Nach einiger Suche fand er jedoch Umgehungsmöglichkeiten. Der Begriff Eltern wurde zwar eng ausgelegt, nahe Verwandte kamen statt ihrer nicht in Betracht. Ein Vormund wurde allerdings Eltern gleichgesetzt. Er oder jemand anders musste also mit Billigung der Eltern Vormund des jungen Spielers werden. Es war auch nicht schwer, einen Grund für den Ortswechsel anzugeben, der nichts mit dem Fußball zu tun hatte, einen beruflichen Standortwechsel des Vormunds eben. Das waren für seine Pläne »good news«. Er musste trotzdem den Kopf schütteln. Gab es wirklich keine Möglichkeit, eine Regelung so zu treffen, dass sie Umgehungen unmöglich machte? Das Millionengeschäft mit minderjährigen Talenten zog eben viele zwielichtige Akteure an. Sie verbargen sich hinter der Schutzbehauptung, junge Spieler seien Risikoanlagen und besonders gefährdete »Pennystocks«, die, wenn sie denn mal einschlugen, eine außergewöhnliche Rendite rechtfertigten. Ihnen wollte er es jedenfalls nicht gleichtun. Er wollte seinem »Findling« durch sein Tun auf jeden Fall eine faire und bessere Zukunft verschaffen!
Für das Gespräch mit Frank wollte er bereits entschieden haben, in welchem Land er den Spieler suchen würde. Er legte sich auf Kamerun fest. Kamerun hatte sich von den afrikanischen Mannschaften am häufigsten für die Fußballweltmeisterschaft qualifiziert, insgesamt sieben Mal. Es hatte viermal den Afrika-Cup gewonnen, zuletzt 2017. 1990 erreichte das Team in Italien das Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Das Land hatte Ausnahmespieler hervorgebracht. Richie dachte sofort an Samuel Eto’o, der zwischen 1997 und 2014 Kameruns wichtigster Angriffsspieler gewesen war und 56 Tore geschossen hatte. Kameruns größere Erfolge traten nur in größeren Abständen ein. Das schrieb Richie allein der Schwäche der Verbandsführung zu. Nach der Weltmeisterschaft 2014 in Südafrika hielten sich sogar hartnäckig Gerüchte über Spielmanipulationen. Die Betrugsvorwürfe betrafen die drei Vorrundenspiele. All das war jedoch keinesfalls ein Indiz dafür, dass die Anzahl der befähigten Straßenfußballer abgenommen hatte. Auf den staubigen Sandplätzen in den Armenvierteln wollte Richie suchen. Vereinbarungen mit Eltern, wenn die Kinder bereits Vereinsmitglieder waren, würden schwieriger zu treffen sein. Funktionäre mischten dann mit. Ihn reizte es, Kamerun zu erkunden, und er freute sich darauf, sein Französisch wieder gebrauchen zu können.
Das Gespräch mit Mira lief besser als erwartet. Sie nahm ihm seine Geschichte nicht nur ab, sondern sah in der Einladung und der Zustimmung des Olympiastützpunkts nur Positives. »Ich freue mich, dass deine Befähigung anerkannt wird. Das kann deiner Karriere nur förderlich sein. Ich drücke dir beide Daumen, mein Schatz.«