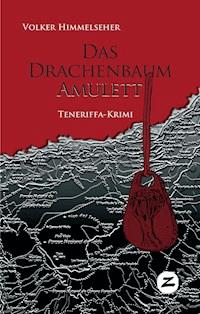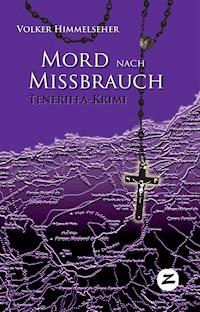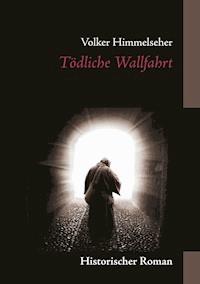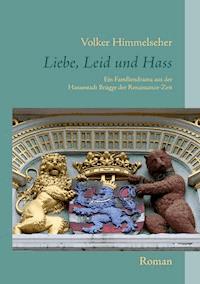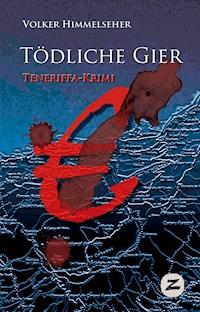Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eine satanische Sekte treibt auf Teneriffa ihr Unwesen. Schwarze Messen, Grabschändungen, tödliche Mutproben und Mord schocken die Inselbewohner. Inspektor Martin und seine Kollegen stehen vor einem teuflischen Fall. Dabei trifft sich gut, dass die Ehefrau des Inspektors, die Kriminalpsychologin Teresa Zafón-Martin, bei den Ermittlungen hinzugezogen werden muss. Ihr Hausfrauendasein nach der Geburt der Tochter Mercedes war für sie schon unerträglich geworden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anmerkungen des Autors:
Die Geschichte ist frei erfunden.
Viele ihrer Elemente haben jedoch einen realen Hintergrund. Die Grabschändung in Arico hat es gegeben, genauso wie den hässlichen Mord an einer alten Engländerin im Süden der Insel. Auch der Versuch eines Massensuizids unter Anstiftung der Sektenführerin Heike Fittkau-Garthe entspricht den Tatsachen.
In Candelaria hat man schon mehrfach die Jesusfigur aus der Krippe gestohlen, und das Sektenunwesen auf Teneriffa ist Realität.
Die Feierlichkeiten an Silvester und zum Tag der Heiligen Drei Könige, die Beschreibung von Wegen und Örtlichkeiten sowie Restaurants und ihrer verlockenden Speisenkarten haben einen realen Hintergrund und machen hoffentlich Lust auf die Überraschungen der Frühlingsinsel.
Mein Dank gebührt Frau Ingrid Wilkening, die meine Schreiblust mit ihrer Lektoratsarbeit positiv kritisch begleitete.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Epilog
1.
Ramón nahm mit dem Wagen die letzte Kurve in seine Garage und war froh, zu Hause zu sein.
Mit dem wachen Blick des Polizisten schaute er sich um. Was war das denn? Am Heck des Wagens seiner Frau Teresa hatte ihn stets ein kleiner Aufkleber – Baby an Bord – angelacht. Er galt seiner Tochter Mercedes, die sein Ein und Alles war. Nun war das Schild fort! Teniente Coronel Martin ging rasch die Treppe hinauf und lauschte nach oben. Es war ungewohnt still. Er hörte nichts von dem fröhlichen Gekrähe und Geplapper, das Mercedes ins Haus gebracht hatte. Unbehagen beschlich ihn. Wo waren nur seine beiden »Frauen«?
Als er ins Wohnzimmer kam, saß Teresa allein im Sessel. Ein trauriger Blick heftete sich auf ihn.
Ihre schönen dunklen Augen zeigten keine Freude. Mercedes ist nicht bei ihr, registrierte er.
Die schon rituelle Eifersucht konnte ihn heute also nicht plagen, die aufkam, wenn das Töchterchen bei seinem Kommen am Rockzipfel der Mutter verharrte und ihn nur anlächelte.
Mercedes brauchte ihre Mutter, außer sie schlief.
Ihre übliche Schlafenszeit war aber längst vorbei.
»Wo ist unser Schatz?«, fragte er noch, bevor er Teresa küsste.
»Mercedes ist bei Ana, denn ich muss mit dir reden«, antwortete sie brüsk.
Ana war Teresas beste Freundin und sprang immer mal wieder beim Kinderhüten ein, wenn Not an der Frau war. Er ahnte mit einem Mal, dass es heute zu dem Disput kommen würde, den er schon länger erwartete. Ramóns Besorgnis wuchs.
Er unternahm den Versuch, den Streit zu verhindern, küsste Teresa als Friedensangebot auf den Mund und sagte: »Ich liebe dich!«
Für einen Moment glaubte er, sein Plan ginge auf, doch dann wandte sich seine Frau abrupt von ihm ab.
»Lass das«, sagte sie rau. »Ich weiß das, aber es ist mir nicht genug. Ich erwarte einfach mehr vom Leben.«
Ein Glas Wasser verschwand genauso schnell in ihrem Mund, wie der verletzende Satz gefallen war. Teresa war eindeutig wütend.
Ramón beschloss in der Defensive zu bleiben, bis Teresa sich ein wenig beruhigt hatte. Aber sie tat ihm den Gefallen nicht. Sie war in Fahrt und blieb dabei. Angriff war die beste Verteidigung! Sie legte also nach: »Du weißt, wie wichtig mir meine Freiheit ist und wie schwer es mir deshalb fiel, unserer Heirat zuzustimmen. Meine Vorbehalte erwiesen sich als richtig. Ich bin nun durch Mercedes ans Haus gebunden und nicht mehr so frei, wie ich es für mich wünsche. Dein beharrliches Werben um mich hat zwar gesiegt, aber zulasten meiner Zufriedenheit.«
»Wie kannst du so etwas sagen? Ich wollte nicht siegen, sondern mit dir zusammenleben«, erwiderte er. Entrüstung schwang in seinen Worten mit.
»Zu viel Nähe kann entzweien«, konterte sie hartnäckig.
Nach kurzer Bedenkzeit strapazierte Ramón ein nur vermeintliches Zugeständnis: »Nun gut, ich muss zugeben, heute sind Mercedes und du die beiden wichtigsten Menschen in meinem Leben. Du musstest teilen lernen.«
Teresa protestierte: »Das geht an der Sache vorbei!« Sie erklärte ihre Sicht der Dinge: »Als ich noch ungebunden war, fühlte ich mich im Beruf anerkannt, fand Erfüllung darin, anderen Menschen zu helfen, und wurde von dir und anderen Männern als Frau bewundert. Nun bin ich zum ,Kümmerer‘ für Mercedes und zu einer grauen Hausmaus mutiert.«
Ihr Mann sah sie fassungslos an.
Teresa fuhr unbeirrt fort: »Seit ich Mutter bin, sieht keinen Mann mehr in mir eine begehrenswerte Frau.«
Diese Analyse konnte Ramón nicht im Raum stehen lassen. Wie konnte die Frau, die er liebte, so gering über das denken, was er als gemeinsames Glück empfand?
»Wo bleibt dein Einfühlungsvermögen in die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, mein Schatz?«, erwiderte er. »Quien se acepta a sí mismo está preparado para perdonar a los demás.« – Wer sich selbst akzeptiert, ist bereit, auch die anderen zu akzeptieren. »Liebe dich selbst, und deine Zufriedenheit wird zurückkommen.«
Teresa blieb bei ihrem Standpunkt: »Von wegen, liebe dich selbst! Von der aufstrebenden Akademikerin ist nichts übrig geblieben. Ich bin heute nur noch Señora Martin und Mutter, die bis vor kurzem gestillt hat und deren Lebensrhythmus ein Kind bestimmt«, antwortete sie.
Wie konnte sie Ramón nur klarmachen, dass sie den Verlust ihrer Freiräume als Schmerz empfand? Musste sie Schuldgefühle haben? Das tat sie schnell ab. Sie hatte sich doch nur noch verabscheut. Mit ihrem dicken Bauch während der Schwangerschaft hatte sie sich wie eine aufgeblähte Muttersau gefühlt, und die tumbe Glückseligkeit der anderen Mütter bei der Schwangerschaftsgymnastik konnte sie nie empfinden.
»Unser Kind ist das schönste und liebste Kind der Welt. Du hast Mercedes die meiste Zeit für dich. Genieße das! Wie schnell vergeht diese Freude. Mercedes ist heute schon ein Menschenkind mit eigenem Denken und Willen. Das geht so weiter, bis sie sich ganz abnabeln wird.«
Wehmütig dachte er an das rosa Bündel zurück, das auf der Entbindungsstation in eine Decke gewickelt hilflos im Kinderbettchen gelegen hatte. Mit ihren dunklen Ewigkeitsaugen hatte Mercedes ihn angesehen und verzaubert. Daran hatte sich bis heute nichts geändert. Er liebte sein Töchterchen so heftig wie Teresa! Wir sind doch ein starkes Trio, dachte er. Warum kann ein solches Glück nicht einfach nur glücklich machen? Seine Gedanken gingen zu Teresa zurück. Es hörte sich nur an, als habe sie Probleme, die meisten davon gab es gar nicht. Davon wollte er sie unbedingt überzeugen.
»So ist es doch gar nicht. So darfst du es nicht sehen. Erkenn doch endlich, wie stark wir als Team sind. Das muss auch so bleiben! Mit Mercedes und dem häuslichen Bereich sind nur zwei Felder hinzugekommen, die wir beackern müssen. Wir, sage ich ausdrücklich! Wir können uns gegenseitig alles anvertrauen und über alle Probleme reden. Das tun wir doch auch, oder nicht?«
Diese Frage ließ aus seiner Sicht nur ein klares Ja als Antwort zu. Er fuhr fort: »Auch bei beruflichen Problemen greife ich auf deinen Rat zurück. Die aufstrebende Akademikerin ist nicht verloren gegangen. Was wäre ich ohne dich? Du bist für mich mehr als ein Backoffice. Jeder auf dem Revier weiß um deine wertvolle Mithilfe. Was für eine gut aussehende Frau du bist, höre ich täglich mit Stolz. Frag doch meine Kollegen. Deine Figur ist heute schon wieder wie vor der Geburt, und du musstest fast nichts dafür tun. Andere Frauen zetern hingegen: Komm mit mir ins Bad und ich zeige dir meinen Kängurubauch! Die meisten von ihnen haben Stress mit dem Abnehmen, weil sie direkt nach der Geburt wieder aussehen wollen, als hätten die Kleinen in Blumentöpfen gekeimt. Dir flog das Abnehmen einfach zu.«
Teresa winkte ab. Sie atmete tief durch und wollte Widerworte geben. Doch dann stieß sie nur den Atem aus. Was Ramón gesagt hatte, stimmte sie nachdenklich. Sie musste sich neu aufstellen. Gegen ihren Willen begannen seine Argumente ihren Frust zu lösen. Sie wurde versöhnlicher.
»Dann solltest du mich das alles öfter spüren lassen«, versuchte sie eine letzte Gegenwehr.
Ramón erkannte, dass ein Erfolg nahe war. »Sei nicht töricht, ich zeige es dir doch am laufenden Band, und auch noch gern.«
Er nahm sie in den Arm, der Weg ins Schlafzimmer war nur kurz. Noch vor dem Bett hatte sich, wie von selbst, ihr Haar geöffnet, und die schweren schwarzen Strähnen lagen wie ein Fächer auf dem weißen Kissen. Teresas Augen senkten sich schicksalsergeben in die seinen. Das Paar erfasste eine tiefe Gefühlswallung und erlebte ein Versöhnungsfest. Wie früher wurde es, hatte sich Teresa doch seit Wochen verweigert! Ihr Eigenduft drang aus den Poren und schwebte über der spärlichen Bekleidung, die sie noch anhatte. Diese sinnliche Beigabe erregte Ramón sehr. Seine Finger reagierten vor Aufregung ungeschickt, als er freilegen wollte, was ihm so lange verwehrt worden war. Teresa half ihm und war viel geschickter als er.
Als ihr Liebesspiel ein Ende fand, waren sie nicht nur eins, sondern sich auch wieder einig.
»Du sollst mich nicht mehr daran erinnern müssen, dir zu zeigen, was du mir bedeutest«, murmelte er ihr zärtlich und träge ins Ohr, dabei biss er ihr leicht in das Ohrläppchen. »Querer es poder.« – Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, dachte er.
Als Ramón morgens das Haus verlassen hatte, besah sich Teresa nackt im Spiegel. Ramón hatte recht. Ihre dicken Brüste, die mit Adern wie eine Straßenkarte durchzogen gewesen waren, hatten sich auf Normalgröße zurückgebildet, nachdem sie abgestillt hatte. Ihre Selbstdisziplin hatte sich bewährt, und das matronenhafte Aussehen der Schwangerschaft war ihren alten Reizen gewichen. Hässliche, elastische Einsätze über dem Bauch und riesige weiße Unterhosen aus Kochwäsche, adiós, dachte sie und fühlte sich sofort wohler. Vieles, was sie an ihrer neuen Situation abgestoßen hatte, war wirklich vorüber. Sie wohnte in einem Heim, das sie nach eigenen Wünschen eingerichtet hatte und um das sie viele beneideten. Über Ramóns Fürsorge konnte sie sich nicht beklagen. Er liebte sie beide, Mutter wie Tochter, genau besehen gab es wenig Grund, Trübsal zu blasen. Sei geduldiger mit der ganzen Welt, vor allem mit dir selbst, nahm sie sich vor. Sie wollte alles positiver sehen. Sie konnte nicht gleichzeitig die Eier essen und die Henne schlachten!
2.
Juan Méndez schaute aus dem Fenster seines Apartments hinaus in die Nacht. Die Dunkelheit war nicht so vollkommen wie die seiner Gedanken. Die vielen elektrischen Lichter in Puerto hatten die hellen Sonnenstrahlen ersetzt und spendeten immer noch Licht, wenn auch spärlicher als tagsüber. Méndez hatte seit mehreren Stunden nachgedacht und stand vor einer wichtigen Entscheidung. Er war lange Zeit an Geist und Seele krank gewesen und hatte sich in psychiatrische Behandlung begeben müssen. Nach langwieriger Therapie hatte sich Erfolg eingestellt, und ein Neuanfang schien möglich. Man entließ ihn als geheilt. Doch als er wieder auf sich allein gestellt war, traten erneut Schwierigkeiten auf. Sein Umfeld nahm ihn nicht mit offenen Armen auf, sondern betrachtete ihn mit Misstrauen und Skepsis. Méndez litt darunter sehr und fiel erneut in Depressionen.
Der Abend des 1. Novembers brachte für ihn eine Schicksalswende. Er war auf seinem schweren Motorrad in den Straßen Puertos unterwegs und stieß auf eine Gruppe von Männern, die ihn sofort interessierte. Sie saßen ebenfalls auf Krafträdern. Teufelszeichen und die satanischen Ziffern 666 auf ihren schwarzlackierten Chassis zogen ihn magisch an.
Dunkle Ledermonturen, Helme mit herabgelassenen Visieren oder Motorradbrillen vermummten sie und ließen sie wie geheimnisvolle Ritter eines schwarzen Ordens aussehen. In Méndez wuchs der Wunsch, zu ihnen zu gehören.
Entgegen der Ablehnung, die er sonst von seinem Umfeld erfuhr, zeigte diese Gruppe Interesse an ihm. Er wurde angesprochen, und bevor er sich’s versah, hatte er mit verbundenen Augen Platz auf dem Rücksitz einer ihrer Maschinen genommen und donnerte ihrem »Clubhaus« entgegen …
Als die Maschinen anhielten, packte ihn eine Hand am rechten Oberarm und führte ihn vorwärts. Er trat über eine Schwelle und befand sich auf planem Boden, aus Holzdielen, wie er richtig vermutete. Er entnahm den Geräuschen, dass auch seine Gastgeber in den Raum traten. Stühle schurrten, und man drückte ihn auf einen davon. Erst jetzt wurde ihm die Binde von den Augen genommen. Neugierig sah er sich um. Die Männer hatten um einen roh gezimmerten Holztisch Platz genommen.
Die »Ritter« waren immer noch unkenntlich. Ihre Gesichter waren nicht mehr hinter Motorradbrillen und Helmen verborgen, sondern hinter Masken. Seine Gastgeber hatten deshalb für ihn kein spezifisches Aussehen, keinen Namen, nur Stimmen.
Mit Fremden in ihrer Runde trugen sie, um ihre Identität zu verbergen, Guy-Fawkes-Masken wie der Freiheitskämpfer im Film V wie Vendetta: weißer Teint, schwarze Konturen der Brauen und der Augenschlitze, schwarzer Schnurrbart sowie Strichbart am Kinn.
Die Maskengesichter waren zu einem zynischen Grinsen verzogen und ließen keine wahren Regungen erkennen.
Juan Méndez sah sich um. Der Raum, in dem sie sich befanden, war mit schwarzen Tüchern abgehängt und mit Kerzenleuchten sparsam erhellt. Hinter dem Tisch stand ein großes, auf den Kopf gestelltes Kreuz aus Metall. Der Maskierte, der ihm gegenübersaß, richtete das Wort an ihn. Seine Stimme klang hinter der Maske dumpf und hohl: »Dein Interesse an uns war unübersehbar. Sei willkommen im Kreis unserer Gemeinschaft. Wir sind Jünger des Satans. Mein Name ist Gran Tinerfe, genannt nach dem großen Guanchenfürst. Ich bin der Anführer. Willst du mehr über uns wissen?«
Juan Méndez antwortete schnell mit einem Ja.
Der Wortführer schien zufrieden und fuhr fort: »Wer zu unserer Gemeinschaft gehören möchte, muss Satan dienen. Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz, Lebenskraft anstatt Hirngespinste.«
Er legte einen toten Fisch auf die Tischplatte und verstümmelte ihn mit einem Messer. Dazu erklärte er: »Das griechische Wort für Fisch, Ichthys, enthält für Christen das Glaubensbekenntnis: Iesous Christós Theoú Hyiós Sytér« – Jesus der Gesalbte, Gottes Sohn und Erlöser. »Darum zerstöre ich den Fisch. Könnten dich unsere Maxime reizen?«
Méndez zögerte nicht, mit einem weiteren vernehmlichen Ja zu antworten. Er war darauf aus, endlich irgendwo dazuzugehören.
Die Runde verharrte in Schweigen, bis Gran Tinerfe fortfuhr: »Das ist gut, doch wenn du versuchen solltest, uns aufs Kreuz zu legen, anstatt das Kreuz zu verlachen, werden wir dich töten. Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange.« Seine Stimme blieb bei dem Wortspiel mit dem Kreuz todernst. Zweifellos war ihm nicht nach Scherzen zu Mute.
»Nein, nein«, antwortete Méndez hastig, »ich will zu euch gehören. Was muss ich tun, um das zu beweisen?«
»Mutprobe, Mutprobe!«, schallte es dumpf und fordernd hinter den Masken hervor. Dazu schlugen die Männer mit den Fäusten einen eintönigen Takt auf die Tischplatte.
Der Anführer erklärte Méndez, was Mutprobe bedeutete: »Du musst über Leichen gehen, um zu zeigen, dass du für uns und unseren Herrn geeignet bist.«
»Im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen?«, fragte Méndez beunruhigt zurück.
»Ja, ohne Wenn und Aber, aber eine Leiche tut es fürs Erste«, antwortete Gran Tinerfe bestimmt.
In Méndez’ Kopf überschlugen sich die Gedanken. Sollte er noch einen Rückzieher machen, oder musste er dann mit dem Schlimmsten rechnen, vielleicht mit dem Tod? Diese Drohung stand schließlich im Raum.
Er versuchte es mit Hinhaltetaktik: »Wie werdet ihr von meiner Tat erfahren?«
»Das ist nicht dein Problem. Wir haben unsere Augen und Ohren überall. Auch die Medien werden uns berichten«, fuhr Gran Tinerfe ihm scharf über den Mund. Um weitere dumme Fragen zu vermeiden, ergänzte er: »Nach erfolgreicher Prüfung werden wir dich finden, und du darfst unser Bruder sein.«
Méndez spürte, dass jede weitere Frage gefährlich war und besser unterblieb. Er nickte ergeben.
Der Anführer reichte ihm einen Becher Rotwein mit den Worten: »Nimm diesen Blutersatz aus dem Eichenfass und trink!« Mit lüsterner Stimme sprach er zu ihm über die Bedeutung von Sex. Dann ließ er abrupt von ihm ab und wandte sich seinen Jüngern zu. Er streckte seine rechte Hand aus. An seinen Fingern trug er schwere Silberringe, die mit teuflischen Symbolen geschmückt waren. Er zeigte mit ihnen auf die Anwesenden und sprach: »Ich mache mir große Sorgen um euch.«
Er hatte einen bestimmten Sprechduktus eingeübt und registrierte zufrieden, dass seine Stimme wie Schmierseife in seine Gefolgsleute drang.
Er erarbeitete seine Auftritte wie Theateraufführungen. Choreographie, Bild und Ton mussten stimmen.
Schon als Kind hatte er gern vor dem Spiegel gestanden und rezitiert. Seine Mutter war immer wütend geworden, wenn sie ihn dabei erwischte. Diese Zeiten waren vorbei. Jetzt und hier war er der Meister!
Er bewegte seine Hände theatralisch und schlug einen Kreis, als wollte er sein Gefolge darin einschließen.
Sein Zeigefinger verharrte auf dem Bruder neben ihm, und der begann sofort mit einer eintönigen Litanei:
»Bei dem Symbol des Schöpfers schwöre ich, ein zuverlässiger Diener des mächtigsten Fürsten Luzifer zu sein. Der Schöpfer hat ihn zu seinem Regenten bestimmt, zum Herrn der Welt.«
Gran Tinerfe wies auf den Nächsten am Tisch, und der fuhr in gleichem Singsang fort: »Ich schwöre, dass ich meinen Verstand, meinen Leib und meine Seele stets zur Förderung der Pläne unseres Gebieters hingeben will.«
Ein Dritter kam zu Wort: »Ich verleugne Jesus Christus und schwöre auf ewig dem christlichen Glauben ab. Ich verachte alle christlichen Werte.«
Nach diesen Bekenntnissen fielen alle Männer am Tisch in einen eintönigen Gesang ohne erkennbare Worte und wiegten dazu ihren Oberkörper im Takt.
Ab und zu glaubte Méndez die Worte Oh Asmodi, schau auf deine Diener zu verstehen. Bei diesen Worten schlugen sich die Männer auf ihren rechten Oberarm. Sie brachten sich damit immer mehr in Trance.
Ein längeres Wortgeplänkel folgte.
Gran Tinerfe erklärte Juan Méndez die Hierarchie der Gruppe. Der war vom Sinngehalt der Regeln tief beeindruckt.
Schließlich beendete der Anführer die Sitzung mit einem rauen Befehl an den Gast: »Such dir ein Opfer und lass uns nicht zu lange auf dessen Ende warten, wir haben nicht allzu viel Geduld!«
Sie verbanden Méndez wieder die Augen, und als ihn auf dem Rücksitz eines Motorrades der kalte Fahrtwind umströmte, ahnte er, dass er auf dem Rückweg nach Puerto war. Dort ließen ihn die Männer grußlos am Straßenrand stehen, genau wo sie ihn getroffen hatten. Er fand sein Kraftrad, und bald grübelte er, was zu tun war. Die Nacht dümpelte lau vor sich hin, und der Wind war fast eingeschlafen. Er bot keine erfrischende Brise mehr gegen die Wärme. Am Himmelszelt blinkten unzählige Sterne wie ferne, kreisrunde Halogenspots, viel zu schwach, um unten auf der Welt gute oder böse Taten ins rechte Licht zu setzen.
Juan Méndez war ratlos, wusste nicht, was er tun sollte. Mehrere Tage brauchte er, um sich eine Mutprobe zurechtzulegen. Dann war ein Plan in seinem Hirn gereift. Er wollte in den Süden fahren, dort ein Opfer suchen, es töten und nach der Tat auf dem Motorrad fliehen. Weiblich sollte das Opfer sein, denn Frauen waren vor Satan minderwertigere Geschöpfe. Das Nummernschild seiner Maschine wollte er bis zur Unkenntlichkeit mit Schmutz überdecken. Niemand durfte die Ziffern bei seiner Flucht erkennen.
Um sich über Satanismus zu informieren, hatte er sich mit einigen kultischen Dingen eingedeckt. Mit Teufelsmusik vertrieb er sich die Zeit bis zum nächsten Morgen. Von Black Sabbath hörte er: Jesus, du bist der Abscheuliche! Voll Schaudern las er über die Hardrock-Gruppe ACDC und erfuhr, dass die Abkürzung Antichrist, death to Christ, bedeutete. Antichrist, Tod für Christus.
Den Beatles-Song Number Nine ließ er nach gelesenen Anweisungen rückwärts abspielen: Turn me on, dead man, hörte er nun. Dieser Satz war als Verspottung des Gottessohnes gedacht. Das verwirrend Neue erschöpfte ihn. Endlich fühlte er sich bereit für einen kurzen Schlaf.
Frühmorgens machte er sich auf den Weg in den Süden. Der Himmel war strahlend blau. Nur hier und da zogen Schäfchenwolken über dem Blau ihre Bahn. Zwischen den Uferfelsen hing ein Falke im Aufwind und suchte mit scharfen Augen nach Beute, so wie Juan Méndez es bald selbst tun wollte. Als ein Hubschrauber der Polizei mit Rotorknattern im Tiefflug über das Wasser herankam, fragte er sich, ob das ein böses Omen sei. Er verwarf die Bedenken, als die Maschine sich wieder entfernte.
Nach gut einer Stunde hatte er Playa de las Americas erreicht und war bereit für die Bluttat.
Eine 65-jährige Britin, Mary Mills, wurde sein Zufallsopfer. Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. In einem Supermarkt unten am Strand erregte er nur kurz Aufsehen, als er in voller Montur mit geschlossenem Helm in den Laden stürmte.
In einem Seitengang traf er auf die alte Dame und erstach sie mit einem Messer, welches er gerade erst aus dem Regal genommen hatte. Dann enthauptete er die Tote mit zwei mächtigen Schlägen und trug ihren blutüberströmten Kopf auf die Straße. Dabei brüllte er eine Verherrlichung des Teufels. Er wählte dazu Englisch, die Sprache seines Opfers.
Eine Videokamera im Geschäft zeichnete den grausigen Vorfall auf. Die Unvermitteltheit der Tat sollte der Polizei später Rätsel aufgeben.
Auf Flucht besann sich Juan Méndez sehr spät. Zu lange hatte er sich im Triumph des Mordes gesonnt. Ein anderer Motorradfahrer riss seinen Helm vom Kopf und warf ihn nach dem Mörder. Juan Méndez strauchelte, fiel hin und das Haupt der Toten sowie das Messer entglitten seinen Händen. Ein mutiger Wachmann war schnell über ihm. Er hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf und ihn arretierte. Mit einem grässlichen Fluch auf den Lippen beschrie Juan Méndez sein Versagen.
3.
Ramón musste an diesem Morgen das Haus früh verlassen. Er hatte um acht Uhr einen Gesprächstermin in Santa Cruz. Teresa und er waren deshalb zeitig aufgestanden. Mercedes schlief noch. Im Wohnzimmer roch es nach frisch gebrühtem Kaffee und aufgebackenen Brötchen. Die Eheleute saßen am Frühstückstisch und konnten sich ungestört unterhalten. Ramón merkte, wie sehr seine Frau dies genoss. Umso mehr amüsierte ihn, wie schnell sie auf Mercedes zu sprechen kam: »Deine Tochter weiß wie du genau, was sie will.«
»Was willst du damit sagen, mein Schatz?«
»Der Zahnarzt hat sie bei der Kontrolluntersuchung mit Traubenzucker vom Weinen abgehalten. Da Mercedes beim Nägelschneiden ebenfalls gerne weint, habe ich den Trick auch versucht, und er hat genauso geklappt. Aber stell dir vor, was das gerissene Biest beim zweiten Mal getan hat.«
Ramón wartete neugierig auf die Antwort.
»Sie wollte doch wirklich für jede Hand ein Stück Traubenzucker.«
»Und du hast dich breitschlagen lassen?« Ramón lachte, als sie nickte.
»Aber das Beste kommt noch. Beim nächsten Mal hielt sie mir auch noch ihre kleinen Füßchen hin.«
Nun war es an beiden, herzlich zu lachen.
Ramón beneidete Teresa insgeheim um die schönen Episoden, die sie mit Mercedes immer wieder erlebte, und musste an ihr letztes Streitgespräch denken.
Als sie mit dem Frühstücken fertig waren, sah er auf die Uhr. Es blieb ihm noch ein Moment, um in die Zeitung zu schauen. Auf der Titelseite fesselte ihn der Aufmacher:
Die Insel des ewigen Frühlings unter Schock!
Juan Méndez, ein schon mehrfach behandelter, psychisch labiler Einheimischer wurde zum Mörder an einer bejahrten Britin. Die grausige Tat geschah in Playa de las Ámericas. Der 30-Jährige hat in einem Supermarkt ohne erkennbaren Grund ein Messer aus dem Regal genommen und auf die 65-jährige Frau eingestochen, bis sie tot zusammenbrach.
Doch damit nicht genug: Der anscheinend Geistesgestörte riss die Tote an den Haaren empor und trennte mit zwei Schlägen ihren Kopf vom Rumpf.
Blutbesudelt rannte er mit dem Kopf auf die Straße und schrie dabei immer wieder: Ich bin Satans Rächer! Ein vorbeifahrender Motorradfahrer und ein beherzter Wachmann rangen den Irren nieder und konnten ihn der Polizei übergeben. Der Supermarkt war videoüberwacht, und die schreckliche Tat wurde vollständig aufgezeichnet.
Die Schuldfrage ist zwar klar, doch die Polizei steht trotz allem vor einem Rätsel, denn der Verhaftete schweigt verbissen über sein Motiv.
Sein Kampfschrei nach der Tat lässt vermuten, dass er zu einer der Teufelssekten gehört, die auf Teneriffa ihr Unwesen treiben. Besonders für unsere ausländischen Gäste ist diese Bluttat ein großer Schock.
Der Tourismusminister bedauert die Tat ausdrücklich und verspricht schnelle Aufklärung.
Wir bleiben am Ball!
»Scheiße«, entfuhr es Ramón, »da werden sie schnell wieder Druck auf uns ausüben.«
Dann las er Teresa den Artikel vor. Als sie den Namen des Täters hörte, stutzte sie und unterbrach ihn: »Den Mörder kenne ich! Der war mal bei mir in Behandlung.«
Ramón vergaß seine zeitliche Enge, und es sprudelte aus ihm heraus: »Welche psychischen Probleme hatte er?«
Teresa grinste ihn an. »Ich weiß, dass die Schweigepflicht über Patienten aufgehoben werden kann, wenn sie Gegenstand einer polizeilichen Ermittlung werden. Das ist bei Méndez wohl der Fall. Folgendes kann ich dir sagen: Die Diagnose wies damals auf fehlendes Selbstwertgefühl hin. Méndez hasste sich geradezu und war eine emotional total instabile Persönlichkeit. Er griff zu Medikamenten und Drogen, um sich selbst zu ertragen. Ich hatte das Gefühl, dass meine eingeleitete Therapie fruchtete und ihn stabilisierte. Und nun das, das trifft mich hart.«
Nach kurzem Zögern fuhr sie fort: »Ich muss Méndez nochmals untersuchen, schon um mich für meine Therapie rechtfertigen zu können.«
Ramón nickte. »Das kann ich nachvollziehen. Ich werde mein Bestes tun, dir das zu ermöglichen. Du kannst uns damit sogar eine Hilfe sein, wir tappen ja noch völlig im Dunkeln. Das kleinste Detail, das du aufdeckst, kann die Initialzündung für den Abschluss des Falls werden. Ich erhoffe mir von dir so etwas wie eine psychologische Obduktion.« Er scheute sich nicht, ihr mit diesen blumigen Worten zu schmeicheln. Ganz ohne Reiberei kam er jedoch nicht davon. Er legte seine Hand auf ihre Schulter und küsste sie flüchtig auf ihre glänzenden Haare.
»Kein Aber?«, antwortete sie keck.
Ramón rollte die Augen. »Doch, ich kann nicht allein über die Untersuchung befinden. Außerdem ist Méndez gefährlich. Ich möchte nicht, dass du mit ihm allein bist«, erwiderte er bestimmt. »Einverstanden?«
Teresa war überhaupt nicht einverstanden. Mit deutlichem Ärger widersprach sie: »Das ist doch Quatsch! Ein ergiebiges Gespräch setzt voraus, dass ich wieder eine Beziehung zu Méndez aufbauen kann. Das muss eine Angelegenheit zwischen ihm und mir bleiben, zwischen uns beiden allein!« Sie war nun ziemlich aufgeregt und hatte rote Flecken am Hals.
»Warum musst du nur immer gleich so wütend werden?«, fragte Ramón.
»Ich empfinde Wut als Motor, der mich antreibt«, antwortete sie kämpferisch. »Außerdem müssen Gefühle raus, die soll man nicht unterdrücken.«
Ramón nahm sich vor, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Sein Zeitmangel wurde ihm plötzlich wieder bewusst. Auch der sprach gegen längere Diskussionen.
So suchte er einen Kompromiss: Méndez würde mit Teresa allein sein, aber Handschellen tragen.
»Dir wird von ganz oben bald der Wind ins Gesicht wehen, du Armer«, sagte Teresa mitfühlend. Sie war mit dem Kompromiss zufrieden.
»Wind von oben sorgt für einen aufrechten Gang«, antwortete Ramón grinsend. Noch ein letzter flüchtiger Kuss, dann eilte er aus dem Haus. Er vergaß sogar einen Blick auf Mercedes zu werfen, doch das fiel ihm erst auf, als er sich schon auf der Autobahn Richtung Santa Cruz befand.
Nach einigen Minuten Fahrt holte ihn die Zeitungsmeldung wieder ein. Er wollte nicht den ganzen Tag ungenutzt vergehen lassen und rief auf dem Revier an, um Weisungen zu erteilen. Er verlangte nach Teniente Morales.