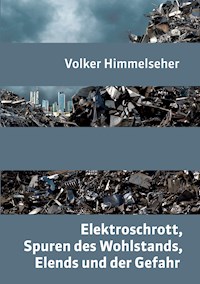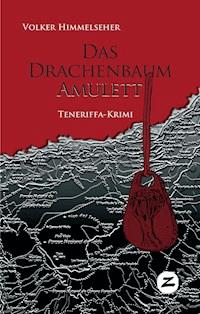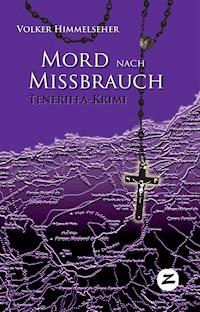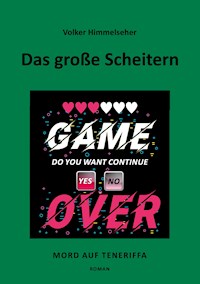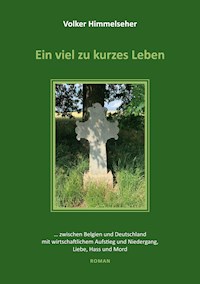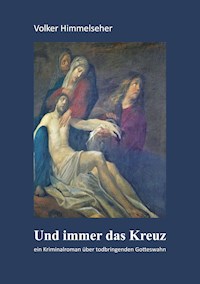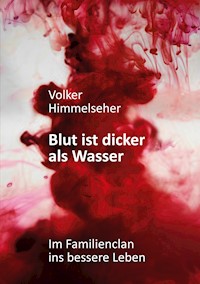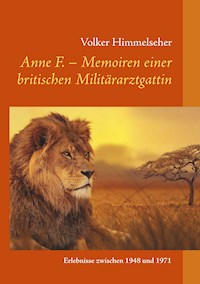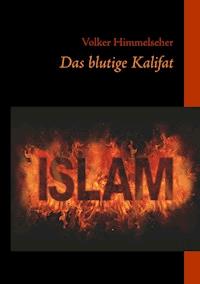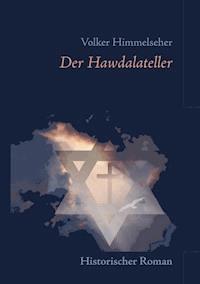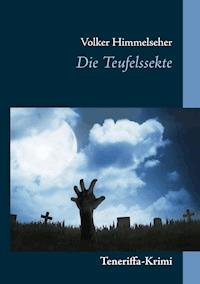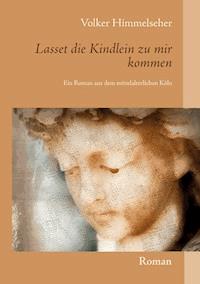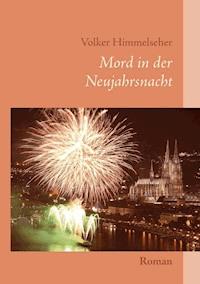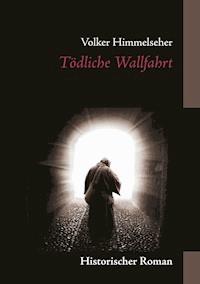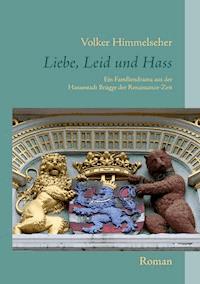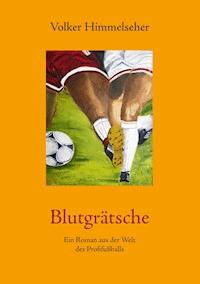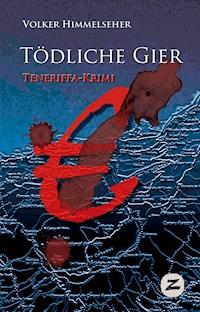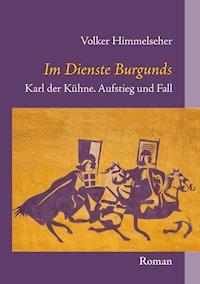
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Karl der Kühne machte das Herzogtum Burgund zu einem bedeutenden Machtfaktor im Europa des ausgehenden Mittelalters. In Dauerfehde mit dem französischen König träumte er davon, selbst die Königswürde zu erlangen. Dafür ging er viele Zweckallianzen ein. Sein Leben und Wirken bietet einen reichen Spannungsbogen. Sein Aufstieg verlief rasant. Karl unterstrich ihn mit Ritterlichkeit und prachtvoller Hofhaltung. Die Schweizer Eidgenossenschaft mit ihrer unorthodoxen Kriegsführung hatte schließlich wesentlichen Anteil an Niedergang und Tod des Burgunders, eines der letzten großen Ritter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorbemerkung des Autors
Der Roman nimmt seinen Beginn in Flandern.
Von hier aus machte Karl der Kühne das Herzogtum Burgund zu einer bedeutenden Kraft Europas. Exquisite Hofhaltung, prächtige Kleidung, höfisches Zeremoniell und ausgeprägte Festkultur setzten neue Maßstäbe. Strenges Turnierwesen, hohe Kriegskunst und straffes Militärwesen förderten den Aufstieg des Herzogs. Sein späterer Niedergang verlief nicht minder aufsehenerregend. Die neue Kriegsführung der Schweizer Eidgenossen lehrte Karls Ritterheer das Fürchten und Verlieren. Die Lebensschicksale des Herzogs, seiner Verwandten, Verbündeten und Feinde finden sich in diversen Aufzeichnungen und bestimmen mit spannenden Ereignissen den Handlungsstrang des Romans.
Fiktive Personen wie die der Familie van der Weyden ergänzen das Bild um die Freuden und Sorgen der Untertanen.
Inhaltsverzeichnis
Geschichtliche Ausgangslage
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Geschichtliche Ausgangslage
Man schrieb das Jahr 1468. Das christliche Europa stand noch ganz unter dem Eindruck der pompösen Hochzeitsfeierlichkeiten des Burgunderherzogs Karl und seiner Frau Margarete von York. Die Schwester des englischen Königs Edward IV. sollte durch ihre Ehe mit dem Herzog das Waffenbündnis der beiden mächtigen Männer festigen. Der Duc de Bourgogne hatte während der prächtigen Festwoche der Vermählung seine ganze Herrlichkeit zur Schau gestellt und seinen Machtanspruch in Europa deutlich gemacht. Mit einer atemberaubenden Hochzeitsschau in der reichen Hansestadt Brügge hatte er alles bisher Dagewesene übertroffen und nicht nur sein frisch angetrautes Eheweib beeindruckt. Das europäische Machtgefüge, das sein Vater, der friedliebende Herzog Philipp, akzeptiert und behutsam gepflegt hatte, schien mit einem Male ins Wanken zu geraten. Philipp hatte über lange Zeit den Ausgleich mit dem französischen Herrscherhaus gesucht und mit seinem französischen Lehnsherrn und Verwandten Frieden gehalten. Er hatte sogar dem nun amtierenden König vor dem Zorn des Vaters Asyl gewährt. Zum Dank dafür durfte er ihm nach dem Tode des Vaters die Königskrone aufsetzen und wurde zu seinem mächtigsten Vasal. Herzog Karl hielt nichts von Wohlverhalten gegenüber Frankreich. Er war sich sicher, dass König Ludwig einstmals sogar Meuchelmörder auf ihn angesetzt hatte, um nach dem Tode Philipps dessen Herrschaftsgebiet zu vereinnahmen. Der König bestritt dies zwar vehement, aber der Burgunder glaubte daran und provozierte ihn permanent, nicht erst durch die frisch geknüpften ehelichen Bande zum englischen Königshaus. Ludwig lebte mit England in Fehde! Schon kurz nachdem er die Nachfolge seines Vaters angetreten hatte, ließ Karl keinen Zweifel darüber aufkommen, wie sehr er den Franzosenkönig verabscheute. Die beiden Herrscher wurden schnell zu Gegenspielern auf der Bühne der Macht. Dabei scherte sie nicht, vom selben Geblüt zu sein. Das Haus Valois hatte sowohl französische Könige als auch burgundische Herzöge hervorgebracht. Vom Charakter und dem Einsatz der Mittel her waren die beiden Potentaten sehr verschieden. Herzog Karl war einer der letzten Ritter, König Ludwig eher ein Intrigant und Ränkeschmied. Herzog Karl kämpfte meist mit offenem Visier, König Ludwig eher aus dem Hinterhalt. Der frisch gekürte Burgunderherzog schwor bald öffentlich, er wolle König Ludwig, wo immer möglich, als Lehnsherren »verlieren«. Ein Bonmot machte am burgundischen Hof schnell die Runde: »Unser Duc liebt Frankreich so sehr, dass er ihm an Stelle eines Königs deren sechs von Ludwigs Sorte wünscht!« König Ludwig verbarg als Leisetreter, anders als sein Blutsverwandter, wie sehr ihm dessen Stolz und Machtanspruch missfielen. Des Ducs aufbrausende, herrische Art passte ihm zwar gar nicht, aber er schwor sich zunächst nur insgeheim, Karl gefügig zu machen und aufs rechte Maß zusammenzustutzen. Zu Beginn unterliefen ihm bei seinem Bemühen allerdings viele Fehler. Die machte sich sein Rivale zu Nutze. Die Entmachtung aller Räte seines Vaters war Ludwigs unglücklichster Beschluss. Er stand fortan im eigenen Land vor einer unüberwindbaren Wand von Gegnern.
Auch das Einfordern immer höherer Steuern trug dazu bei, dass sich in der »Ligue du Bien public« seiner Vasallen tiefste Unzufriedenheit ausbreitete. So konnte sich Karl an die Spitze dieser Koalition der großen Feudalherren stellen und sie gegen seinen Erzfeind einschwören. Zusammen mit König Ludwigs Bruder Charles, Herzog von Berry und Herzog Franz II. der Bretagne machte der Burgunderfürst dem Regenten Frankreichs mit großem Vergnügen das Leben schwer. Kriegerische Aktionen scheute Karl dabei nicht. Nach einer unentschiedenen Schlacht bei Monthery, in der er schwer verwundet wurde, demütigten er und seine Verbündeten den König regelrecht. Ludwig musste sich in den Verträgen von Conflans und Saint-Maur der Verpflichtung unterwerfen, die einst Herzog Philipp abgekauften Somme-Städte entschädigungslos an Herzog Karl zurückzugeben. Auch die Verbündeten Karls erhielten beachtliche Gebiete zugesprochen. Der König konnte in seiner Zwangslage dem Knebelvertrag nur zustimmen. Er zögerte aber die Umsetzung der Zusagen immer wieder hinaus. Zuletzt rief er im Hochzeitsjahr des Herzogs eine Ständeversammlung ein und ließ von ihr die Rückgabe der Städte verweigern. Es gärte also heftig zwischen den beiden Herrschern. Karl war, ähnlich wie sein Gegenspieler, mit seinem Vater bis zu dessen Tode oft überquer gewesen. Aber er hatte von ihm die Verwirklichung eines burgundischen Großreiches als Herzenswunsch übernommen. Er träumte von einem neuen Land Brabant, wie es einst unter dem mächtigen Lothar aus dem karolingischen Mittelreich Lotharingien entstanden war.
Er sehnte sich nach einem unabhängigen Königreich, dem zusätzlich zu seinen bisherigen Ländereien, Geldern, Kleve, Jülich, Berg, Bar, Lothringen, die Grafschaften Mark, Moers und Vaudémont angehören sollten. Er wollte also seine oberen und niederen Lande ergänzen und durch eine Landbrücke verbinden. Ein Lothringen unter seiner Führung sollte das Bindeglied zwischen »Oben« und »Unten« werden.
Herzog Karls wahres Herrschaftsgebiet präsentierte sich vorerst noch als Flickenteppich einzelner Ländereien.
Zeit, dies zu ändern, blieb dem Fürsten zunächst nicht.
Seine ganze Kraft wurde vom feindlichen Frankreich gebunden. Weil die Führer der einzelnen Gebiete verspürten, wie sehr der Herzog von Ludwig gefordert war, suchten sie mit ihrem Lehnsherrn Karl immer wieder die Machtprobe, um weitere Privilegien oder gar die Unabhängigkeit zu erlangen. Die unruhigen Zeiten ließen dem frisch vermählten Paar keinen Raum für Flitterwochen. Schnell mussten die Eheleute getrennte Wege gehen. Herzogin Margarete blieb zudem das Herz ihres Gemahls verschlossen. Das hatte seine zu früh verstorbene Frau Isabella vereinnahmt und über den Tod hinaus nicht losgelassen. Margarete gewann allerdings über die Jahre Karls Wertschätzung und Treue.
Die Ehe blieb trotzdem vordergründig eine politische Liaison. Auf ihren Wappen und Siegeln beschrieben die Eheleute das eingegangene Zweckbündnis: »Je l’ai emprins.« Ich habe es gewagt, stand in Herzog Karls Wappen und Siegel. Herzogin Margarete hatte als Antwort darauf: »Bien en aviengne.« Möge Gutes daraus erwachsen.
Die Herzogin wurde keine glückliche Gattin, aber für ihre Stieftochter Maria eine gute Freundin und Ersatzmutter. Für die Außenwelt stand sie loyal zu ihrem Gatten. Wenn sie mit der zierlichen Halskette spielte, die sie, mit den Rosen des Hauses York und einem güldenen Anhänger aus den Buchstaben M und C auf schwarzroter Emaille-Arbeit verziert, am Halse trug, zeigte sie für alle sichtbar gelebte Einigkeit mit »ihrem Carolus«!
1
Es wurde Nacht. Der Herzog stand im Schloss von Brügge am Fenster seines Schlafgemachs. Bald würde die Wache zur Nacht aufziehen. Er besah sich das Spektakel gern, denn es erfolgte nach festem, von ihm selbst vorgegebenem Protokoll. Da kamen die Soldaten auch schon um die Ecke marschiert. Diesen Abend führte Seigneur de Semply das Kommando, stellte der Duc fest. Er kannte alle seine wichtigen Leute beim Namen. Der Kommandeur ließ die Männer in Reihe und Glied antreten. Bewaffnete zu Fuß, Bogenschützen aus der Picardie und dem Hainaut sowie ein Fahnenträger mit der herzoglichen Standarte in den Fäusten platzierten sich im Karree. De Semply ergriff die Parole. Er übergab die Standarte an einen Berittenen, der von zwei Fackelträgern begleitet wurde. Der kleine Zug setzte sich langsam in Bewegung, stracks auf das Fenster des Herzogs zu. Trompeten und Hörner bliesen einen letzten Gruß zur Nacht. Der Herzog zeigte sich gnädig hinter den trüben Scheiben. Er entblößte sein Haupt und winkte huldvoll hinab. Er wusste sich sicher für die kurze Nachtruhe, die ihm nun gegönnt war. Die Männer würden bis zum Hahnenschrei ihre Pflicht tun. Schon in aller Frühe, am zweiten Tag nach der Hochzeitswoche, wollte er Richtung Holland aufbrechen. Er beabsichtigte dort die Abordnungen von 57 Städten zu empfangen und sich von ihnen als Lehnsherrn huldigen zu lassen.
Am frühen Morgen ließ Herzog Karl seine Garde antreten.
Seine Leibwache bestand aus stattlichen Männern, die wie er den Kampf nicht scheuten. Verächtlich dachte er an den Pomp, mit dem sein Vater sich einst umgeben hatte. Der hatte in seiner Umgebung eine Vorliebe für Türken gezeigt. Mit Seidenturbanen, vor Juwelen blitzend, mussten sie sich als herausgeputzte Schutzschilde um ihn aufpflanzen und Soldat »spielen«. Philipp hatte sie für viel Geld meist direkt in Istanbul angeworben. In großen Wannen ließ er sie zwangstaufen. Danach waren sie Christen für ihn, wie es der Kodex der herzoglichen Garde verlangte. Dem Duc war es hernach ziemlich egal, ob sie immer noch ihr Angesicht gegen Mekka wandten und Allah anbeteten. Hauptsache, der Kodex war eingehalten, und die Kerle gaben was her!
Für solche Eskapaden hatte sein Sohn nichts übrig.
Der brauchte für seine Pläne echte Kämpfer! Es war ein kühler, nebeliger Morgen, als sie aufbrachen. Die Berittenen trugen Kesselhauben mit vorkragendem Visier, das sich öffnen und schließen ließ. Die Hauben waren größtenteils in Mailand gefertigt und hatten Eisenkoller, die auch die Schultern schützten. Die Helme waren mit Lederfutter versehen und hatten eine Innenkappe, gleichfalls aus Leder.
An der Qualität der Panzerhandschuhe ließ sich der Wohlstand der Kämpfer erkennen. Die höchstwertigen Handschuhe waren aus versilbertem Stahlnetz mit weichem Ziegenlederfutter gefertigt. Sie waren sehr haltbar und lagen angenehm auf der Haut. Ein kleiner Trupp Fußsoldaten stand fröstelnd neben dem Reiterzug. Er würde den Berittenen im Eilmarsch folgen. Diese Männer trugen zum Schutz ihrer Schädel nur randlose Eisenkappen. Als Brustschutz hatten sie lediglich kurzärmlige Kettenhemden am Leib. Das Leben des kleinen Mannes war eben nicht so viel wert wie das eines Edelmanns! Die Truppen setzten sich bald in Bewegung. Die hochgewachsenen Männer der Garde erregten überall Aufmerksamkeit und Bewunderung. Ihnen schlug aber keine Sympathie entgegen. Die meisten Untertanen führten ein viel zu freudloses Leben dafür. Wie sollte man bei so trostlosem Leben diese Kerle mögen, die den Herzog so viele Taler kosteten! Die von den Bürgern abgepressten Militärsteuern und Abgaben waren inzwischen kaum noch aufzubringen. Von einem Stück saftigen Fleisches oder einer Scheibe fetten Käses bei Tisch konnten viele nur noch träumen. Oftmals mussten fromme Bibelsprüche die warme Mahlzeit ersetzen. Die Älteren lebten ständig in der Angst, dass ihre Söhne von Herzog Karls Häschern in den Soldatenrock gezwungen würden. Sie waren doch ihre einzige Garantie für einen auskömmlichen Lebensabend. Ohne sie würden ihre Äcker verwaisen und bald der Hungerstod folgen! Der Herzog und seine Eskorte ritten an vielen feindlich geschlossenen Fensterläden vorbei. Der stickige Geruch von Armut und Schmutz drang ihnen aus altem Mauerwerk wie ein stiller Vorwurf entgegen. Die Reiter bemerkten das nicht einmal! Nach vier Tagen erreichte die wehrhafte Schar Zeeland. Ihre Brustpanzer und Hellebarden glänzten silbrig im letzten Sonnenlicht. Die Fahne Burgunds flatterte stolz im Wind und forderte Huldigung. Die goldenen Lilien auf blauem Grund bezeugten die Abstammung aus dem französischen Königshaus. Goldene und blaue Schrägstreifen in rotem Rahmen repräsentierten das burgundische Kerngebiet. Der stehende rot gekrönte Löwe auf Weiß herrschte über Limburg, der goldene auf Schwarz über Brabant! Herzog Karl blieb über Nacht und ließ sich am nächsten Morgen von der Bevölkerung Treue geloben. Vor der beeindruckenden Schar der Bewaffneten tat man dies zumindest als Lippenbekenntnis. Rastlos stürmte der Zug weiter. Die nächste Station war Den Haag. In dieser Stadt übertünchte der bürgerliche Wohlstand die Armut der Unterschicht. Karl wurde von den Reichen mit Begeisterung begrüßt. Die Abgeordneten der Städte, die im prächtigen Stadthaus auf ihn warteten, bedachten ihn ebenfalls mit Jubel. Ihre Gesichter wurden jedoch merklich länger, als Herzog Karl seine Beschlüsse verkündete. Er gab die Höhe seines »Gesuchs« bekannt, welches die Untertanen in den nächsten sieben Jahren aufbringen sollten. Der Herzog wollte sich mit ihrer Hilfe für den nächsten Waffengang gegen König Ludwig rüsten …
Sensibel verspürte er die kaum unterdrückte Feindseligkeit, die ihm nun entgegenschlug. Sie bereitete ihm Verdruss, doch er ließ sich nichts anmerken. »Oderint dum metuant«. – Mögen sie mich hassen, solange sie mich fürchten, dachte er, wie bei den alten Römern gelesen. Er verachtete diese Kleingeister. Wichtig waren ihm nur seine hochgesteckten Ziele. Die Begründungen für sein Fordern waren eindeutig: »Ich bin mir sicher, dass der Franzosenkönig nicht ruhen wird, bevor er Burgund vernichtet hat. Dem muss ich zuvorkommen! Solange der König seine Intrigen spinnt, wird Burgund keinen Frieden finden und erst recht nicht zu dem Reich anwachsen, das ich schon lange vor meinem inneren Auge sehe.« Der Téméraire, der Kühne, wie seine Untertanen ihn respektvoll nannten, wollte ein ständig unter Waffen stehendes Heer aufbauen. Bezahlte Söldner und eine starke Artillerie sollten den Kern dieser Heerschar bilden.
Seine Artillerie musste mindestens verdoppelt werden. Es war mühselig und teuer, neue Kanonen zu gießen. Auch ein streitbares Heer würde Unsummen verschlingen, und die prachtvolle Hochzeitsfeier hatte gerade erst den Staatssäckel stark strapaziert! Nochmals beschwor er die Menge: »Ludwig, die listige Schlange, wird nicht ruhig auf dem Hintern sitzen bleiben, bis sich meine Schatztruhen wieder von selbst gefüllt haben. Es bedarf dafür eines besonderen Kraftakts. Mein Verlangen an Euch ist also gerecht!« Sein Vortrag war so entschieden und die Machtentfaltung so überzeugend gewesen, dass die Ratsherren ihre Verbitterung verbargen und den Vorstellungen des Landesvaters entsprachen. Sogar ein lautes »Es lebe Burgund« rauschte durch den Saal. Herzog Karl war versöhnt und schon wieder ungeduldig bedacht, weiterzureisen. Der Abend brachte noch eine eindrückliche Bestätigung seiner Befürchtungen. Ein übermüdeter Kurier, verschwitzt und vom strammen Ritt verdreckt, wurde an die Tafel vorgelassen. Er hatte den Staub der Straße geschmeckt und war völlig erschöpft. Mühsam niederkniend überreichte er dem Herzog zwei Briefe. Der Duc öffnete, von schlimmer Vorahnung getrieben, den ersten Umschlag. Auf dem Schreiben prangte das Siegel des Herzogs der Normandie. Schnell las er die Zeilen, sein Gesicht färbte sich rot vor Zorn, und es kostete ihn Mühe, nicht in einen seiner gefürchteten Wutausbrüche zu verfallen. König Ludwig hatte seine Abwesenheit aus den Stammlanden genutzt, um seinen Verbündeten zu überfallen! Der rief nun nach Hilfe! »Die sollst du haben«, brüllte der Herzog erbost und griff nach dem zweiten Schreiben. Das machte die Schreckensmeldungen komplett. König Ludwigs Heerscharen waren auch in die Bretagne eingedrungen. Von dort erreichte den Burgunder nun ebenfalls ein drängender Hilferuf. Der Herzog konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Voll Ungeduld erwartete er den nächsten Morgen. Bevor er mit seinem Gefolge weiterritt, befahl er den Ratsherren, frische Truppen für einen Vergeltungsschlag gegen Ludwig auszuheben. Im Gewaltritt ging es zurück nach Brüssel. Auch dort gönnte sich der Fürst keine Pause. Er benötigte schnellstens Soldaten für eine Strafaktion gegen König Ludwig. Überall im Land ließ er waffenfähige, junge Männer einziehen. Für viele Eltern trat nun das ein, was sie schon lange als Schlimmstes befürchtet hatten …
2
Ende August 1468 hatte Herzog Karl 15.000 Mann unter Waffen. Weitere Verstärkung aus Holland sollte bald eintreffen. Darauf wollte der Duc jedoch nicht warten. Er fühlte sich mit den vorhandenen Truppen stark genug und machte sich auf den Weg zu den Somme-Städten. Dort vermutete er nämlich Ludwigs nächsten Angriff. Schnell ließ er in der Nähe von Péronne ein befestigtes Lager ausheben und sah dem Feind voll Ungeduld entgegen. Schon bald erreichten ihn ungünstige Nachrichten. Der Herzog der Bretagne war unter König Ludwigs Druck zu Frankreich übergelaufen. »Amicus certus in re incerta cernitur.« – Den wahren Freund erkennt man in der Not, dachte Karl bitter, wobei er automatisch in sein geliebtes Latein verfiel. Der feige Bretone hätte sicher noch etwas ausharren können! Auch der Herzog der Normandie habe sich Ludwig unterworfen, erreichte Karls Ohr zuerst nur als Gerücht und wurde bald zur Gewissheit! Der Burgunderherzog rief seine Heeresführer zusammen, um die Lage zu beratschlagen. Es sah sehr danach aus, als wäre sein Heer, trotz aller Eilmärsche, zu spät gekommen! Der rachsüchtige Fürst konnte jedenfalls nicht mehr mit Verstärkung durch die Verbündeten rechnen. Allein wollte der Téméraire jedoch trotz aller Wut keinen Angriff auf die Franzosen wagen. König Ludwig hatte sich mittlerweile mit seinem starken Heer bei Noyon verschanzt. Herzog Karls Kriegsrat beschloss abzuwarten, wie sich die Dinge entwickelten. Bald tat sich etwas. Nach einigen Tagen begehrte eine französische Abordnung Einlass im burgundischen Lager. Unter der Führung des Grafen von Saint-Pol und des Kardinals La Balue wünschte sie den burgundischen Herzog zu sprechen. Ein junger Gardeoffizier brachte die Edelleute zum Zelt des Duc. Der erwartete ihr Eintreten mit eisigem Gesichtsausdruck. Wütend ertrug er ihre leeren Begrüßungsphrasen. Seine Miene blieb teilnahmslos. Ich komme ihnen kein Stück entgegen, hatte er sich vorgenommen. Endlich kamen die Franzosen auf den Grund ihres Besuches zu sprechen: König Ludwig bot Herzog Karl Friedensverhandlungen an! Der alte Angsthase will einen Waffengang mit mir vermeiden, dachte der Duc selbstzufrieden. »Unser Herr ist bereit, für die Kosten aufzukommen, die Euer Aufmarsch und der Aufbau des Lagers vor Péronne verschlungen haben«, ergänzte der Kardinal mit sanfter Stimme. »Unser König denkt an 120.000 Kronen«, fügte Saint-Pol schnell hinzu. Herzog Karl schwollen die Adern an seinem kräftigen Hals merklich an. Er ließ den angehaltenen Atem aufgebracht zwischen seinen Zähnen entweichen. »Als würde das genügen«, stieß er erbost hervor. Unter den burgundischen Edelmännern setzte Unruhe ein. Der Duc verlangte von ihnen mit einer rüden Bewegung seiner Rechten, Ruhe zu bewahren. In seinem Kopf überschlug er das Angebot und zur Überraschung seiner Getreuen stimmte er zu. »Die holländische Verstärkung hat mein Lager noch nicht erreicht. Auf bretonische und normannische Unterstützung kann ich nicht zählen. Vielleicht stehen deren Truppen inzwischen sogar schon auf der Seite des Gegners. Meine Soldaten sind den Franzosen zahlenmäßig unterlegen. Der angebotene Betrag ist für viele Kanonen, Kugeln und Pulver gut. Meine Ehre wird durch eine Zustimmung nicht beschädigt. Es wird sich schnell herumsprechen, wer für den Frieden bezahlt hat, dafür werde ich sorgen! Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich werde mir Ludwig schon später kaufen«, sagte er sich. Diese Gedankenkette war durch das Hirn des Fürsten gerast und hatte zu der Entscheidung geführt, die alle Anwesenden so sehr überraschte. Besonders die Burgunder hatten ihren Herrn als uneinsichtiger und streitbarer eingeschätzt. Die Franzosen zeigten sich erleichtert und schieden, ohne eine förmliche Essenseinladung zu erhalten.
Als König Ludwig bei ihrer Rückkehr das Ergebnis erfuhr, stieg Misstrauen in ihm auf. »Nihil fit sine causa.« Nichts geschieht ohne Grund. Wieso hat Karl nicht reagiert, wie es seinem Charakter entspricht?, fragte er sich. Der König hatte fest mit der Ablehnung seines Vorschlags gerechnet und einem unbedachten Angriff seines Gegners. Lässt sich der Burgunder wirklich mit einem Trinkgeld abspeisen? Ist Burgund vielleicht gar nicht so stark, wie ich immer befürchtet habe? Je länger der König die Lage bedachte, umso mehr kam er zu der Überzeugung, sich nur durch ein persönliches Zusammentreffen mit dem Herzog ein richtiges Bild machen zu können. Gegen alle Mahnungen seiner Ratsherren sandte er eine zweite Abordnung zum Hof des Burgunders und bot ihm ein Vieraugengespräch an. Er erklärte sich dafür sogar bereit, zu Herzog Karl hinzureisen. Seine Berater warnten ihn eindringlich davor. »Es ist fahrlässig, Sire, sich dem Burgunder ohne Not in die Hände zu geben.« Doch der König hörte nicht auf sie. Am 8. Oktober traf ein Geleitbrief des Burgunders bei ihm ein. Der Herzog schlug ein Treffen in Péronne vor und gewährte König Ludwig freies Geleit durch sein Gebiet. Er versprach ihm Sicherheit und Schutz gegen jegliche Angriffe. König Ludwig war zufrieden. Sein Plan schien aufzugehen. Einen letzten Versuch des edlen Saint-Pols, ihn abzuhalten: »Stellt Euch vor, mein König, der Herzog bricht sein Wort!«, schüttelte er wie eine lästige Fliege ab. Er ließ keine Zeit verstreichen und machte sich auf den Weg ins Lager von Péronne. Er reiste mit kleiner Eskorte und schlug auch den nächsten Vorschlag seiner Räte aus, wenigstens mit starkem Heer bei Herzog Karl zu erscheinen. Nur 50 Herren galoppierten mit ihm, darunter der Herzog von Bourbon, sein Bruder, der inzwischen Kardinal-Bischof von Lyon geworden war, und Saint-Pol. Die zwei Brüder Isabelles, der verstorbenen Ehefrau des kühnen Karls, stellten sich an die Spitze der Delegation. Sie konnten trotz ihrer engen Familienbande zum Burgunderherzog ihre Feindschaft zu ihm nicht verhehlen. Herzog Karl ging im großen Saal des alten Kastells von Péronne nervös auf und ab und debattierte mit sich selbst. Zehn Schritte herauf, zehn wieder hinab hallten die Sohlen seiner Lederstiefel. Er erwartete seinen Erzfeind mit Ungeduld. Das Kastell war als Unterkunft für den königlichen Gast nicht zu gebrauchen gewesen. Neben dem Turm existierte nur ein schäbiges Wohngebäude. Der Herzog hatte deshalb für ihn das gediegene Palais des örtlichen Steuereinnehmers herrichten lassen. Schritte näherten sich, und der Duc erwartete die Meldung von König Ludwigs Eintreffen. Es war jedoch nicht die Ankunft des Königs, die man ihm meldete. Man benachrichtigte ihn vielmehr, dass die Bürger von Lüttich einen Aufstand gegen ihn angezettelt hätten. Mit dem Ruf »Vive le roi!« hatten sie sich mit einem Bekenntnis zu Frankreich in offener Revolte gegen Burgund erhoben. Das war wirklich schlimm! Lütticher Truppen hatten den schon von Herzog Philipp eingesetzten Fürstbischof Ludwig von Bourbon, dessen Neffen, sowie den burgundischen Gouverneur, Guy de Brimeu in Tongern gefangen gesetzt! Der Bischof von Philipps Gnaden war von Anfang an in Lüttich ungeliebt gewesen. Als 17-Jähriger war er ohne priesterliche Vorbildung in das geistliche Amt erhöht worden. Er wurde aber nie ein Mann der Kirche. Er frönte stattdessen zum Ärger der Bürger allen weltlichen Vergnügen, besonders den Tafelfreuden.
Als Herzog Karl von dem Kampfruf der Aufständischen vernahm und erfuhr, dass bei der Feindseligkeit gegen den Bischof sogar zwei französische Gesandte zugegen gewesen waren, zählte er schnell eins und eins zusammen. Die Lütticher hatten seit seiner letzten Strafaktion gegen sie stets engen Kontakt zu König Ludwig gehalten. Das wusste er. Ludwig hatte bei diesem Aufstand nun bestimmt seine schmutzigen Finger im Spiel. Die giftige Spinne versuchte es wohl mit einem Doppelspiel! »Ut sementem feceris, ita metes.« Was du gesät hast, wirst du ernten, knirschte Karl wütend durch seine Zähne. »Ich werde alles tun, um dich in den Staub zu zwingen.« »Alles auf Erden ist nichts in der Welt, bleibt bescheiden«, versuchte ihn sein Hofkaplan zu beschwichtigen. Doch der Herzog war nicht zu besänftigen.
Schließlich kam der französische König doch noch in Péronne an. Sein Empfang fiel eisig aus. Das geplante Jubelfest hatte der Duc längst abgesagt. Das vorgesehene Festmahl mit Saucen, Brühen und Farcen aus wertvollen Zutaten, wie Gold und Edelsteinen, blieb ungekocht. Der Herzog ließ den Gästen lediglich die Zimmer zuweisen. Bald bemerkten sie sorgenvoll, dass vor ihren Räumen Soldaten Wache schoben. Sie standen unter Arrest!
König Ludwig schickte einen seiner Höflinge auf den Gang hinaus, um zu sehen, was geschähe. Dem armen Mann wurde der Durchgang verwehrt! Er kam mit schreckensbleichem Gesicht zurück. Ein burgundischer Edelmann hatte süffisant durchblicken lassen, was in Lüttich geschehen war und was der Herzog daraus folgerte. Jetzt machte sich der König wirklich Sorgen. »Wie können meine Leute einen Aufstand so zur Unzeit anzetteln?«, fragte er sich. Er empfand keinerlei Gefühl eigener Schuld! Dabei hatte er kurz vor seiner Abreise die Agenten nach Lüttich in Marsch gesetzt! Dass sie so unüberlegt und zur falschen Zeit intrigieren würden, hatte er allerdings nicht bedacht …
Herzog Karl ließ den König einige Tage in seiner Kammer schmoren und verweigerte ihm jedes Gespräch. In Ludwig wuchs die Angst. »Haben mich meine Ratgeber doch zu Recht davor gewarnt, mich schutzlos in Karls Hände zu begeben?« Vergeblich versuchte er, die Wachen mit Geld zu bestechen. Schließlich blieb ihm nur das Gebet. Der Duc wurde langsam ebenfalls unruhig. Er war ein Mann von Ehre. Er hatte dem König Sicherheit und freies Geleit versprochen. Er konnte ihn nun nicht festsetzen oder gar töten, so gern er das auch getan hätte. Eine andere Lösung musste her. Eine Strafe aber sollte Ludwig treffen, und sie musste bitter schmecken! Als Herzog Karl seine Rachegelüste wieder im Zaume hatte, begann er mit zwei seiner Vertrauten einen harten Friedensvertrag auszuarbeiten. Den sollte Ludwig ohne »Wenn und Aber« unterzeichnen. Im Vertragstext wurden Burgund alle Gebietsgewinne seit 1465 bestätigt. Außerdem sollten neue Einkünfte aus der Picardie, dem Gebiet von Mortagne, und Steuern aus Amiens als dauerhafte Verpflichtungen hinzukommen. Weitere Zugeständnisse wollte der Herzog verlangen. Am wichtigsten war ihm die Befreiung Burgunds von jeglicher Dienstleistungspflicht an das französische Königshaus. Seine Lehnspflicht gegenüber Ludwig musste enden! Der Duc war fest entschlossen, dem Franzosen zu all diesen Punkten ein »Ja« abzutrotzen. Am dritten Tag nach Beginn des Arrestes suchte Karl den König in dessen beengten Räumlichkeiten auf. König Ludwig versuchte ihn sofort wieder, in gewohnt verlogener Art einzuwickeln. Er nannte ihn Bruder, versprach alles und nichts, beteuerte seine Unschuld am Lütticher Aufstand und beschwor seine unerschütterliche Freundschaft zu Burgund. Der Herzog blieb davon unberührt, frostig und unerbittlich. Er legte seinem Intimfeind den Vertragstext vor und verlangte zu allen Klauseln dessen Unterschrift vor Zeugen. Der König war erschüttert über das, was er las, aber da er in seiner verzweifelten Lage keinen Ausweg sah, gab er die Zustimmung zu allen Punkten. Er wagte nicht einmal, irgendeine Änderung vorzuschlagen. Schließlich ließ der Duc zwei Reliquien, die der König, wie er wusste, immer mit sich führte, in den Verhandlungsraum bringen. Es waren ein Arm des in Frankreich hoch verehrten Saint-Leu und ein Stück des heiligen Kreuzes, das aus dem Besitz Karl des Großen stammte. Auf Drängen des Herzogs beschworen die beiden Herrscher ihren Pakt auf diese Heiligtümer. Selbst das war Herzog Karl noch nicht genug. Er hatte sich ganz spontan noch eine weitere Demütigung für den König ausgedacht: »Ich bin in Eile. Lüttich ist in Aufruhr, und ich muss die Stadt aufs Schärfste bestrafen. Ich gehe davon aus, dass Ihr mich mit Euren Leuten auf meiner Strafexpedition begleitet, lieber Bruder«, äffte er den König nach. »Besser könnt Ihr Eure Freundschaft zu mir nicht beweisen«, fügte er mit einem grausamen Lächeln hinzu. Auch diese Kröte schluckte Ludwig, wenn auch nur schwer. Nach einem opulenten Versöhnungsmahl befestigten er und seine Leute sogar das burgundische Andreaskreuz auf den Waffenröcken und setzten sich gemeinsam mit Herzog Karls Soldaten gen Lüttich in Marsch. »Mit diesem Zeichen will ich vor den Aufständischen dokumentieren, wie sehr ich auf Eurer Seite stehe«, versuchte der König dem Herzog zu schmeicheln und wies auf das Kreuz Burgunds auf seiner Brust. Insgeheim hoffte er jedoch, in diesem Habit von den Lüttichern nicht als König der Franzosen erkannt zu werden. Schließlich verband ihn mit der Stadt ein Waffenbündnis auch gegen Karl!
3
Am 26. Oktober standen Burgunder und Franzosen vor den Mauern der Stadt. Die Aufständischen wussten genau, dass sie mit keiner Gnade rechnen konnten. Sie waren deshalb entschlossen, sich bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Ihre große Hoffnung setzten sie auf einen verwegenen Plan von 600 Kämpfern aus Franchimont. Goes van Strailhe, ihr Anführer, hatte ihn den Stadtoberen nahegebracht. Die Männer wussten durch Späher, dass Herzog Karl und König Ludwig in einem kleinen Häuschen in der bereits eingenommenen Vorstadt logierten. Der Eigentümer des Häuschens gehörte zu den tapferen Kämpen und die kannten einen geheimen Weg dorthin. Den Geheimgang wollten die Männer für einen nächtlichen Ausfall nutzen und die beiden Herrscher dabei gefangen nehmen. Mit ihnen als Geiseln würde sich das Kriegsglück wenden, dessen waren sie sich sicher! In der Nacht zum 29. Oktober machten sie sich auf den Weg. Die Wetterverhältnisse waren günstig. Es regnete in Strömen, und der Himmel war rabenschwarz. Ihr Führer lotste die Schar durch eine Schlucht, die als unpassierbar galt. Die Burgunder hatten deshalb dort auch keine Wachen aufgestellt. Erst am Ende der Schlucht trafen die Rebellen auf einen feindlichen Wachposten. Der konnte keinen Alarm schlagen. Er wurde von ihnen vorher überwältigt und erstochen. Vorsichtig ging der Trupp weiter vor. Bald war die Grenze des burgundischen Lagers überschritten. Trotz ihrer beachtlichen Anzahl wurden die Männer von niemandem entdeckt oder gar aufgehalten. Die Belagerer schliefen im Vertrauen auf ihre Stärke alle fest. Die Eindringlinge schafften es unentdeckt bis vor das Haus, in dem Herzog und König nächtigten. Im Garten trafen sie dann doch noch auf eine Wachmannschaft. Auch diese Wachen wurden niedergestreckt. Einer der Männer konnte jedoch vor seinem Tod noch einen Warnruf ausstoßen. Das blieb nicht ohne Folgen. Bald wimmelte es überall von burgundischen Soldaten. Das Burgunderlager erwachte! Die Eindringlinge wurden umzingelt und starben einer nach dem anderen unter den Klingen ihrer wütenden Gegner. 600 weitere Tote hatte Lüttich zu beklagen! Der Überfall auf seine Unterkunft erboste Karl so sehr, dass er am nächsten Morgen die Stadt ohne Rücksicht auf Verluste stürmen ließ. König Ludwig ritt an seiner Seite und rief, um seine Freundschaft zu beteuern, mit Falschheit im Herzen: »Vive Bourgogne!« Ein Großteil der Bevölkerung Lüttichs war mittlerweile in die Ardennen geflüchtet. Die Geistlichen hatten ihnen, aus Angst vor Karls Zorn, selbst Asyl in den Kirchen verweigert. »Lüttich muss von der Landkarte verschwinden«, feuerte Herzog Karl seine Soldaten an. Die teilten die Stadt in vier Zonen unter sich auf, plünderten gründlich und verwüsteten alle Gebäude und Anlagen. Eine große Anzahl der Bewohner wurde mit Waffengewalt getötet, andere wie junge Katzen in der Maas ersäuft. Wo man König Ludwig erkannte, folgten ihm Blicke voller Hass. Schmährufe wurden laut. Der König fühlte sich schrecklich in seiner Haut und trachtete danach, so schnell als möglich aus Karls Gewalt zu kommen. Doch Herzog Karl quälte ihn noch einige Zeit. Bei einem gemeinsamen Essen im bischöflichen Palast fragte er ihn: »Mein Bruder, was meint Ihr, was der Stadt gebührt?« König Ludwig antwortete ihm aus der Angst geboren ohne Rücksicht auf seine früheren Bundesgenossen: »Sie gehört dem Boden gleichgemacht!« Mit diesem Ziel ging die Bestrafung Lüttichs am 3. November weiter. Wer sich nicht gegen hohes Lösegeld freikaufen konnte, wurde getötet. Alle weltlichen Gebäude wurden angezündet. Nur Kirchen wurden auf Geheiß des Herzogs verschont. Nach diesen Gräueltaten ließ der Duc den König endlich ziehen. Mit einer hämischen Geste vermeintlicher Courtoisie geleitete er ihn bis an die Grenze seines Reichs und verabschiedete ihn förmlich. Erst am 9. November zog sich der Fürst selbst mit seinen Truppen aus der verwüsteten Gegend zurück. Noch sechs Wochen stiegen aus den Ruinen Rauchschwaden auf. Als König Ludwig endlich wieder sicher in seinem Palast angekommen war, fiel er nieder und küsste den Boden seines Audienzzimmers. Dann rief er vor all seinen Edelleuten aus: »Karl von Burgund, das wirst du mir bezahlen!« Von da ab spann er noch viel eifriger ein Netz der Intrige gegen den Herzog. Von Tag zu Tag wurde es engmaschiger! …
Auch an einer anderen Stelle Europas wüteten derweilen Unruhen, die in absehbarer Zeit für das mächtige Burgund bedeutsam werden sollten. Zu dieser Zeit standen große Teile im Elsass unter habsburgischer Herrschaft und damit unter dem Einfluss von Herzog Sigmund von Tirol. Sigmund hatte um 1457 die Vorlande übernommen, die habsburgischen Besitzungen im Elsass, im Schwarzwald und die vier Waldstädte am Oberrhein. Ihm standen nun Probleme ins Haus. Die freie Reichsstadt Mülhausen lebte schon seit längerem mit dem österreichischen Adel und den Bauern im Konflikt. Allzu arg kamen der stolzen Stadt deren Steuerforderungen hoch. Gestützt auf ein Bündnis mit Solothurn und Bern warf sie Herzog Sigmund den Fehdehandschuh hin. Die Verbündeten schlossen sich ihr bereitwillig an. Die Eidgenossen hatten schon lange ein Auge auf die Gebiete geworfen. Die Mühlhauser verbrannten als Fanal ihres Aufstands das Dorf Sausheim. Der Habsburger Adel ließ sich das nicht bieten und schlug zurück. Er schloss mit einem stattlichen Heer die Reichsstadt ein. Mit über 8.000 Mann Fußvolk und 400 Reitern kam jedoch ein Heer aus Bernern, Neuenburgern, Freiburgern, Bielern und Solothurnern unter Leitung des Berner Schultheiß Adrian von Bubenberg Mülhausen zur Hilfe. Schon im Sundgau wüteten diese Truppen. Sie zündeten Häuser an und verschonten nicht einmal Kirchen. In ihrer Wut vernichteten sie die gerade eingefahrene Ernte und meuchelten große Teile der Bevölkerung hin. Sie zogen sengend und brennend durch das Elsass bis zu den Vogesen. Am Schluss waren 16 Burgen und 160 Dörfer zerstört. Herzog Sigmund hielt sich von den Kampfplätzen ängstlich zurück, er war kein tapferer Krieger! Das war sein Glück, denn ohne ihn als Gegner zogen die Berner bald wieder heimwärts und hinterließen nur ein blutiges Desaster. Ihr leichter Erfolg weckte jedoch die Begierde anderer. Die übrigen Eidgenossen zogen vor die Stadt Waldshut und belagerten sie ebenfalls. Das ließ die Berner Union ihre Pläne wieder ändern. Auch sie zog gegen die Stadt. Man hoffte, durch einen gemeinsamen Sieg den Aargau endlich aus den Fängen der Habsburger zu befreien. Die Waldshuter verteidigten sich jedoch mit großem Erfolg und konnten dem Ansturm der Belagerer standhalten. Zähneknirschend mussten sie Friedensverhandlungen zustimmen. Die wurden für den Tiroler Herzog recht schmerzhaft. Sigmund musste sich verpflichten, eine Ablösesumme von 10.000 Gulden an die Eidgenossen zu zahlen. Waldshut und der Schwarzwald wurden bis zum Begleichen der Schuld von ihnen zum Pfand genommen. Alle Belagerer bis auf Bern waren mit diesem Ergebnis zufrieden. Die Berner hätten anstelle des Geldes lieber den Aargau für sich bekommen. Fürs Erste hatte der blutige Streit ein Ende. Doch durch diese kriegerischen Taten war auch in dieser Region der Boden für die Expansionsgelüste des kühnen Karl bereitet, wie sich bald zeigten sollte.
4
Die Bestrafung Lüttichs machte Herzog Karl klar, dass er gegen alle aufmüpfigen flämischen Städte mit harter Hand vorgehen musste, wenn er den ambitiösen Plan eines großen, gesamtburgundischen Reichs verwirklichen wollte. Er brauchte in seinem Herrschaftsgebiet Ruhe, um außerhalb erfolgreich agieren zu können. Das reiche Gent war immer die widerborstigste aller Städte gewesen. Karls Geschichtsschreiber hatten die Schmach aufgeschrieben, die er vor gut einem Jahr dort erleiden musste. Sie stand Karl stets vor Augen und wartete noch auf Sühne:
»Für den 28. Juni 1467 hatte sich »notre très redoubté et souverain seigneur«, unser Herr in Gent angesagt. Seine Ankündigung brachte den Rat der Stadt vor große Probleme. Seit Jahr und Tag gingen die 52 Gilden an diesem Tag auf Pilgerfahrt nach Houtem, um Sint-Lieven zu feiern. Der herzogliche Besuch würde sich also mit dem Auszug aus der Stadt überschneiden. Der Abzug der Bürger gerade bei Ankunft des Herzogs wäre aber mehr als ein Affront gegen ihn gewesen! Das Fest abzusagen war unmöglich. Das hätte unter der Bevölkerung zu einem Aufruhr geführt. Die Ratsherren überlegten, was zu tun war. Plötzlich hatte einer von ihnen eine Idee. »Wir lassen das Fest einen Tag länger andauern. Keiner der Gläubigen wird dagegen murren, schon einen Tag früher auf Pilgerfahrt zu gehen.« Gesagt, getan. Der Besuch des Herzogs schien also doch noch geordnet ablaufen zu können. Als unser Herr in die Stadt einzog, war es verständlicherweise sehr ruhig auf den Straßen. Fast unbeachtet zog der Téméraire mit seinem Gefolge an der imposanten Wasserburg Gravensteen vorbei. Rund um das Gemäuer flatterten Burgunds Fahnen im Wind. Im Wasser aus Leie und Live schwammen schwarze Schwäne mit roten Schnäbeln. Alles war friedlich wirkte nur recht menschenleer. Unser Fürst zeigte sich zufrieden, so problemlos aufgenommen zu werden. Da war er anderes von der aufmüpfigen Stadt gewohnt! Zurzeit rumorte es im gesamten Flandernland und ein ruhiger Empfang war schon ein Geschenk. Unser Herzog freute sich, seine Tochter Maria wiederzusehen. Die Genter hatten sich schon früh von ihm ausbedungen, Maria unter ihre Obhut zu nehmen. So war der Prinsenhof, der Hof Ten Walle, in dem einstmals die Burgvögte der Stadt residierten, für Maria prächtig ausgebaut worden. Unser Herzog musterte den Bau äußerst interessiert: Im Südosten und Südwesten lagen durch eine hohe Mauer umfriedet ausgedehnte Parkanlagen.
Dahinter bildete, vom Fluss Lieve gespeist, ein tiefer Wassergraben eine weitere Sicherungsbarriere. Nördlich des Schlosses lief der Fluss in einem Teich aus. In ihm war eine sechseckige Insel angelegt, auf der ein herrlicher Garten blühte. Der Wohntrakt des Palais hatte 300 Gemächer. Eine eigene Schlosskapelle für die täglichen Messen war vorhanden. An Komfort fehlte es also nicht und unser Herzog konnte sich wohlfühlen. Am nächsten Nachmittag kamen die Pilger in die Stadt zurück. Johlend zogen sie an der Sint-Jan-Kirche vorbei, deren Westturm noch eingerüstet und unvollendet in den Himmel ragte. Zwei Tage hatten die Gläubigen ein ausgelassenes Fest gefeiert. An den heißen Junitagen war viel Alkohol durch die durstigen Kehlen gelaufen. Die Pilger waren beschwingt und sangen fröhliche Lieder, als sie mit der Statue des Heiligen am Kornmarkt anlangten. Alles sah danach aus, als könne der Duc mit einer grandiosen Huldigung rechnen. Doch dann verflog die Idylle. Einem der Anführer stieß das kleine Zollhaus am Rande des Platzes mächtig auf. In dem waren an den Markttagen Steuern zu entrichten. Der angetrunkene Mann wiegelte die Menge auf: »Sint-Lieven geht hier durch, ohne zu zahlen. Ein Heiliger zahlt keine Steuern!« Die Menge brüllte ausgelassen ihre Zustimmung. Bald war das Zollhäuschen kurz und klein geschlagen. Plötzlich tauchten aus dem Nichts alte Banner auf, die an die Demütigungen der Stadt durch unseres Herzogs Vater vor anderthalb Jahrzehnten erinnerten. Die Prozessionsteilnehmer begannen, auf diese Weise aufgestachelt, mit Stöcken und Eisenstangen zu wüten. Unser Fürst befand sich im Zimmer seiner Tochter, als das Gelärme durch die Scheiben drang. »Das hört sich nach Aufruhr an. Führt jemand etwas gegen mich im Schilde?« Herzog Karl eilte ans Fenster. Als er die Zusammenrottung sah, war er nicht mehr zu halten. Er rannte in den Hof, bestieg sein Pferd und ritt mitten auf den Platz. Das geschah so überraschend, dass ihm nur wenige seiner Getreuen folgen konnten. Herr van Gruuthuse war unter ihnen, ein besonnener und loyaler Edelmann aus Brügge. Als die Menge unseren Herzog erkannte, trat für einen Moment Ruhe ein. Doch dann wiegelte ein großer Kerl die weinselige Schar erst richtig auf. Mit einer großen Axt schlug er erneut auf das Zollhaus ein und rief: »Auch wir zahlen keine Steuern mehr. Wir wollen unsere Privilegien zurück!« Er meinte die Privilegien, die ihnen des Herzogs Vater 14 Jahre zuvor nach der Schlacht von Gavere genommen hatte. Mit seiner Forderung traf der Mann die Stimmung der Versammelten. Das Volk machte sich den Ruf des Aufwieglers zu eigen. Unser hochmächtiger Fürst lief vor Zorn rot an. All seine Sinne drängten danach, in die Aufrührer zu reiten, um es ihnen so richtig zu geben. So geht man mit seinem Herzog nicht um, dachte er! Seine Lippen wurden bleich und sein Blick starr. Er holte mit seiner Rechten aus und schlug dem Anführer mitten ins Gesicht. Für einen Moment trat tödliche Ruhe ein, und es sah so aus, als wollte der Mob den Duc anfallen. Da war es an Mijnheer Gruuthuse, einzuschreiten. Vermittelnd legte er seinen Arm auf den des Fürsten. »Schlagt nicht mehr zu, mein Fürst, wenn Ihr ein Blutbad vermeiden wollt. Das Volk wird nicht zu bändigen sein, und wir sind viel zu wenige, um uns zu wehren.« Johann IV. Graf von Nassau trat dem Brügger Edelmann zur Seite. Mit großer Bestimmtheit drängte er den Herzog zurück in den Palast. Inzwischen wurde es dunkel. Es brannten Fackeln und der Tumult wurde immer bedrohlicher. Als der Lärm auf dem Platz nicht nachließ, überzeugte van Gruuthuse seinen Regenten, sich der Menge noch einmal auf dem Balkon zu zeigen. Wieder bewies der edle Mann große Besonnenheit. Er trat neben den Herzog und übernahm es, für ihn zu sprechen. Seine Worte waren so vage, dass sie dem Volk zwar genügten, aber das Wesentliche offen ließen. »Bürger von Gent«, rief er. »Der Herzog verzeiht euch. Alles, was ihr fordert, wird mit großem Wohlwollen bedacht. Der Magistrat wird danach beschließen. Geht nun friedlich nach Hause!« Die Leute hörten, was sie hören wollten, und großer Jubel brach aus. Die Gefahr eines Aufstandes war überwunden. Am nächsten Tag setzte der Fürst seine Reise fort. Ihm war klar, dass diese Stadt noch ihren gerechten Lohn erhalten müsse. Er schwor sich, dass ihm die erlittene Schmach nie mehr aus dem Kopf gehen sollte. Nie wieder wollte er vor dem Pöbel auf solch erniedrigende Weise wie ein feiger Hund den Schwanz einziehen!« …
Herzog Karls Entschluss stand fest. Er richtete nun sein Augenmerk auf Gent. Mich ärgert maßlos, wie aufmüpfig sich diese Stadt noch immer gebärdet, dachte er. Bestimmt fühlt sie sich als größte Stadt nördlich von Paris besonders stark. Das wollen wir ändern! Die Bürger von Gent waren alles andere als dumm. Sie erkannten nach der Strafaktion von Lüttich die aufziehende Gefahr auch für sich. Anfang 1469 machte sich deshalb bei Eis und Schnee eine Delegation auf den Weg nach Brüssel zum Herzog, um ihn um Verzeihung zu bitten. »Bei uns wurden schlimme Elemente von französischer Seite aufgeheizt«, versuchten sie eine Rechtfertigung, die ihnen für die Ohren des Fürsten passend erschien. Das klang auch einleuchtend, doch der Duc blieb unzugänglich. Er war fest entschlossen, an Gent endlich Rache zu nehmen. Für Sonntag den 15. Januar rief er mitten in Brüssel auf dem großen Platz eine Feierlichkeit aus. Die Genter bestellte er für den Morgen des Tages vor den Palast. Der Tag kam heran. Es war kalt und schneite dicke Flocken aus grauem Himmel. Die Genter waren gehorsam und pünktlich angereist. Der Duc ließ ihre Abordnung mehrere Stunden in der Kälte frieren. Als die Halberfrorenen endlich in den Audienzsaal geführt wurden, trafen sie auf einen ungnädigen Herrn. Der erwartete sie auf einem hoch über ihnen aufgebauten Thron mit abweisend arrogantem Gesichtsausdruck. Um ihn herum saßen, genauso feindselig blickend, die Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies in ihren rot leuchtenden fußlangen Gewändern. Auf den weißen Tellerkragen blitzten ihre Ordensketten so gefährlich wie ihre Augen. Die Bittsteller fielen vor dem Regenten nieder und richteten ihre Entschuldigungen nochmals persönlich an ihn. Der Herzog antwortete überhaupt nicht darauf. Schließlich begann ein Herold auf seinen Fingerzeig hin am Fuß des Podestes das »große Privileg« zu verlesen. Gent hatte viele Jahre dafür gekämpft, es zu erhalten. Karls Vater Philipp hatte es gegenüber der schon damals starrköpfigen Stadt unter dem Druck der Umstände zugestehen müssen. Als die Schrift verlesen war, fragte der burgundische Kanzler den Herzog: »Was soll mit den Privilegien nunmehr geschehen?« »Sie werden eingezogen«, antwortete der kurz angebunden. Den Gentern wurde angst und bange bei diesen Worten. Ein Schreiber nahm die Urkunde in Empfang und schnitt sie bedächtig in kleine Stücke. Damit war sie auch symbolisch außer Kraft gesetzt. Nun belegte der Herzog die Sünder noch mit einer hohen Geldstrafe. 36.000 Gulden wurden festgesetzt. Danach verwies er die Abordnung grußlos des Saales. Die Genter fühlten sich zwar schlimm abgestraft, waren aber trotzdem nicht ganz unglücklich. Immerhin hatten sie ein besseres Los gezogen als die Lütticher! Und die Zeit konnte Änderungen mit sich bringen. Des Herzogs Härte sprach sich in Windeseile herum und wurde schon bald von Barden besungen:
Ich sah den Kessel um das hochmütige Dinant.
Eine stets speziell aufmüpfige Stadt.
Der kühne Löwe hat sie für ihre
Große Arroganz hart bestraft und eingeäschert.
Ich sah die Mauern von Lüttich
Zerstört und zerschlagen.
Die Freitreppe verschwunden,
Die Aufrührer überwunden!
Selbst der französische König
Rief »vive Bourgogne«
Und trug schamlos das Andreaskreuz!