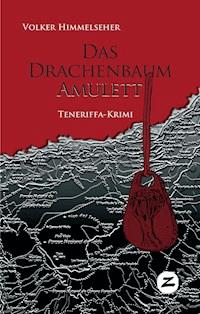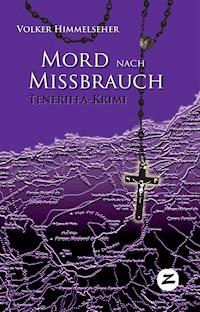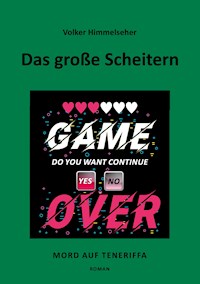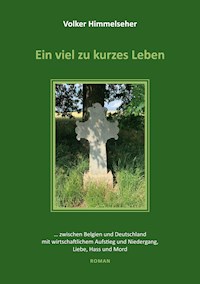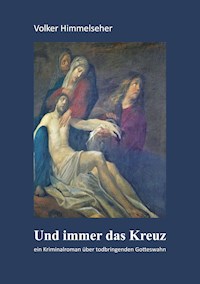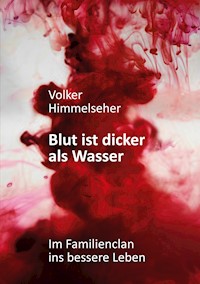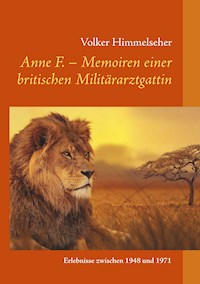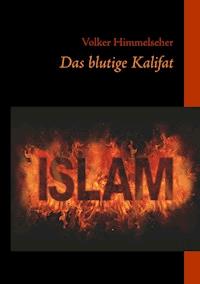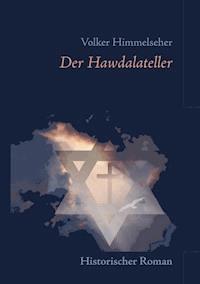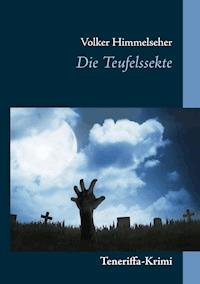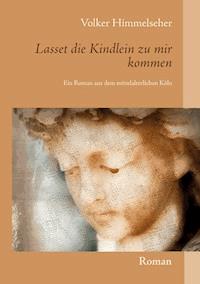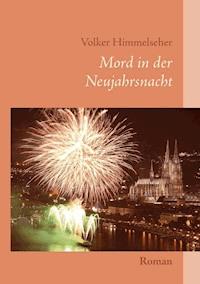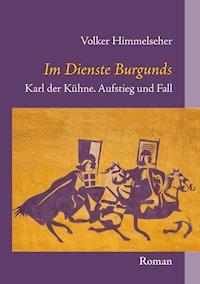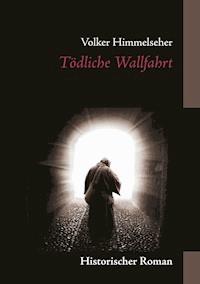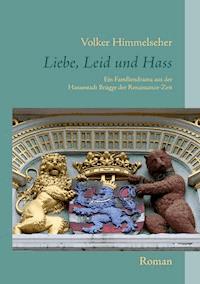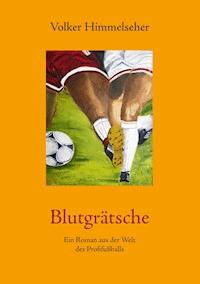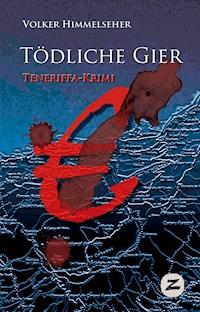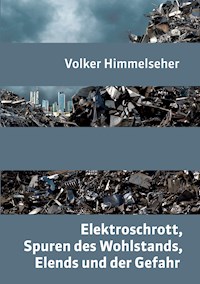
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Elektroschrott überflutet die Menschheit, mit immer deutlicheren Folgen. Mit dieser Entwicklung gehen Wohlstand, aber auch Elend und Gefahren einher. Sind die Probleme in den Griff zu bekommen, oder führen sie ohne Umdenken zur Apokalypse? Dr. Volker Himmelseher schildert Facetten der Problematik in wirklichkeitsnahen Einzelgeschichten. Sie berühren und regen zum Mitdenken an. Denn kein Mensch ist eine Insel. Im globalen Zeitalter sind die einzelnen Länder stärker miteinander verbunden. Das gilt auch für die Bereiche Konsum und Mülltrennung. Unser blauer Planet ist durch die Menschheit gefährdet und vom Untergang bedroht. Nur durch unser aller Einsicht scheint eine Wendung zum Besseren möglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zur Einführung
Elektronik, Digitalität und ihr Elektroschrott in der Wissenschaft
Anmerkungen zur wissenschaftlichen Theorie
Das wirtschaftlich starke Deutschland und seine Repräsentanten im Elektro- und Elektronikgeschäft
Das Jahr 2020, das Corona-Jahr
Die moralische Bewertung dieses wirtschaftlichen Verhaltens, ein Fazit:
Das Entwicklungsland Ghana hat Probleme, auch Elektroschrottprobleme!
Überlegungen zu Ghanas Fortentwicklung
Das Schwellenland China und der Elektroschrott
Pekings Vorort Dongxiaokou
China im Jahr 2020
Was lehren die chinesischen Werte?
Das Problem Elektroschrott in der Politik
Ein Fazit für die Bundesrepublik Deutschland
Die Apokalypse als Strafe für menschliche Verfehlungen
Personenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Zur Einführung
Elektroschrott
Mittlerweile ertrinkt die Welt im Elektroschrott.
2016 hatte man es schon mit 45 Millionen Tonnen zu tun.
Das entspricht fast dem Gewicht von 6800 Eiffeltürmen! Pro Kopf lagerten, Stand 2019, sechs Kilogramm Elektroschrott auf unserem Planeten. Der Berg wächst weltweit jedes Jahr weiter an und hinterlässt seine dramatischen Spuren. Er ist ein Teil all der Probleme, die uns heute zu schaffen machen. Die Weltgemeinschaft produziert ein vergiftetes Erbe, denn die meisten Folgen ihrer Sünden müssen die nächsten Generationen tragen. Für die daraus erwachsenden Beeinträchtigungen gilt:
Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean.
(Sir Isaac Newton)
Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Andrew Revkin schlug vor, die Zeit, in der wir leben, aus dem Holozän, dem Nacheiszeitalter, herauszulösen und ihr einen eigenen Namen zu geben. Einen Namen, der Rechnung dafür trägt, in welchem enormen Maße der Homo sapiens seit den letzten dreihundert Jahren einen schlimmen Einfluss auf die Erde nimmt. Der Begriff »Anthropozän« solle das deutlich machen. »Anthropos« , griechisch »der Mensch« , als Namensteil einer eigenen geochronologischen Epoche hebe hervor, wie dominant der Mensch für die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Ernst zu nehmende Stimmen sprechen in diesem Zusammenhang von menschlicher Aggressivität, die, so fortgeführt, die Bewohnbarkeit des Planeten infrage stellt, ihn zum Untergang verdammt. Allein aus allem menschlichen Tun, das den Elektroschrott verursacht, oder aus den Problemen, die dieser hinterlässt, kann nach Überzeugung von Sachkundigen die Apokalypse erwachsen.
Weltuntergang als Eskalation menschlicher Sünden?
Wenn viele Experten sich einig sind, ist mehr als nur Vorsicht geboten.
(Bertrand Russell)
Unsere Situation kann mit einem Oxymoron beschrieben werden: Wir nähern uns einem Abgrund, der voll ungelöster Probleme ist. Ein Abgrund dürfte eigentlich nicht voll sein, erst recht, wenn er uns mahnen soll. Denn voll wird er unsichtbar.
Diese Situation wirft Fragen auf und schürt Ängste:
Sucht der Mensch etwa den Tod, weil er den wahren Sinn des Lebens bis zum heutigen Tag nicht gefunden hat?
Baut die Menschheit aus Hybris an einem neuen Turm zu Babel, und der wird zusammenstürzen und alle unter sich begraben?
Gilt der Satz aus Dantes »Göttlicher Komödie«:
Lass alle Hoffnung fahren?
Oder törnt die Menschen das sich Aufladen von Schuld sogar an, dies weiter zu tun?
Friedrich Dürrenmatt, der Schweizer Schriftsteller und Theaterautor, führt uns in seiner wunderbaren Satire »Die Panne« einen so gearteten Menschen vor Augen: Nach einer Autopanne kommt der Protagonist bei einem pensionierten Rechtsanwalt unter, der zum Abend drei weitere Juristen eingeladen hat. Sie stellen dem Gast die Frage, ob er in seinem Leben Schuld auf sich geladen habe. Mit juristischen Spitzfindigkeiten drehen sie ihm das Wort so lange im Mund herum, bis er »an der Grenze seiner Denkkraft« unter ihren perfiden Fragen gesteht. Die Juristen erklären ihn für schuldig und fordern harte Bestrafung. Herr Traps, der Gast, fühlt sich zwar überrumpelt, aber auch irgendwie beglückt. Endlich fühlt er sich in seinem Leben, wenn auch als überführter, schuldiger Übeltäter, irgendwie wichtig.
Und nun zu den Ängsten: Sie sind berechtigt, wenn man den Menschen genau betrachtet.
Denn allein der Mensch erfand die Atombombe. Keine Maus der Welt käme auf den Gedanken, eine Mausefalle zu konstruieren. (Albert Einstein)
Trotz allem ist der Mensch selbst in hohem Maße seines Glücks oder Unglücks Schmied. Gestaltbar ist immer noch die Gegenwart, aber auch die Zukunft. Das Prinzip Hoffnung allein funktioniert aber nicht.
Wer glaubt, dass Schweigen und Zuwarten Probleme lösen können, hält sich auch die Augen zu, um unsichtbar zu werden. (Volksweisheit)
Der Verfasser nutzt in diesem Buch die Form der Anthologie. Er formt für den Leser einen Strauß unterschiedlicher Gedanken und Episoden, die allesamt mit den Problemen des Elektroschrotts verbunden sind. Klangvolle Worte großer Persönlichkeiten setzen im Kontext Zeichen. Er bedient sich einzelner Erlebnisbilder von Menschen mit ihren Stärken, Schwächen, Erwartungen und Nöten. Dabei werden auch Interessengruppen mit ihren Gruppeninteressen sichtbar.
Die Welt ist nicht in Ordnung, jeder der Protagonisten steht vor anderen Problemen oder nimmt sich ihrer an.
Zunächst geht es um Elektronik, Digitalität und Elektroschrott in der Theorie, als wissenschaftliche Betrachtung. Die erfolgt hier als Momentaufnahme. Die Wissenschaft muss eigentlich Wandlungsvorgänge berücksichtigen, aber Grundprobleme und die Definition, was man unter Elektroschrott versteht, lassen sich als Hilfskonstrukt auch in einer statischen Darstellung sinnvoll beschreiben.
Darauffolgend ergänzt den angekündigten Strauß eine Episode zum ungerechten Wohlstand der Reichen: Die Industrieländer sind ökonomisch die Gewinner im Reigen der Interessen. Sie versuchen, deshalb den Ist-Zustand zu erhalten und, wenn möglich, auszubauen. Mit ständigem Wachstum und mit weiteren Konsumanreizen nehmen sie das Anwachsen des Elektroschrotts als Folge bewusst in Kauf. Die damit verbundenen Übel sind für sie schlichtweg Kollateralschäden. Notwendige Ressourcen werden (unnötig) verknappt oder verbraucht. Im Zeitraum 1990 bis 2015 waren die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung (630 Millionen Menschen) für 52 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Im genannten Zeitraum hatten sich Emissionen mehr als verdoppelt. Mahnende Stimmen zu diesem Verhalten gibt es genug:
Lebensstandard ist kein würdiger Ehrgeiz für eine Nation. (Charles de Gaulle) Aber die größten Egoisten verlangen immer am meisten Verständnis.
Reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern mehr noch durch das, was man mit Würde zu entbehren weiß. (Volksweisheit)
Wie bei Fragen der Umweltzerstörung werden sich frühere Generationen gegenüber den nachfolgenden für die eigennützige Ausbeutung natürlicher, sozialer und ethischer Ressourcen rechtfertigen müssen.
Automatisierung und Digitalisierung zur Verbesserung des Lebensstandards werden zum Grund für neue elektronische Geräte und für den daraus anfallenden Elektroschrott. Wir verstehen uns als die Sprintergeneration und nicht als die Dauerläufer, die nach dem Zweiten Weltkrieg geduldig den Wiederaufbau angingen. Wir sind schnelle Menschen für schnelle Zeiten! Schnell durch die Digitalisierung! Das ist keine geeignete Entschuldigung, sondern zeigt einen Teufelskreis auf. Die ungehemmte Konsumgesellschaft sollte eher beachten, dass sie in ihren reichen, schönen Ländern auf Messers Schneide lebt. Die Armen drängen schon nach! Der Strom der Migranten zu uns her ist unübersehbar.
Auch das Elend der Ärmsten der Armen rückt in den Fokus:
Spuren finden sich besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Entsorgung von Elektroschrott ist dort günstiger als in den reichen Ländern. Das Prinzip der Gewinnmaximierung verlangt den Transport des Unrats dorthin. Anfänglich wurde er sogar als Entwicklungshilfe verbrämt. Elektroschrott enthält nämlich neben Restmüll wertvolle Inhaltsstoffe wie Gold, Kupfer, Nickel, Blei und seltene Materialien wie Indium oder Palladium. Wirtschaftlich lohnt sich das Recyceln, dort, wo der Schrott entsteht, jedoch nicht. Die Lohnkosten und die Schutzvorschriften sind dafür zu hoch.
Wie lange gibt es noch genügend Nachschub an Rohstoffen? Wann sind die Recyclingtechniken endlich kostengünstig ausgefeilt? Bevor das erreicht ist, sind es die Ärmsten der Armen in den Empfängerländern, die als Sammler der Wertstoffe von einem Tag auf den anderen ihr Leben fristen, indem sie mit primitivsten Mitteln die Schrottteile ausbeuten und dabei ihre Gesundheit und ihr Lebensumfeld ruinieren.
Quid pro quo als Rechtsgrundsatz und als ökonomisches Prinzip gilt für sie nicht. Diese Menschen geben ihre Arbeitskraft hin, ohne dafür eine angemessene Gegenleistung zu erhalten. Bedeutende Menschen sind darüber in Resignation verfallen:
Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. (Mahatma Gandhi)
Weit entfernt ist das Ziel, eine globale, soziale und umweltverträgliche Kreislaufwirtschaft mit fairen Spielregeln zu finden. Bemühungen in diese Richtung sind nicht genügend erkennbar. Industrie-, aber auch Schwellen- und Entwicklungsländer sind, immer noch mit Eigeninteressen, am Werk und in ihnen die Politik, die Unternehmen und die Konsumenten. Das Karussell der Entsetzlichkeiten dreht sich weiter. Verteilungskämpfe verlaufen im Gleichschritt. Jeder will überleben. Und wie überlebt man leichter als auf Kosten der anderen?
Aber nur ein Teil der Menschen kann auf Kosten der anderen leben, nicht die ganze Menschheit. (Klaus Michael Meyer-Abich, deutscher Physiker und Naturphilosoph)
Das Szenario des Untergangs unseres Planeten bleibt schon deshalb realistisch.
Politiker, Journalisten, Künstler und andere nehmen das Wort. Oftmals sprechen sie als sprachlich schöne Blitze Worte des Zorns und der Fassungslosigkeit oder bewegen mit ihren Werken. Sie machen nicht nur leere Versprechungen, sie halten sich auch daran. Die Probleme sind aber so komplex, dass alle vorbehaltlos an die Sache herangehen müssten. Doch Vorbehaltlosigkeit ist selten gegeben.
So erweist sich zum Beispiel die Politik oft als Führung öffentlicher Angelegenheiten zum privaten Vorteil (Ambrose Bierce) und ihr Beamtenapparat als von Zwergen bediente Riesenmaschinerie der Bürokratie. (Honoré de Balzac)
Gedanken zum Ende der Welt komplettieren den Strauß der Überlegungen. Mit der Kraft einer Offenbarung treten dabei die mit dem Untergang verbundenen Ängste der Menschheit zutage. …
Die geschilderten Episoden sind ein fiktives Abbild der Realität. Personen, soweit sie nicht solche des öffentlichen Lebens sind, sind frei erfunden.
Unser blauer Planet ist durch die Menschheit gefährdet und zum Untergang verdammt. Nur durch unser aller Einsicht besteht die Chance für eine Wendung zum Besseren.
Man muss die Welt so nehmen, wie sie ist, aber man darf sie nicht so lassen. (Willy Brandt) Die Informationen in diesem Buch können Sie in die richtige Richtung lenken.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Es erwarten Sie nicht nur aufgereihte Tatsachen.
Der Text als Behälter der Informationen erhält Farbe durch menschliche Züge, durch die Wesensarten derer, die agieren. Ihr Verhalten offenbart ihre Charaktere. Dadurch wird der schwer zu verdauende Stoff erträglicher, aber auch berührender. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise durch die einzelnen Episoden. Machen Sie die Vorhänge auf und sehen selbst.
Elektronik, Digitalitätund ihr Elektroschrott in der Wissenschaft
Die Theorie ist eine Vermutung mit Hochschulbildung. (Jimmy Carter)
Herbst 2015, es war gegen 7:00 Uhr morgens, Bochum erwachte. Die kreisfreie Stadt war neben Duisburg, Essen, Dortmund und Hagen eine der fünf Oberzentren des Ruhrgebiets. Heute würde es ruhiger zugehen, als während der meisten Zeit des Jahres. Die Ruhruniversität hatte Semesterferien, und von den über 40.000 Studierenden, die zu den etwa 370.000 Einwohnern gehörten, war eine Vielzahl zurzeit nicht in der Stadt.
Professor Dr. Emil Fischer, Leiter der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, wollte heute zu Hause arbeiten und nicht in die Uni gehen. Der Professor war Frühaufsteher und saß bereits in seinem Arbeitszimmer am Schreibtisch und schaute sinnierend in den gepflegten Garten. Für ihn, wie die meisten Menschen, brauchte es am Morgen vor allem eins: eine duftend heiße Tasse Kaffee. Ohne sie erschien der Start in den Tag unmöglich. Zum Frühstück aß er später nur einen Apfel. Kaffeegeruch füllte wohltuend den Raum. Die Gedanken des Professors befassten sich mit seiner persönlichen Situation. Im Resümee war er mit seinem Leben sehr zufrieden. Alle Bereiche passten. Mit seiner Frau Elisabeth war er schon viele Jahre glücklich verheiratet. Die Ehe resultierte aus einer Studentenliebe, die gehalten hatte. Elisabeth hatte ein Semester nach ihm Pädagogik studiert und das Studium, wie er, erfolgreich abgeschlossen. Mit Gerd und Mareike hatten sie zwei Kinder bekommen, die schon flügge waren und sich gut machten. Nun waren sie beide in der geräumigen Villa übriggeblieben, die in Nähe des botanischen Gartens und damit fußläufig zum Universitätsgelände lag. Sie wohnten im Stadtteil Stiepel, in der teuersten Wohngegend der Stadt. In der Nähe lagen die Erholungsgebiete Lotten-Tal und Kemnader-See. Oberhalb des Stausees befand sich, eingebettet in einen Grüngürtel, der landschaftlich reizvolle 18-Loch-Golfplatz des Bochumer Golfclubs, den seine Frau und er so liebten. An ihm klebten Erinnerungen vieler schöner Runden. Der Professor war inzwischen 55 Jahre alt und immer noch sportlich und fit. Darauf achtete er sehr. Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, war ihm eine geläufige Redewendung. Er spielte, wenn immer möglich, Golf, um seinen Körper fit zu halten und mit der dabei abverlangten Konzentration seinen Geist zu trainieren.
In seinem Fach hatte er schon seit Längerem über die Landesgrenzen hinaus hohes Ansehen gewonnen. Diesem Umstand, vielleicht auch ein wenig dem Zutun eines Parteifreundes der Christdemokraten, war geschuldet, dass er von der Bundesregierung mit einem Einführungsreferat zum Thema Elektroschrott, Spuren des Wohlstands, des Elends und der Gefahr beauftragt worden war. Mit dem Thema sollte im nächsten Frühjahr ein renommiert besuchter Fachkongress eröffnet werden. Heute wollte sich Professor Fischer über die Grundzüge des Vortrags im Klaren werden. Er hatte bereits eine Vorstellung über die Vorgehensweise: Für die richtige wissenschaftliche Darstellung war nur die intakte Funktionsweise des menschlichen Verstandes vonnöten. Seiner würde ihm die Art und Weise schon zeigen. Teile der bisherigen Forschung mussten infrage gestellt werden, andere getroffene Entscheidungen waren zu präzisieren und zu begründen. Quod erat demonstrandum. Ein Handwerker nutzte dieselbe Denkarbeit in gleicher Art, dachte er demütig. Fischer musste lediglich für seine komplexeren Analysen fein abgestufter zu Werke gehen. Für morgen hatte er sich mit dem Dozenten Dr. Manfred Simmel verabredet. Der wollte es übernehmen, zusammen mit Doktoranden, aus Fischers Rohkonzept ein stimmiges Ganzes zu erarbeiten. Die Zusammenführung der einzelnen Referatsteile lag in Simmels Hand. Professor Fischers Frau schätzte Manfred Simmel sehr und hatte sofort angeboten, für morgen etwas Leckeres zu kochen. Also trafen sich die beiden Männer gegen 13:00 Uhr im Privathaus des Wissenschaftlers.
Emil Fischer war froh, dass seine Einführung insbesondere für Kollegen gedacht und nicht nur als Statement für Politiker bestimmt war. Die ordnete er im Stillen in der Mehrzahl gerne als Münchhausen-Täter ein. Sie agierten in seinen Augen meist nur, um auf sich selbst aufmerksam zu machen. Sein Lieblingsmoderator und Showmaster Frank Elstner hatte mal gesagt:
»Mikrofone sind das Einzige, das sich Politiker gerne vorhalten lassen.«
Der Professor musste in Erinnerung dieser Aussage grinsen. Seine Zeit wäre ihm wirklich zu schade gewesen, nur für Politiker dienlich zu sein. Dafür waren die zu erörternden Probleme viel zu ernst. Der Zustand der Welt, auch in diesem Bereich, konnte einem durchaus den Schlaf rauben. Fischer hatte sich schon länger mit dem Thema befasst. Nun galt es, seine bisherigen Überlegungen in Kurzfassung vorzutragen.
Emil Fischer stand auf und holte sich aus der Kaffeemaschine eine weitere Tasse Kaffee schwarz. Die sollte der Startschuss werden, mit dem Brainstorming zu beginnen. Er hatte bereits Block und Stift auf der Schreibtischplatte zurechtgelegt. Er bevorzugte zunächst handschriftliche Aufzeichnungen, bevor er sie genauer formuliert in seinen Laptop übertrug. Zunächst suchte er für den Hauptbegriff »Elektroschrott« eine griffige Definition. Eigentlich lehnte er abschließende Definitionen ab, Probleme waren viel zu komplex, um sie mit einer Definition zu beschreiben. Außerdem verlangten Definitionen meist Fortentwicklungen. Aber eine Arbeitsdefinition für den Moment und für ein eingegrenztes Thema brauchte man. Er sammelte fast eine halbe Stunde Einzelbestandteile, die ihm wichtig erschienen und erarbeitete die folgende Definition, die Herr Simmel mit seinen Leuten natürlich nochmals überprüfen musste:
Als Elektroschrott werden all jene Geräte oder deren Bauteile bezeichnet, welche strom- oder batteriebetrieben waren und aus objektiven Gründen in ihrem momentanen Zustand oder auch endgültig ausgedient haben.
Nun kam er fast automatisch auf die sechs W-Fragen:
Wer, was, wann, wo, wie, warum? Mit seinen Überlegungen wollte er ein Formblatt ausfüllen. Seine Stichworte und Verweise sollten so ausführlich ausfallen, dass seine Helfer die große Linie seiner Gedanken vor Augen hatten, wenn sie das Referat ausarbeiteten. Er begann mit der Frage:
Wann wurde das Problem Elektroschrott evident? Der Professor entschloss sich, den Zeitpunkt am ersten großen internationalen Abkommen gegen Elektroschrott festzumachen: Das Elektroschrottproblem hatte eine große Anzahl Vertragsstaaten auf einer Konferenz in Nairobi mit der sogenannten Baseler Konvention (1989) erstmals zum Thema gemacht. 169 Länder unterzeichneten Anfang der 90er Jahre ein weltweites Verbot von Giftmüllexporten. Elektroschrott durfte laut dem Übereinkommen nicht in Länder exportiert werden, die keine angemessene Recycling-Infrastruktur hatten. Giftmüll musste möglichst nah am Ort seines Anfallens entsorgt werden. Eine internationale Verschiffung sollte die Ausnahme sein. Nur reparable Altgeräte durften noch in Schwellen- und Entwicklungsländer exportiert werden, weil sie, repariert, für die lokale Bevölkerung erschwinglicher als neue Geräte waren. Für den rasanten Anstieg des Elektroschrottvolumens gab er einige Statistiken vor, die während des Referats an die Wand geworfen werden sollten.
Wer waren die an den Problemen beteiligten Parteien? Professor Fischer stellte die relevanten Gruppen zusammen:
Industrieländer, Schwellenländer, Entwicklungsländer, Hersteller, Händler, Exporteure, Verbraucher, Politiker, Sammler und Verwerter des Elektroschrotts.
Um was es ging, hatte er bereits in der Definition festgelegt.
Aber was war zu tun? Er ordnete seine Gedanken danach, wie die Spuren des Elektroschrotts seiner Meinung nach in den Griff bekommen werden konnten. Er führte die entsprechenden Stichworte zu seinen Gedanken auf:
Zu Wohlstand (global):
Faire Verteilung der Erträge. (
Quid pro quo
als Rechtsgrundsatz).
Schonen der knappen Primärrohstoffe aus natürlichen Ressourcen, durch Verzicht auf unnötigen Konsum. (Vermeidung des Konsums überhaupt, längere Nutzung der Geräte, Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit der Geräte).
Lückenloser Recyclingkreislauf zwecks Ressourcenerhalt. (Sekundärrohstoffe, wiedergewonnene Rohstoffe anstatt Abbau weiterer Primärrohstoffe). Als wegweisend ist das europäische Projekt aus 2007
make IT fair
zu nennen:
Unternehmen erkennen Rohstoffverantwortung an.
In den Haushalten gelagerte Altgeräte für Recycling in den Kreislauf zurückführen.
Ressourcenrelevante Geräte für das Ausschlachten besser erfassen.
Sammelmenge für Recycling erhöhen (kein Versickern im Restmüll). Anmerken wollte er dazu, dass die weltweite Rücklaufquote von Elektronikgeräten schätzungsweise nur bei 15 bis 20 Prozent lag.
Abbau von Interessenskonflikten (beispielsweise wehren sich manche Mitgliedsstaaten der Basler Konvention gegen strenge Entsorgungsvorschriften, da sie Arbeitsplatzverluste befürchteten. Reiche Rohstoffvorkommen heizen zudem immer wieder regional kriegerische Konflikte an (siehe Demokratische Republik Kongo).
Zu Elend:
Abbau sozialer Missstände durch:
Verpflichtende Einhaltung der Menschenrechte.
Entschärfung der Verteilungskämpfe.
Veränderung der Marktwirtschaft mit Gewinnmaximierung in Richtung soziale Marktwirtschaft.
Einigung auf ein Mindestvergütungssystem (in den armen Ländern ist die Wiedergewinnung von Rohstoffen aus Elektroschrott viel zu schlecht bezahlt).
Globaler Aufbau von Sozialversicherungssystemen (in den armen Ländern ist die Wiedergewinnung von Rohstoffen aus Elektroschrott gesundheitsschädlich, gefährlich und ohne medizinische Betreuung).
Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen. (Sebastian Kneipp, Naturheilkundler und katholischer Theologe)
Zu Gefahren:
Abbau ökologischer Missstände durch Strategien gegen Umweltgefahren:
gegen Einwirken von Lärm, Schmutz, Strahlung zum Beispiel durch uranhaltigen Abbau von Kobalt, toxische Gifte …).
Strategien für den Grundwasserschutz,
für die Reinigung der Luft von Emissionen,
für die Entgiftung von Böden, Bauwerken und Gerätschaften, (Verbote und Beschränkungen toxischer Stoffe in Geräten, Richtlinien zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.)
Mit folgender Information die Zuhörer schockieren: 2 Prozent des weltweiten Ausstoßes des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) entfallen auf IT und den daraus anfallenden Elektroschrott! Die Auswirkung auf das Klima ist bereits messbar.
Folgende Teilbereiche müssen rasch fortentwickelt werden:
Ausbau lokaler Strukturen sowie die Einführung effizienter, umweltverträglicher Techniken zur Rückgewinnung von Wertgütern.
Internationale Recycling-Kooperationen.
Technologietransfer.
Transparenz in der Recyclingkette: vom Sammeln, Sortieren, Zerlegen und Aufbereiten zum Material-Recycling selbst.
Transparenz in der Lieferkette der Neugeräte, aber auch des Elektroschrotts.
Einheitliche Standards zum Schutz der Abbaugebiete (große Waldflächen verschwinden heutzutage, auch Tierarten und Pflanzen, Wasserquellen werden verseucht und Landschaftsformationen für immer zerstört).
Strategien gegen Gesundheitsgefährdungen (dazu gehören optimierter Arbeitsschutz, gesundheitliche Vorsorge, zeitnahe Gesundheitskontrolle, Vermeidung exzessiver Überstunden und geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Altersregelung für die Arbeitsfähigkeit).
Wie kann reguliert werden? Der Professor sortierte seine Gedanken von übergeordneten Punkten hin zu Unterpunkten:
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien bedürfen des Schließens erkannter Lücken durch Novellierungen und Ergänzungen. (Den Prozess des Entstehens des heftig kritisierten
Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten kurz ElektroG
als Beispiel erläutern!)
Lücken erkennen durch Learning by Doing.
Regelungen der Verantwortlichkeiten für die Entsorgung (dazu gehört die geteilte Produktverantwortung, Pflichten zum einen bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, zum anderen bei den Herstellern).
Denkanstöße: Entsorgung auf kommunalen Sammelstellen in Betracht ziehen sowie die übernationale Einführung einer Wertstofftonne bei der Mülltrennung, mobile Deponiefahrzeuge, Rücknahmeverpflichtungen des Handels.
Als Einzelmaßnahmen besprechen:
Akzente setzen bei öffentlicher Beschaffung,
bessere Umsetzung des Elektroschrottexportverbots,
Hilfe für Schwellen- und Entwicklungsländer beim Aufbau sozial- und umweltverträglicher Recyclingsysteme und kontrolliertes Elektroschrottmanagement,
Lösung der Vollzugsprobleme bei der Abgrenzung von Abfall und Nicht-Abfall,
Entwicklung von Qualitätsstandards für Altgeräte, deren Export erlaubt ist,
höhere Vollzugsstrafen und zahlreichere Stichproben gegen den Verpackungsschwindel,
ökologische und sozialverträgliches Produktsortiment im Handel (zum Beispiel Stromfresser aus dem Sortiment verbannen).
Einheitliche Regelungen der Finanzierung aller Maßnahmen. (Aus Steueraufkommen, durch Hersteller, Händler, Konsumenten, zum Beispiel Handypfand)
Zum wo müssen alle angesprochenen Prozesse stattfinden? hatte Professor Fischer eine eindeutige Meinung:
Probleme müssen überall auf der Welt angegangen werden. Das bedeutete Kompromissbereitschaft, aber auch Inkaufnahme von Verzögerungen und zeitweiligen Stillstand. Man muss sich vor übereilten Vorurteilen gegenüber anderen Kulturen und Systemen hüten. Kein Blatt gleicht dem anderen. Keine Kultur ist besser als die andere. Irgendwas kann jede von der anderen lernen! Es gilt einen interkulturellen Dialog zu eröffnen. Es herrscht keine Dichotomie, eine Struktur aus zwei Teilen, die einander ohne Schnittmenge gegenüberstehen. Das überproportionale Engagement der reichen Länder, besonders das finanzielle, ist unvermeidbar.
Jegliches Geschehen an einem bestimmten Punkt in der Welt ist von lokalregionaler und gleichzeitig von global-überregionaler Bedeutung!
(Merksatz)
Warum das alles? Die ansonsten düsteren Prognosen für die Zukunft aufzeigen. Ein Weiter-so führte auf Dauer in die Apokalypse. Bereitschaft zum Umdenken und Umlenken hingegen kann die Rettung sein (zum Beispiel mit einer Zielvereinbarung für alle Bereiche, wobei realistische Zwischenziele Sinn machten).
Professor Fischer las seine Aufzeichnungen mehrfach durch. Er korrigierte das ein oder andere oder setzte es um. Als er mit der Rohfassung am Computer fertig war, kopierte er das Papier für das morgige Gespräch mit Dr. Simmel. Er schaute auf die Uhr. Es war 14:30 Uhr. Das Wetter war stabil, und es war noch früh genug für eine Runde Golf. Er hatte sich schon am Morgen sportlich angezogen. Seine Golfausrüstung lag immer im Kofferraum seines Wagens. Er konnte sofort losfahren. Mens sana in corpore sano als Alibi, dachte er grinsend.
Emil Fischer war froh, dass er für sich allein eine Startzeit bekommen hatte. Er war noch angespannt wegen des konzentrierten Arbeitens und wusste, dass er besser allein mit sich selbst wieder runterkommen konnte. Das erste Loch war ein Par fünf und dort konnte er seinen mentalen Zustand testen. Er war kein Longhitter, deshalb musste er eine 5-Schlag-Strategie wählen. Überraschend landete sein Tee-Shot bereits neben dem Bunker. Er hatte eine gute Ausgangsposition für einen Bogey, ein Ergebnis von einem Schlag über Par. Er war mit sich sehr zufrieden, als er das erste Loch wirklich so nach Hause brachte. Nicht alle weiteren Löcher liefen gleich gut. An Bahn neun verdarb er sich seinen Score. Bei diesem kurzen Par drei Loch herrschte wieder mal Rückenwind und der Ball ging bergab bis kurz vor die sehr nahe Ausgrenze. Der folgende Chip ging ungenau, und auf dem sehr stark ondulierten Grün brauchte er nochmals drei Schläge. Mit zwei Schlägen über Par, allein bei diesem Loch, lag er zur Halbzeit vier Schläge über seinem Handikap. Das wurmte ihn, aber Golf verlangte Demut. Entsprechend wollte er sich verhalten. Das Wetter war gut, auch am Zustand des Platzes lag sein Spielergebnis nicht, er wollte konzentriert weitermachen. Wie die erste Bahn war auch die letzte, Bahn achtzehn, ein Par fünf. Der Teich hinter dem Grün zerstörte vollends seine Träume von einem zufriedenstellenden Score. Er versenkte seinen Ball im Wasser. Nun war er um Seelenmassage bemüht. Ich habe gekämpft, bin an der frischen Luft gewesen und mein Kopf fühlt sich wieder freier an als zuvor. Das Spiel hat sich also gelohnt. Das nächste Mal wird es wieder besser laufen, dachte er für sich.
Er fuhr nach Hause zurück, fest entschlossen, am Abend mit seiner Frau noch eine gute Flasche Rotwein zu trinken. Das taten sie, und es wurde ein sehr schöner Abend.
Elisabeth Fischer war, wie ihr Mann, eine Lerche, also früh auf den Beinen. Sie bereitete gerade den Einkaufszettel für das Mittagessen vor. Sie hatte sich entschlossen, etwas typisch Westfälisches auf den Tisch zu bringen. Sie wusste, dass dies sowohl ihr Mann, aber auch Dr. Simmel schätzte. Sie hatte sich für einen deftigen Pfefferpotthast entschieden. Das Gericht passte bestens zum herbstlichen Wetter. In Dortmund war es sogar Brauch, diesem Essen im Herbst ein eigenes Pfefferpotthastfest zu widmen. Elisabeth brauchte Rindfleisch und Schmalz sowie Zwiebeln. Gewürzgurken, Rote Bete und Semmelbrösel schrieb sie noch hinzu. In ihrem Vorratsschrank hatte sie nachgesehen, Lorbeerblätter, Nelken, Kapern und eine Zitrone waren vorhanden. Die Zubereitung würde ihr schnell von der Hand gehen. Das Fleisch wurde in Schmalz kräftig angebraten. Mit einer gleich großen Menge an Zwiebeln, Lorbeerblättern und mit einigen Nelken wurde das Gemisch weich geköchelt, bis alles in Fasern zerfiel. Nachdem das Gemenge mit Kapern, Salz und viel Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft abgeschreckt war, wurde die Masse mit Semmelbröseln gebunden. Sodann konnte das Gericht mit Salzkartoffeln, Roter Bete und Gewürzgurken serviert werden. Mit einem kühlen Bier würde es ihr und den beiden Männern bestimmt munden. Sie freute sich auf dieses Essen.
Dr. Simmel kam pünktlich, und auch das Essen war fertig.
Bei Tisch wurde eine eherne Regel der Fischers eingehalten: Man sprach beim Essen nicht über Geschäftliches. Bald plätscherte eine angenehme Konversation vor sich hin. Das Gespräch kam auf die geplanten Skiurlaube im Dezember. Alle drei waren begeisterte Skiläufer. Die Fischers wollten in die Schweizer Alpen, nach Crans-Montana, Dr. Simmel zog es mit mehreren Freunden nach Tirol. Bald wurden die Pisten durchgehechelt, die Preise der Skipässe ausgetauscht und auch die Hotels schwärmend geschildert. Crans-Montana hatte spätestens mit der Skiweltmeisterschaft 1987 den Durchbruch zum mondänen Skiort geschafft. Inzwischen gab es im Umfeld rund 160 Kilometer Skipiste. »Hoffentlich haben wir genug Schnee« , schloss Emil Fischer das Thema ab.
Das Hauptgericht fand nicht nur der Gast äußerst köstlich. Auch die Nachspeise, ein leichter Obstsalat mit etwas Schlagsahne, wurde bis auf den letzten Rest verspeist. Die beiden Männer waren voll des Lobs auf die Kochkunst der Hausherrin.
Recht zügig zogen sie sich danach ins Arbeitszimmer zurück, um bei Kaffee und Wasser das Referat durchzusprechen. Sie kannten durch die lange Zusammenarbeit ihre jeweilige Arbeitsweise gut. Die Aufzeichnungen des Professors warfen wenig Nachfragen auf und erwiesen sich als selbsterklärend. Unausgesprochen war klar, dass Manfred Simmel das Recht hatte, zu kürzen, hinzuzufügen und umzugruppieren. Das Referat sollte nicht länger als zwanzig Minuten dauern. Nach etwa dreißig Minuten ließ erfahrungsgemäß die Aufmerksamkeit der Zuhörer nach. Das wollten beide vermeiden. Manfred Simmel sagte zu, zu allen Themenbereichen eine wissenschaftlich fundierte Quellensammlung zu verfassen. Sie würde am Abschluss der Eröffnungsveranstaltung allen Teilnehmern in Printform ausgehändigt werden. Auch ein Skript mit Kernsätzen und Zitaten wollte er erstellen. Anschließend wurde der Medieneinsatz erörtert. Wo immer sinnvoll, sollten Folien, im Hintergrund auf die Leinwand geworfen, den Vortrag unterstützen. Abspielen von Audio-/Videofiles wurde nicht vorgesehen. Man wollte das Ganze nicht überfrachten. »Diese Medien könnten höchstens Bedeutung gewinnen,