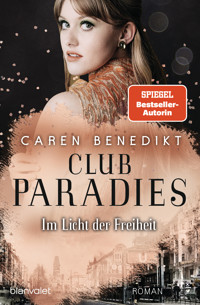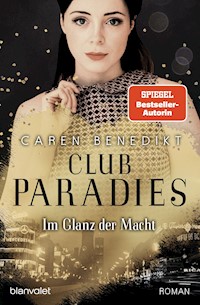9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Grand-Hotel-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Rache, Liebe und Verrat: Die Geschichte um Bernadette von Plesow, der Inhaberin des Grand Hotels auf Binz, und die ihrer Kinder geht weiter.
Bernadette von Plesow hat schon viel durchmachen müssen, aber das letzte Jahr hat ihr fast zu viel abverlangt. Von ihrem prächtigen Hotel konnte sie alle Schäden abwenden, nicht jedoch von ihre Familie: Ihr Sohn Alexander ist tödlich verunglückt. Die Trauer lastet schwer auf ihr, besonders da sie im Unguten auseinandergegangen sind. Unterstützung erhält sie von ihrer Tochter Josephine, jedoch fällt es Bernadette nicht leicht, sich wieder mit aller Kraft dem Hotel zu widmen. Und plötzlich steht auch noch ein Mann vor der Tür, den sie nur von einer alten Fotografie kennt …
Bernadettes anderer Sohn Constantin, Eigentümer des verruchten Hotels Astor in Berlin, geht hingegen ganz anders mit der Trauer um seinen Bruder um. Er weiß, dass er die Schuld an dessen Tod trägt, wollte sich doch der Kopf der Frankfurter Unterwelt damit an ihm rächen. Constantin kann und will das nicht hinnehmen. Er hat sich einen perfiden Plan ausgedacht, wie er es dem Mörder seines Bruders zurückzahlen könnte und lässt sich damit auf ein gefährliches Spiel ein …
Die Grand-Hotel-Trilogie:
Das Grand Hotel. Die nach den Sternen greifen.
Das Grand Hotel. Die mit dem Feuer spielen.
Das Grand Hotel. Die der Brandung trotzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Bernadette von Plesow hat schon viel durchmachen müssen, aber das letzte Jahr hat ihr fast zu viel abverlangt. Von ihrem prächtigen Hotel konnte sie alle Schäden abwenden, nicht jedoch von ihrer Familie: Ihr Sohn Alexander ist tödlich verunglückt. Die Trauer lastet schwer auf ihr, besonders da sie im Unguten auseinandergegangen sind. Unterstützung erhält sie von ihrer Tochter Josephine, jedoch fällt es Bernadette nicht leicht, sich wieder mit aller Kraft dem Hotel zu widmen. Und plötzlich steht auch noch ein Mann vor der Tür, den sie nur von einer alten Fotografie kennt …
Bernadettes anderer Sohn Constantin, Eigentümer des verruchten Hotels Astor in Berlin, geht hingegen ganz anders mit der Trauer um seinen Bruder um. Er weiß, dass er die Schuld an dessen Tod trägt, wollte sich doch der Kopf der Frankfurter Unterwelt damit an ihm rächen. Constantin kann und will das nicht hinnehmen. Er hat sich einen perfiden Plan ausgedacht, wie er es dem Mörder seines Bruders zurückzahlen könnte, und lässt sich damit auf ein gefährliches Spiel ein …
Autorin
Caren Benedikt ist das Pseudonym der Autorin Petra Mattfeldt. Sie liebt den Norden, eine steife Brise und das Reisen an die Orte, über die sie schreibt. Nach einer eher nüchternen Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten arbeitete sie als freie Journalistin. Inzwischen ist die Schriftstellerei ihr Hauptberuf, und sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einem kleinen Ort in der Nähe von Bremen.
Von Caren Benedikt bereits erschienen:
Das Grand Hotel. Die nach den Sternen greifen. Band 1Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
CAREN BENEDIKT
DASGRAND HOTEL
Die mit dem Feuer spielen
Band 2
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kristina Lake-Zapp
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Shutterstock.com (rdonar; 100ker; Falk Herrmann; weerawath.p; zakaz86; Artiste2d3d)
NG · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24356-2V003www.blanvalet.de
Ich widme diesen Roman meiner Großmutter, der Frau, deren Geschichte mich hierzu inspiriert hat.
Prolog
Binz, 08. Februar 1912
»Ein Leben, das nicht meines ist. Oder doch das, das mir immer vorherbestimmt war? Ich weiß es nicht. Doch ich weiß, dass ich zugreifen werde. Ich muss es einfach tun.«
HANS MEGERLEIN
Ich kann es nur rückblickend zusammenfassen, wenngleich mein Erinnerungsvermögen sich weigert, mir jedes Detail der Ereignisse zu offenbaren, die sich an jenem schicksalhaften Tag im April des Jahres 1879 zugetragen haben. Womöglich ist es gut so, eine Art Schutz meiner damals erst siebzehnjährigen Seele. Und doch bleiben immer diese Fragen und Zweifel. War es richtig, wie ich mich verhalten hatte?
Noch am Morgen hatte ich geglaubt, dass es einer der glücklichsten Tage, wenn nicht gar der glücklichste Tag meines Lebens würde, denn all die Mühen und das viele Lernen hatten sich am Ende bezahlt gemacht. Ja, es war genauso gekommen, wie Leopold von Plesow es vorausgesagt hatte: Sohn eines Knechts oder Sohn eines Gutsherrn – jeder konnteBildung erlangen, wenn er nur wissbegierig und fleißig genug war.
Und ich hatte es geschafft. Ich, Hans Megerlein, einfacher Sohn eines Knechts und einer Magd, die schon lange nicht mehr am Leben waren. Wie sehr hätte Mutter es geliebt, mich an diesem Tage so sehen zu können! Ich trug einen Anzug, einen richtigen Anzug, der eigens für mich geschneidert worden war. Leopold und Felicitas von Plesow hatten ihn für mich anfertigen lassen, und ich sollte ihn als Geschenk erhalten, wenn es mir gelänge, meine Prüfungen zu bestehen und den ersehnten Abschluss zu erhalten. Nun durfte ich ihn tragen, zur feierlichen Übergabe der Urkunde. Ich konnte mein Glück, vor allem aber auch die Großzügigkeit der von Plesows kaum fassen. Menschen wie sie gab es wohl kein zweites Mal auf dieser Welt, und ihr Verhalten und ihre Art, mit Untergebenen umzugehen, wurden mir zum Wegweiser, der mich mein ganzes Leben lang begleiten sollte.
Ich hatte die von Plesows nie anders kennengelernt denn als gütige Menschen mit einem reinen Herzen, die dankbar waren für das, was der Herrgott ihnen im Leben geschenkt hatte. Ich wusste nicht viel über die Geschichte der Familie, nur dass bereits die Großeltern und, wenn ich mich richtig erinnere, auch deren Eltern schon auf dem prächtigen Gutshof mit dem weitläufigen Anwesen in der Nähe von Teterow gelebt hatten. Es war ein stattliches Haus, das sich in einem freundlichen Gelb über das satte Grün des Geländes erhob. Der Anblick hatte für mich stets etwas Friedvolles gehabt und trotz der immensen Größe nichts Einschüchterndes, was womöglich daran lag, dass ich wusste, welche herzensguten und freundlichen Menschen hinter den Fenstern und Mauern lebten.
Auch meine Eltern, die als Magd und als Knecht im Dienste der von Plesows standen, hatten stets nur gut über die Herrschaften zu sprechen gewusst. Und als es erst meine Mutter und kurze Zeit später auch meinen Vater dahinraffte, hatten die von Plesows nicht lange überlegt, was mit mir, einem damals erst achtjährigen Jungen, geschehen sollte. Ganz selbstverständlich sorgten sie dafür, dass ich aus dem Gesindetrakt ins Haupthaus wechselte, gleichwohl sie hierzu keinerlei Verpflichtung gehabt hätten. Hätte es die von Plesows nicht gegeben, wäre ich in einem der vielen Armenhäuser gelandet, die zu jener Zeit wie Pilze aus dem Boden schossen und über die die schlimmsten Geschichten erzählt wurden. Kaum vorstellbar, was die Kinder dort zu erdulden hatten.
Ich weiß nicht, ob die von Plesows irgendein wie auch immer geartetes Potenzial in mir sahen. Der Nutzen, den ich ihnen in Zukunft bringen würde, war – wenn überhaupt – mehr als überschaubar. Nein, es lag wohl einfach in ihrer Natur zu helfen, ohne die Hoffnung, hierfür selbst etwas zu erhalten. Und so nahmen sie mich auf, und ich lebte bei ihnen, Seite an Seite mit Karl, ihrem einzigen Sohn, und tatsächlich fühlte es sich fast so an, als wäre er mein richtiger Bruder. Bis auf wenige Monate waren wir im gleichen Alter, und Felicitas von Plesow hatte mehr als einmal gesagt, dass sie und ihr Ehemann nun zwei Söhne hätten, der eine blond und der andere dunkelhaarig. Karl und ich machten einfach alles zusammen, wir waren unzertrennlich. Und obwohl jeder von uns die Wahrheit kannte, schien es doch, als spiele es keine Rolle mehr, ganz so, als wäre meine Herkunft nicht mehr von Belang.
Ja, es war eine glückliche Zeit damals, und ich glaube, so verwegen sein und behaupten zu können, dass die von Plesows mich aufrichtig gemocht, womöglich sogar geliebt haben. Ich jedenfalls liebte sie von Herzen, daran gibt es nicht den geringsten Zweifel.
Wenn ich nun an jenen schrecklichen Apriltag zurückdenke, so wird mir bewusst, dass der Verlust der von Plesows mich härter traf als seinerzeit der Tod meiner leiblichen Eltern. Ich schäme mich für den Gedanken, und doch ist er da. Immer wieder bin ich im Geiste alles durchgegangen, habe mich gefragt, ob ich es hätte verhindern können. Die Verzweiflung über das, was nicht mehr zu ändern war, brachte mich fast um den Verstand.
Ich weiß noch, dass wir zusammen in der Kutsche saßen. Felicitas, Leopold, Karl von Plesow und ich. Otto fuhr die Kutsche und trieb den Gaul an, weil es in Strömen regnete, obwohl die Tage zuvor heiteres Wetter geherrscht und die Sonne dem Anschein nach jeden Tag an Kraft gewonnen hatte. Karl und ich hielten unsere Urkunden in Händen, den Beleg dafür, wie fleißig wir gelernt hatten. Ja fast war es mir peinlich, und ich fühlte mich sogar ein wenig undankbar, dass mein Ergebnis knapp besser war als seines. Doch Karl schien das nicht zu stören. Vielmehr freute er sich für mich, genau wie seine Eltern. Felicitas von Plesow sagte mir an jenem Tag, ich könne stolz auf mich sein, und ich konnte ihr die Anerkennung, die sie mir zollte, deutlich am Gesicht ablesen. Ja, sie war stolz auf mich wie eine Mutter, und ich musste gegen die Tränen kämpfen, als sie mir mit einer vertrauten Geste über die Hand strich. Nie zuvor hatte ich eine solche Wertschätzung erfahren. Bewegt wandte ich den Blick ab und sah aus dem Fenster. Die Kutsche rollte soeben auf die Brücke, die den Fluss, welcher wie ein breites graues Band durch die ergrünende Landschaft mäanderte, überspannte.
Kurz darauf hörten wir Otto aufschreien, ganz plötzlich, und schon im nächsten Moment geriet die Kutsche ins Schleudern. Ich sehe noch heute Felicitas von Plesows Augen vor mir, ihren ängstlichen Blick, der verriet, dass sie das Unheil ahnte, das in jenem Augenblick über uns alle hereinbrach.
Es krachte, Otto brüllte, und die Kutsche stürzte in rasender Geschwindigkeit in die Tiefe. Wir wurden von unseren Sitzen geschleudert und flogen wild durcheinander. Kurz darauf spürte ich den Aufprall, spürte, wie Wasser durch die Fenster eindrang und rasch höher stieg. Dann verlor ich das Bewusstsein.
Als ich die Augen wieder aufschlug, fand ich mich im Bett eines Hospitals wieder. Auf einem Stuhl zu meiner Rechten saß Dr. Kramer, der Anwalt der von Plesows. Sobald er bemerkte, dass ich zu mir kam, stand er eilig auf und beugte sich zu mir herüber.
»Hans«, flüsterte er. »Du musst jetzt genau das tun, was ich dir sage, hörst du?«
Ich weiß nicht, ob ich nickte oder ihm sonst irgendwie zu verstehen gab, dass ich einwilligte, doch er sprach schon weiter und teilte mir mit, dass die von Plesows und ihr Kutscher tot waren. Alle waren bei dem Sturz von der Brücke in den Fluss ums Leben gekommen.
Nur bruchstückhaft erinnere ich mich, dass er mir zuflüsterte, er habe dem Krankenhauspersonal weisgemacht, dass ich Karl von Plesow sei. Ich verstand kaum, was er mir mitzuteilen versuchte. Eindringlich zischte er mir zu, dass es keine Erben gebe und daher sämtlicher Besitz der von Plesows, der sich seit Generationen in der Familie befand, an den Staat falle.
»Du bist Karl von Plesow, hörst du?«, zischte er mir wieder und wieder zu und versicherte mir, dass er sich um alles kümmern werde.
Und das tat er.
Noch während ich mich im Hospital von meinen diversen Knochenbrüchen erholte, veranlasste er, dass die von Plesows und Hans Megerlein bestattet wurden.
Anfangs glaubte ich, es müsse doch jemand kommen, der mich kannte oder Karl von Plesow im Hospital besuchen wollte, doch das war nicht der Fall.
Am Tag meiner Entlassung bezahlte Dr. Kramer für die immerhin fast zweimonatige Behandlung und nahm mich mit. Wir fuhren nicht zum Anwesen der von Plesows. Genau genommen kehrte ich niemals dorthin zurück.
Dr. Kramer hatte sich um alles gekümmert, sämtliche Papiere erstellt und für mich eine Bleibe nahe Berlin gefunden, die er als angemessen bezeichnete. Ich selbst fand das Haus viel zu groß. Doch diesen Gedanken behielt ich für mich.
Als er mir die Abrechnungen für seine Dienste vorlegte, die ich auszugleichen hatte, wurde mir klar, dass Dr. Kramer einen guten Gewinn aus alldem zog. Doch hätte ich ihn deswegen verurteilen sollen?
Bis zu unserem letzten Treffen beharrte er darauf, in Leopold von Plesows Sinn gehandelt zu haben, dem es gar nicht gefallen hätte, wenn sein gesamtes Vermögen an den Staat gefallen wäre. Zudem ließ er nicht unerwähnt, dass ich ohne die Großmut meiner Gönner keine echte Zukunft vor mir gehabt hätte. Im Grunde meines Herzens wusste ich, dass er mit beiden Behauptungen recht hatte, doch milderte das nicht mein schlechtes Gewissen. Dennoch, so muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, hegte ich niemals ernsthaft den Gedanken, die Angelegenheit aufzuklären. Nein. Ich war von jenem Tage an Karl von Plesow, mit allen notwendigen Papieren, um dies zu belegen, und einem Vermögen, das mir einen mehr als guten Start in die Zukunft bereiten würde. Ja, ich ließ es geschehen. Und vielleicht hätten alle, die gestorben waren und sich hierzu ein Urteil hätten erlauben können, es wirklich so gewollt. Doch fragen konnte ich sie nicht. Und so musste ich einfach mit dem Geheimnis leben.
Ob ich wohl im Jenseits die Gelegenheit dazu bekomme? Was, wenn sie mich deswegen verfluchen oder beschimpfen? Was, wenn sie mir ihre Enttäuschung ins Gesicht speien? Oder gibt es gar kein Jenseits, sondern einfach nur ein großes Nichts, und all die Seelen, die Mutter Erde Jahr für Jahr verlassen, zerfallen und werden vom Wind der Zeit fortgetragen?
Ich spüre, wie ich mich sträube, mich zu erheben und zur Tat zu schreiten. Doch das ist allemal besser, als Tag für Tag einen immer jämmerlicher werdenden Anblick zu bieten, bis der qualvolle Tod eintritt. Nein, ich möchte nicht, dass sie mich so in Erinnerung behalten.
Gleich schon werde ich dort unten liegen, dort vor dem Hotel, das ich zusammen mit meiner geliebten Frau Bernadette aufgebaut habe. Bernadette. Wundervolle, schöne, kluge Bernadette, Mutter meiner Kinder und Liebe meines Lebens. Du wirst es verstehen, das weiß ich. Denn du bist anders als all die anderen Menschen, die sich von ihren Gefühlen leiten lassen und danach ihre Entscheidungen treffen. Ich zweifle keinen einzigen Augenblick, dass du all das meistern wirst, was das Leben an Herausforderungen für dich bereithält. Einzig bedauere ich, dass ich nicht mehr dabei sein kann, um es mit dir zu erleben.
Schon wieder spüre ich, dass ich mich in meinen Gedanken verliere. Ja, ich schiebe den Moment hinaus, weigere mich loszulassen. Doch es muss sein, jetzt und nicht erst später. Andernfalls könnte mein Fortbleiben auffallen und meine Pläne womöglich durchkreuzen.
Schweren Herzens stehe ich auf, taste mich auf dem Dach weiter vor. Fast schon habe ich die Kante erreicht. Ich binde mir das Seil um den Bauch, das mich sichern soll. Das andere Ende habe ich an dem stabilen Haken neben dem Fenster angebracht. Niemand darf annehmen, dass ich leichtsinnig in die Tiefe gestürzt bin. Nein, es muss so aussehen, als wäre das Seil gerissen, während ich die schadhaften Dachziegel auswechseln wollte. Niemand darf zu einem anderen Schluss kommen.
Meine Finger gleiten über die Stelle am Seil, die ich vorsichtig mit dem Messer bearbeitet habe. Ein kräftiger Ruck, und es wird reißen.
Mein Blick schweift über die See, über den Steg, den Bernadette und ich so oft gemeinsam entlangschritten. Ich stelle mich ganz vorn an die Kante des Daches, lehne mich mit ganzem Gewicht gegen das Seil. Noch gibt es nicht nach, ein weiterer Lebensmoment wird mir geschenkt. Ich beuge mich weiter vor, das Seil gibt einen kurzen, knarrenden Laut von sich. Ich rieche die See, höre die Möwen schreien und schließe die Augen. Das Seil reißt, und ich stürze in die Ewigkeit.
1. Kapitel
Binz, 11. Mai 1925
»Und es ist endlich. Alles Leben stirbt und ist ein ständiger Verfall. Es fällt mir schwer, den Sinn in der Sinnlosigkeit zu finden.«
BERNADETTE VON PLESOW
Bernadette wusste nicht, wie lange sie nun schon so dastand und auf das Grab sah, in dem ihr Ehemann Karl und ihre Söhne Alexander und Maximilian die letzte Ruhe gefunden hatten. Ein Dreivierteljahr war es nun her, dass das Grab erweitert und Alexander neben seinem Vater und Bruder bestattet worden war. Doch die Zeit hatte für Bernadette nicht gereicht, wieder die Alte zu werden. All das, was ihr früher wichtig gewesen war, zählte für sie nicht mehr. Niemand sollte seine eigenen Kinder begraben müssen, und für Bernadette fühlte es sich fast wie eine Strafe Gottes an, die sie zu verbüßen hatte. Dabei war sie nicht einmal gläubig, zumindest nicht im üblichen Sinne. Sie bezweifelte nicht, dass es einen Gott gab – sie bezweifelte vielmehr, dass er sich noch für sie interessierte. Zu oft schon hatte sie ihre Seele verkauft, um zu bekommen, was sie wollte, und nun konnte sie sich des Gefühls nicht erwehren, dass Gott aufgegeben hatte und sie gewähren ließ – einfach weil er nicht an ihre vermeintliche Bekehrung glaubte.
Bernadette bückte sich, legte eine Rose auf jedes der Gräber, stand auf, strich ihren Rock glatt und ging. Sie gab sich Zeit, sich zu sammeln, bis sie die metallene Friedhofspforte erreichte, die nur quietschend den Weg zurück zu den Lebenden freigab. Sobald sie diese Pforte wieder schloss, würde sie es sich nicht mehr erlauben, ihren Gedanken nachzuhängen und mit ihrer Situation und dem Schicksal zu hadern. Wie es in ihr aussah, ging nur sie allein und sonst niemanden etwas an.
Sie kam am Haus des Pastors vorbei, in dessen Gemeindegarten ein halbes Dutzend Helfer damit beschäftigt waren, die Büsche und Sträucher zu stutzen und alles für die immer wärmer werdenden Tage herzurichten. Der neue Pastor war erst vor Kurzem mit seiner Ehefrau und seinen vier Kindern hergezogen, nachdem der Kirchenvorstand den früheren Prediger mit Schimpf und Schande aus Binz fortgejagt hatte. Bernadette schüttelte den Kopf bei dem Gedanken an die gelebte Doppelmoral, die diesem Vorgang vorausgegangen war. Natürlich verstand sie, dass sich der frühere Pastor in eine prekäre Lage gebracht hatte, indem er nach dem Tod seiner Gemahlin ein Verhältnis mit einer gut zehn Jahre jüngeren Frau angefangen hatte. Gewiss wäre es besser gewesen, die Sache so lange unter Verschluss zu halten, bis beide einander das Jawort gegeben hätten, und genau das, so betonte es zumindest Pastor Dietrichs, hatten sie ja auch vorgehabt. Es war nur eben so, dass der Ehemann der Geliebten nicht aus dem Krieg heimgekehrt war und sie sich bisher geweigert hatte, ihn für tot erklären zu lassen. Sonst hätte einer Eheschließung nichts im Wege gestanden, auch die beiden Kinder der Frau hatte Pastor Dietrichs annehmen wollen. So jedoch hatte sich alles verzögert, und niemand hatte ahnen können, dass sich der Kirchenvorstand über das Verhältnis der beiden derart echauffierte, dass er den Pastor seines Postens in Binz enthob. Absurd und vollkommen übertrieben, fand Bernadette, vor allem da sie wusste, dass mindestens zwei der so kompromisslos agierenden Vorstandsmitglieder ebenfalls jüngere Geliebte hatten – mit dem Unterschied, dass ihre eigenen Frauen noch am Leben waren und sich bester Gesundheit erfreuten.
In Bernadettes Augen war die Entlassung von Pastor Dietrichs ein großer Verlust für die Gemeinde, hatte sie doch dessen pragmatische und menschennahe Art sehr geschätzt. Er war nicht nur ein verknöcherter Geistlicher, sondern vor allem ein Mann, der sein Leben lebte und stets mit kluger Sicht auf die Belange der Menschen in seiner Gemeinde einging. So überbrachte er beispielsweise bei runden Geburtstagen nicht nur die besten Wünsche der Kirche und forderte zum Gebet auf, sondern lockerte danach auch den obersten Knopf am Hemdkragen unter dem Talar und trank mit seinen Schäfchen das eine oder andere Bier. Durch ebendiese umgängliche Art gab er den Menschen so viel mehr Halt im Glauben als ein Pastor, der mit erhobenem Zeigefinger von der Kanzel predigte und mit göttlichen Strafen drohte. Dennoch hatte sich Bernadette nicht für Pastor Dietrichs eingesetzt, als der Kirchenvorstand die Entscheidung fällte, ihm die Stelle wegzunehmen.
Mittlerweile lag die Sache ein Vierteljahr zurück; Alexander war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal ein halbes Jahr tot gewesen. Ihr hatte einfach die Kraft gefehlt, einen Kampf zu führen, der letztendlich nicht ihrer war, noch dazu in einer Zeit, in der es ihr morgens oft schwerfiel, auch nur das Bett zu verlassen. Erst als Pastor Dietrichs zu ihr ins Hotel gekommen war, um sich von ihr nach all den Jahren, die sie zusammen hier in Binz gelebt hatten, zu verabschieden, bereute sie, nichts unternommen zu haben. Sie wusste, dass ihre Stimme in der Gemeinde Gewicht hatte, und sie wusste auch, dass sie so manches Vorstandsmitglied zum Umdenken hätte zwingen können, hätte sie damit gedroht, Dinge preiszugeben, die nicht für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt waren. Doch sie hatte es nicht getan. Sie hatte geschwiegen, genau wie die anderen. Auf dem Weg zurück zum Grand Hotel grüßte sie die Menschen, denen sie begegnete, ganz gleich, ob sie diese zu kennen glaubte oder nicht. Denn auch wenn sie meinte, viele der Gesichter nie zuvor gesehen zu haben, ahnte sie doch, dass wohl jeder wusste, wer sie war. Und sie wollte nicht, dass man ihr ansah, in welcher Stimmung sie sich befand und welch trübe Gedanken ihr auf der Seele lagen. Nein, das ging niemanden etwas an, und wichtiger als alles andere war es, Haltung zu bewahren und für jeden ein Lächeln zu haben, ganz gleich, wer ihr begegnete. Denn eines hatte sie gelernt, eine Lektion, die ihr in Fleisch und Blut übergegangen war: Ohne Disziplin konnte man nicht überleben. In ihrer Welt gab es keine unbedachten Momente, keine Äußerung, die ihr einfach über die Lippen kam und die sie womöglich später bereute. Sie war die Disziplin in Person, ein Mensch, der sich weder gehen ließ noch Schwäche zeigte. Ihr Gesicht war hinter einer lächelnden Maske verborgen, und sie gestattete niemandem, ihr diese abzunehmen, nicht einmal sich selbst.
Als sie das Hotel betrat, blickte Werner Druminski an der Rezeption auf.
»Ah, gnädige Frau«, sagte er, als Bernadette näher kam, und griff nach einem Brief, der auf der Ablage hinter dem Tresen lag. »Dieses Kuvert wurde für Sie abgegeben.«
»Danke sehr, Werner.« Bernadette nahm den Brief, auf dem lediglich ihr Name stand, und drehte ihn um. Auch auf der Rückseite stand kein Absender.
»Sind die von Constantin angekündigten Gäste, die von Hohewalds, schon eingetroffen?«
»Die gnädige Frau Frederike von Hohewald, ja. Ihr Gatte wird erst am frühen Abend in Binz ankommen.«
»Gut. Ich werde gleich hinaufgehen und sie persönlich begrüßen. Wurde das Blumenarrangement aufs Zimmer gebracht?«
»Selbstverständlich, gnädige Frau.«
Bernadette nickte. »War sonst noch etwas?«
»Regierungsrat Ernst Bautner hat sich für das Wochenende angemeldet und wird von insgesamt vier weiteren Herren«, er räusperte sich, »sowie von einigen Damen begleitet werden.«
»In Ordnung. Lassen Sie bitte alles wie üblich vorbereiten, Werner.«
»Jawohl, gnädige Frau.«
Bernadette konnte dem Rezeptionisten ansehen, dass ihm das Arrangement, das Bernadette mit Bautner getroffen hatte, gar nicht gefiel, lag es in seinen Augen doch weit unter dem Niveau des angesehenen Hotels, dass hier verheiratete Männer mit Damen zweifelhaften Rufs ihrem Vergnügen frönten. Bernadette hatte diese Übereinkunft einst mit Ernst Bautner getroffen, weil sie damals, noch vor Alexanders Tod, Major Götz Wilhelm hatte heiraten und aus diesem Grunde die Affäre mit Bautner beenden wollen. Als Regierungsrat mit entscheidendem Einfluss auf Baubehörde und Gemeindeverwaltung hatte Bautner ihr gegen gewisse Gefälligkeiten über Jahre hinweg zu den erforderlichen Baugenehmigungen zur Verwirklichung ihrer Pläne verholfen. Um sich dennoch seiner Unterstützung sicher sein zu können, hatte sie eingewilligt, ihn und andere Regierungsbedienstete von Zeit zu Zeit im Hotel logieren zu lassen und ein oder sogar beide Augen zuzudrücken, wenn diese diverse Damen einluden und gemeinsam ausgelassene Abende begingen. Zuletzt war es um ihr Vorhaben gegangen, das Palais, den größten Konkurrenten des Grand an der Promenade von Binz, zu kaufen, doch nach Alexanders Tod hatte Bernadette das Interesse daran verloren. Inzwischen fragte sie sich sogar, wie genau Bautner ihr noch nützen könnte und ob es nicht an der Zeit wäre, die Vereinbarung zu beenden.
»Gibt es sonst noch etwas?«, fragte sie ihren treuen Rezeptionisten gedankenverloren.
»Uns erreichen immer neue Reservierungen, und tatsächlich werden wir dieses Jahr wohl kaum in der Lage sein, allen Anfragen zu entsprechen«, gab Werner Druminski Auskunft.
»Gut so«, befand Bernadette, wenngleich sie es schon fast als selbstverständlich ansah, dass das Hotel ausgebucht war. Es hatte andere Zeiten gegeben, die noch nicht einmal besonders lange zurücklagen, doch mittlerweile hatte sie es geschafft, das Grand als erstes Haus am Platz zu etablieren. Jeder, der einmal hier gewesen war, kam wieder. »Hat meine Tochter angerufen?«
»Ich bedaure, doch das gnädige Fräulein hat sich bisher nicht gemeldet.«
»Bestimmt wird sie das heute noch tun. Bitte stellen Sie sie sogleich zu mir durch.«
Druminski deutete eine Verbeugung an. »Gewiss, gnädige Frau.«
»Gut. Ich werde noch bei Frau von Hohewald vorbeigehen, und danach finden Sie mich in meinem Büro.«
»Sehr wohl, gnädige Frau.«
Bernadette nahm das Kuvert, ging zur Treppe und stieg die Stufen in den ersten Stock hinauf. Sie hatte dem Ministerialrat von Hohewald und dessen Ehefrau Zimmer 135 gegeben, ein großzügiges Doppelzimmer mit Bad und herrlichem Blick auf die See.
Vor der Tür blieb sie stehen und klopfte. Eine Frau, die sie in etwa so alt schätzte wie sich selbst, vielleicht auch etwas jünger, öffnete die Tür.
»Frau von Hohewald? Mein Name ist Bernadette von Plesow.« Sie legte den Kopf schräg und lächelte, wie sie es immer tat, wenn sie jemanden begrüßte. »Willkommen in unserem Hause.«
»Ach, wie wunderbar.« Frederike von Hohewald griff nach Bernadettes Händen und zog sie ins Zimmer. »Ich habe Sie sofort erkannt«, stellte sie fest. »Ihr Sohn Constantin ist wirklich Ihr Ebenbild.«
»Wir haben die gleichen Augen«, pflichtete Bernadette ihr bei.
»Ach, liebe Frau von Plesow, ich bin ja ganz und gar verzückt. Was für ein wunderbares Hotel!«
»Haben Sie herzlichen Dank. Ja, das Grand ist schon etwas Besonderes.«
»Und erst einmal die herrlichen Blumen, die Sie als Willkommensgruß haben bereitstellen lassen – einfach wundervoll.«
»Von Herzen gern.« Bernadette nickte ihr freundlich zu. »Von Constantin weiß ich, dass Sie ganz besonders geschätzte Gäste des Astor und seine persönlichen Freunde sind. Umso größer ist unsere Freude, dass Sie nun auch uns hier in Binz beehren.«
Frederike von Hohewald legte eine Hand auf die Brust. »Wie reizend von Ihnen. Und dass Ihr Sohn meinen Gatten und mich so überaus schätzt, ist sowohl Freude als auch Ehre.«
»Constantins Freunde sind unsere Freunde«, stellte Bernadette fest. »Darf ich Sie heute Abend als meine Gäste begrüßen? Wäre Ihnen neunzehn Uhr genehm?«
»Ich hoffe, dass mein Gatte dann bereits eingetroffen sein wird.«
»Nun, essen müssen Sie so oder so, meine Teure.« Bernadette beugte sich weiter vor und sagte in verschwörerischem Tonfall: »Und wenn er noch nicht da ist, haben wir Frauen die Gelegenheit, miteinander zu plaudern, was für mich ebenso reizvoll wäre, wie den Abend mit Ihnen und Ihrem Gatten zu verbringen.«
Frederike lachte auf. »Sie haben so eine wunderbar gewinnende Art, liebe Frau von Plesow. Ihr Sohn ist da ganz genau wie Sie.«
»Bitte, nennen Sie mich doch Bernadette.«
»Oh, sehr gern. Ich heiße Frederike mit Vornamen.«
»Vielen Dank, Frederike.« Sie lächelte ihrem Gast zu. »Dann treffen wir uns um neunzehn Uhr unten im Restaurant?«
»Ja, ich werde da sein. Und ich freue mich wirklich sehr auf den Abend.«
»Ich ebenso, liebe Frederike.« Bernadette ging zur Tür und öffnete sie. »Dann bis später, und genießen Sie die Zeit in unserem wunderschönen Binz.« Damit ging sie hinaus und schloss die Tür hinter sich. Kaum dass sie auf den Korridor getreten war, verschwand das aufgesetzte Lächeln von ihrem Gesicht, und ihre Miene wurde ernst. In Momenten wie diesen fragte sie sich stets, wie lange ihr Lächeln schon nicht mehr echt gewesen war.
Sie hatte das Fenster geschlossen, um die von der Promenade herüberklingende Melodie des Akkordeons auszusperren, und saß bereits wieder eine geraume Zeit an ihrem Schreibtisch, als das Prüfen der Korrespondenz durch Telefonklingeln unterbrochen wurde. Das Kuvert, auf dem nur ihr Name geschrieben stand und das unten an der Rezeption für sie abgegeben worden war, lag noch immer ungeöffnet vor ihr auf dem Tisch. Bernadette hatte es sich schon vor langer Zeit zur Gewohnheit gemacht, nicht spontan zu reagieren und sich Dingen zu widmen, die so nicht angedacht waren. Nein, sie weigerte sich, anderen Menschen zu gestatten, ihre Neugierde zu wecken und sie so dazu zu bringen, ihre für den Tag gemachten Pläne zu verwerfen. Wann sie etwas tat oder auch nicht, bestimmte sie allein.
Sie nahm den Hörer ab. »Ja?«
»Gnädige Frau, Ihr Fräulein Tochter wünscht, Sie zu sprechen.«
»Wunderbar, Werner. Bitte stellen Sie sie durch.« Täuschte sie sich, oder klang ihr Rezeptionist eigenartig? So fröhlich, fast schon ausgelassen.
»Sehr wohl, gnädige Frau.«
Nun war sich Bernadette sicher, dass er bei seinen Worten schmunzelte. Doch das Klicken in der Leitung, womit er das Telefonat durchstellte, nahm ihr die Gelegenheit, ihren Angestellten darauf anzusprechen.
»Josephine, wie schön. Wie geht es dir?«
»Guten Tag, maman. Es geht mir gut, vielen Dank. Doch ich habe Sehnsucht nach zu Hause. Und wie geht es dir?«
»Du hast Sehnsucht? Dann solltest du bald einmal wieder nach Binz kommen.«
»Ach, wem sagst du das?« Josephine kicherte. »Was denkst du? Wann passt dir mein Besuch?«
»Wann immer du willst, das weißt du doch.«
»In drei Wochen geht es auf keinen Fall, aber das weißt du ja. Da findet meine Vernissage statt.«
»Ja, natürlich weiß ich das. Ich werde eigens deshalb nach Leipzig reisen.«
»Und die Woche darauf ist es auch schlecht«, fuhr Josephine fort und prustete unterdrückt.
»Josephine, was ist denn los? Du lachst so albern.« Bernadette runzelte die Stirn und drehte sich dann zum Fenster um. Hatte sie es nicht richtig geschlossen? Sie hörte noch immer den Akkordeonspieler, oder täuschte sie sich? Sie hielt den Telefonhörer ein wenig vom Ohr weg, und die Melodie schien leiser zu werden.
»Aber ich lache doch nicht albern, maman«, entrüstete sich Josephine, und Bernadette stellte fest, dass die Melodie des Akkordeons nicht von draußen, sondern aus dem Hörer kam. In diesem Moment fiel der Groschen.
»Josephine von Plesow, veralberst du mich etwa und stehst unten am Empfang?«
Jetzt lachte Josephine lauthals los. »Sie hat uns durchschaut, Herr Druminski«, hörte Bernadette sie sagen. »Bleib oben in deinem Büro. Ich komme zu dir hinauf.« Damit hängte Josephine den Hörer ein.
Bernadette tat es ihr gleich, stand auf, ging gemessenen Schritts zur Tür und öffnete diese. Nur einen Augenblick später hörte sie Schritte, die eilig näher kamen. Offenbar rannte Josephine, etwas, was Bernadette ihr von klein an tunlichst verboten hatte. Damen rannten nicht, sie gingen nicht einmal rasch. Sie schritten und strahlten mit jedem einzelnen Schritt Würde und Stolz aus. Bernadette stöhnte innerlich. Ob es ihr wohl je gelingen würde, eine Dame aus ihrer Tochter zu machen?
Sie trat auf den Flur und sah den Korridor entlang. Gerade in diesem Moment erreichte Josephine die letzte Stufe und rannte nun mit ausgebreiteten Armen auf ihre Mutter zu.
»Maman!«, rief sie laut.
Am liebsten hätte sie die Tochter zurechtgewiesen, doch ihre Freude, ihr kleines Mädchen nach so vielen Wochen wiederzusehen, überwog. Glücklich schloss sie sie in die Arme. »Josie, mein Schatz!«
Bernadette schluckte schwer, um die aufsteigenden Tränen zurückzudrängen, als Josephine schluchzend stammelte: »Ich bin so glücklich, wieder hier zu sein.«
Sie schob Josephine ein wenig von sich und betrachtete sie. »Du siehst gut aus, Liebes. Das Kostüm steht dir fantastisch.«
»Ach ja? Es gefällt dir? Das hatte ich gehofft.« Josephine strahlte. »Und du bist so wunderbar und makellos wie immer, maman.«
Bernadette lächelte. »Komm erst einmal herein.« Sie legte den Arm um Josephines Schultern und führte sie in ihr Büro. »Komm, setzen wir uns.« Sie deutete zur Sitzecke mit den Sofas hinüber, in der sie nur selten Platz nahm. Wenn sie sonst jemanden in ihrem Büro empfing, dann ließ sie ihn auf den Stühlen vor ihrem Schreibtisch Platz nehmen.
»Möchtest du etwas trinken?«
»Ein Bier aus der Flasche«, gab Josephine prompt zur Antwort, was ihr einen fragenden Blick ihrer Mutter einbrachte. Sie lachte auf. »Ich wollte nur dein Gesicht sehen«, prustete sie los. »Ich hätte gern ein Wasser, allenfalls einen Wein oder ein Glas Champagner.«
Bernadette schmunzelte, dann sagte sie in liebevoll-mahnendem Ton: »Würdest du bitte aufhören, mich zu veralbern?«
Bernadette nahm zwei Gläser von der Anrichte und stellte sie auf den Tisch, dann holte sie die mit Wasser gefüllte Kristallkaraffe, schenkte ein und setzte sich zu Josephine auf eines der Sofas. Die Frauen fassten sich an den Händen.
»Ich freue mich so, dass du gekommen bist«, begann Bernadette das Gespräch.
»Es ist herrlich, wieder hier zu sein«, gab Josephine glücklich zurück.
»Aber warum hast du denn nicht gesagt, dass du kommst? Ich hätte etwas vorbereiten können.« Bernadette strich über Josephines Hände. Sie zog die Stirn in Falten. »Oder ist etwas geschehen? Musst du mir etwas sagen?«
»Aber nein. Warum denkst du immer gleich, es wäre etwas Schlimmes passiert, wenn ich nach Hause komme?« Josephine schüttelte lächelnd den Kopf.
»Ach verzeih, das war dumm von mir. Aber nun erzähl«, forderte Bernadette die Tochter lächelnd auf. »Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen?«
»Ich sehe, wenn du dieses Lächeln aufsetzt«, stellte Josephine fest.
»Was meinst du?«
»Na, dieses verbindliche, das du für unsere Gäste und deine Geschäftspartner benutzt. Bei mir kannst du dir das sparen.«
Bernadette wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Josephine hatte vollkommen recht, doch das wollte sie keinesfalls eingestehen. »Mein Lächeln ist nicht falsch, Liebes. Ich bin nur etwas abgespannt, das ist alles.«
»Aber weshalb denn?«
»Es ist viel zu tun im Moment.«
»Es ist immer viel zu tun, maman.«
Bernadette gefiel nicht, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelte. Ihre Tochter legte den Kopf schräg, eine Geste, die sie zweifelsohne von ihrer Mutter übernommen hatte. Ob gewollt oder nicht, hätte Bernadette nicht sagen können, nur dass Josie sie schon immer bewundert und von klein auf in ihre Fußstapfen hatte treten wollen. Doch seit dem Tod ihres Bruders Alexander hatte sich etwas verändert. Offenbar spürte Josephine, dass die Kraft, die ihre Mutter stets ausgestrahlt hatte, nicht mehr dieselbe war.
»Wie geht es dir wirklich, maman?«, wollte sie nun wissen.
»Es ist alles in Ordnung.« Bernadette bemühte sich um ein Lächeln. »Das Hotel ist so gut wie immer ausgebucht, und wir sehen einem vortrefflichen Sommer entgegen.«
»Ich frage dich nicht, wie es um das Hotel steht, sondern wie es dir geht«, stellte Josephine klar.
»Ich kann wirklich nicht klagen«, beteuerte Bernadette. »Und nun erzähl mir endlich, weshalb du so überraschend nach Binz gekommen bist. Wie lange wirst du bleiben?«
»Ich bin deinetwegen hier«, begann Josephine. »Und so wie ich dich jetzt erlebe, denke ich, dass meine Entscheidung richtig war.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Du kannst die anderen täuschen, maman, mich jedoch nicht. Früher einmal, ja, doch heute gelingt dir das nicht mehr. Ich weiß, du traust es mir nicht zu, aber ich bin erwachsen geworden und sehe endlich einmal nicht mehr nur auf mich.«
»Und das soll ich bitte wie verstehen?«
»Es geht dir nicht gut«, stellte Josephine fest, und ihre Stimme ließ keinerlei Zweifel aufkommen, dass sie meinte, was sie sagte. »Und genau aus diesem Grunde bin ich gekommen.«
Bernadette sah die Tochter an und wartete ab, was wohl als Nächstes kommen würde.
»Ich möchte mit dir über die Zukunft sprechen, maman.«
»Über deine oder meine?«
»Über unsere, um genau zu sein. Ich weiß, wie sehr dir Alexanders Tod zugesetzt hat. Mir ebenfalls«, fügte sie eilig hinzu, »doch ich glaube, für eine Mutter ist so etwas weitaus schwerer zu ertragen als für eine Schwester. Du hast Vater verloren, Maximilian und jetzt auch noch Alexander. Wer könnte es dir verübeln, dass du mit dem Schicksal haderst?«
»Wie kommst du darauf, dass ich das tue?«
Josephine sah sie voller Mitgefühl an. »Deine Augen, deine Stimme. Deine ganze Art verrät dich. Du warst immer sehr stark.« Sie befeuchtete mit der Zunge ihre Lippen. »Du hattest Ziele und wusstest immer sehr genau, wie du bekommst, was du willst. Doch seit Alexander nicht mehr lebt, scheint es, als würdest du nur noch …«, sie zögerte und zuckte die Schultern, »nun ja, als würdest du nur noch das tun, was notwendig ist, und alles andere wäre dir egal.«
»Es ist mir nicht egal«, widersprach Bernadette, doch dann wurde sie nachdenklich. Sie schwieg eine Weile, bevor sie leise einräumte: »Womöglich hast du recht. Vielleicht ist mir wirklich vieles gleichgültig geworden. Vieles«, sie hob den Zeigefinger, »jedoch nicht alles. Du bist mir nicht egal.«
Josephine lächelte. »Das weiß ich, maman.«
»Es ist schwer zu beschreiben, musst du wissen. Und ich rede nicht gern darüber. Allerdings fühle ich mich ständig müde und erschöpft.« Sie senkte den Blick und schloss für einen kurzen Moment die Augen.
»Das ist die Trauer, maman. Dennoch es ist an der Zeit, dass du in dein Leben zurückfindest.«
»Weshalb?« Bernadette sah Josephine in die Augen. »Du hast es selbst gesagt: Mein Mann ist tot, genau wie zwei meiner Söhne. Ich habe niemanden, an den ich das Grand Hotel übergeben könnte. Ja, ich gebe es zu: Ich habe meinen Ehrgeiz verloren.«
»Aber deshalb bin ich ja hier.«
»Ach?« Bernadette war die Überraschung anzusehen.
»Ich habe mir etwas überlegt, maman.« Josephine drückte die Hand ihrer Mutter ein wenig fester. »Du hast alles für mich getan. Für mich und auch für meine Brüder. Es ist an der Zeit, etwas zurückzugeben.«
»Nein, Josephine. Das ist nicht nötig. Ich danke dir.«
»Doch, das ist es. Und ich habe dir etwas vorzuschlagen.«
Bernadette sah die Tochter interessiert an.
»Ich werde nach Binz zurückkehren und dich im Hotel unterstützen.«
»Du bist Malerin, Josephine.«
»Genau deshalb würde ich mir auch gern mein altes Atelier einrichten, wenn du nichts dagegen hast.«
»Selbstverständlich habe ich nichts dagegen. Doch ich halte es für keinen guten Einfall, Josie. Du musst dein eigenes Leben leben. Und das findet in Leipzig statt.«
»Genau das habe ich vor. Doch nicht in Leipzig. Ich habe eine wunderbare Zeit dort verbracht, und ich bin dankbar, dass Herr von Rubenstein mir geholfen hat, mich als Künstlerin zu etablieren. Doch ich kann mehr als das.«
»Das sind wirklich ganz neue Töne.«
»Ich weiß. Ich habe sehr viel nachgedacht. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich von dir lernen möchte, ein Hotel zu leiten.«
»Und deine Malerei?«
»Die werde ich weiterbetreiben.« Josephine bemühte sich um ein Lächeln. »Machen wir uns doch nichts vor, Mutter. Ich habe in Leipzig gemalt, ja. Und tatsächlich scheinen einige Menschen genug in den Bildern zu sehen, um sie zu kaufen. Doch ich verbringe niemals meine gesamten Tage damit. Zugegeben, manchmal langweile ich mich sogar ein wenig.«
»Ich hätte nie gedacht, das einmal aus deinem Munde zu hören.«
»Ich denke, ich bin endlich erwachsen geworden, Mutter. Das, was ich für ein aufregendes Künstlerdasein gehalten habe, ist mir inzwischen nicht mehr genug. Und irgendwann zwischen Binz, Berlin und Leipzig sind mir wohl die Ausreden ausgegangen.«
»Ich bin sehr stolz auf dich, mein Liebes.«
»Dann lass mich etwas dafür tun, dieses Gefühl zu verdienen, maman.« Sie strich zärtlich über Bernadettes Hand. »Constantin lebt sein Leben in Berlin, und wir beide wissen, zu was für einem Menschen er geworden ist. Von Alexander sind uns nur seine Zwillinge geblieben, wenngleich sie durch Margrits Erziehung gewiss keine einfachen Menschen werden.« Josephine blickte ihre Mutter traurig an. »Wir haben doch nur noch einander, maman. Bitte, stoß mich nicht zurück.«
Bernadettes Augen füllten sich mit Tränen. Und das erste Mal nach langer Zeit gestattete sie es sich, einmal nicht dagegen anzukämpfen.
2. Kapitel
»Berlin ist eine launische, arrogante Hure. Und ich vergöttere diese Stadt dafür.«
CONSTANTIN VON PLESOW
Constantin grinste breit, als er den Tumult sah. Der Fahrer eines Automobils hatte offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Radfahrer erfasst, der nun fluchend am Boden lag. Sein Fahrrad war vollkommen verbogen und reif für den Schrott, während er selbst unverletzt zu sein schien. Die Hose, die er trug, würde jedoch genau wie das Fahrrad irreparabel sein.
Nach und nach kamen immer mehr Passanten herbei, um zu sehen, was geschehen war. Fast alle schimpften auf den Fahrer des Automobils ein, und einige beschwerten sich lautstark darüber, dass von diesen neumodischen Vehikeln ohnehin nur Unheil ausginge, weil immer mehr Fahrer rücksichtslos durch die Stadt brausen würden. Besonders amüsant fand Constantin, dass direkt über dem am Boden liegenden Fahrradfahrer eine Plakatwerbung für ein großes Autorennen prangte, das dem Geschwindigkeitsrausch dieser Zeit geschuldet war.
Zusammen mit Gerd Nolte ging er voraus, während Ludger Schnurr, Klaus Denker und Eduard Köhler ihnen folgten. Sie überquerten die Straße und erreichten kurz darauf die Sporthalle in dem baufällig wirkenden Gebäude, dessen Tür am oberen Scharnier so schräg saß, dass Nolte kräftig ziehen musste, um sie öffnen zu können. Mit einem quietschenden Laut gab sie schließlich nach und den Eingang frei.
Nolte ließ Constantin den Vortritt, dann betrat er selbst das düstere Innere. Die anderen folgten ihnen wortlos.
Drinnen roch es nach Schweiß. Einige der Sportler sahen auf, als die fünf Männer eintraten, andere wiederum beachteten sie gar nicht.
»Wir suchen einen Mann namens Fritz Langkamp«, erklärte Nolte, als er auf einen der Boxer zutrat.
»Fritz? Das ist der da vorne im Ring.« Der Boxer deutete mit dem Kinn nach vorn, ein Stück tiefer in die Halle, während er eine Bandage von seinem Handgelenk löste.
»Danke.«
Zusammen gingen sie weiter.
»Fremde haben hier keinen Zutritt«, sprach sie ein Mann von der Seite an.
»Wer sind Sie?«, wollte Constantin wissen.
»Manfred Koziol. Ich trainiere Fritz.«
Constantin streckte ihm die Hand entgegen. »Dann sind Sie genau der Mann, den ich sprechen will. Mein Name ist Constantin von Plesow.«
»Constantin von Plesow.« Koziol pfiff durch die Lippen. »Der Name sagt mir was. Ihnen gehört das Varieté, oder?«
»Das Varieté und das Hotel Astor.« Constantin nickte.
»Fritz macht keine Zirkusnummern«, stellte Koziol sogleich klar. »Er ist ein richtiger Boxer und der kommende Champion.«
»Nun, nach dem, was man so hört, dürfte dieser Max Schmeling wohl bessere Chancen haben, der kommende Champion zu werden. Er ist jünger als Langkamp und hat Biss.«
»Biss hat Fritz auch. Und er hat mehr Erfahrung. Aber was interessiert Sie das überhaupt?«
Constantin sah zu Langkamp hinüber, der seinem Gegner gerade einen rechten Haken verpasste, worauf dieser stumpf zu Boden ging. »Nun, sagen wir, ich überlege, mein Geschäftsfeld zu erweitern.«
»Ich habe viel von Ihnen gehört und weiß, wie Sie Ihre Geschäfte machen«, stellte Koziol fest.
»Und ich darf doch wohl annehmen, dass Sie hiervon sehr angetan sind?« Constantin lächelte, doch es lag etwas Gefährliches, Warnendes in seinem Blick.
»Was wollen Sie von Fritz?«
»Nun, wenn ich es richtig sehe, könnte er etwas Unterstützung gebrauchen, um voranzukommen.«
»Unterstützung welcher Art?«
»Er braucht einen großen Kampf, nicht dieses Fallobst, das man ihm bisher serviert hat. Einen Kampf, den die Leute sehen wollen. Und ich kann dafür sorgen, dass er ihn bekommt.«
»Aber doch nicht ohne Gegenleistung?«
»Was denken Sie? Ich bin Geschäftsmann. Ich kümmere mich um alles, und dafür will ich achtzig Prozent der Einnahmen.«
»Achtzig Prozent?« Koziol tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. »Und dafür soll Fritz seinen Kopf hinhalten und sich die Nase breitschlagen lassen?«
»He, he«, begehrte nun Ludger Schnurr, selbst ein ehemaliger Boxer, auf. »Rede nicht so respektlos mit dem Chef, sonst wird’s dir noch leidtun.«
»Wer bist du denn?« Koziol machte einen Schritt auf Schnurr zu.
»Na, na, wir wollen doch nicht unhöflich werden, nicht wahr?«, ging Constantin dazwischen. »Die kleinen Machtspielchen können wir uns sparen.« Er stellte sich so hin, dass Koziol der Blick auf Schnurr verwehrt war. »Im Grunde hat mein Mitarbeiter recht, Herr Koziol, und das wissen Sie auch.«
»Ich kann den Jungs da drüben Bescheid sagen«, drohte Koziol an. »Dann werden wir ja sehen, wer hier recht hat.«
»Nein, das werden wir nicht. Denn das wäre doch wohl sehr kurzfristig gedacht, nicht wahr? Ihre Männer prügeln auf meine Männer ein, wir gehen, holen den Rest unserer Leute und nehmen uns jeden einzelnen Ihrer Jungs, wie Sie sie nennen, vor. Glauben Sie mir, da bleibt kein einziger Knochen heil, und dann ist es vorbei mit dem Boxen.« Constantin klopfte ihm mit einer vermeintlich freundschaftlichen Geste auf den Oberarm. »Und das wollen wir doch alle nicht, oder?«
»Sie reden nicht lange um den heißen Brei herum.« Manfred Koziol spuckte auf den Boden. »Der Ruf, der Ihnen vorauseilt, scheint zu stimmen.«
»Sehr gut«, befand Constantin. »Dann wäre das geklärt.«
»Was ist hier los?« Fritz Langkamp lehnte sich auf die Seile des Boxrings und sah zu ihnen herunter.
»Mein Name ist Constantin von Plesow. Ich denke, wir werden künftig zusammenarbeiten.«
»Ach ja?« Langkamp warf seinem Trainer einen fragenden Blick zu.
»Ja«, stellte Constantin fest. »Ich habe vor, Ihnen die Chance zu bieten, vor großem Publikum gegen richtige Boxer zu kämpfen.« Er nickte mit dem Kopf in Richtung des soeben zu Boden gegangenen Sportlers. »Was halten Sie davon?«
»Das klingt erst einmal verdammt gut.« Wieder suchte Langkamp den Blick seines Trainers, dessen Miene jedoch nur schwer zu entnehmen war, wie er darüber dachte.
»Was halten Sie davon, heute Abend ins Varieté Astor zu kommen? Wir können etwas zusammen trinken und über die Details sprechen.«
»War schon ein paarmal da«, erklärte Langkamp. »Ganz schön gepfefferte Preise.«
»Betrachten Sie sich als meinen Gast.« Constantin suchte Koziols Blick. »Werden Sie Ihren Schützling begleiten, oder wollen wir beide uns ein andermal weiter unterhalten?«
»Er will achtzig Prozent deiner Einnahmen«, sagte Koziol zu Langkamp, ohne auf Constantins Frage einzugehen.
»Achtzig Prozent?«, wiederholte der Boxer ungläubig.
»Richtig«, erklärte Constantin. »Damit bleiben Ihnen zwanzig Prozent einer gewaltigen Summe, während Sie jetzt hundert Prozent von gar nichts haben und in diesem Drecksloch hier trainieren müssen.«
Langkamp wiegte den Kopf. »So betrachtet klingt es doch ganz gut, Trainer.«
Koziol war anzusehen, dass er widersprechen wollte, doch als er Constantins Blick begegnete, schluckte er die Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, hinunter. »Wir können ja mal darüber reden«, lenkte er ein.
»Gut.« Constantin streckte Koziol die Hand entgegen. »Ich erwarte Sie beide heute Abend im Varieté.« Koziol ergriff die ihm gebotene rechte. »Bis heute Abend.«
Constantin setzte ein zufriedenes Lächeln auf, verabschiedete sich und bedeutete dann seinen vier Begleitern, mit ihm die Sporthalle zu verlassen. Als sie an den anderen Sportlern vorbeigingen, die einen Großteil des Gesprächs verfolgt hatten, sprach einer von ihnen Constantin an. »He, von Plesow. Sind wir anderen auch eingeladen?«
»Wenn ihr boxen könnt und die Leute dafür bezahlen, euch zuzugucken, warum nicht?«
»Herbert. Halt deinen Mund und trainiere lieber!«, schnauzte Koziol.
»Man wird doch mal fragen dürfen«, maulte dieser, wandte sich aber ohne ein weiteres Wort ab.
»Ganz schöne Schisser dafür, dass sie sich selbst als Boxer bezeichnen«, urteilte Ludger Schnurr, als sie ins Freie traten.
Gerd Nolte warf Constantin einen kurzen Blick zu, sagte aber nichts. Er war überrascht, wie deutlich sein Chef im Hinblick auf die ausgesprochenen Drohungen geworden war. Vor allem weil ein halbes Dutzend Zeugen das Gespräch mitbekommen hatten. Normalerweise ging er wesentlich subtiler vor. Constantin hatte sich verändert, und zwar schon vor einer ganzen Weile. Vermutlich hatte das etwas mit dem Tod seines Bruders Alexander zu tun. Keiner aus Constantins Familie wusste, wie dieser wirklich ums Leben gekommen war. Constantin hatte alle glauben gemacht, dass Alexander bei ihm zu Besuch gewesen und dort aus Unachtsamkeit eine Treppe hinuntergestürzt war. In Wahrheit jedoch war Alexander aus Rache an Constantin ermordet worden, und Nolte hatte schon damals bezweifelt, dass Constantin die Sache auf sich beruhen lassen würde. Nein, dafür war er nicht der Mensch. Der Besuch in der Boxhalle heute bestätigte Noltes Verdacht, wusste er doch, dass Schnidtke, der Anführer des Ringvereins in Frankfurt und Auftraggeber des Mordes an Alexander, seine Finger ebenfalls im Boxgeschäft hatte. Bisher hatte Constantin die Geschäfte des Ringvereins in Berlin, dessen erster Mann er war, ausschließlich auf Schutzgeld und Drogen gestützt. Die Einnahmen, die zusätzlich durch das Hotel und auch das Varieté in die Kassen gespült wurden, waren nicht ohne, wenngleich nicht ansatzweise so hoch wie die aus den illegalen Geschäften.
Zwar war tatsächlich zu beobachten, dass das Interesse der Menschen an Boxkämpfen gestiegen war, doch auch Autorennen und alle möglichen Formen von Wetten wurden bei der Bevölkerung immer beliebter. Aber daran schien Constantin kein Interesse zu haben. Gerd konnte nur hoffen, dass sein Chef sich nicht zu irgendwelchen unüberlegten Handlungen hinreißen ließ und dass sein Interesse am Boxen ausschließlich dem Geschäft galt. Zwar hielt er Constantin für keinen sonderlich emotionalen Menschen, aber der Tod seines Bruders Alexander war ihm nahegegangen. Viel mehr, als er es sich nach außen hin anmerken ließ. Vor allem aber glaubte Nolte, dass Constantin die Last, für den Tod seines Bruders verantwortlich zu sein, fast erdrückte. Und das verstand er nur zu gut. Er hatte selbst einen Bruder gehabt. Erich war ein Nachzügler gewesen, fünfzehn Jahre jünger als er, und bereits in den ersten Kriegstagen gefallen. Gerd hatte erst fast ein Jahr später davon erfahren. Er erinnerte sich noch ganz genau, wie er vor dem Einschlafen an Erich gedacht und sich gefragt hatte, ob es ihm wohl gut ging und wie er sich hielt. Dabei war er zu jenem Zeitpunkt schon gar nicht mehr am Leben gewesen. Hätte er es nicht irgendwie spüren müssen? Immerhin floss das gleiche Blut durch ihre Adern. Lag es daran, dass er sich schuldig am Tod seines kleinen Bruders fühlte? Oder hatte er einfach nur ein schlechtes Gewissen, weil er selbst überlebt hatte und Erich nicht? Erich, der Jüngere, der Begabtere von beiden. Die Eltern hatten große Hoffnung in ihn gesetzt, viel größere als in Gerd. Und sie hatten recht behalten. Was war denn schon aus ihm geworden? Er, der gelernte Buchhalter, der zu Beginn des Krieges bereits achtunddreißig Jahre alt gewesen war und bis dahin ein Leben in geradezu langweiliger Beschaulichkeit geführt hatte. Wäre der Krieg nicht dazwischengekommen, würde er vermutlich noch immer in der Steuerkanzlei, in der er gearbeitet hatte, die Belege zusammentragen. Und vermutlich wäre er glücklich damit. Doch der Krieg hatte ihn, wie wohl auch jeden anderen im Land, verändert. Er dachte daran, wie er das erste Mal einen Menschen getötet hatte – einen jungen Soldaten, vermutlich nicht älter als Erich damals. Gerd erinnerte sich noch genau an den Moment, als die Kugel direkt in dessen Stirn einschlug. Er schrie nicht und gab auch sonst keinen Laut von sich. Sein Gesichtsausdruck ließ keinen Schmerz vermuten. Er wirkte einfach nur überrascht, ja erschrocken. Und so blieb er liegen, mit einem Loch im Kopf, weit geöffneten Augen und aufgeklapptem Mund – fast so, als wollte er im nächsten Moment noch etwas sagen. Er war ein junger Mann wie Erich oder Dutzende andere, die er kannte. Nur eben für die andere Seite. Der Feind. Ein Feind oder einfach nur ein Mann, der genau wie er in eine Schlacht geführt worden war, deren Sinn er im Grunde nicht einmal verstand. Und nun mussten seine Eltern um ihn trauern, vielleicht auch Geschwister oder eine Liebste, die ein Leben mit ihm hatte verbringen wollen. Oder Kinder? Hatte er einem jungen Vater das Leben genommen? Gerd wusste es nicht. Er wusste nicht, wie der Mann geheißen hatte, er und all die anderen, deren Leben er beendet hatte. Genau wie der Soldat, der Erich erschossen hatte, nicht wissen konnte, dass er einen jungen Architekten getötet hatte, dessen Traum es gewesen war, nach Amerika zu gehen und dort die höchsten Wolkenkratzer der Welt zu bauen. Einen Mann voller Träume und Visionen. Was für eine Verschwendung! Niemand würde nun die Gebäude bauen, die Erich vor seinem inneren Auge gesehen hatte. Und mehr noch: Wie viele Männer waren auf der einen wie der anderen Seite gestorben – bedeutende Künstler, Erfinder und Vordenker oder solche, die es noch geworden wären? Wie viele Musikstücke würden nun der Menschheit verwehrt bleiben, wie viele Skulpturen oder Gemälde niemals gefertigt werden? Was, wenn genau der Mensch, der zur Lösung eines entscheidenden Problems der Zukunft hätte beitragen können, durch eine Gewehrkugel niedergestreckt worden war? Wofür? All diese Gedanken, mit denen Gerd sich während des Krieges und auch danach quälte, hatten ihn zu einem anderen Menschen werden lassen. Der Buchhalter Gerd Nolte mit seinen Werten und moralischen Vorstellungen war im Krieg gestorben. Und das bisschen Leben, das dieser elende Krieg als halbverdauten Rest wieder ausgespuckt hatte, war nicht mehr das gleiche wie zuvor. Es mochte verwerflich sein und gewiss gegen das Gesetz, was er heute tat und zu welchen Mitteln er griff, um das durchzusetzen, was bei seiner Tätigkeit für Constantin notwendig war und was von ihm erwartet wurde. Doch Gerd hatte keinerlei Bedenken oder gar Gewissensbisse. Zu viel war inzwischen geschehen, und seine Eltern und seine Frau waren längst tot. Sein Interesse galt nun ausschließlich dem Schutz Constantins und der Organisation, denn das war die einzige Familie, die er noch hatte.
Sie erreichten das Hotel Astor, und während Schnurr, Köhler und Denker sich verabschiedeten, um im nebenan gelegenen Varieté ihrer Arbeit nachzugehen, betraten Constantin und Gerd zusammen das Hotel.
»Kann ich dich kurz sprechen?«, wandte sich Gerd an seinen Chef.
Constantin sah ihn an. »Sicher. Komm mit nach oben. Ich wollte noch eben bei Marie vorbeischauen und mich erkundigen, ob irgendetwas Besonderes vorgefallen ist. Doch das kann warten.«
»Danke.«
Zusammen gingen sie in Richtung Lift. Der Rezeptionist grüßte überschwänglich, was Constantin mit einem Kopfnicken quittierte. Dann betraten sie den Aufzug und ließen sich vom Liftboy in die zweite Etage fahren.
Sie sprachen kein Wort, erst im Büro brach Constantin das Schweigen.
»Also, Gerd, wo drückt der Schuh?«
»Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile«, begann Nolte.
»Allerdings. Und du willst mir hoffentlich nicht sagen, dass du die Nase voll hast und vorhast, dich aus dem Staub zu machen.«
Gerd schüttelte den Kopf. »Nein, keine Sorge. Das ist es nicht.«
»Was ist es dann?« Constantin beugte sich vor. »Hast du Schwierigkeiten? Keine Sorge, das kriegen wir hin. Egal, was es ist.«
Nolte hob abwehrend die Hände. »Nichts dergleichen. Trotzdem danke.« Er setzte sich gerade hin. »Wir konnten doch immer ganz offen sein, nicht wahr?«
»Sicher.«
»Gut. Denn ich möchte nicht, dass du mich falsch verstehst.«
»Gerd, rede nicht um den heißen Brei herum. Raus mit der Sprache!«
Nolte räusperte sich. »Warum willst du ins Boxgeschäft einsteigen?«
Constantin lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück. »Das weißt du ganz genau, Gerd.« Er musterte seine rechte Hand einen Moment lang, dann fügte er hinzu: »Falls du glaubst, ich würde dir weismachen, dass man damit eine Menge Geld verdienen kann, irrst du. Das ist die Version für die anderen.« Er beugte sich wieder vor. »Ich werde nach und nach immer mehr Kämpfe veranstalten und nebenher ordentlich Kohle scheffeln, doch am Ende geht es mir darum, diesen Arnold Schnidtke aus der Reserve zu locken. Einer seiner Frankfurter Boxer wird gegen einen von unseren Leuten kämpfen, und dann ist er fällig.« Er verzog grimmig die Miene und ballte die Hand zur Faust.
Nolte atmete geräuschvoll aus. »Genau das hatte ich befürchtet.«
»Du kennst mich gut, Gerd. Vermutlich besser als jeder andere. Und genau aus diesem Grund mache ich dir auch nichts vor. Ich habe jetzt fast acht Monate die Füße still gehalten, um innerhalb des Rings keinen Staub aufzuwirbeln. Doch die Sache auf sich beruhen zu lassen ist für mich keine Option. Ich werde mir diesen Kerl vorknöpfen. Nicht unsere Leute, nein, ich nehme ihn mir vor. Ich allein. Und wenn ich mit ihm fertig bin, wird nicht mehr viel übrig sein, was sie mit zurück nach Frankfurt nehmen können.«
Gerd überlegte kurz, dann nickte er. »Ich dachte mir, dass es darum geht und nicht um die Einnahmen aus den Wetten oder dem Kampf selbst.«
»Und nun willst du es mir ausreden?« Constantin sah ihn herausfordernd an.
»Nein.« Nolte schüttelte den Kopf. »Das wäre sinnlos. Sag mir lieber, wie ich dich unterstützen kann und auf was ich achten soll.«
»Genau deshalb schätze ich dich so«, stellte Constantin fest. »Du hast einen sehr realistischen Blick auf die Dinge, und ich weiß, dass ich mich zu hundert Prozent auf dich verlassen kann.«
»Das kannst du«, bekräftigte Gerd.
Constantin streckte den Arm aus und klopfte seiner rechten Hand auf die Schulter. »Ich denke, wir sollten es langsam angehen lassen. Dieser Langkamp ist nicht schlecht und hat das Potenzial, Leute zu ziehen. Wir werden ihn ein bisschen aufbauen.«
»Und was kann ich konkret machen?«
»Deine Aufgabe wird es sein, weitere Boxer anzuwerben. Wir müssen mehr als nur einen Langkamp haben, wenn wir uns für die Frankfurter interessant machen wollen.«
»Du willst das also richtig groß aufziehen, ja?«
»Mit stetiger Steigerung, ganz genau. Fünf oder sechs vorzeigbare Boxer müssten genügen. Hör dich ein bisschen um.«
»In Ordnung. Was sonst noch?«
»Wir brauchen einen Ort, an dem die Männer vernünftig trainieren können.«
»Vielleicht in einer der Lagerhallen am Westhafen«, schlug Nolte vor.
»Gute Idee. Kümmere dich darum und besorg alles, was die Jungs zum Trainieren brauchen. Sie sollen glauben, dass wir wirklich etwas für sie aufbauen. Dann kommen auch die guten Boxer von ganz allein.«
»Wird erledigt.« Nolte stand auf. »Eines noch. Was wird aus der Boxhalle und allem anderen, wenn du mit Schnidtke fertig bist?«
Constantin zuckte die Schultern. »Ist mir gleich. Von mir aus kannst du eine Fackel reinwerfen und alles niederbrennen. Ich will nur Schnidtke. Und den werde ich auch kriegen.«
Es war gegen halb zehn am Abend, als Constantin sein Büro im Varieté verließ und sich oben ans Geländer stellte, um von dort aus das Treiben in seinem Lokal zu beobachten. Sein Blick fiel auf einen Stammgast, der schon um diese Zeit so betrunken zu sein schien, dass ihm das Bier seitlich aus dem Mundwinkel lief und einen dunklen Fleck auf seinem hellen Hemd hinterließ – für Constantin unvorstellbar. Sich derart gehenzulassen hatte in seinen Augen nicht das Geringste mit Genuss, sondern ausschließlich mit Kontrollverlust zu tun, und wenn er diesen Kerl so betrachtete, empfand er nichts als Abscheu.
Sein Blick fiel auf die Tür. Der dunkle Vorhang, der als Windfang diente, wurde beiseitegeschoben, und Fritz Langkamp und sein Boxfreund, dessen Namen Constantin nicht kannte, traten ein. Koziol war nicht dabei. Doch damit hatte Constantin auch gar nicht gerechnet. Dieser Dummkopf von einem Trainer überschätzte seinen Einfluss auf Langkamp erheblich. Constantin lächelte. Er wusste, dass er Langkamp ohne Koziol noch um einiges schneller auf seine Seite ziehen und dazu bringen würde, genau das zu tun, was er wollte. So wie alle stets das taten, was Constantin von ihnen verlangte.
Er stieß sich vom Geländer ab und stieg die Stufen hinab. Unten heizten Fredy und seine Jungs dem feierlustigen Publikum mit lauten, schnellen Dixie-Klängen ein. Constantin hob kurz die Hand, was Fredy mit einer Bewegung seiner Trompete erwiderte, dann ging der Varietébetreiber zu Langkamp und dessen Begleiter hinüber, die hinter dem Vorhang stehen geblieben waren und sich offenbar einen Überblick zu verschaffen versuchten.
Constantin streckte erst Langkamp, dann dessen Boxkumpan die Hand entgegen. »Willkommen im Astor. Constantin von Plesow«, stellte er sich Langkamps Begleiter vor.
»Peter Schiller«, antwortete dieser und schüttelte die ihm gereichte Rechte.
»Kommen Sie!«, bot Constantin an und führte die beiden hinüber zum Tresen.
»Whisky?«
Langkamp schüttelte den Kopf. »Für mich lieber ein Bier.«
»Ebenso«, stimmte Schiller zu.
»Eduard«, sprach Constantin seinen Mann hinter dem Tresen an, »zwei Bier und einen Whisky.«
»Kommt sofort, Chef.«
»Die Herren hier sind meine persönlichen Gäste.«
»Geht klar, Chef.«
Köhler reichte ihnen die Getränke, und Constantin stieß mit den beiden an. »Auf unsere Zusammenarbeit, würde ich sagen.«
»Ganz so weit sind wir noch nicht«, bremste Langkamp vorsichtig.
»Stimmt. Denn bisher habe ich noch keinen von Ihnen beiden kämpfen sehen. Ich weiß also gar nicht, ob sich eine Investition für mich überhaupt lohnt.«
»Haben Sie nachher noch Zeit?«, fragte Schiller.
»Halt die Klappe, Peter«, fuhr Langkamp seinen Freund an.
Constantin sah von einem zum anderen. »Es gibt also nachher noch einen Kampf?«
Langkamp schüttelte den Kopf. »Ist nur ’n Spaß. Keine große Sache.«
»Und wo?«, fragte Constantin.
Schiller sah schuldbewusst zu seinem Freund. Er wusste, dass es ein Fehler gewesen war, so leichtfertig darüber zu sprechen. »Fritz hat recht. Es ist eigentlich nichts.«
Constantin legte den beiden die Arme um die Schultern. »Wir sind doch hier unter Freunden«, stellte er jovial fest. »Da sollten illegale Wetten kein Thema sein. Also?«
»Wir verdienen uns bloß ein bisschen Geld dazu, mehr nicht«, räumte Schiller zögerlich ein. Ist echt keine große Sache.«
»Und wer tritt gegen wen an?«
Langkamp zuckte mit den Schultern. »Wolfgang Schenker organisiert das Ganze. Er bringt unsere Gegner mit.«
»Wolfi?« Constantin lachte spöttisch auf. »Mit so einem lasst ihr euch ein?« Fast unmerklich war er zum vertrauten Du übergegangen. »Der hat nun wirklich seine besten Zeiten hinter sich.«
»Das wissen wir«, pflichtete Schiller ihm bei. »Doch es ist leicht verdientes Geld.«
Constantin schmunzelte gönnerhaft. »Ich werde kommen und mir die Sache mal ansehen. Und dann reden wir darüber, wie eure Zukunft aussehen kann.«
Langkamp und Schiller tauschten einen Blick. »Um Mitternacht am Hafen, in der alten Fischfabrik.«
»Da gibt es einen Boxring?«
»Keinen Ring. Nur Boxen.«
»Gut. Dann haltet euch einigermaßen nüchtern. Nicht dass ich am Ende in die Männer investieren will, die Wolfi mitbringt.«
Es war kurz vor Mitternacht, als Constantin von Plesow in Begleitung von Gerd Nolte, Ludger Schnurr und Klaus Denker die alte Fischfabrik betrat, vor der etliche Autos parkten und die zu den wenigen Gebäuden am Hafen gehörte, die jetzt noch beleuchtet waren. Sollte es eine Razzia geben, würde die Polizei schnell fündig werden.