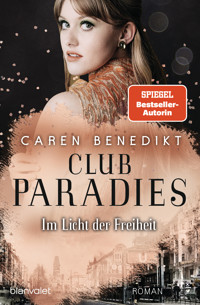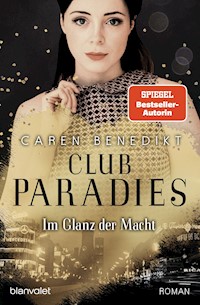9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Deutschland im Jahre 1349. Endlich bietet sich der sechzehnjährigen Anna die Gelegenheit zur Flucht vor ihrem gewalttätigen Vater. Sie macht sich auf den Weg nach Bremen, in die Heimatstadt ihrer verstorbenen Mutter, begleitet von dem jungen Gawin. Hier kommt Anna bei einer Seifensiederin unter. Sie wird Schneiderin und lässt sich etwas ganz Besonderes einfallen: In die Säume der Kleider näht sie Seife ein und erzeugt so wundervolle Düfte. Bald finden ihre außergewöhnlichen Kreationen Anklang bei den hochstehenden Damen der Stadt. Die zwischen Anna und Gawin aufkeimende Liebe muss zunächst geheim bleiben – schließlich haben sie sich als Geschwister ausgegeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 747
Ähnliche
Caren Benedikt
Die Duftnäherin
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Deutschland im Jahre 1349. Endlich bietet sich der sechzehnjährigen Anna die Gelegenheit zur Flucht vor ihrem gewalttätigen Vater. Sie macht sich auf den Weg nach Bremen, in die Heimatstadt ihrer verstorbenen Mutter, begleitet von dem jungen Gawin. Hier kommt Anna bei einer Seifensiederin unter. Sie wird Schneiderin und lässt sich etwas ganz Besonderes einfallen: In die Säume der Kleider näht sie Seife ein und erzeugt so wundervolle Düfte. Bald finden ihre außergewöhnlichen Kreationen Anklang bei den hochstehenden Damen der Stadt. Die zwischen Anna und Gawin aufkeimende Liebe muss zunächst geheim bleiben – schließlich haben sie sich als Geschwister ausgegeben.
Inhaltsübersicht
Für meine Rasselbande
Mit euch geht alles,
ohne euch nichts
Mit ihren sechs Jahren konnte sie nicht verstehen, was vor sich ging. Alles hatte sich draußen abgespielt, lediglich die dumpfen Geräusche waren ins Innere der kleinen Kate gedrungen. Bis zur Nasenspitze hatte sie sich die Decke hochgezogen, wie sie es immer tat, wenn Vater und Mutter sich stritten. Doch diesmal war es anders. Der Vater war allein in die Hütte zurückgekehrt, und sosehr sie auch mit fest aufeinandergepressten Augenlidern gewartet hatte, die Mutter war ihm nicht gefolgt. Erst als die Sonne schon durch die Ritzen der hölzernen Fensterläden gedrungen war, war der Schlaf über sie gekommen.
Weder am nächsten noch am übernächsten Tag kehrte die Mutter heim. Anna hatte Mühe, ganz allein mit ihren kleinen Händen das Essen zuzubereiten und Ordnung zu schaffen, um nicht den Zorn ihres Vaters zu spüren zu bekommen.
Am dritten Tage war dann Gerhild, die Wirtin der Schänke, gekommen, hatte sie an die Hand genommen und zu einem Platz hinter der Kirche geführt, an dem viele Menschen aus der Nachbarschaft versammelt waren. Auch ihr Vater war dort. Er stand an einem Erdhügel, der neben einem Loch aufgeschüttet worden war. Anna beugte sich vor, um erkennen zu können, was sich in dem Erdloch befand. Sie sah ein weißes Tuch, das etwas verhüllte.
Pater Anselm sprach ein paar Worte, die sie nicht verstand, kam herüber und strich ihr über das Haar. Dann wurde die Erde in das Loch gefüllt, und Gerhild führte sie fort.
Sie beschloss, der Mutter von dem eigenartigen Geschehen zu berichten, sobald diese nach Hause kommen würde, und sie zu fragen, was dies alles zu bedeuten hatte.
Sie war noch zu klein, um zu ahnen, dass sie ihr die Frage niemals würde stellen können.
1. Kapitel
Lünen im Jahr 1349
Nur drei Tage. Mehr Zeit blieb ihr nicht, um so weit wie möglich fortzukommen. Eilig stopfte Anna ihre Habseligkeiten in das Tuch, das sie mit einem groben Knoten zum Bündel geschnürt hatte. Als sie das Seidenkleid ganz unten aus der Truhe zog, stockte sie und drückte es an sich. Tief atmete sie den Duft ein. Das Gewand war das Einzige, was ihr von der Mutter geblieben war, und all die Jahre über hatte sie es gehütet wie einen wertvollen Schatz.
Ihr gesamtes Vermögen bestand aus den Münzen, die sie mühsam Tag für Tag in einem kleinen Säckchen inmitten ihres Strohlagers versteckt hatte. Welch unbeschreibliche Angst hatte sie jedes Mal ausgestanden, wenn sie aus der Schänke oder vom Markt heimkam und die Einnahmen bei ihrem Vater ablieferte. Ganz vorsichtig, damit kein Verdacht aufkam, behielt sie nie mehr als nur einen Silberpfennig für sich. Wäre sie von ihrem Vater dabei ertappt worden, er hätte sie totgeprügelt. Doch meist war er zu betrunken, um ihr auf die Schliche zu kommen. Zufrieden spürte sie nun das Gewicht der Geldkatze um ihren Hals. In den letzten Jahren hatte sich genug angesammelt, dass sie fortlaufen und anderswo ein neues Leben beginnen könnte. Wie hatte sie diesen Tag herbeigesehnt! Doch nun, da er gekommen war, verspürte sie die Erleichterung nicht, die sie sich so sehr erhofft hatte.
Anna schämte sich nicht des befreienden Gefühls, das sie empfunden hatte, als die Büttel ihren Vater abführten. Solange sie ihn wegsperrten, war sie in Sicherheit, wenngleich diese nicht lange anhalten würde. Dass der Schultheiß durchgreifen würde, hatte sich abgezeichnet. Zu vielen Menschen war Helme das Geld schuldig geblieben. Nur ihm selbst war es in seinem Dunstkreis von Bier und Schnaps entgangen. Nun war die Gelegenheit für ihre Flucht gekommen. Anna rechnete damit, einen guten Vorsprung herausholen und ihre Spuren verwischen zu können. Drei Tage, mehr Zeit bliebe ihr nicht. Zum Glück hatten sie Helme so überraschend mitgenommen, dass Anna dem Schicksal entgangen war, einem Kumpan ihres Vaters zu Willen sein zu müssen, um so einen Teil seiner Schulden zu begleichen. Helme hatte nur gelacht, als Anna ihn unter Tränen anflehte, ihr diese Schmach zu ersparen, sie gepackt und in das Kellerloch sperren wollen, gerade in dem Moment, als der Schultheiß mit einem Helfer die Kate betrat und ihn mitnahm.
Der letzte Blick, den sie ihm zuwarf, bevor er ins Freie gezerrt wurde, ließ all den Hass und die Verachtung erkennen, die sich seit dem Tod ihrer Mutter vor bald zehn Jahren in ihr angesammelt hatten. Sein wütendes Gebrüll verriet Anna, dass er den Ausdruck in ihren Augen sehr wohl hatte lesen können.
Jetzt raffte sie ihre wenigen Habseligkeiten, schnürte mit dem zerschlissenen Tuch, das sie über ihr Lager gespannt hatte, ein Bündel und verließ das Haus. Bevor sie die Tür hinter sich schloss, blickte sie sich ein letztes Mal um. Nie wieder würde sie zurückkehren. Wenn sie es schaffte, ohne Spuren zu hinterlassen, zu verschwinden, läge ein neues Leben vor ihr. Finge er sie jedoch wieder ein, bliebe ihr nichts, als sich den kleinen geschnitzten Holzdolch, den sie sich unter den Röcken fest ans Bein geschnürt hatte, ins Herz zu rammen. Sie war bereit dazu. Weder Schmerz noch Tod würden ihr die gleichen Qualen bereiten, die sie empfand, würde sie weiter mit ihm leben müssen. Leise zog sie die Tür ins Schloss, atmete geräuschvoll aus und trat auf den Weg. Bis Dortmund, die nächstgelegene Stadt, bräuchte sie nicht mehr als den Nachmittag. Hier würde er sie als Erstes suchen. Bis nach Münster, in die andere Richtung, verginge dagegen ein ganzer Tag. Doch Anna wollte weder in den einen noch in den anderen Ort. Zielsicher setzte sie ihren Weg fort. Sie hörte schnelle Schritte hinter sich, drehte sich jedoch nicht um. Ihr Atem ging rasch und flach, sie ballte die Hände zu Fäusten.
»Wo willst du hin?«
Erleichtert atmete sie aus, als sie die Stimme erkannte und stehen blieb.
»Wo willst du hin?«, wiederholte Jakob. Der Achtjährige lebte in der Kate seiner Tante, nur einen Steinwurf von Annas Heim entfernt.
»Ich gehe fort.«
»Weshalb?«
Anna schwieg.
»Kommst du wieder?«
Ruhig schüttelte sie den Kopf.
»Und wohin willst du?«
Anna schaute sich um, konnte jedoch niemand entdecken, der ihr Gespräch belauschen konnte.
»Du darfst es aber niemandem sagen, hörst du?«
Jakob nickte eifrig.
»Vor allem nicht meinem Vater. Hast du verstanden? Er wird dir Geld geben, damit du mich verrätst. Doch du darfst es nicht tun!«
»Versprochen.«
»Ich will versuchen, mich nach Köln durchzuschlagen.«
»Köln?«
»Sei ruhig!«, zischte sie. »Man könnte dich hören.«
»Aber das ist furchtbar weit«, flüsterte Jakob.
»Ich weiß. Aber ich muss es einfach schaffen.«
»Ich werde dich nicht verraten.«
Sie beugte sich zu ihm hinab, drückte ihn kurz an sich und ging dann bis zur Weggabelung, wo sie die Straße Richtung Süden einschlug. Jakob sah ihr nach, bis sie aus seinem Blickfeld verschwunden war. Er brauchte nicht lange, um einen Entschluss zu fassen. Annas Vater hatte seine Schulden nicht bezahlen können und war nun im Keller des Pfarrers eingesperrt. Es war nicht das erste Mal, und Jakob wusste, dass Helme noch immer irgendeine Möglichkeit gefunden hatte, um Geld aufzutreiben. Woher, das wusste er nicht. Doch dass ihm die Nachricht von Annas Flucht etwas wert sein würde, dessen war sich Jakob sicher. Also schlenderte er hinüber zum Pfarrhaus, setzte sich auf einen der großen Findlinge davor und wartete. Irgendwann würde Helme wieder auf freien Fuß gesetzt werden, und dann wäre Jakob zur Stelle. Er zog sein Messer hervor und setzte seine Schnitzerei an der Flöte fort, die er am nächsten Markttag verkaufen wollte. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Wie dumm Anna doch war, wenn sie glaubte, ihm vertrauen zu können. Er selbst würde einen solchen Fehler niemals begehen.
Kaum dass Anna hinter der Biegung verschwunden war, blickte sie sich um. Jakob hatte ihr die Geschichte abgekauft und wartete wahrscheinlich nur darauf, ihrem Vater einige Pfennige abzuschwatzen, indem er ihm verriet, dass sie sich in Richtung Köln davongemacht hatte. Eilig legte sie den Weg bis zu dem kleinen Waldstück zurück, wo sie im Schutze der Bäume die Richtung änderte und ihren eigentlichen Weg nach Bremen einschlug.
2. Kapitel
Sein Körper fühlte sich taub an. Gawin kauerte am Waldboden und beobachtete jede noch so kleine Bewegung seines Opfers. Die Angst, dass ihm seine Beine im richtigen Moment nicht gehorchen würden, ließ ihm den Angstschweiß im Nacken zusammenlaufen. Vorsichtig prüfte er seine Glieder. Zu lange schon hatte er dort gehockt und das Kaninchen nicht aus den Augen gelassen. Fest umklammerte er den massiven Stock, mit dem er zustechen würde. Langsam stemmte er sich vom Boden hoch. Das Kaninchen blieb ungerührt sitzen. Wenn es jetzt aufschrecken und davonlaufen würde, müsste er verhungern. Schon seit Tagen hatte er nur noch Blätter gekaut. Davor war es ein Apfel gewesen, den er einer der Marktfrauen gestohlen und sofort verschlungen hatte. Die Prügel, die er dafür bezog, waren fürchterlich gewesen. Noch immer spürte er die Wunden, die das Knotenseil, mit dem der Marktaufseher zuschlug, auf seinem Rücken hinterlassen hatte. Doch immerhin war er an diesem Tag nicht vor Hunger eingegangen. Ob ihm das heute wieder gelingen würde, wusste er nicht. Vorsichtig pirschte er sich heran, das Kaninchen blickte auf. Gawin erstarrte. Einen Moment lang schien das Tier ihn anzusehen. Er fühlte sich ertappt, rührte sich nicht und wartete, bis es wieder zu Boden sah. Jetzt war der Moment gekommen. Er fasste den Stab so fest, dass seine Fingerknöchel weiß unter der Haut hervortraten. Dann machte er einen Sprung, holte mit dem Stock aus und stieß ihn seiner Beute in den Leib. Gawin keuchte, starrte auf den Kaninchenkörper und wartete. Kein Fortspringen, keine Bewegung. Das Kaninchen war tot. Seine ganze Anspannung entlud sich in einem einzigen, gellenden Siegesschrei. Eine Welle der Befriedigung ging durch seinen Körper. Mit einem Ruck zog er den Stock aus dem Leib, hob das tote Geschöpf vom Boden auf und betrachtete es von allen Seiten. Er würde nicht verhungern. Weder heute noch in den nächsten Wochen.
Anna beobachtete den Fremden mit wechselnden Gefühlen. Er schien nicht älter als zwölf oder dreizehn Jahre zu sein und besaß einen hageren, ausgemergelten Körper. Seine Bekleidung bestand ausschließlich aus Lumpen, die vor Dreck standen. Die Arme waren so dünn, als würden sie jeden Moment zerbrechen. Überhaupt wirkte sein gesamter Körper, als hätte er überhaupt kein Fleisch mehr auf den Knochen, sondern als wären diese nur noch von Haut umspannt. Nie zuvor hatte sie solch einen klapperdürren Menschen gesehen, und der Anblick ließ sie erschaudern. Bei dem Schrei, den der Junge nach dem Erlegen seiner Beute ausgestoßen hatte, war sie zusammengefahren. Still verbarg sie sich hinter den Bäumen, während ihr Herz heftig pochte. Zwar konnte ihr dieser kleine Kerl nicht gefährlich werden, doch die Art, in der er das Kaninchen erlegt hatte, ließ an seiner Entschlossenheit keinen Zweifel aufkommen. Sie hatte viel Geld bei sich, und wenn ihr dieses Kind auch körperlich unterlegen sein mochte, konnte es dennoch schnell genug sein, um ihr die Geldkatze zu entreißen und im Dickicht zu entkommen. Also wartete sie, bis der Junge seine Habseligkeiten zusammengetragen hatte und sich weiter durch den Wald schlug, um dann in sicherer Entfernung ihren eigenen Weg fortzusetzen.
Gawin war auf der Hut. Das Mädchen, das sich so tölpelhaft laut durch den Wald bewegt hatte und ihn nun beobachtete, musste irgendetwas im Schilde führen. Bestimmt würde es versuchen, ihm seinen Fang zu stehlen. Was sollte es auch sonst von ihm wollen? Dass er außer seiner Beute nichts besaß, sah man ihm schließlich deutlich an. Doch er konnte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen, das Kaninchen aufzuspießen und zu braten. Sein Hunger war einfach zu groß. Wenn die junge Frau ihm noch lange folgte, würde er wohl oder übel ein Stück aus dem Tier herausreißen und roh hinunterschlingen müssen. Seinen Verschlag aufzusuchen schien ihm zu riskant. Er sah sich um. Nicht weit von hier gab es eine einigermaßen geschützte Stelle, wo er ein Feuer machen und dabei die Umgebung im Auge behalten konnte. Wenn sie ihn dort überfallen wollte, würde er sie rechtzeitig kommen sehen, um sich das Kaninchen zu schnappen und damit verschwinden zu können.
Ein Geräusch ließ Anna zusammenfahren. Hastig drehte sie den Kopf und blickte sich um. Wurde sie verfolgt? Oder war es ein Tier, das sie jeden Moment angreifen würde? Schnell fuhr sie wieder herum und suchte nach dem Jungen, der sich weiter in nördlicher Richtung bewegte. Nur noch einen Moment, dann würde sie ihn aus den Augen verlieren. Wie von selbst setzten sich ihre Beine in Bewegung. Auch wenn sie nicht darauf hoffen durfte, würde er ihr womöglich beistehen, sollte sie in Not geraten. Und solange er ohnehin in die gleiche Richtung ging, in die auch sie wollte, konnte es nicht schaden ihm zu folgen. Er machte nicht den Eindruck, als ob er sich nur auf der Jagd befunden hätte und nun mit seinem Fang nach Hause zurückkehren würde. Mehrfach blieb er stehen und blickte sich nach allen Seiten um. Anna duckte sich, um nicht von ihm entdeckt zu werden. Nach einiger Zeit lichtete sich der Wald. Der Bursche schien sich hier auszukennen. Zielstrebig hielt er auf eine Fläche zu, die offenbar schon mehrfach als Feuerstelle benutzt worden war. Er sammelte einige Zweige und schichtete sie auf. Aus einem Tuch zog er etwas hervor, das Anna auf die Entfernung hin nicht erkennen konnte. Doch nachdem nur einen Augenblick später einige Funken aufsprühten, musste es wohl ein Feuerstein gewesen sein. Sorgfältig legte der Knabe noch mehrere dicke Äste auf das von ihm entzündete Reisig, trat einen Schritt zurück und betrachtete die Flammen, die sich gierig am Holz hinauffraßen. Er zog einen etwas kleineren Holzspeer hervor als den, mit dem er das Kaninchen erlegt hatte, und spießte ein Stück Fleisch auf. Anna stellte verwundert fest, dass er seine Beute irgendwann, nachdem er sie erlegt hatte, auch zerteilt haben musste, ohne dass sie es bemerkt hatte. Obwohl er das Fleisch erst wenige Augenblicke über den Flammen gedreht hatte, zupfte er etwas vom Rand ab und steckte es in den Mund. Sein Hunger musste unvorstellbar groß sein. Bei diesem Anblick begann auch Annas Magen, sich bemerkbar zu machen und laut zu knurren. Schnell duckte sie sich auf den Boden hinab, wartete einen Moment, ob der Knabe sie entdeckt haben könnte, und zog, als dieser nicht einmal in ihre Richtung sah, ein Stück Trockenfleisch aus ihrem Bündel hervor. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie seit ihrem Aufbruch vor zwei Tagen nur einmal etwas gegessen hatte. Zu schnell hatte sie vorankommen und zu dem Zeitpunkt, an dem ihr Vater freikam, schon möglichst weit weg sein wollen. Selbst wenn er sich zunächst in eine falsche Richtung wandte, würde ihm wahrscheinlich irgendwann aufgehen, dass sie ihm eine Falle gestellt und ihn in die Irre geführt hatte. Wohin er dann als Nächstes gehen würde, wusste nur Gott allein. Sie schreckte hoch. Der Knabe saß nicht mehr am Feuer. Oh, mein Gott! Sie war unaufmerksam gewesen und hatte nicht bemerkt, dass er sich davongemacht hatte. Einen Moment schlug ihr Herz schneller. Wo war er hin? Gerade wollte sie sich aufrichten, als sie plötzlich von hinten gepackt und hochgezogen wurde. Ihr Kopftuch wurde so heftig heruntergerissen, dass sich ihre hellblonden, langen Haare aus dem Knoten lösten.
»Na, was haben wir denn da für ein Täubchen?«
Anna wehrte sich gegen den harten Griff, konnte sich jedoch nicht aus der Umklammerung befreien. Der Alkoholgestank des grobschlächtigen Kerls erinnerte sie so stark an ihren Vater, dass ihr vor lauter Ekel und Angst ganz übel wurde.
»Was treibst du dich hier herum, hä?« Sein Gesicht war nun ganz nah vor ihrem. Sie wandte den Kopf ab, um dem Fäulnisgeruch, der seinem Mund bei jedem Wort schwallartig entströmte, auszuweichen.
»Na, willst du nicht antworten?« Er zog sie noch dichter an sich heran. »Alles hier im Wald gehört dem Grafen Bernhard zur Lippe, dem Herrn von Rheda. Und ich bin sein Meier. Also bestimme ich über den Wald, die Ländereien und alles, was sich dort befindet. Verstehst du?« Er umfasste ihre Taille und presste sein Gesicht an ihren Hals. »Alles hier ist meins«, keuchte er und leckte mit der Zunge über ihre Haut.
Anna versuchte, ihn von sich wegzuschieben. »Lasst mich!« Verzweifelt drückte sie ihre Hände gegen seine Gurgel, und es gelang ihr tatsächlich, ihn ein Stück von sich zu drücken. Worauf er nur noch fester zupackte, sie erneut an sich zog und mit seiner Hand ihre linke Brust umfasste. »Ja, so mag ich’s.« Brutal presste er seine Lippen auf die ihren, als er plötzlich mit einem verdutzten Gesichtsausdruck seine Umklammerung löste und einen Schritt nach hinten taumelte. Ein weiteres Mal sauste der dicke Ast auf seinen Hinterkopf, und der Meier schlug, ohne sich noch abfangen zu können, der Länge nach auf dem Waldboden auf.
Anna blickte den Jungen an, der mit erhobenem Arm dastand, bereit, nochmals zuzuschlagen. Erst als er sah, dass der Mann sich nicht mehr rührte, ließ er seinen Arm mit dem Ast langsam sinken.
»Du musst besser aufpassen. Eine Horde Reiter hätte sich lautloser durch den Wald bewegt als du«, murmelte er zerknirscht, beugte sich dann zu Annas Angreifer hinab und durchsuchte ihn. Er zog ein kleines Lederbündel aus dessen Wams hervor, prüfte den Inhalt und steckte das Säckchen ein.
»Wir sollten von hier verschwinden. Er wird noch ein Weilchen schlafen und mit einer gewaltigen Beule am Kopf wieder aufwachen. Dann will ich lieber nicht mehr hier sein.«
Benommen hob Anna ihr Bündel auf, zog das Kopftuch wieder über ihr Haar und folgte dem Jungen, der sich flink seinen Weg durch den Wald bahnte. Sie lief ihm eine ganze Weile nach, bis er schließlich abrupt stehen blieb. Er sah sich um, und auch Anna blickte in alle Richtungen, um zu sehen, ob ihnen jemand gefolgt sein könnte.
»Wir sind da. Komm!«
Der Wald war hier so dicht, dass man kaum noch die Hand vor Augen sehen konnte. Einen Moment glaubte sie sogar, den Jungen verloren zu haben. Doch als sie etwas weiterging, stieß sie mit der Hüfte gegen das Holzdach eines Verschlages, duckte sich und kroch auf allen vieren hinein. Drinnen war es stockdunkel. Tastend rutschte sie auf den Knien weiter. Der Geruch wurde modriger, der Boden sandiger.
»Wir sind gleich da«, hörte sie die Stimme des Jungen.
Sie hallte, und es klang, als sei er ein gutes Stück von ihr entfernt. Wie blind bewegte sie sich weiter voran, bis sie ein Geräusch hörte und im nächsten Moment einige Funken, gefolgt von einer Flamme, aufblitzen sah, die sich zischend durch ein paar trockene Zweige brannte.
Sie war in einer Steinhöhle, in einem großen Felsendom, wie sie nun erkannte, als der Knabe ein größeres Holzstück nachlegte und es sofort um einiges heller wurde.
Sie ließ ihren Blick an den Wänden entlangschweifen, die über und über mit Malereien versehen waren. An einigen Stellen waren sogar Formen in den Stein gehauen worden, und in einer Ecke waren kleine geschnitzte Holzfiguren aufgereiht.
»Das reicht«, befand er, als er ein weiteres Stück Holz aufgelegt hatte. »Wenn die Flammen zu weit nach oben züngeln, kann der Rauch nicht mehr abziehen.«
Sorgfältig errichtete er mit weiteren Holzstücken eine Art Gestell zum Braten des Fleisches ähnlich dem, das Anna schon gesehen hatte, als sie ihn im Wald aus der Ferne beim Feuermachen beobachtet hatte.
»Hast du all die Malereien und Schnitzarbeiten angefertigt?«
Der Junge nickte. »Hast du etwas zu essen bei dir?«
Anna bejahte und zog schnell ein Tuch aus ihrem Bündel hervor, in dem sich Trockenfleisch, fünf Äpfel, ein Kanten Brot und einige Beeren befanden, und breitete alles vor dem Jungen aus. Hastig griff er nach einem Apfel und biss in ihn hinein.
»Gut. Ich gebe dir auch was von dem Kaninchen ab.«
Anna nickte stumm und sah ihn an. Aus der Nähe erkannte sie, dass er keineswegs mehr so jung war, wie sie ihn geschätzt hatte. Er konnte nur wenig jünger sein als sie selbst. Sein Körper war zwar dünn und ausgemergelt, doch er war so groß wie sie, vielleicht sogar etwas größer. Mit verbissenem Gesichtsausdruck bohrte er ein kleines, stumpfes Messer in den Rumpf des Kaninchens und versuchte, ein Stück Fleisch aus ihm herauszuschneiden.
»Warte, ich habe etwas Besseres.« Anna zog ein Messer hervor, das sie ihrem Vater, kurz bevor sie das Haus für immer verließ, gestohlen hatte. Er hatte es dazu benutzt, Hühner auszuweiden, oder manchmal auch, um ihr Angst zu machen. »Hier!«
Der Bursche nahm es und betrachtete es von allen Seiten. »Donnerwetter!«
Augenblicklich stieß er es in den Leib des Kaninchens und versenkte es fast vollständig darin. Geschickt bewegte er es vor und zurück, trennte das Fell von den Muskeln und zog es danach mühelos vom Rumpf ab. Er teilte das Fleisch in mehrere Stücke, spießte eines nach dem anderen auf und lehnte es vorsichtig an das soeben aufgeschichtete Feuergestell. Blut tropfte herab und zischte in den Flammen auf. Sorgsam packte er das restliche Fleisch, von den Eingeweiden getrennt, auf ein Tuch, legte die Enden des Stoffes übereinander, bis alles abgedeckt war, und schob das Bündel vorsichtig an die Höhlenwand. Dann drehte er sich wieder dem Feuer zu.
Anna starrte in die Flammen. »Danke«, brachte sie kurz hervor.
Er erwiderte nichts.
»Du musst besser aufpassen«, sagte er nach einer Weile. »Was macht eigentlich eine wie du hier im Wald?«
Anna schwieg. Ganz gewiss würde sie ihm nicht erzählen, wer sie war und woher sie kam. Und erst recht nicht, wohin sie gehen wollte. Er hatte ihr zwar geholfen. Aber das hieß noch lange nicht, dass sie ihm vertrauen konnte. Sie hätte nicht einmal mit ihm hierherkommen sollen. Ihr Herz pochte schneller, als sie an das Geld dachte, das sie bei sich trug. Ohne zu zögern, hatte er den Meier niedergeschlagen und ihn beraubt. Und nun befand sie sich mit ihm zusammen in diesem Verschlag. Wie hatte sie nur so dumm sein können? Verstohlen blickte sie in die Richtung, aus der sie gekommen war.
»Dann eben nicht.« Seine Stimme ließ Anna zusammenzucken.
»Wenn du stumm sein willst wie ein Fisch, ist mir das auch recht.«
Er drehte alle Spieße nacheinander um. Das gebratene Fleisch roch köstlich, und Annas Magen meldete sich lautstark.
»Dein Magen erzählt mehr als du.«
Sie musste schmunzeln. Auf einmal kam es ihr albern vor, sich vorzustellen, was ihr der Bursche alles an möglichen Greueltaten antun könnte, während er einfach nur dasaß und darauf wartete, das Fleisch essen zu können.
»Ich heiße Anna!«
»Meine Güte, der Magen spricht auch noch.«
Sie lachte kurz auf, um sofort wieder zu Boden zu sehen.
»Ich heiße Gawin.«
»Woher kommst du, Gawin?«
»Von hier und dort. Und du?«
»Ich auch.«
Sie sahen sich einen Moment lang an, dann lachten sie los.
»Also kommen wir sogar aus dem gleichen Dorf«, witzelte Gawin. Er betrachtete seinen unerwarteten Gast. Sie war bildhübsch, wahrscheinlich etwas älter als er. Als ihr der Meier das Tuch vom Kopf gerissen hatte, waren lange, hellblonde Haare zum Vorschein gekommen. Solche Haare hatte er noch nie zuvor gesehen, nur davon gehört. Die Damen bei Hofe, hieß es, bleichten ihre Haare so lange mit Zitronensaft, bis sie einen helleren Farbton annahmen. Warum sie das taten, hatte Gawin nie verstanden. Doch dieses Mädchen machte ihm nicht den Eindruck, seine Haare derart behandelt zu haben. Einen Moment überlegte er, es danach zu fragen. Doch da es gerade einmal mit Mühe seinen Namen hervorgebracht hatte, von dem er noch nicht einmal wusste, ob es sein richtiger war, ließ er es lieber bleiben. Und warum sollte es auch einem wie ihm auf eine solche Frage antworten?
»Wohnst du hier?«
Er nickte.
»Ziemlich ungewöhnlich, so eine Höhle mitten im Wald.«
»Eigentlich nicht. Hier gibt es einige Felsen, sie fallen nur nicht so auf, weil sie völlig von Pflanzen überwuchert sind. Manche sind hohl, andere nicht.«
»Lebst du allein hier?«
Seine Miene verfinsterte sich, und Anna bereute augenblicklich, ihm diese Frage gestellt zu haben.
»Entschuldige.«
»Schon gut. Es stimmt ja, ich bin allein.« Das hatte er ursprünglich nicht sagen wollen, doch nun, da es heraus war, tat es ihm gut, und seine Anspannung ließ nach.
»Ich auch.« Ihre Stimme war nicht mehr als ein Flüstern.
»Sind deine Eltern tot?«, fragte Gawin.
Anna nickte. »Und deine?«
»Ich habe sie nie kennengelernt.« Ohne weiter darüber nachzudenken, hatte er ihr die Wahrheit gesagt. Ein ungewohntes Gefühl. Wann immer er in den vergangenen Jahren ein Wort über sein Leben verloren hatte, spann er stets eine Geschichte zusammen, die ihm im jeweiligen Moment passend erschien. Manchmal wusste er selbst nicht mehr, was wahr oder erfunden war.
»Wie lange lebst du schon hier?«
»Ein paar Jahre. Für mich ist es in Ordnung, wenn ich genug zu essen finde.« Leise fügte er hinzu: »Nur im Winter ist es schwer.«
Anna nickte, dann schwiegen beide eine Weile.
»Du kannst hierbleiben, wenn du willst«, nahm Gawin das Gespräch wieder auf.
Anna sah ihn an. »Bis morgen früh. Dann muss ich weiter.«
Ihre Antwort versetzte ihm einen Stich. Nie zuvor war jemand außer ihm in der Höhle, seinem Zuhause, gewesen. Und es hatte ihm nichts ausgemacht. Doch jetzt, wo sie mit ihm am Feuer saß und die Einsamkeit durchbrochen hatte, die ihn seit Jahren umgab, wollte er nicht, dass sie wieder ging.
»Wo willst du hin?«
Wieder war ihre Antwort nur ein Schweigen. Gawin nahm einen der Fleischspieße, prüfte ihn und reichte ihn Anna.
»Ist fertig.«
Er sammelte die anderen Stöcke ein, legte sie sorgfältig auf das Tuch, in dem sich das rohe Fleisch befand, und aß endlich selbst das erste Stück. Der Genuss, den ihm diese Mahlzeit bereitete, war ihm deutlich anzusehen. Seine Besucherin verfolgte aus dem Augenwinkel heraus, dass er jeden Bissen lange kaute, bevor er ihn hinunterschluckte. Sie selbst hatte bisher keinen Hunger gekannt und fragte sich nun, was wohl schlimmer war. Ihr eigenes elendes Dasein bei ihrem Vater oder Gawins Leben, geprägt von Hunger, Angst und Einsamkeit.
»Willst du mitkommen?«, hörte sie sich selbst sagen, ohne zuvor darüber nachgedacht zu haben.
Gawin blickte verwundert auf. »Wohin?«
Ihr Herz klopfte. Sie hatte ihn ganz spontan gefragt und überlegte nun, wie es wohl wäre, eine Begleitung zu haben. Gawin sah sie jedoch so erwartungsvoll an, dass sie wünschte, ihren Mund gehalten zu haben.
»Ich will in die Stadt.«
»In welche?«
Sie antwortete nicht.
»Und was willst du dort?«
»Leben«, erklärte sie sofort. »In Freiheit leben und Kleider nähen.«
Gawin schien verblüfft. »Bist du Näherin?«
»Ich habe genäht, dort, wo ich bisher lebte, und die Kleider auf den Märkten verkauft.«
»Aber du hast gar keine Stoffe bei dir.«
Schon wollte Anna nach der Geldkatze um ihren Hals greifen, doch dann hielt sie mitten in der Bewegung inne und legte beide Hände um den Fleischspieß.
»Ich werde Stoff und Garn kaufen, sobald ich den nächsten Markt erreiche.«
Gawin gingen eine Menge Fragen durch den Kopf, vor allem die, ob sie den Stoff denn auch bezahlen könne. Doch ein Gefühl sagte ihm, dass es besser wäre still zu sein. So nickte er nur und beließ es bei ihrer Erklärung.
»Ich kann nicht nähen, und ich habe auch kein Geld«, sagte er schließlich. »Ich wüsste nicht, wie ich in einer Stadt überleben sollte. Außerdem«, er machte eine kurze Pause, »würden sie einen wie mich gar nicht erst durchs Stadttor hineinlassen.«
Anna erwiderte nichts. Schweigend aß sie das Fleisch, trank einen Schluck aus ihrem Wasserschlauch und rückte bis an die Höhlenwand zurück, wo sie sich zusammenkauerte. Mit einem Mal überkam sie eine gewaltige Müdigkeit. Die schützende Höhle, das Feuer, der gefüllte Bauch. Und sie war nicht allein.
»Schlaf gut«, sagte Gawin und legte sich mit dem Rücken zum Feuer gleichfalls nieder.
»Du auch«, vernahm er ihre Stimme.
Einen Moment lang lag er nur so da und lauschte ihrem Atem. Es war schön, Gesellschaft zu haben. Er spürte, wie ihm eine Träne über die Wange lief. Morgen früh würde sie fort sein und er wieder allein. So einsam wie in diesem Moment hatte er sich noch nie gefühlt.
3. Kapitel
Hastig schlug sie die Augen auf. Ihr Atem ging schnell, und sie versuchte, im Dunkeln etwas zu erkennen. Das Feuer war ausgegangen, und sie hatte jedes Zeitgefühl verloren.
»Es ist noch nicht Morgen«, hörte sie Gawin in die Dunkelheit hinein sagen.
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß es eben. Schlaf weiter. Ich wecke dich, sobald der Tag anbricht.«
Hatte er etwa schon länger dort wach gelegen und ihrem Atem gelauscht? Sie fröstelte. Die feuchte Luft in der Höhle fühlte sich klamm an, die Kleidung klebte schwer an ihrem Körper. Das Strohlager zu Hause war wärmer und vor allem trockener. Dennoch fühlte sie sich hier wohler und sicherer und empfand vor allem Stolz. Sie war geflohen, hatte den Aufbruch gewagt und ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen. Nie wieder wollte sie Angst empfinden und sich fügen. Lieber würde sie sterben. Mit diesen Gedanken glitt sie sanft zurück in den Schlaf, während Gawin weiterhin mit bangem Herzen ihrem Atem lauschte. Sobald der Morgen da wäre, würde sie fortgehen und ihn zurücklassen. Einen Moment lang, einen kurzen Augenblick, hegte er den Gedanken, den Ausgang zu versperren und sie dadurch zum Hierbleiben zu zwingen. Er wollte nicht mehr allein sein. Mutlos seufzte er, als er wieder zur Besinnung kam. Selbstverständlich würde er die Höhle nicht verschließen. Er schalt sich selbst einen Dummkopf. Einen Dummkopf, der es nicht anders verdiente, als für immer allein zu sein.
»Es wird Tag.« Seine Stimme klang sanft, vorsichtig berührte er ihre Schulter. Anna kam es so vor, als habe sie seit dem letzten Wachwerden nur einen Wimpernschlag lang die Augen geschlossen, dabei mussten seither mehrere Stunden vergangen sein.
»Danke.«
Sie setzte sich auf und blinzelte in die Dunkelheit. Sie konnte keinen Lichtunterschied zu vorher ausmachen. Woher Gawin wissen wollte, dass der Tag mittlerweile angebrochen war, konnte sie sich nicht erklären.
»Willst du noch etwas essen?«
Im ersten Moment wollte sie ablehnen, doch dann besann sie sich. Es kam nicht darauf an, ob sie sofort aufbrach oder sich noch etwas Zeit ließ. Ihr nächstes Ziel würde sie heute sowieso nicht erreichen und ob sie Gelegenheit fände, eine sichere Rast einzulegen, konnte sie nicht wissen.
»Ja.«
»Dann entfache ich das Feuer.«
»Und du?«, fragte Anna. »Bist du sicher, dass du wirklich hierbleiben und nicht mit mir kommen willst?«
Funken sprühten auf. Eine kleine Flamme fraß sich durch trockenes Gehölz, entzündete ein breiteres Holzscheit und erwärmte sofort ihre Haut. Anna rieb sich die Arme und streckte ihre Hände dem Feuer entgegen. Gawin hatte ihr noch nicht geantwortet, und sie suchte seinen Blick. Er sah sie nicht an, steckte geschäftig das Fleisch auf die Spieße und lehnte sie dann an das Gestell, das er am Vortag über der Feuerstelle gebaut hatte. Einen Spieß behielt er in den Händen und drehte ihn mit gleichmäßigen Bewegungen über der Flamme. Auf ihm befand sich eines der Fleischstücke, die er schon gestern vorgegart hatte. So brauchte es nicht lange, bis er es für den Verzehr für gut befand und an Anna weiterreichte.
»Danke.«
Er nickte, nahm dann einen der angelehnten Spieße und prüfte das Fleisch. Mit nur geringem Appetit zupfte er Stücke vom Rand ab und stopfte sie sich in den Mund.
»In welche Stadt willst du gehen?«
»Mal sehen«, wich Anna der Frage aus.
»Einen wie mich wollen sie in der Stadt nicht.« Es gelang ihm nicht, die Traurigkeit dabei aus seiner Stimme zu verbannen.
»Du könntest dir dort Arbeit suchen.«
»Was soll einer wie ich schon arbeiten?«
Anna überlegte. Die Frage war berechtigt. Wenn er schon so lange im Wald wohnte und nie etwas mit den Stadtmenschen zu tun gehabt hatte, war sein Leben nicht nur völlig anders verlaufen als das ihre. Er hatte zudem auch nie irgendeine Art von Tätigkeit erlernt oder ausgeübt. Daran hatte sie bisher nicht gedacht.
»Du kannst gut jagen.«
»Das kann jeder.«
Sie wollte widersprechen, wusste aber nichts Stichhaltiges dagegen einzuwenden.
»Hast du denn nie woanders gelebt? Ich meine, außer hier im Wald?«
Er zögerte und hörte auf zu essen. Stattdessen zupfte er missmutig weitere Fasern von dem gebratenen Stück Fleisch auf seinem Spieß ab. Noch nie hatte er jemandem seine Geschichte erzählt. Manchmal glaubte er ja selbst nicht mehr, dass es ein Leben außerhalb des Waldes für ihn gegeben hatte.
»Ich war auf einem Schiff«, hörte er sich selbst mit rauher Stimme sagen.
»Du bist zur See gefahren? War dein Vater Seefahrer?«
Gawin schüttelte den Kopf. »Er war nicht mein Vater. Nur ein Freund meiner Eltern. Nach ihrem Tod hat er sich um mich gekümmert.«
»Was ist geschehen?«
Gawin schwieg. Statt zu antworten, stopfte er sich wieder Fleisch in den Mund und kaute geräuschvoll. Er wollte ihr nicht erzählen, was passiert war. Was hätte er auch schon groß sagen sollen?
Seine Eltern waren gestorben, noch bevor er sich ihre Gesichter hatte einprägen können. Ein Mann, der ihm erzählte, ihr Gefährte gewesen zu sein, nahm sich seiner an und ließ ihn auf seinem Schiff leben, bis zu jenem Tag, an dem er wegen einer Gaunerei am höchsten Mast aufgeknüpft worden war. Ihn hatte die Besatzung beim nächsten Anlegen an Land abgesetzt und sich selbst überlassen. Das war viele Jahre her, aber er wollte weder jetzt noch irgendwann sonst in seinem Leben wieder darüber sprechen.
Anna sah die Veränderung in seinem Gesicht. Er brauchte nichts weiter zu sagen, sie wusste auch so, dass er nicht darüber reden wollte.
»Du hast mir gestern sehr geholfen«, sagte sie. »Was ist, wenn der Meier dich erwischt?«
»Er weiß ja nicht, dass ich es war. Außerdem hat er mich bisher auch nie bemerkt.«
»Ich will nicht, dass dir etwas geschieht.«
Gawin spürte, wie er errötete. Noch nie hatte ihm jemand etwas so Freundliches gesagt. Sein Herz klopfte schnell in seiner Brust.
»Warum?«, brachte er überrascht hervor.
Anna hob kurz die Schultern. »Ich weiß nicht. Weil du mir geholfen hast.« Sie machte eine kurze Pause. »Wie alt bist du?«
Er überlegte. Nicht weil er abwog, ob er ihr die Wahrheit sagen sollte. Gawin wusste es einfach nicht.
»Vierzehn«, antwortete er. »Nein, warte, eher fünfzehn. Wir haben Frühjahr.«
Seine Antwort ließ Anna erschauern: Er konnte sein eigenes Alter nicht mit Gewissheit benennen. Sie empfand tiefes Mitleid mit ihm. Dieser Junge verkörperte für sie die Einsamkeit. Sie räusperte sich.
»Dann bist du bald ein Mann. Willst du dein Leben etwa damit verbringen, dich in einer feuchten Höhle zu verstecken?«
Gawin zuckte mit den Schultern. Anna wartete noch einen Moment, ob er etwas sagte. Schließlich begann sie ihre Habseligkeiten zusammenzusammeln.
»Ich werde mich jetzt aufmachen. Hab Dank für deine Hilfe.«
»Ich zeige dir den Weg hinaus. Sonst stößt du in der Dunkelheit noch irgendwo an.«
Dicht hinter Gawin kroch Anna aus der Höhle. Der Morgen graute, und nur wenig Licht drang durch das Blätterdach der Bäume auf den Waldboden hinab.
»In welche Richtung willst du?«
Anna zögerte. Sie wollte ihm nicht die ganze Wahrheit sagen. Zu groß war ihre Angst, dass ihr Vater irgendwann hier auftauchen und Gawin nach ihr befragen könnte. Wer wusste schon, wie lange es dauern würde, bis der Junge sie unter Schmerzen verriet? Doch bereits im nächsten Moment schalt sie sich einen Dummkopf. Wie sollte ihr Vater ausgerechnet darauf kommen, in diesem Wald nach ihr zu suchen, und dann auch noch direkt auf Gawin stoßen?
»Du musst es mir nicht sagen«, unterbrach Gawin ihre Gedanken.
»Das ist es nicht«, gab sie schnell zurück. »Ich will an der Weser entlang flussabwärts.«
»Komm! Ich zeig dir den Weg.« Gawin schlug sich vor ihr durch das dichte Gebüsch, hielt die Zweige für sie beiseite und ließ sie hindurchschlüpfen. Es dauerte nicht lang, bis sie eine Lichtung erreichten und er stehen blieb.
»Du musst da runtergehen«, deutete er mit ausgestrecktem Arm nach rechts. »Nach der Lichtung kommst du wieder in ein kleines Waldstück. Die Bäume stehen dort nicht sehr dicht. Halte dich dort linker Hand, dann kommst du bald an eine Weggabelung. Auch hier hältst du dich links. Der Weg führt dich aus dem Wald hinaus.«
Anna folgte mit den Augen seinem Fingerzeig. Sie traute sich nicht, noch einmal zu fragen, ob er sie nicht begleiten wolle. Wahrscheinlich war es ohnehin besser, sich allein durchzuschlagen. So ein ungepflegter, halb verhungerter Kerl wie Gawin würde sie nur aufhalten.
»Es soll ein Kloster in Rehburg-Loccum geben. Kennst du es?«
Gawin runzelte die Stirn. »Hast du nicht gesagt, dass du in eine Stadt willst?«
»Ich will ein paar Tage im Kloster unterkommen, um dort zu rasten und mir neue Kleider zu nähen.«
»Und du glaubst, die Ordensschwestern geben dir einfach so Stoff für ein Kleid, nur weil du darum bittest?«
Anna zuckte mit den Schultern. Sie würde ihm unter keinen Umständen verraten, dass sie genug Geld dabeihatte, um den Schwestern ganze Stoffballen abzukaufen.
»Na, versuchen kannst du es ja«, räumte Gawin ein und deutete erneut über die Lichtung. »Ich kenne das Kloster. Es ist derselbe Weg. Aber da wirst du kein Glück haben.«
»Weshalb nicht?«
»Es ist ein Mönchskloster. Die werden einer einzelnen Frau keinen Zutritt gewähren und erst recht nicht mit ihr unter einem Dach leben.«
Anna überlegte. Auf den Gedanken, dass in dem Zisterzienser-Kloster, von dem sie schon das eine oder andere Mal in der Schänke gehört hatte, keine Ordensschwestern, sondern nur Mönche leben könnten, war sie nie gekommen. Sie musste sich etwas anderes einfallen lassen.
»Ich danke dir.« Anna war versucht, ihn zum Abschied zu umarmen, überlegte es sich aber schnell anders. »Leb wohl!«
Gawin sah ihr nach, wie sie sich schnellen Schrittes davonmachte. Sein Herz lag schwer wie ein Felsklumpen in seiner Brust. So plötzlich, wie Anna in sein Leben getreten war, hatte sie ihn auch wieder verlassen. Die Einsamkeit, an die er sich mit der Zeit gewöhnt und die ihm zuvor nur ab und zu zu schaffen gemacht hatte, breitete sich jetzt wie ein Flächenbrand in seinem Körper aus und schien ihm den Atem zu nehmen. Er war wieder allein, nur fühlte es sich auf einmal unerträglich an. Wütend machte er sich auf den Rückweg zu seiner Höhle. Er wünschte, er wäre ihr nie begegnet.
4. Kapitel
Margrite konnte es nicht leiden so langsam voranzukommen. Sie hatte einiges an Gewicht mit sich herumzuschleppen, war aber immer noch flinker unterwegs als diese dünnen Klappergestelle von Dirnen, die vor lauter Schwatzhaftigkeit keinen Fuß mehr vor den anderen bekamen. Und dieses furchtbare Gekicher immerzu, sobald sich die Männer anschickten, ein wenig mit ihnen zu plaudern. Glaubten diese Kerle etwa, dass sie deswegen nicht bezahlen müssten? Da würde Margrite sie ganz schnell eines Besseren belehren. Grimmig zog sie dem Ochsen eins mit der Peitsche über. »Na los, mach schon. Sonst müssen wir noch hier draußen übernachten.«
Das Tier schien den Schlag gar nicht bemerkt zu haben. Unbekümmert und ohne Hast zog es den Karren hinter sich her.
»Warum so übellaunig, Margrite? Wir werden das Rasthaus auch ohne Eile noch vor der Dunkelheit erreichen.« Gutmütig klopfte Anderlin ihr den Rücken und sah sie aufmunternd an.
»Wir kommen viel zu langsam voran.« Sie seufzte. »Ich will rasch weiter Richtung Norden. Dort hat sich die Pest längst nicht so ausgebreitet wie hierzulande.«
»Sorg dich nicht. Wir sind der Krankheit bislang entkommen und werden es auch weiterhin.«
Sie mühte sich um ein Lächeln, doch auf ihrer Stirn erschien eine tiefe Sorgenfalte. Sie hatte schon zu viele Menschen elendig verenden sehen. Wann auch immer ihr Tag kommen würde – auf diese Art und Weise wollte sie die Welt nicht verlassen.
Früher als gedacht erreichten sie die Schänke. »Nicht mehr weit von hier liegt Burg Beyenburg. Wir könnten in der Burgsiedlung Rast machen und einige Waren anbieten«, schlug Anderlin vor und sprang vom Karren.
»Wir werden in Beyenburg haltmachen, aber nicht mehr heute. Wenn wir Geschäfte machen wollen, sollten wir uns dort in anständigem Zustand zeigen. Das bringt mehr Geld«, widersprach Margrite.
Die anderen Mitglieder der Gruppe, zwei weitere Frauen und zwei Männer, standen teilnahmslos neben ihnen am Wagen und verfolgten das Gespräch. Seit ihrem Aufbruch in Würzburg hatten ausschließlich Margrite und Anderlin das Wort geführt. Daran schien sich auch jetzt nichts zu ändern.
»Außerdem«, fügte Margrite hinzu, »werden wir hier weniger für die Nacht bezahlen müssen als in der Siedlung.«
»Ja, weil es hier weniger sicher ist«, gab Anderlin zu bedenken.
»Ich beschütze dich schon«, frotzelte Margrite. »Ich habe bisher gutes Geld verdient. Davon spendiere ich dir am Abend ein Bier, mein Guter.« Sie tätschelte ihm den Arm. »Und euch anderen auch. Aber nur eines, den Rest bezahlt ihr hübsch selbst.«
Im Innern der Schänke roch es muffig und klamm. Die Binsen am Boden mussten schon seit geraumer Zeit nicht mehr gewechselt worden sein. Der Gestank von Erbrochenem stieg Margrite in die Nase.
»He, Wirt, bei dir stinkt es!«, rief sie beim Eintreten.
Doch statt eines erwachsenen Mannes stand ein Kind hinter dem Tresen, ein kleiner Junge, nicht älter als zehn Jahre.
»Entschuldigt!« Der Bursche trat verlegen von einem Bein auf das andere. »Das ist der Kerl da«, fügte er flüsternd hinzu und deutete auf einen Mann, den Margrite übersehen hatte. Er lag zusammengerollt in der hintersten Ecke des Raumes und schlief.
»Ist er verletzt?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Nur betrunken. Ist besser, wenn er schläft.«
Sie wandte sich um. »Wo sind deine Eltern? Wir brauchen ein Lager für die Nacht.«
»Mein Vater wird bald zurück sein. Wie viele seid ihr?«
»Sechs und ein Ochse.«
»Dann werdet ihr genug Platz in der Scheune finden.«
Margrite nickte und gab den anderen ein Zeichen, ihre wenigen Habseligkeiten abzuladen und zum Stall hinüberzubringen.
»Trag uns Essen und Trinken zusammen und bring es zum Lager.« Sie drückte dem Jungen zwei Münzen in die Hand. »Dies wird für eine Nacht reichen, morgen ziehen wir weiter. Und das hier«, sie zog einen Pfennig hervor, »ist nur für dich, das brauchst du deinem Vater nicht zu sagen.«
»Danke.«
»Nun geh und bereite uns das Essen. Wir sind hungrig.« Margrite verließ die Schankstube. Bevor sie die Tür schloss, warf sie jedoch noch einen letzten Blick auf den Trunkenbold in der Ecke. Ein Gefühl, auf das sie sich bisher noch immer hatte verlassen können, riet ihr zur Vorsicht. Er schien ihr einer der Männer zu sein, denen man als Frau besser aus dem Wege ging. Instinktiv tastete sie nach dem Messer, das sie sich unter ihrer Kleidung mit einem Band um die Hüfte herumgebunden hatte. Sie würde es heute Nacht lieber in der Hand behalten. Dann schloss sie die Tür.
Als sie die Scheune erreichte, hatten die anderen bereits den Ochsen ausgespannt, den Karren abgeladen und sich jeder einen Platz für die Nacht gesucht. Der Strohgeruch stieg ihr in die Nase. Es war kein frisches Stroh, wie sie es von früher her kannte. Doch es erinnerte sie an ihr ehemaliges Zuhause, an Sorglosigkeit, an eine Wiese, auf der sie als Kind gespielt hatte. So schön diese Erinnerungen auch waren, dachte sie trotzdem nur ungern an jene Zeit zurück. Zwar waren seit damals viele Jahre vergangen, doch der Schmerz über den Verlust war geblieben. Margrite ballte die Hände zu Fäusten. Ihre Fingernägel bohrten sich in die Haut ihrer Handflächen. Ihr tat es wohl, verdrängte die kleine Verletzung doch den weit tieferen Schmerz, den sie in sich trug.
»Da bist du ja. Hast du dem Jungen Bescheid gegeben, dass er uns Bier bringen soll?«
»Du kriegst gleich was zu saufen. Der Bengel hat hier keine Hilfe. Er bereitet das Essen und bringt uns dann alles rüber.« Margrite ließ ihr Bündel gleich an der ersten freien Stelle zu Boden gleiten.
»Warum gehen wir nicht in die Schankstube? Dort können wir am Tisch essen und saufen, ohne dass der Bursche hin und her laufen muss?«, fragte Cecilie.
»Weil da drin ein Besoffener liegt, der stärker stinkt als ein ausgeweidetes Schwein.«
»Dann packen wir ihn eben an allen vieren und schmeißen ihn raus«, mischte sich nun auch Anderlin ein. »Cecilie hat recht. Wenn wir schon in einem Wirtshaus übernachten, will ich auch an einem Tisch essen.«
»Ich sage euch, mit dem Kerl da drin gibt es nur Ärger«, versuchte Margrite die anderen abermals zu überzeugen. Doch sie wusste, dass es zwecklos war. Die fünf standen bereits am Scheunentor und sahen sie an, gespannt, wie die Auseinandersetzung ausgehen würde. Sie wollten sich die Bequemlichkeit gönnen, ihre Speisen nicht wie auf der Wanderung, auf dem Boden vornübergebeugt, einnehmen zu müssen. Sie würde sie nicht umstimmen können. »Wenn ihr es unbedingt wollt.«
Als sie die Scheune verließen, wären sie fast mit dem Jungen zusammengestoßen, der, mit Speisen beladen, das Tor zu öffnen versuchte.
»Gib schon her«, forderte Anderlin ihn auf und nahm ihm das Bier ab. »Wir kommen in die Schänke. Du kannst alles andere dort auftischen.«
Der Bengel zögerte einen Moment, entgegnete aber nichts und folgte seinen Gästen in die Wirtschaft. Die Tür stand offen, und der Mann, der noch kurz zuvor in der Ecke gelegen hatte, war fort.
»Wo ist denn nun dein stinkendes Schwein, Margrite?«, fragte Otto.
»Eben war er noch hier«, gab sie schulterzuckend zurück. »Umso besser. Aber lasst die Tür offen stehen. Sein Gestank ist geblieben.«
Der Junge tischte reichlich auf. Vermutlich mehr, als sein Vater den Gästen für das Geld geboten hätte. Wann immer noch Bier oder Schinken verlangt wurde, eilte er sich das Gewünschte herbeizuholen. Bestimmt würde er Prügel beziehen, dachte Margrite, wenn der Wirt zurückkäme und seine Bestände prüfte. Sie gab vor austreten zu müssen. Ohne dass die anderen es mitbekamen, sagte sie dem Knaben im Vorbeigehen, dass es genug an Essen sei und er mehr Geld verlangen müsse, wenn weitere Speisen gefordert würden. Sie steckte ihm noch eine Münze zu. »Und das hier reicht auch nur noch für zwei Krüge Bier.« Er nickte unmerklich. In diesem Moment baute sich der Trunkenbold, der sich anscheinend doch noch nicht auf und davon gemacht hatte, vor ihr in der Tür auf. Margrite musterte ihn und ging wortlos zurück an den Tisch, ohne ihre vermeintliche Notdurft verrichtet zu haben.
»He, du Bengel, ich hab noch nicht genug. Bring mir Schnaps. Dein Bier ist so dünn, dass nicht mal ein kleines Mädchen davon besoffen wird«, lallte der Mann.
»Dafür hat es aber bei ihm ganz gut gereicht«, kicherte Cecilie. Margrite warf ihr einen warnenden Blick zu.
»Was hast du Hure gesagt?« Der Fremde schwankte auf den Tisch zu.
Anderlin verdrehte die Augen. Dass die Weiber aber auch nie ihr vorlautes Mundwerk halten konnten. Nun konnte er wieder die Kohlen für sie aus dem Feuer holen. Es gab wirklich nur Ärger, wenn man Dirnen mit sich reisen ließ. Er stand auf.
»Ach was, lass doch die Huren schwatzen«, sagte er versöhnlich und legte seine Hand auf die Schulter des Mannes. »Ich gebe dir ein Bier aus, und dafür vergessen wir die Sache.«
»Ich werd sie an den Haaren nach draußen schleppen und ihr beibringen, dass ein Weibsbild sich dem Manne zu fügen hat.«
Zwar lallte er, doch Anderlin schätzte ihn deshalb noch lange nicht als leichten Gegner ein. Er war auffallend groß, und auch wenn sie in der Überzahl waren, würde er ihnen doch gewaltigen Ärger bereiten können. Und das alles nur, weil eine Hure ihr freches Maul nicht gehalten hatte.
»Das ist es nicht wert. Setz dich und trink mit uns.« Margrites Körper spannte sich. Anderlins Stimme klang besänftigend, und vielleicht ließ der Mann sich ja durch seine Worte beruhigen. Noch war sie sich nicht sicher, ob es ihr lieber war, dass der Kerl sich einfach zu ihnen gesellen und sie damit erneut seinem widerlichen Gestank aussetzen würde, oder ob ihre Begleiter ihn nicht besser packen und zu Boden prügeln sollten, bis er den Schwanz einzog und davonkroch. Doch da murmelte er schon einige unverständliche Worte und zog sich einen Stuhl heran. Zu Margrites Erleichterung rückte er ihn wenigstens neben Cecilie und damit an das entgegengesetzte Ende des Tisches. Wenn er schon bei ihnen saß, dann wenigstens so weit weg von ihr wie nur möglich.
»Wie ist dein Name?«, begann Anderlin das Gespräch und musterte ihn. Der Mann hatte ein gefälliges Äußeres, gut geschnittene Gesichtszüge, dichtes schwarzes Haar und ebenso dunkle Augen. Ein Kerl, der den Frauen gefallen mochte, wäre da nicht der Gestank gewesen.
»Helme«, kam die kurze Antwort.
Anderlin stellte alle am Tisch Anwesenden vor, plauderte über dies und das und berichtete, dass sie aus Würzburg kamen.
»Aus Würzburg? Dann seid ihr die alte Königsstraße gegangen?«
Anderlin nickte. »Ebendie.«
»Womöglich könnt ihr mir helfen.« Der Fremde schien plötzlich völlig klar. »Ich suche jemanden.«
»Wie wir alle«, scherzte Anderlin.
Doch der andere ging nicht darauf ein. Seine Miene zeigte keine Regung.
»Wen suchst du denn?«
»Sie hat blonde, lange Haare bis hierher.« Er legte die Finger an die Hüfte. »In der Farbe nicht ganz so kräftig wie Weizen, sondern viel heller. Man vergisst ihren Anblick nicht, wenn man sie einmal gesehen hat. Ist sie euch begegnet?«
Anderlin wollte etwas sagen, doch Margrite kam ihm zuvor. »Was willst du von ihr?«
»Das geht dich nichts an, Weib!«, spie der Fremde aus. »Sie ist meine Tochter, wenn ihr das wissen wollt.«
»Wir haben sie gesehen«, antwortete Margrite schnell.
»Wo?«
»Auf dem Weg hierher.«
»Weit von hier?«
»Wir sahen sie gerade erst gestern. Sie war mit einer kleinen Gruppe unterwegs.« Margrite sah in die Runde ihrer Begleiter und bedeutete ihnen fast unmerklich zu schweigen.
»Ist sie Richtung Süden gegangen?«
Margrite nickte.
»Dann hat sie es tatsächlich wahr gemacht«, murmelte Helme.
»Willst du versuchen sie einzuholen?« Margrite musterte ihn mit Interesse. Er hob den Krug und trank gierig das Würzbier, das ihm rechts und links aus den Mundwinkeln lief und auf sein Wams tropfte.
»Ich weiß jetzt, wo ich sie finde. Sie kann sich ruhig noch ein wenig länger in Sicherheit wiegen. Sie ist zu Fuß, ich zu Pferd. Da hole ich sie schnell ein.« Bei seinem verächtlichen Grinsen stellten sich Margrites Nackenhaare auf. Sie war schon vielen Männern wie ihm im Laufe ihres Lebens begegnet und erkannte es wie immer an den Augen. Keine Seele und kein Verstand, die ihn zügelten, kein Herz, das Leid und Not zu verstehen vermochte. Er hatte eine schöne äußere Hülle, die wohl so manch einen zu blenden vermochte. Aber nicht sie. Angewidert griff sie nach dem Krug und ihrem Essen und stand auf.
»Ich bin müde und brauche Schlaf.« Keiner der anderen machte Anstalten ihr zu folgen. Sie fragte sich, ob einer von ihnen ihre Lüge mit einer unbedachten Bemerkung aufdecken würde, und ließ nochmals ihren Blick über ihre Begleiter streifen. Doch diese schienen sie ohne ein Wort verstanden zu haben. »Macht nicht mehr so lange. Wir müssen früh am Morgen weiter.«
»Wir kommen bald nach«, versprach Anderlin. Bevor sie den Schankraum verließ, sah Margrite noch, dass der Wirtsjunge erneut die Krüge füllte. Mit einem unguten Gefühl verließ sie das Haus.
Dass die anderen nach und nach zum Schlafen in die Scheune gekommen waren, hatte Margrite nur vage wahrgenommen. Zu bequem war die Lagerstatt im Stroh, zu wohl fühlte sie sich in der Wärme und dem Geruch um sie herum. Das erste Mal seit Tagen hatte sie die Riemen ihrer Sandalen lösen und ihre Schuhe beiseitestellen können. Eine Wohltat für ihre geschundenen Füße, die sie tagein, tagaus über die Pfade trugen. Ein Geräusch schreckte sie auf. Durch die Schlitze der Holzbretter hindurch konnte sie erkennen, dass draußen noch tiefe Nacht herrschte. Der Morgen graute noch nicht, und nun wurde ihr auch bewusst, dass es die Hufschläge eines fortgaloppierenden Pferdes waren, die sie geweckt hatten. Nur umrissartig konnte sie ihre Begleiter in der Scheune ausmachen. Ganz sicher war sie nur bei Anderlin, der mit seinem Schnarchen fast schon die Stallwände erzittern ließ. Langsam gewöhnten sich Margrites Augen an die Dunkelheit. Binhildis lag am nächsten bei ihr. Sie hatte sich zusammengerollt wie ein kleines Kind, atmete gleichmäßig und seufzte gelegentlich zufrieden auf. Wolfker und Otto hatten es sich am anderen Ende der Scheune gemütlich gemacht. Margrite war schon mehrfach aufgefallen, dass sie sich ein wenig vom Rest der Truppe absonderten. Sie hatte in Würzburg, kurz vor ihrem Aufbruch, Gerüchte vernommen, dass Wolfker und Otto nicht nur Freunde aus Jugendtagen wären, sondern sich in einer Art und Weise miteinander verbanden, wie es gottessträflicher nicht sein konnte. Sie selbst hatte keine Beobachtung in diese Richtung gemacht. Doch sie war wachsam. Wenn sich die beiden tatsächlich wider die Natur und Gottes Willen einander näherten, waren sie alle in Gefahr, auf dem nächstbesten Scheiterhaufen zu landen. Umso genauer beobachtete sie nun, ob sie etwas erkennen konnte, was dem Verhalten zweier Männer im Schlaf nicht geziemte. Doch alles, was sie sah, waren zwei Männer, die leise schnarchten, ohne einander in einer irgendwie anstößigen Weise zu berühren. Beruhigt atmete sie aus. Doch etwas, das sie nicht näher zu bestimmen vermochte, ließ ihren Blick abermals unruhig durch die Scheune wandern. Sie verstand es selbst nicht sofort. Plötzlich wurde es Margrite klar, und ihr Herz begann so heftig in ihrer Brust zu schlagen, dass sie keuchte. Wo war Cecilie? Hatte sie dem Fremden das Pferd, das vor dem Wirtshaus stand, gestohlen und sich damit auf und davon gemacht? Sicher würden die anderen und sie eine solche Tat schwer zu büßen haben. Doch weit weniger als dieser Gedanke beunruhigte Margrite noch etwas ganz anderes. Ihr Gefühl sagte ihr, dass etwas geschehen war, etwas viel Schlimmeres als der Diebstahl eines Pferdes. Sie schob ihren Umhang, mit dem sie sich während des Schlafs zugedeckt hatte, beiseite und schlich vorsichtig zur Tür. Einen Moment lang überlegte sie Anderlin zu wecken, um mit ihm gemeinsam nachsehen zu gehen. Doch dann entschied sie sich dagegen. Wenn sie weiterhin ihre Stellung in der Gruppe behaupten wollte, durfte sie nicht bei der erstbesten Gelegenheit Angst zeigen und nach einem Beschützer rufen. Bekämen die beiden Dirnen das mit, würde sie deren Respekt, den sie sich mühsam erworben hatte, schnell wieder verlieren und könnte womöglich nicht einmal mehr den Hurenlohn für sie einfordern, der neben dem Handel mit Kleinwaren immerhin einen guten Teil ihrer Einkünfte darstellte. So gab sie acht, keinen Laut von sich zu geben, öffnete mit einem leichten Knarren die Tür und trat ins Freie. Es war eine sternenklare Nacht. Margrite sog die klare Luft mit einem tiefen Atemzug in ihre Lungen ein und sah sich um. Der Platz neben dem Wirtshaus, wo noch gestern der Gaul gestanden hatte, war leer. Einen Moment war sie versucht, nach Cecilie zu rufen, doch schien ihr das im Hinblick auf den möglichen Diebstahl nicht besonders schlau. Vorsichtig näherte sie sich dem Wirtshaus. Sie wusste nicht, ob der Wirt in der Nacht noch zurückgekommen war. Ebenso wenig war ihr bekannt, wie es sich mit der Mutter des Jungen verhielt. Aber es war sehr wahrscheinlich, dass die Familie die oberen Räume des Gasthauses bewohnte. Sie musste also leise sein, um keinen von ihnen zu wecken. Darauf bedacht, nur ja keinen Laut von sich zu geben, öffnete sie die Tür zum Schankraum. Der Gestank hatte sich im Vergleich zum Vortag etwas gelegt. Trotzdem stiegen Margrite immer noch die unterschiedlichsten Gerüche in die Nase, die ihr alles andere als angenehm waren. Sie riss die Augen weit auf, um in der Dunkelheit besser sehen zu können, und lauschte auf jedes Geräusch. Ein Schnarchen oder Atmen war nicht zu hören. Im Schankraum waren also weder Cecilie noch der Fremde, obwohl Margrite ganz fest damit gerechnet hatte, wenigstens einen von ihnen hier anzutreffen. Ihre Haut begann zu kribbeln, als sie neben dem ihr bekannten Gestank von Bier und menschlichen Absonderungen noch einen anderen Geruch wahrnahm, einen metallenen. Im selben Moment spürte sie, dass ihre Füße feucht wurden. Sie musste in irgendeine Lache getreten sein. Wie von selbst brachte ihr Verstand den Geruch und die Pfütze, in der sie stand, in einen Zusammenhang. Schnell trat sie zurück und stolperte zur Tür hinaus. Im Licht des Mondes hob Margrite einen ihrer Füße, um die Flüssigkeit genauer betrachten zu können, und unterdrückte einen Schrei. Sie rannte zur Scheune hinüber, riss die Tür auf, stürzte zu Anderlin und rüttelte ihn aus dem Schlaf.
»Komm schnell!«, waren die einzigen Worte, die sie herausbrachte. Verschlafen, vom Anblick der verstörten Margrite aber alarmiert, folgte er ihr ins Freie.
»Im Wirtshaus«, brachte sie flüsternd hervor.
Sie eilten zur Schänke hinüber, und Margrite öffnete die Tür, hielt Anderlin aber zurück, als er eintreten wollte.
»Du kannst es von hier aus sehen«, kündigte sie an und deutete mit dem Finger nach unten. Anderlin kniff die Augen zusammen. Er sah den Umriss eines Menschen am Boden liegen.
»Wir brauchen eine Fackel«, flüsterte er, doch Margrite schüttelte langsam den Kopf.
»Sieh genau hin, dann kannst du alles erkennen.«
Anderlin bückte sich hinab und trat so nah wie möglich heran. Er zuckte zurück, als er im einfallenden Mondlicht in die weit geöffneten Augen Cecilies blickte. Trotz des aufkommenden Ekels zwang er sich, sie genauer zu betrachten. In ihrem Mund steckte ein Stoffbündel, das wohl dazu gedient hatte, ihre Schreie zu unterdrücken. Ihr Kleid war vom Halsbund bis fast hinunter zur Taille aufgerissen und ließ einen Teil ihrer nackten Brust erkennen. Ihr Rock war bis über die Hüfte hochgeschoben, ihre Beine nackt und eigenartig verkrümmt, so als ob sie gar nicht zu Cecilies Oberkörper mit den seitlich gerade ausgestreckten Armen gehören würden. Eine große Blutlache hatte sich um sie herum ausgebreitet, ohne dass Anderlin in der Dunkelheit jedoch eine offene Wunde an ihrem Körper hätte ausmachen können.
»Dieses Schwein«, war das Einzige, was Anderlin entfuhr. Margrite sagte nichts. Vorsichtig schlossen sie die Tür wieder hinter sich, und Anderlin atmete mehrmals tief ein und aus. Der Schreck war ihm in alle Glieder gefahren. Mit seinen mehr als vierzig Lebensjahren hatte er schon so einiges gesehen. Doch eine dergestalt zu Tode gequälte Kreatur ließ Übelkeit in ihm aufsteigen und entsetzte ihn zutiefst.
»Was sollen wir jetzt tun?«
Margrite überlegte einen Moment. »Ist der Wirt gestern noch heimgekehrt, wie der Junge es angekündigt hat?«
Anderlin nickte. »Ja, kurz nachdem du gegangen bist.«
»Dann müssen wir ihn wecken und ihm die Schweinerei da drinnen zeigen.«
»Was ist, wenn er uns nicht glaubt und behauptet, wir seien das gewesen?«
Der Gedanke war Margrite auch schon gekommen, doch sie hatte ihn sofort wieder verworfen.
»Warum hätten wir so etwas tun sollen? Sie gehörte zu uns. Während sich der Kerl, der gestern noch hier war, dagegen klammheimlich mitten in der Nacht auf und davon gemacht hat.«
Anderlin rieb sich nachdenklich das Kinn. »Du hast recht. Wenn wir die anderen zusammenrufen und uns ebenfalls davonstehlen, würde das nur gegen uns sprechen und unsere Lage verschlechtern.«
»Du gibst dem Wirt Bescheid. Ich wecke die anderen und berichte ihnen, was geschehen ist.«
Anderlin ballte die Hände zu Fäusten. »Wir dürfen das Schwein nicht entkommen lassen.«
»Der ist doch längst über alle Berge.« Ihre Stimme klang traurig. »Aber so etwas hat der nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal gemacht. Dennoch wird er seine Strafe noch bekommen.« Sie wollte zur Scheune hinübergehen, doch Anderlin hielt sie am Arm zurück.
»Du hast es gewusst, nicht wahr?«
Margrite zuckte mit den Schultern. »Ich habe geahnt, dass er gefährlich ist. Aber an so etwas habe ich nicht gedacht.«
Er hielt sie noch immer an ihrem Arm fest. »Woher?«