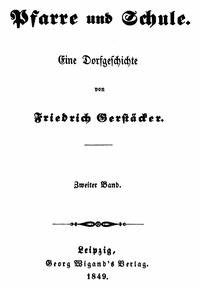0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Ähnliche
Der Erbe.
RomanvonFriedrich Gerstäcker.
Die Uebersetzung dieses Werkes in fremde Sprachen wird vorbehalten.
Zweiter Band.
Jena,Hermann Costenoble. 1867.
Inhaltsverzeichniß.
Seite
1.
Am Krankenbett
7
2.
Zwei Glückliche
24
3.
Frau Heßberger
54
4.
Neben der Werkstätte
86
5.
Die Werbung
112
6.
Staatsanwalt Witte zu Hause
136
7.
Bei der Leiche
164
8.
Der Raubmord
185
9.
Die Untersuchung
222
10.
Verschiedene Eindrücke
248
11.
Rath Frühbach
275
12.
Die Nachbarin
296
13.
Das Geständniß
323
1. Am Krankenbett.
Ungleich der stürmischen oder doch bewegten Unterhaltung im unteren Theil des Schlosses verhandelten die Personen im oberen, in Benno's Krankenstube, und Benno selber saß mit hochgerötheten Wangen in seinem Bett und lauschte der Erklärung Baumann's, der vor ihm auf einem kleinen Tische die mitgebrachte Maschine stehen hatte und jetzt ihre Wirksamkeit beschrieb.
»Aber woher haben Sie das wunderliche Ding, Baumann?« sagte der Knabe mit blitzenden Augen, denn sein ganzes Interesse war geweckt worden. »Doch nicht selber gefertigt? Das sieht ja gerade so aus, als ob es schon über hundert Jahre alt wäre.«
»Das ist es auch vielleicht, lieber Baron,« erwiederte der junge Mechanikus, »und eine nicht ganz werthlose Antiquität, die dem alten, reichen Salomon gehört.«
»Aber was, um Gottes willen, stellt es vor? Was bezweckt es? All' die vielen Räder, die schwere Kugel dann und die Hebel!«
»Es sollte ein altes Problem lösen,« lächelte Baumann, »das perpetuum mobile.«
»Um vielleicht durch ein perpetuum immobile zu beweisen, daß es auch das Gegentheil geben müsse,« lachte Benno, der seine Krankheit ganz vergessen hatte. »Wie komisch das ist! Es rührt und regt sich ja gar nicht.«
»Weil es noch nicht in Gang gebracht ist,« erwiederte Baumann; »wenn das aber geschieht – und wir wollen das gleich einmal thun –, so kann ich Ihnen versichern, daß es ununterbrochen fortläuft und kein Aufhören mehr zu berechnen ist, die Zeit natürlich ausgenommen, wo sich das Material selber abnutzt und die Räder ausgeleiert werden – ein Nachtheil, der allen Menschenwerken anhängt, ob er sie nun später oder früher ereilt.«
»Und wie kommen Sie dazu, Baumann?«
»Es war die erste Arbeit, die mir, seit ich mich selbstständig etablirt habe, anvertraut wurde,« sagte der junge Mechanikus, »und ich glaube, ich habe meine Aufgabe ehrenvoll gelöst, denn der alte Salomon versicherte mir, er hätte das kleine Werk schon in alle größeren Städte Deutschlands, zu den berühmtesten Arbeitern gesandt, ohne es je reparirt zu bekommen. Die Antwort von Allen habe gelautet, sie wollten lieber etwas Aehnliches neu herstellen, als den Fehler finden, der hier die Räder verhinderte, fortzuarbeiten. Und doch lag das Ganze nur an einer Kleinigkeit, an einem falsch eingesetzten Rädchen, das vielleicht einmal eine ungeschickte Hand beim Reinmachen herausgenommen und, da es Aehnlichkeit mit einem andern hatte, nicht wieder an die rechte Stelle brachte. Das aber störte natürlich die Arbeit des ganzen Werkes, weil seine Zähne etwas weiter aus einander stehen.«
»Und Sie fanden den Fehler?«
»Gewiß, und Sie sollen sich jetzt selber überzeugen, wie günstig und glatt es geht. Drei Tage und drei Nächte habe ich es schon bei mir im Zimmer in Gang gehabt; es arbeitet vortrefflich, und ein Ablaufen des Räderwerkes ist, so lange die Räder selber in Ordnung bleiben, gar nicht denkbar.«
Er hatte dabei die Messingkugel auf einen bestimmten Punkt gelegt und ließ sie dort auf einen Hebel fallen; dadurch kam das ganze Räderwerk in Gang, und die Kugel selber wurde langsam, aber in genau abgemessener Weise nach und nach und von Zahn zu Zahn wieder hinauf an ihre alte Stelle gebracht, um ihren Kreislauf dort von Neuem zu beginnen. Jedesmal aber, wenn sie den Punkt erreichte und dann wie vorher ab und auf den Hebel traf, brachte sie das Ganze von Frischem in Gang.
Kathinka, die sich noch im Zimmer befand, hatte der kleinen Maschine, an der sich Benno nicht satt sehen konnte, mit vielem Interesse zugeschaut, aber doch dabei manchmal aus dem Fenster gehorcht, denn es war ihr fast, als ob sie unten die scharfe, keifende Stimme des Fräuleins von Wendelsheim hörte. Was war da wieder vorgefallen – und sicher trug wieder der Baron Bruno daran die Schuld, der eben dort zum Thore hinaussprengte, oder hatte wenigstens die Ursache gegeben. Sollte sie selber jetzt hinuntergehen? Es war wohl besser, sie wartete noch eine kurze Zeit, bis der Sturm ein wenig ausgetobt; sie mochte der »Tante« nicht muthwillig in den Weg laufen.
Eine Viertelstunde verging noch so, und Benno konnte nicht müde werden, das kleine Kunstwerk zu beobachten, das, freilich immer nur eine Spielerei, doch dem Verfertiger alle Ehre machte, als plötzlich die Thür rasch geöffnet wurde und Tante Aurelia einen Blick in's Zimmer warf.
»So,« rief sie dabei, »und Du sitzest noch hier, die Hände im Schooß, und weißt gar nicht, daß unten Alles auf dem Kopfe steht? Und Benno soll seinen Thee wohl ebenfalls kalt trinken, Mamsell, heh? Haben wir Dich deshalb in's Haus genommen und die langen Jahre gefüttert, um nur eine Hofdame aus Dir zu machen, die sich Morgens in Staat wirft und dann den ganzen Tag spazieren geht?«
»Ich wußte nicht, daß es schon so spät war,« sagte Kathinka schüchtern und glitt an der Zornigen vorbei aus der Thür, während die Tante ihr nachzankte: »Und wozu hast Du Deine Augen, als Dich selber darum zu bekümmern und nach der Uhr zu sehen, Du nachlässiges Ding Du! Den jungen Leuten nachlaufen, ja, das kann sie, aber zu sonst ist sie auf der Gotteswelt nichts nutz, und ich erlebe doch hoffentlich auch noch die Zeit, wo wir die Bürde hier vom Halse los werden!«
Kathinka hatte wahrscheinlich nicht die Hälfte der harten Worte mehr gehört, denn sie war in Schreck und Scham die Treppe hinabgesprungen. Benno aber, als sie die Thür wieder schloß, jedenfalls um ihr nachzugehen und ihre Strafpredigt fortzusetzen, seufzte recht tief auf und sagte traurig: »Das arme, arme Mädchen! Sie ist so gut und brav, arbeitet von früh bis spät und pflegt mich, wie es eine Mutter nicht besser könnte, und nie ist die Tante mit ihr zufrieden; immer und ewig zankt sie und macht ihr unser Haus zu einer Hölle. O, daß ich nur gesund wäre und ihr beistehen könnte! Aber wenn ich nur laut reden will, sticht es mich hier so in der Brust, und ich muß dann stundenlang regungslos auf meinem Kissen liegen.«
»Ich glaube,« sagte Baumann leise, »das gnädige Fräulein Tante zankt mit Jedermann und braucht täglich einen gesunden Skandal, um sich bei frischen Kräften zu erhalten. Es ist auch so eine Art perpetuum mobile, das ich aber, aufrichtig gesagt, lieber nicht repariren möchte, wenn es einmal aufhören sollte zu arbeiten.«
»Sie haben recht, Baumann,« lächelte Benno, »und ihre Zunge ist die Kugel, die stets auf's Neue das ganze Räderwerk in Bewegung setzt, denn schon nach den ersten Worten arbeitet sie sich selber in die größte Aufregung hinein. Nur mit mir zankt sie nicht, so gern sie es auch manchmal möchte, und daß Sie mich besuchen, scheint ihr auch nicht angenehm zu sein.«
»Ich habe wenigstens noch nie einen freundlichen Blick oder Gruß von ihr bekommen.«
»Dessen können sich überhaupt nur wenig Menschen rühmen,« seufzte Benno. »O, warum sich und Anderen das Leben so schwer machen! Es ist doch so schön und, ach, so kurz!«
Kathinka trat herein und brachte den Thee, setzte ihn aber nur auf den Tisch und verließ augenblicklich das Zimmer wieder. Sie hatte rothgeweinte Augen und wollte die wahrscheinlich nicht vor den jungen Leuten sehen lassen.
Baumann's Blick haftete auch mit innigem Mitleiden auf ihr; sie war so jung und so unglücklich schon, stand so ohne Schutz und Freunde da, und ertrug doch Alles mit so stiller Demuth, ohne ein einziges Wort der Widerrede! Er hatte auch wirklich einen bittern Fluch gegen die »steinerne Tante« auf den Lippen, verbiß ihn aber, um Benno nicht wehe zu thun, und setzte nun langsam die Maschine außer Gang und zurück neben seinen Hut.
»Sie wollen doch noch nicht fort, Baumann?« fragte Benno rasch. »Du lieber Gott, dann bin ich ja ganz allein, denn Kathinka hat die Tante weggejagt und Bruno ist ja auch wieder fortgeritten, er wäre sonst gewiß noch einmal heraufgekommen.«
»Ich kann noch etwas bleiben, lieber Baron, aber ich fürchte, Sie regen sich zu sehr auf. Sie sehen jetzt schon so blaß aus.«
»Weil ich mich über die Tante geärgert habe,« sagte der Knabe. »Weshalb zankt sie immer mit der armen Kathinka – ich bin ja auch gar nicht krank mehr, nur noch schwach, wie mir der Doctor selber gesagt hat, und nur ausruhen soll ich mich, recht ordentlich ausruhen, damit ich wieder zu Kräften komme – könnt' ich nur fort von hier!«
»Aber wohin?« fragte Baumann.
»Bruno hat mir versprochen,« fuhr der Knabe mit leuchtenden Blicken fort, »wenn er jetzt das viele Geld von seiner großen Erbschaft bekommt, was ja nur noch wenige Wochen dauert, dann macht er mit mir eine Reise nach Italien. Dort ist weiche, warme Luft, dort erhol' ich mich gewiß in so viel Tagen, wie hier in Monden, und dann nehmen wir Kathinka als Krankenpflegerin mit – ja, Baumann, gewiß! Ich habe es schon Alles mit meinem Bruder ausgemacht – ich brauche noch Pflege unterwegs, wenigstens in der ersten Zeit – aber die Tante,« setzte er lächelnd hinzu, »die lassen wir hier in dem alten, öden Schlosse, wo es mir immer ist, als ob die Mauern über mir zusammenbrechen müßten, und dann kann sie nicht mehr mit Kathinka zanken, und sie wird wieder heiter und glücklich werden und wieder lachen – ach, Baumann, Sie sollten sie einmal lachen hören, wie herzlich, wie lieb das klingt! Aber,« setzte er leise hinzu, »es ist schon lange her, daß ich es nicht mehr gehört habe, und es thut mir doch so wohl.«
Er lag viele Minuten still und regungslos, und Baumann, das Herz von innigem Mitleiden mit dem Armen erfüllt, wagte selber nicht das Schweigen zu brechen. Welchen Trost hätte er ihm auch geben können? Endlich sagte Benno wieder:
»Wo nur der Vater heute sein mag, daß er nicht ein einziges Mal zu mir heraufkommt, und er weiß doch, wie ich mich immer freue, ihn hier zu sehen – aber freilich,« setzte er seufzend hinzu, »bei mir hier oben ist es so langweilig, und er hat so wenig Geduld – da ist die Kathinka besser, und wenn sie dürfte, säße sie halbe Tage lang an meinem Bett und erzählte mir ihre wunderhübschen Geschichten. Ach, sie kann so schön erzählen, Baumann, und wenn sie es thut, seh' ich all' die Personen, die sie beschreibt, all' die Feen und Elfen mit ihren lieben Gestalten um mein Bett stehen, und es wird mir dann so wohl, o, so wohl...«
Er sank zurück, Todtenblässe deckte seine Züge, er war ohnmächtig geworden, und Baumann zog jetzt die Klingel, um Hülfe herbeizurufen, aber nur die Magd erschien. Das gnädige Fräulein Tante war unten in den Ställen und zankte sich gerade mit einer der Viehmägde, Fräulein Kathinka war aber in den Garten geschickt, um dort die Blumen zu begießen.
Benno erholte sich jedoch, wie ihm nur Baumann ein nasses Tuch um die Stirn legte, rasch von selber wieder; aber er war jetzt so schwach geworden, daß er nach Ruhe verlangte.
»Ich will schlafen,« sagte er leise, indem er dem Freund die Hand reichte – »heute bin ich recht elend, aber wenn Sie wieder herauskommen, finden Sie mich von allen Schmerzen frei – dann beginnt eine glückliche Zeit. Leben Sie wohl, mein guter Baumann!« Er drehte sich ab und legte sich auf die Seite. Baumann sah nur noch die eingefallenen Wangen, die hohlen Schläfe und geschlossenen Augen. Es war ihm, als ob er einen Todten verließ, als er, seine Maschine im Arm, die Thür des Zimmers hinter sich zudrückte.
Er stieg langsam die Treppe hinunter und betrat durch eine Seitenthür den Garten – es wurde unten im Park an dem einen Theile der Mauer gebaut, und er wußte, daß er dort hinaus ein bedeutendes Stück seines Weges abschneiden konnte –, aber er mußte an dem Gartensaal vorüber, und als er die Thür desselben passirte, bemerkte er den alten Freiherrn, der dort, die Stirn noch immer an die Glasscheibe gelegt, stand und anscheinend hinaus in den Garten sah. Im ersten Momente wollte er ihn auch anreden und ihm sagen, daß Benno wieder eine Ohnmacht gehabt. Der Kranke schlief aber jetzt gerade; wenn der Baron hinaufging, störte er ihn nur wieder. Das vorher gerufene Mädchen würde es schon der Tante sagen; er selber beschloß, nichts davon zu erwähnen. Nur als er vorüberging, zog er seinen Hut ab und grüßte den alten Herrn, dessen stieres Auge auf ihm haftete – aber ob er ihn trotzdem nicht sah? Er dankte wenigstens nicht, noch gab er irgend ein Zeichen der Erkennung. Still und regungslos stand er an der Glasthür und starrte, wie in das Leere, in die grünen Büsche und Sträucher hinein. Dem jungen Mann wurde es auch ganz unheimlich, als er ihn da so stehen sah. Was um Gottes willen war vorgegangen, das den alten, sonst so strengen und kalten Herrn dermaßen erschüttern und von seiner nächsten Umgebung ablenken konnte!
»Soll mich der Himmel vor Macht und Reichthum bewahren,« flüsterte Baumann leise vor sich hin, als er durch die laubigen Gänge des Parkes schritt, »wenn ich sie solcher Art mit meinem Seelenfrieden erkaufen mußte! Wie kummervoll der Mann aussieht! Hat er vielleicht von dem neuen Anfall des jüngsten Kindes gehört und sorgt sich darüber? – armer Vater! – Oder ist es etwas Anderes, das ihn drückt? Wenn so, dann müßte er es auch allein tragen, denn er hat keinen Freund, dem er sich anvertrauen könnte oder wollte.« Er war wohl ein »vornehmer Herr,« aber er stand allein, trostlos allein in der weiten Welt, und Niemand half ihm seine Lasten tragen, und doch war der Glanz und Prunk, der ihn umgab, und das Meiste von alledem, nur noch gemacht, wie Baumann recht gut wußte. Ein übertünchtes Elend, um Rang und Stand mit den letzten, fast erschöpften Kräften aufrecht zu erhalten, und das Alles ohne die Spur von häuslichem Glück und Frieden, und nichts in dem großen, öden Schlosse, als Stolz, Haß und Unfriede, und dazwischen den lauernden Tod am Krankenbett des Sohnes!
Baumann war, in seine trüben Gedanken vertieft, rasch durch den Park jener Stelle zugeschritten, an welcher, wie er wußte, die Mauer niedergeworfen worden und eben neu aufgebaut werden sollte. Er hatte auch auf seine Umgebung wenig oder gar nicht geachtet, als er plötzlich ein lichtes Kleid durch die Büsche schimmern sah und gleich darauf Kathinka erkannte. Sie kam gerade, eine große, aber jetzt leere Gießkanne in der Hand, von den ihr anvertrauten Beeten her und wollte nach dem Schloß zurück. Als sie Baumann bemerkte, war es auch fast, als ob ihr Fuß einen Moment zögerte; sie wäre ihm in der That am liebsten ausgewichen, denn ihre Augen zeigten noch Spuren von vergossenen Thränen, und sie scheute sich, die den Fremden sehen zu lassen; aber es ging nicht mehr, er war schon zu nahe herangekommen, und Baumann selber ging auf sie zu, um ihr den Unfall mitzutheilen, der Benno während ihrer Abwesenheit betroffen.
»Du lieber Gott,« rief sie erschreckt aus, »der arme junge Mensch! O, nicht einen Augenblick sollte er allein gelassen werden – sie wissen ja gar nicht, wie krank er ist, sie können es nicht wissen, oder sie würden anders handeln. Ich will gleich zu ihm.«
»Lassen Sie ihn jetzt,« sagte Baumann freundlich; »er ist eingeschlafen, und die Ruhe wird ihm gut thun; er bedarf ihrer.«
»Er wird bald von allen seinen Leiden ausruhen,« sagte Kathinka traurig – »bald und für immer.«
»Halten Sie seinen Zustand wirklich für so gefährlich?«
»Ich fürchte, ja. Er hat die letzten Tage an Kräften in erschreckender Weise abgenommen, und seine Augen haben einen so unheimlichen Glanz bekommen.«
»Der arme, arme Benno, wie wenig Freude hat er noch im Leben gehabt, und so jung schon sterben – sterben jetzt, da vielleicht in dem Reichthum seines Bruders und dem neu erwachenden Glanz des Hauses auch ein besseres Dasein für ihn beginnen könnte! Glauben Sie nicht?« fuhr er fort, als Kathinka leise mit dem Kopf schüttelte. »Bruno würde gewiß freundlich mit ihm sein, er ist von Herzen gut und hat ihn lieb.«
»Ja,« sagte Kathinka, »Bruno schon, aber die Tante ist der böse Geist im Hause, der kein Glück und keinen Frieden aufkommen läßt, und ich selber hätte es auch schon lange verlassen, wenn ich nicht Benno's wegen bliebe. Aber er hat sich so an mich gewöhnt, daß er ganz unglücklich sein würde, wenn ich ginge – sonst lieber trocken Brot unter Fremden essen,« setzte sie leise hinzu.
»Sie haben ein schweres Leben hier im Hause, mein armes Fräulein,« sagte Baumann mitleidsvoll, »und ich begreife da wirklich die Tante nicht, denn sie hat Benno lieb, das zeigt sich in Allem, und doch kränkt sie ihn so oft durch Sie. Er sagte mir selber heute, daß ihn das Zanken wieder krank gemacht.«
»Ich muß zum Hause zurück,« erwiederte Kathinka ausweichend. »Benno könnte aufwachen und nach mir verlangen, und meine Arbeit ist hier beendet. Leben Sie wohl, Herr Baumann!« Und mit leichten Schritten eilte sie den Gang hinab dem Schlosse zu.
Fritz Baumann verließ den Park heute mit recht schwerem Herzen. Er hatte den kranken Knaben wirklich liebgewonnen, und wie lange konnte es noch dauern, bis er in der kühlen Erde ruhte! Dann kehrte auch er nicht mehr in den Schatten dieser Bäume zurück, dann war auch ihm der Weg hieher abgeschnitten, denn er fühlte recht gut, daß ihn der Baron wie die Tante hier nur Benno's wegen duldeten. Er selber würde sie auch nie aufgesucht haben.
Er stand noch und sah zu dem Schloß nachdenkend zurück, das gerade hier, bei einer Biegung des Weges, durch die dichten Wipfel sichtbar wurde, als er plötzlich das schmerzliche Winseln und Heulen eines Hundes und scharfe Peitschenschläge auf dessen Rücken hörte. Es war der Revierförster, der seinen Dachs an der Leine hatte und aus irgend einem Grund jämmerlich abprügelte.
»Du großer Gott,« sagte Baumann fast unwillkürlich vor sich hin, »ist das ein trostloser Platz hier – nicht einmal ein Hund kann sich da wohl fühlen! Ich will dem Himmel danken, wenn ich ihn nicht mehr zu betreten brauche!« Und rasch ausschreitend, erreichte er bald darauf die Parkbrücke und gleich dahinter die freie Straße, wo er ordentlich aufathmete, als ob er einem Gefängniß entwichen sei.
2. Zwei Glückliche.
Bruno von Wendelsheim war in scharfem Trab in die Stadt zurückgeritten, aber heute wahrlich in keiner so gedrückten Stimmung, als er sonst wohl das väterliche Haus verlassen; denn jenes ruhige Gefühl überkam ihn dabei, das uns immer ergreift und beherrscht, wenn wir nach langen, peinigenden Zweifeln über irgend einen wichtigen Abschied unseres Lebens zu einem bestimmten und festen Entschlusse gekommen sind.
Liebe – wann hatte er Liebe je in seinem Vaterhaus gefunden? Nie, nie! Nur mit Furcht war er erzogen und geleitet worden, nur Furcht hatte er vor dem strengen alten Herrn gekannt, bis er heranwuchs und auch diese abschüttelte. Dann war nichts geblieben, als das Bewußtsein, daß er dem Manne, als seinem Vater, Achtung und Gehorsam schuldig sei – aber nur Gehorsam so weit, als es nicht sein eigenes Lebensglück, seine ganze Zukunft betraf, die zu leiten er durch seine Härte und Gleichgültigkeit schon des Rechtes verlustig gegangen war.
Als er heute Morgen hinaus nach Wendelsheim ritt, war er denn auch nur darauf gefaßt gewesen, nach seiner Erklärung einem Sturm von Vorwürfen und Zornesworten zu begegnen, die ja auch kaum ausbleiben konnten, da er zum ersten Mal es wagte, nicht allein vollkommen unabhängig seinem Vater entgegenzutreten, nein, ihn sogar an seinem verwundbarsten Punkt, seinem alten Adelsstolz, seinem unantastbaren Stammbaum zu verletzen. Daß er gänzlich unvorbereitet darauf war, ihn, statt aufbrausend und wüthend, nur weich und schmerzbewegt, ja, wie gebrochen zu finden, läßt sich denken; er würde es nie im Leben für möglich gehalten haben, und so überrascht, so erschüttert selbst fühlte er sich davon, daß er sogar für einen Moment schwankend in seinem Entschluß wurde, um von dem alten Mann den Schmerz zu nehmen, bis die Tante mit ihrem kalten, höhnischen Blicke in's Zimmer trat und mit ihrem Augenblick Alles, Alles zurückrief, was er in seinem Leben hier erduldet.
Seine ganze, ihm abgestohlene und mißhandelte Jugend lag bei ihrem Anblick vor seinen Augen; all' die Thränen, die er im Stillen geweint, all' der heimliche Ingrimm, den sie in die Kindesbrust gepflanzt und mit ihm groß gezogen, aber immer nur genährt, nie auch selbst durch ein freundliches Wort gemildert hatte, und gerade das Bewußtsein, ihrem starren, keines guten Gedankens fähigen Herzen noch einmal einen Streich zu versetzen, sie endlich einmal fühlen und wissen zu lassen, daß ihre Herrschaft vorbei sei und sie aufgehört habe, den Knaben zu meistern, warf alles Mitleid für den Vater über Bord. Er sah nur seine geopferte Jugend, fühlte nur, zum ersten Mal in seinem Leben, das Bewußtsein in sich erwachen, zu vergelten, und in der wonnigen Empfindung, gerade dieser Frau den Fehdehandschuh hinwerfen zu können, gerade ihr zu zeigen, daß ihr Regiment über ihn aufgehört und sie darauf verzichten müsse, ihn als Knaben zu behandeln, vergaß er selbst den Schmerz des Vaters über das ihm zugefügte Leid.
Jetzt war es geschehen, der Würfel gefallen, und ihm blieb nichts weiter übrig, als nach seinem Gefühl zu handeln.
Damit trabte er auf seinem Weg dahin, und noch nie war ihm der Himmel so blau, die Erde so frisch und maiengrün, die Luft so mild, der Vögel Sang so lieb erschienen, wie gerade heute, wo er nicht allein zum ersten Mal seinem Herzen folgen, sondern auch eine heilige Pflicht erfüllen durfte, die ihn lange gedrückt.
Daß ihn Rebekka liebte – wie konnte es ihm Geheimniß bleiben, da des Mädchens ganze Seele ja in dessen Augen lag? Und wenn es ihn bis jetzt nur immer in das Haus, in das trauliche Stübchen des alten Salomon zog, so verließ er es auch jedesmal mit den bittersten Vorwürfen gegen sich selbst, daß er eine Leidenschaft nähre und unterhalte, der er, wie er damals dachte, nie gerecht werden durfte. Und doch war er nicht im Stande, jenen Zauber zu meiden, den Rebekka schon selber auf ihn ausübte, und der alte Salomon schüttelte wohl oft, von ihm ungesehen, den Kopf, wenn er mit dem Mädchen am Instrument saß und die Tochter dann, glücklich in der Nähe des Geliebten, mit jubelnder Stimme ihre Lieder sang.
Er, der alte Salomon, kannte die Verhältnisse der Menschen draußen auf dem Schauplatz, den wir die Welt nennen; er kannte sie besser wohl als tausend Andere, denn er hatte mit allen Schichten der Bevölkerung und besonders mit den Großen und Vornehmen verkehrt, und er war von ihnen geschmeichelt und auf Händen getragen oder auch unter die Füße getreten worden, gerade wie man ihn gebrauchte. Er kannte aber auch die Ansichten, den Stolz und Hochmuth dieser Leute, die, was ihren Stammbaum betraf, doch hätten zu dem Juden mit Neid und Bewunderung aufsehen müssen, denn keiner von allen leitete so weit zurück als dessen Abstammung, die zu Abraham hinaufreichte. Aber ihre Standesvorurtheile machten sie blind – blind gegen Alles, nur nicht gegen ihren eigenen Werth, und Salomon wußte gut genug, daß sie, so hoch sie sich selber überschätzten, eben so tief den Juden verachteten, den sie wohl gebrauchen und benutzen konnten, wo er ihren Zwecken diente oder ihnen nöthig wurde, dem sie aber sonst nie verstattet hätten, auch nur in ihre Nähe sich zu wagen, viel weniger denn auf gleichen Rang, auf gleiche Stufe mit ihnen zu treten.
Und was sollte da aus einer Liebe werden, die er im Herzen der Tochter gegen Einen jenes, ihnen stets fremd gebliebenen Stammes sich entwickeln sah? Er fürchtete das Hoffnungslose einer solchen Leidenschaft, aber wagte, aus Liebe zu dem einzigen Kinde, nicht einmal einen Einspruch zu thun, ja, ihr nicht einmal die Gefahr zu nennen, in der sie schwebe, aus Furcht nur, die Gefahr gerade dadurch erst heraufzubeschwören.
Er mochte den jungen Officier wohl leiden: er war anders, als die Uebrigen seines Standes und Gewerbes, und hatte sich seit der Zeit, wo er zufällig einmal Rebekka im Laden ihres Vaters gesehen und kennen gelernt, stets so achtungsvoll und dabei so einfach und herzlich betragen, daß er es nicht über sich gewinnen konnte, ihn abzuweisen – und doch wäre es vielleicht besser, viel besser gewesen. Damals nun, als er zu ihm um das Anlehen kam und er es ihm verweigerte, glaubte er den Zeitpunkt gekommen, wo er ein Verhältniß abbrechen konnte, das anfing ihm Sorge zu machen. War einmal das Capitel »Geld« zwischen ihm und Rebekka besprochen und verhandelt worden, dann wußte er recht gut, daß der Zauber schwinden mußte, der bis jetzt auf der seltenen Erscheinung des Geliebten gelegen – aber er hatte sich geirrt. Bruno fühlte das selber; er wagte das Wort nicht auszusprechen, und wenn er auch fast verzweifelnd das Haus verlassen mußte, das einzige Wesen auf der weiten Welt, das ihn wirklich liebte, sollte nie einen Schatten auf seiner Ehre sehen.
Damit war der ganze Plan des alten Salomon in Trümmer gegangen und das gerade beschleunigt, was er vermieden haben wollte – eine Erklärung der Beiden, ein Erkennen und Sichbewußtwerden des Gefühls, das nun natürlich nicht mehr zurückgehalten werden konnte. Was nun kam – er mußte der Sache ihren Lauf lassen, sah aber die Zukunft, trotzdem daß seine Frau und Rebekka darin schwelgten, in einem trüben, traurigen Licht – und er war ein Mann, der viel, viel erlebt hatte und sich nicht so leicht in etwas täuschen ließ. – Aber wo blieb indessen der Baron? Seit jenem Tage, an welchem er den Wechsel erhalten, waren acht, waren vierzehn Tage verflossen, ohne daß er sich im Hause Salomon's wieder hätte sehen lassen. Rebekka erwartete seine Rückkunft mit heißem Sehnen, der Vater zählte ebenfalls die Tage, aber aus einem andern Grunde; denn jeder schwindende Tag bestätigte nun mehr und mehr seine Ueberzeugung, daß Baron von Wendelsheim doch endlich selber eingesehen habe – leider, leider nur zu spät für sein armes Kind –, der reiche Baron passe nicht in die Familie des Juden.
Bruno von Wendelsheim ritt indessen fröhlich seine Bahn entlang. Er war mit sich im Reinen, und wenn er auch wochenlang gekämpft und das Für und Wider erwogen, jetzt kannte er nur ein einziges Ziel: das Haus der Geliebten, und dem eilte er entgegen, so rasch ihn sein altes Pferd nur tragen konnte.
An seiner Wohnung hielt er an, um vorher sein Thier einzustellen und dann den Weg zu der Judengasse zu Fuß zurückzulegen; der alte Salomon hatte ja keine Stallung, und ein Officierspferd dort wäre nur aufgefallen. Dann reinigte er sich erst von dem Staub der Straße, überraschte auch seinen Burschen etwas durch den Vorwurf, daß er die Knöpfe der neuen Uniform lange nicht blank genug geputzt und den Rock selber nicht sauber ausgebürstet habe – denn sonst achtete er nie so viel auf sein Aeußeres, um deshalb je mit ihm zu zanken.
»Haben Sie Ihre Mappe schon nachgesehen? Es sind auch heute Morgen wieder ein paar Briefe gekommen, Herr Lieutenant,« sagte der Bursche, als Wendelsheim gerade das Zimmer verlassen wollte.
Bruno trat noch einmal zum Tisch zurück und öffnete die Mappe; es waren drei Briefe – zwei Rechnungen – er konnte das liniirte Formular schon durch das Couvert unterscheiden und kannte derartige Zuschriften nur zu gut; der dritte – kopfschüttelnd und rasch brach er ihn auf – wahrhaftig, er enthielt wieder den geheimnißvollen Fünfthalerschein, ohne weitere Andeutung, woher er kam, und auch das nämliche Siegel wieder, mit einem Fünfgroschenstück zugedrückt. Auch die Handschrift der Adresse war die nämliche wie früher. Wer, um Gottes willen, konnte nur der Geber dieser sich regelmäßig folgenden Geschenke sein, und durfte er sie länger annehmen, ohne sich vielleicht für spätere Zeiten eine lästige Verbindlichkeit aufzuladen? Aber es schien jetzt eben so unmöglich, sie zurückzusenden, als früher – denn wohin? Der Brief war hier in der Stadt jedenfalls, ohne Angabe des Inhalts oder Namens des Absenders, in einen Briefkasten geworfen und von der Post befördert worden.
Oft und oft hatte er auch schon daran gedacht, sich durch die Zeitung gegen derartige Zusendungen, die ihm jedesmal ein unangenehmes Gefühl hervorriefen, zu verwahren, sich aber immer gescheut, das öffentlich zu thun. Brauchte er denn aber seinen Namen zu nennen? So viel Leute gab es sicherlich nicht in der Stadt, die anonym fünf Thaler verschickten. Wenn er nur den Anfangsbuchstaben seines Namens darunter setzte, genügte das. Nicht einmal die Zeitungsexpedition brauchte zu wissen, wer die Annonce einrückte – sein Bursche sollte sie hintragen und nur abgeben – das Geld für die Insertionsgebühren konnte er hineinwickeln – das war das Beste – weshalb hatte er es nicht schon lange gethan? Ohne sich auch weiter zu besinnen, setzte er sich an seinen Tisch und schrieb auf einen Zettel:
»Der Unterzeichnete verbittet sich jede weitere Zusendung von Fünfthalerscheinen; das überschickte Geld ist wieder bei ihm abzuholen. Wo, wird der Absender wohl wissen.
W.«
»So,« sagte er, als er den ungefähren Betrag für den Abdruck hineinwickelte, »das hier trägst Du gleich auf die Expedition des Tageblatts und giebst es nur ab – verstanden?«
»Sehr wohl, Herr Lieutenant.«
»Und wenn Dich Jemand dort fragt, von wem die Annonce kommt, so nennst Du keinen Namen – Du weißt es nicht.«
»Sehr wohl, Herr Lieutenant.«
»Und wenn ich um acht Uhr noch nicht da sein sollte, brauchst Du nicht länger auf mich zu warten.«
»Sehr wohl, Herr Lieutenant.«
Lieutenant von Wendelsheim verließ seine Wohnung und schritt, alle anderen Gedanken von sich abschüttelnd, als nur die lieben, glücklichen an sein schönes Ziel, die Straße hinab.
Am Seitenwege, von seinem Hause gar nicht weit entfernt, grüßte ihn wieder eine ältliche Frau, und er sah sie, gedankenlos den Gruß erwiedernd, von der Seite an. Er kannte sie auch, hatte sie wenigstens oft auf der Straße gesehen; sie mußte jedenfalls hier in der Nähe wohnen – was kümmerte ihn die Frau!
Die Frau blieb aber noch lange, als er schon die Straße hinab und um die Ecke verschwunden war, stehen und sah ihm nach, und ein paar große, helle Thränen glänzten dabei in ihren Augen. Doch sagte sie nicht ein Wort, kein Laut kam über ihre Lippen, und nur still und schweigend wandte sie sich ab, drückte die zusammengefalteten Hände auf die Brust und verfolgte ihren Weg in entgegengesetzter Richtung, als die war, welche der Lieutenant eingeschlagen hatte.
Lieutenant von Wendelsheim beschleunigte indessen seine Schritte, um aus dem Menschengewühl der Hauptstraße zu kommen, und erst als er in die nur zu gut gekannte Seitengasse einbog, ging er langsamer, denn übergroße Eile wäre hier zu sehr aufgefallen. – Jetzt betrat er endlich das Judenviertel wieder, mit seinem ekelhaften Schmutz und fatalen süß-säuerlichen Geruch, der ihn jedesmal zwang, das Taschentuch an die Nase zu nehmen, und mußte hier wirklich Acht geben, um nicht an die überall umher spielenden, schauerlich schmutzigen Kinder anzustreifen, die allerdings nicht solche Rücksicht auf ihre Kleider nahmen. Scheue Blicke voll Ekel und Abscheu warf er auch nach rechts und links in die düsteren Spelunken hinein, die von Unrath strotzten und ihre faulen Dünste aushauchten. – Und diesem Volk entstammte Rebekka! – wie ein eisiges Gefühl zuckte es ihm durch's Herz – aber kaum eine Secunde lang. Das hier war ja nur der Abschaum der Masse, der Auswurf des ganzen zurückgesetzten und durch Jahrhunderte hindurch mißhandelten und unterdrückten Stammes, und welche edle Blüthen er treiben konnte, o, sein Mädchen, seine Rebekka war ihm da ja der schönste, der herrlichste Beweis!
Ohne weiter nach links oder rechts zu sehen, eilte er seine Bahn vorwärts die Straße entlang und athmete erst wieder auf, als er die Erweiterung und damit den besseren Theil derselben erreichte. Von da ab hatte er auch nicht mehr weit zu dem Haus des alten Salomon, und wenige Minuten später stand er auf der Schwelle.
Als er die Thür öffnete, sah er den alten Mann, der in seinem Laden, den Kopf in die Hand gestützt, vor einem dicken Buche saß und darin las.
Als er das Oeffnen der Thür hörte, hob er den Kopf, fuhr aber im nächsten Augenblicke schon erschreckt von seinem Sitze empor. Er hatte den Lieutenant erkannt, und so unerwartet mußte er ihm gekommen sein, daß er es ordentlich in den Gliedern fühlte und sich wieder hinsetzen mußte – er hatte für den Augenblick die Kraft verloren, aufrecht zu stehen.
»Mein lieber alter Freund! nicht wahr, ich bin lange geblieben, um mein Versprechen einzulösen?« rief Bruno und ging, ihm die Hand entgegenstreckend, auf ihn zu.
Der alte Mann nahm die Hand, aber er sagte leise: »Der Herr Baron hat nur versprochen, wiederzukommen, wenn die Zeit um ist, um die Wechsel einzulösen; ich weiß von nichts Anderem?«
»Von nichts Anderem, Salomon? – und Rebekka?«
Der alte Salomon schwieg und schaute lange und still vor sich nieder; er sah auch heute bleich und eingefallen aus – oder machte das nur das halbe Dämmerlicht des düstern, gewölbeartigen Ladens? Endlich stand er langsam auf.
»Setzen Sie sich, Herr Baron,« sagte er ernst, aber nicht unfreundlich, »ich habe ein Wort mit Ihnen zu reden; nicht Jude zu Baron, sondern Mann zu Mann oder, wenn Sie lieber wollen, wie Mensch zu Mensch, wie Vater zu Sohn – ich bin alt genug dazu, Gott weiß es, und Sie wissen, daß ich es immer gut gemeint habe mit Ihnen und Ihnen manchen guten, vernünftigen Rath gegeben die letzten Jahre – wollte der Herr, daß er gefallen wäre auf guten Boden!«
»Aber, bester alter Freund....!«
»Setzen Sie sich einen Augenblick, Herr Baron, es ist gut, daß wir allein sind,« unterbrach ihn der alte Mann; »wir können auch keine Störung gebrauchen und wollen keine. Ich werde den Laden schließen, Herr Baron – wie haißt Geschäft, wir Beide haben auch ein Geschäft mit einander, was ist wichtiger, als ob ich einen alten saracenischen Dolch oder einen Pfeifenkopf verkaufe.«
Salomon ließ keine Einrede gelten, zündete die Lampe an, ging vor die Thür, schloß selber die eisenbeschlagenen Läden, verriegelte die eben so verwahrte Thür oben und unten, drehte den Schlüssel um und kam dann langsam zu dem jungen Officier zurück, der ihn nach all' diesen feierlichen und mit der größten Ruhe ausgeführten Vorbereitungen doch nicht ganz ohne Herzklopfen erwartete. Als er dann wieder zur Lampe trat, zog er seinen Stuhl dem des Barons gegenüber, setzte sich und begann ohne weitere Umschweife.
»So, Herr Baron, jetzt sind wir zu Dreien: der liebe Gott und Sie und ich, weiter Niemand – braucht auch nie ein Mensch weiter auf der Welt zu wissen, was wir hier mitsammen haben gesprochen – und nun will ich Ihnen etwas sagen. Sie haben betreten mein Haus – nicht meinen Laden, mein' ich, wo ich mache Geschäfte und verkehre mit aller Welt, nein, das eigentliche innerste Heiligthum meines Hauses – auch nicht als Baron oder Cavalier, sondern als Freund vom alten Salomon, denn Barone oder Cavaliere kommen sonst nicht dahin. Sie haben dort gesehen mein Kind, meine Rebekka, und mein Kind hat Sie gesehen, und der Vater hat Sie gern gehabt, weil Sie ein gutes Gesicht und ein gutes Herz haben, und die Tochter hat Sie gern gehabt – nicht als Baron oder Cavalier, sondern als Freund vom Vater – und als Freund von sich. Sie haben mit ihr gemusicirt und gesungen – schöne Lieder, brave Lieder; mir altem Manne ist dabei das Herz aufgegangen, und ich habe mir gesagt: Kein böser Mensch kann so spielen, kann solche Musik machen, und der alte Salomon ist eingeschlafen in seiner Wachsamkeit, bis es war zu spät. Jetzt ist er aufgewacht, und er muß mit Ihnen reden, damit kein Unglück geschieht, nicht im Laden oder Geschäft, sondern im eigenen Hause.«
»Aber lieber, bester Salomon, deshalb bin ich ja gerade selber hieher gekommen!« sagte Bruno.
»Sind Sie?« wiederholte der alte Mann und sah ihn scharf und forschend an. »Nun, desto besser dann, um so leichter und schneller werden wir damit zu Stande kommen. Aber lassen Sie mich ausreden – ich muß reden, denn ich habe es die ganzen langen Wochen auf der Seele gehabt und es hat mir das Herz beinahe abgedrückt – ich muß reden, meinet-, Ihret- und Rebekka's wegen.«
»Und kann ich Euch nicht vielleicht vorher durch eine ganz einfache und bestimmte Erklärung beruhigen?« sagte Bruno.
Der alte Mann sah ihn rasch und forschend an. »Durch welche?« fragte er.
»Ich bin heute hieher gekommen, um bei Euch um die Hand Rebekka's anzuhalten.«
Salomon schwieg; er war augenscheinlich im ersten Moment überrascht und wußte nicht gleich, was er erwiedern sollte. Aber der kalte Verstand des alten Juden ließ sich nicht so rasch durch ein erwachendes Gefühl bewältigen; er hatte diesen Fall vorhergesehen, wenn auch vielleicht nicht in so bestimmter Weise ausgesprochen, und mit ruhigen, fast klanglosen Worten entgegnete er endlich:
»Da haben wir's – gerade wie ich vermuthet habe: heißes Blut und kleiner Verstand wirft den Wagen in den Sand. So hören Sie, Herr Baron, was ein alter Mann zu Ihnen sagt: die Erklärung macht Ihrem Herzen Ehre, und sie thut mir gut, weil sie mir beweist, daß ich mich nicht ganz in Ihnen geirrt. Sie glauben, Sie haben Ihr Wort gegeben, und Sie wollen es halten. Als Cavalier wollen Sie es halten und als gewöhnlicher Mensch – aber es geht nicht. Sie werden wohnen auf dem Schlosse Wendelsheim – wir werden wohnen in der Judengasse, und damit hab' ich gesagt Alles, was zu sagen ist. Sie werden haben wollen die Rebekka zur Frau, aber Ihr Herr Vater ist ein vornehmer, ist ein strenger Herr – er wird lachen, wenn Sie es ihm erzählen zum ersten Mal – er wird weinen, wenn Sie es ihm erzählen zum zweiten Mal, und er wird Ihnen seinen Fluch geben, wenn Sie es erzählen zum dritten Mal. Aber die Tochter des alten Salomon soll einziehen in ihre neue Heimath nicht mit des Vaters Fluch, nein, mit des Vaters Segen. Noch ist es Zeit, noch ist die Wunde nicht so tief geschlagen, daß nicht Jahre im Stande wären, sie zu heilen, und deshalb habe ich heute mit Ihnen gesprochen. Sie sind jetzt – lassen Sie mich ausreden, Herr Baron, ich bitte Sie – Sie sind jetzt nichts als ein armer Lieutenant, der Schulden gemacht hat, und glaubt, er wäre dem alten Salomon eine Verbindlichkeit schuldig, weil er sie für ihn bezahlt. Es spricht das für Ihr gutes Herz, aber nicht für Ihren Verstand. Sie werden sein in kurzer Zeit ein reicher Mann selber, ein Baron von altem Adel und Stammbaum – aber wenn Sie wirklich heiratheten des alten Juden Tochter würden Sie sich fühlen geschlagen und unglücklich Ihr ganzes Leben lang. Ich freue mich, daß Sie gekommen sind zu mir und um die Hand meiner Rebekka angehalten haben – wenn sie es auch nie erfahren wird –, ich bin stolz darauf, aber damit lassen Sie die Sache zu Ende sein. Ich liebe Sie, Herr Baron, ich glaube, Sie sind ein guter Mensch – aber ich liebe mein Kind mehr, und, Gott der Gerechte, wer kann's mir übel deuten? Sie würde sich unglücklich fühlen und elend sein, wenn sie in das alte Schloß einzöge und der alte Baron sagte: »Ich will nichts von ihr wissen – es ist des Juden Tochter!« Und Sie würden sich unglücklich fühlen, denn Sie sind der Sohn vom Vater, vom alten Herrn Baron; und die Diener und Mägde im Schlosse würden die Achseln zucken, und die Pferdejungen im Stalle von der Mißheirath sprechen, und der alte Salomon würde sich am unglücklichsten von Allen fühlen, denn er hält sein Kind lieb und werth, und wenn er einen Stolz hat auf der Welt, so ist es Rebekka – und sein ehrlicher, unbescholtener Name.«
»Und darf auch