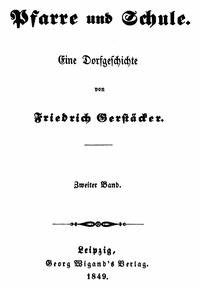0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Ähnliche
DerSoldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika.
Ein
Beitrag zur Kulturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts
von
Friedrich Kapp.
Zweite vermehrte und umgearbeitete Auflage.
Berlin.
Verlag von Julius Springer.
1874.
Seinem Freunde
Ludwig Bamberger
der Verfasser.
Lieber Bamberger!
Als ich Dir vor nunmehr zehn Jahren diese Blätter zuerst übersandte, lebten wir beide gezwungen im Auslande, der Eine in Paris, der Andere in New-York. Damals war der Soldatenhandel ein noch ungesühntes Verbrechen an unsrer nationalen Ehre und darum lastete er auf jedem politisch zurechnungsfähigen Deutschen wie eine persönliche Schmach.
Seitdem ist der Einheitsgedanke, von welchem in unsrer Jugend verhältnißmäßig nur wenige Tausend Köpfe erfüllt waren, durch Millionen von Armen verwirklicht, seitdem ist er mit anderen Worten aus der Theorie zur Praxis unsrer Politik geworden und hat bei Düppel und Königgrätz, bei Sedan und Paris solche überwältigende Beweise für seine Berechtigung geliefert, daß er unser Staatsleben auf neuer nationaler Grundlage wieder aufbauen konnte.
Heute leben wir Beide wieder im Vaterlande und kämpfen im Reichstage, in Reih' und Glied mit vielen alten und neuen Freunden, für die freiheitliche Entwicklung, die Größe und Ehre unsers endlich nach Außen hin geeinigten Volkes.
Der Soldatenhandel ist jetzt eine glücklich überwundene Vergangenheit, über welche wir uns nicht mehr zu grämen brauchen.
Aber ist auch die Erinnerung daran so ganz überflüssig geworden, hat das schmutzige Geschäft gar keine Beziehungen mehr zur Gegenwart?
Das scheint mir eine Frage, welche sich wohl der Beantwortung lohnt.
Allerdings ist seit 1866 „der ganz unhistorische, gott- und rechtlose Souverainitätsschwindel deutscher Fürsten“ in seinen schlimmsten Auswüchsen beschnitten; allerdings können uns die Kleinstaaten, seit ihnen die unbeschränkte Souverainität entwunden, nicht mehr vor uns selbst erniedrigen, noch uns dem Spott und Hohn des Auslandes preisgeben; vor Allem aber tritt den Leidenschaften und den Gelüsten der Kleinen ein fester und großer Staatsgedanke entgegen. Allein das dürfen wir uns nicht verhehlen: der unpolitische Sondergeist ist seit Jahrhunderten zu tief, zu mächtig in das deutsche Volk eingedrungen und hat in dessen Seele eine gewisse zähe Anhänglichkeit an die engeren Stammeseigenthümlichkeiten, einen theils eigennützigen, theils sogar uneigennützigen Partikularismus erzeugt, der von den bewußter und planvoller handelnden dynastischen Intriguanten noch heute höchst erfolgreich ausgebeutet wird. Nur auf Grund dieser Denkweise eines großen Theils unsers Volkes wird der fürstliche Widerstand gegen den einheitlichen Staat, welcher — wenn ich anders unsre geschichtliche Vergangenheit recht verstehe — das letzte Ziel unsrer politischen Entwicklung ist, zu einer positiven politischen Macht, mit welcher wir wohl oder übel rechnen müssen.
Vorläufig freilich ist ein leidlicher modus vivendi hergestellt; aber es bedarf keiner großen Sehergabe, um zu erkennen, daß er nur so lange andauern wird, als ihm nicht mächtige Anstöße von Außen oder Innen zu Hülfe kommen. Nicht wir, die Reichstreuen, werden die Feindseligkeiten beginnen. Die Kleinstaaterei wird und muß, vermöge ihrer zentrifugalen Naturanlage, mit der konsequenten Fortentwicklung der Reichspolitik zusammenstoßen; sie wird den ersten günstigen Augenblick benutzen und den ersten besten Vorwand ergreifen, um, wenn auch unter sich nicht einig, desto einiger im Widerstreben gegen die nationale Einheit, die verlorene Souveränität möglichst wieder zu gewinnen. Das ist die einfache Schlußfolgerung aus der Prämisse des höchst unvollkommnen Bundesstaates. Im Gegensatz zu anderen Bundesstaaten, welche ähnliche Uebergänge zu bestehen hatten, ist glücklicher Weise bei uns die Zentralgewalt unter Preußens Führung stärker als alle Glieder zusammengenommen, so daß der Ausgang des Konfliktes, wenn die leitende Vormacht ihrer Aufgabe nicht untreu wird, keinen Augenblick zweifelhaft sein kann. Er wird mit dem Siege der Staatsidee, der korrekten Durchführung des einheitlichen Staates enden.
Möglich, daß die feindlichen Gegensätze noch lange schlummern, und daß wir ihren Zusammenstoß nicht mehr erleben werden; aber erspart wird Deutschland dieser Kampf nicht bleiben. Die Kleinstaaterei ist unvereinbar mit der fortschreitenden Entwicklung, mit der Ehre und Größe unsers Volkes; ja selbst einzelne ehrenwerthe Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Ihr eigentlicher Charakter, den sie im Soldatenhandel mit so erschreckender Offenheit, wenn ich so sagen darf, in puris naturalibus hervorkehrt, ist bis auf den heutigen Tag unveränderlich derselbe geblieben; höchstens sind die Fragen, in denen er sich äußert, andere geworden. Möge unser Volk darum nicht vergessen, daß mit diesen geborenen Widersachern des nationalen Staates nicht paziszirt werden kann und nicht paziszirt werden darf.
Von diesem Gesichtspunkte aus schien mir selbst im Jahre 1874 eine neue Auflage des Soldatenhandels nicht allein nicht überflüssg, sondern sogar politisch lehrreich und fördernd.
Mögest Du auch diese neue Auflage mit den alten freundschaftlichen Gesinnungen aufnehmen!
DeinBerlin, 13. April 1874.
Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.
The whole is a mere mercenary bargain, for the hire of troops on one side and the sale of human blood on the other; and the devoted wretches thus purchased for slaughter, are mere mercenaries in the worst sense of the word.
Lord Camden, in dem Hause der Lords, Sitzung vom 5. März 1776.
Was ich in den folgenden Blättern erzählen will, ist ein trauriges Stück deutscher Geschichte, ein beschämendes und empörendes Bild unserer öffentlichen Zustände gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Allein so demüthigend es für unser Nationalgefühl auch sein mag, die umständliche Beschreibung der nackten und baar bezahlten Schande zu lesen, welche von dem Namen deutscher Fürsten auf den des deutschen Vaterlandes zurückfällt, so muß dieses Kapitel doch geschrieben werden; denn es ist keine bloße Vergangenheit, die wir glücklich überwunden hätten, sondern handgreifliche Gegenwart, deren Leiden und Schmerzen heute noch ungeheilt sind. Das Verbrechen, dessen Erzählung ich mir vorgenommen habe, ist noch nicht gesühnt; ja es wird noch täglich, wenn auch in zivilisirteren, minder verletzenden Formen überall da begangen, wo das Volk, ohne um seinen Willen gefragt zu werden, für fremde, nicht selten antinationale Zwecke geopfert wird. Die Ursachen, die es erzeugt haben, sind noch heute in derselben zersetzenden Kraft vorhanden; sie wurzeln in unsrer nationalen Zersplitterung, in der deutschen Kleinstaaterei. Trotzdem, daß wir gegenwärtig kaum noch drei Dutzend Souveraine haben, ist sie, wenn nicht noch unerträglicher, doch ebenso unerträglich und hinderlich für unser nationales Gedeihen, als vor nunmehr fast hundert Jahren, wo wir der Landesväter mehr als dreißig Dutzend zählten. Die Fortschritte auf allen übrigen Gebieten des Lebens, die Verwendung des Dampfes und der Elektrizität, die kolossale Verringerung von Raum und Zeit, die revolutionirenden Entdeckungen und Erfindungen in Kunst und Wissenschaft, sie alle haben das Uebel nur noch akuter gemacht, schroffer zum Bewußtsein gebracht und in grellern Widerspruch zu unsrer übrigen Existenz gesetzt. Was im vorigen Jahrhundert noch ein respektabler Mittelstaat war, der unter Umständen sogar nationale Bildungszwecke fördern konnte, ist heut zu Tage eine Anomalie, ein Gemeinschaden.
Die Großväter feilschten zur Aufrechterhaltung ihrer Scheinexistenz sogar noch um die zerschossenen Knochen ihrer Landeskinder und ließen sich ihre Leichen — 51 Thlr. 15 Sgr per Stück! — von England baar bezahlen. Die Söhne, die legitimen Herren von Gottes Gnaden, eilten, um sich nur noch eine Spanne süßen Daseins zu erkaufen, unter die schützenden Fittige des korsikanischen Advokatensohnes, des bürgerlichen Emporkömmlings, und stifteten unter seiner hohen Protektion den Rheinbund, wofür sie ihm ebenfalls ihre Landeskinder zu Hunderttausenden auf die von Spanien bis Rußland reichende Schlachtbank liefern mußten. Das Geschäft war ganz dasselbe, nur lautete der Kaufpreis anders und wurde dies Mal von Frankreich in deutschen Länderfetzen und Titeln, statt von England in baarem Gelde bezahlt. Der Kleinhandel des Jahres 1776 wurde eine Generation später Großhandel: das ist der ganze Unterschied. Und die Enkel? Sie sitzen noch auf den Thrönchen von Napoleon's Gnaden. Wenn sich nur ein Gewitter am politischen Himmel zeigt, so suchen sie natürlich Schutz beim Czaaren, bei Louis Napoleon, beim Kaiser von Oesterreich, oder beim Meistbietenden, wie es gerade das Interesse ihrer Person oder Dynastie erheischt. Die deutschen Fürsten also sind und müssen wegen ihrer Ausnahmestellung sein, was sie waren; sie können nicht anders, selbst wenn sie wollten. Was vor hundert Jahren von ihnen galt, gilt daher noch heute von ihnen.
Das deutsche Volk dagegen strebt mit unwiderstehlicher Macht aus den feudalen Zuständen heraus. Seit der Reformation seinem Wesen und Beruf als Großmacht entfremdet, seit dem westfälischen Frieden durch die von diesem anerkannte Souverainität der früheren Reichsvasallen in sich uneins und schwach, darum zum Schleppenträger fremder ausländischer Interessen herabgesunken, in der französischen Revolution bei der ersten Berührung mit einem starken Feind haltlos in sich zusammenbrechend, beginnt Deutschland erst in neuester Zeit, sich aus seiner Zersplitterung und seinem trostlosen politischen Verfall allmälich wieder zu Wohlstand und nationaler Selbständigkeit emporzuarbeiten; es fängt an, einzusehen, daß es in sich einig und frei sein muß, wenn es in der europäischen Völkerfamilie die seiner Größe und Bildung würdige Stellung wieder einnehmen will.
Ein großes, freies und einiges Volk, wie es Deutschland dereinst werden muß und sein wird, ist sich Selbstzweck. Es kennt keine anderen als seine eigenen Interessen; aber diese seine Interessen, welche durch die freie Bethätigung seiner Bürger geschaffen und gefördert werden, sind eben dadurch, daß eine mächtige Volksindividualität sie aus sich herausarbeitet, im großen Ganzen die Interessen der zivilisirten Menschheit. Darum ist der Staat, um mit Hegel zu reden, die Wirklichkeit der sittlichen Idee — Macht, Größe und Selbständigkeit sind die einfachen Ergebnisse des Staates; fürstliche Domainen haben keinen Anspruch auf den Ehrennamen Staat — darum erzeugt der Staat öffentliche Charaktere, Hingabe an selbständige politische Ziele und tiefgehende politische Kämpfe. Jeder Bürger wird durch das Bewußtsein gehoben, daß die zwischen seinen ökonomischen, politischen und sittlichen Rechten und Pflichten herrschende Harmonie, deren bloßes Erstreben in jenen armseligen Afterstaaten ganz folgerichtig als Hochverrath gilt, ihm den weitesten Spielraum für die Verwerthung seiner persönlichen Kraft bietet. Ein großes und freies Volk kann sich deshalb auch gar nicht von Anderen und für Andere mißbrauchen lassen.
Es ist ein Augenblick der Sammlung und Selbstprüfung, an welchem diese Schrift sich mitbetheiligen will. Sie setzt sich die zeitgemäße Aufgabe, schonungslos die Schmach aufzudecken, welche die Kleinstaaterei auf unser Volk gehäuft hat, an den Auswüchsen des Systems dessen Verderblichkeit für Deutschland nachzuweisen, und die Nation dadurch anzuspornen, daß sie sich um jeden Preis aus diesem Labyrinth fort und fortwuchernder Schande und Erniedrigung befreie. — — — —
New York, 6. Mansfield Place, 24. Februar 1864.
Vorwort zur zweiten Auflage.
Außer den von mir im Vorwort zur ersten Auflage bereits namhaft gemachten Quellen, nämlich: den Dokumenten des englischen Staatsarchivs (State Paper Office), mehr als fünfzig handschriftlichen Tagebüchern und Briefen deutscher Soldaten und Offiziere, den amtlichen braunschweigischen Berichten und den englischen Parlamentsverhandlungen habe ich für die vorliegende Auflage noch benutzt: die aus vier Foliobänden bestehenden handschriftlichen Manual-Akten des anspachischen Ministers von Gemmingen, „betreffend den zwischen Ihro Königlichen Großbritannischen Majestät und Serenissimo abgeschlossenen Subsidien-Traktat und was dahin einschlägt.“ Diese wertvolle Sammlung bot mir eine reiche Ausbeute von Privatbriefen, amtlichen Berichten und öffentlichen Kundgebungen, unter welchen letzteren ich einen äußerst wichtigen, bisher noch nirgend gedruckten Brief Friedrich's des Großen an den Markgrafen ganz besonders hervorhebe. Außerdem habe ich auch aus den anspacher Akten manche an sich zwar untergeordnete, aber für die geschilderte Zeit charakteristische kleine Thatsachen mitgetheilt, welche den Gang der Geschichte, die Motive der handelnden Personen und die Stellung ihrer Untergebenen besser veranschaulichen als Staatsschriften oder sonstige öffentliche Urkunden. Auch in dem von mir eingesehenen Tagebuche eines zerbster Offiziers fand ich einige wertvolle Züge zu dem Bilde, welches ich von den Zuständen in Anhalt-Zerbst entworfen habe.
Meine Bemühungen, die ehemaligen hessischen Archive zu benutzen, sind leider fast ganz erfolglos gewesen. Trotz der sorgfältigsten und zuvorkommendsten amtlichen Nachforschungen, waren in Kassel keine Aktenstücke mehr zu finden, welche auf die Theilnahme hessischer Truppen am amerikanischen Kriege Bezug haben; dasselbe war in Hanau der Fall. Seit dem Sommer 1873 sind die Akten der kurhessischen geheimen Kriegs-Kanzlei dem Provinzial-Archiv in Marburg einverleibt worden. Allein auch hier war die Ausbeute gering. Die auf mein Gesuch von Marburg hierher gesandten Akten habe ich im hiesigen Geheimen Staatsarchiv eingesehen. Sie enthalten Briefe und Theile einer regelmäßigen Korrespondenz des Landgrafen mit seinen Generalen und Obersten in Amerika, sowie einige Berichte der letzteren, und werfen einige nicht uninteressante Streiflichter auf die mich beschäftigende Periode, enthalten aber sonst nichts Neues oder Bedeutendes.
Ich sage den Herren Beamten des Geh. Staatsarchivs für ihr freundliches Entgegenkommen meinen verbindlichsten Dank.
Um Raum für die neu aufgefundenen, interessanten Materialien zu gewinnen und um den Rahmen dieser Schrift nicht zu sehr zu erweitern, habe ich in den Anhang, welcher in der ersten Auflage über siebenzig Seiten einnimmt, nur die wichtigsten Briefe und Dokumente aufgenommen; dagegen andere Aktenstücke und die Zusammenstellung der englischen Zahlungen an die deutschen Fürsten, wie sie sich in den Bänden 35–40 der Journals of the House of Commons finden, ganz weggelassen. Aus demselben Grunde der Raumerspaniß sind auch die Zitate in der gegenwärtigen Auflage nicht wiederholt, zumal die von ihnen nachgewiesenen Quellen den meisten Lesern nicht zugänglich sind.
Berlin, 13. April 1874
Inhalts-Verzeichniß.
Erstes Kapitel.
Geschichtliche Ereignisse werden nur dann richtig begriffen und beurtheilt, wenn man sie im Lichte und Geiste ihrer Zeit betrachtet. Will nun der Leser den Soldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika seinem historischen Verständniß näher rücken, so muß er sich vor Allem die ihn ermöglichenden Zustände vergegenwärtigen. Es wird also zunächst erforderlich sein, einen kurzen Rückblick auf die mit dem Ableben des Mittelalters beginnende Entwicklung der deutschen Heereseinrichtungen und der sie bedingenden politischen Zustände zu werfen.
Das Lehnswesen bildet die Grundlage aller staatlichen Verhältnisse des Mittelalters und beherrscht auch die militärischen Einrichtungen Deutschlands, sowie aller germanischen Länder. Das Heer war vorzugsweise ein Lehnsheer und bestand aus Reitern und Rittern. Die Hussitenkriege machten den ersten Riß in dieses System. Die Ritter und selbst die befestigten Städte unterlagen der in Banden organisirten und theilweise disziplinirten Volkskraft, den Bauern und dem losen Volke der Städte, den Abenteurern von bürgerlicher Herkunft und Ritterart. Nach der Hussitenzeit waren die böhmischen Söldner, der Schrecken des zünftigen Kriegerstandes, überall gesucht und zu finden; sie machten den Krieg selbst zum Handwerk und standen sonst außerhalb der öffentlichen Ordnung. Die Erfindung und täglich allgemeiner werdende Anwendung des Schießpulvers, die Reformation und die mit ihr zusammenfallenden Entdeckungen und Erfindungen zersetzten und zerbröckelten vollends den alten Feudalstaat. Die Welt strebte aus dem losen Nebeneinander staatlicher Embryonen zur festen zentralisirten Staatsgewalt, die moderne Monarchie übernahm die Erbschaft des verfallenden Lehnswesens und trat langsam, aber sicher und bewußt weiter schreitend, ihre Herrschaft über Europa an. Der Lehnsadel entzog sich, je länger die Einzelkriege dauerten, desto lieber dem ihm unbequem gewordenen Waffendienste und suchte sich in dem erworbenen Besitze zu behaupten. In Folge dieser allmälich eintretenden, aber tief eingreifenden Umwälzungen traten an die Stelle des alten Heerbannes und des spätern Lehnsaufgebotes, an die Stelle der bis dahin die Entscheidung gebenden Ritter und Reiter die zunächst blos für einen Feldzug angeworbenen, aus Fußvolk bestehenden Söldnerheere. Den Grund dazu legte in Deutschland Kaiser Maximilian I. Verlassen vom Adel seiner Erbstaaten, nicht unterstützt von den Unterthanen seiner Gemahlin Maria von Burgund und zu arm, um die theuren, ihm wegen ihres Abfalls vom Reiche verhaßten Schweizer anzuwerben, stellte er zuerst aus dem Stadt- und Landvolk von Vorder-Oesterreich, Schwaben, Tyrol und seinen übrigen Erbstaaten ein deutsches Kriegsvolk auf, welches er, weil es weder von den Ständen noch von den Vasallen gestellt, sondern eben aus den freien Bürgern und Bauern des Landes gebildet war, Landsknechte nannte. Die Wehrhaftigkeit des deutschen Volkes, die seiner Jugend innewohnende Ueberfülle an Kraft, Abenteuersucht und Thatendrang kamen dem Kaiser dabei sehr zu Statten. So gelang es ihm, in verhältnißmäßig kurzer Zeit in diese Landsknechtshaufen Zucht und Ordnung zu bringen und sie vortheilhaft im Gefecht zu verwenden. Diese Landsknechte, welche das Ende des Ritterthums in der Kriegsführung bezeichnen, sind das erste geordnete Fußvolk; sie betreiben den Krieg wie zünftige Handwerker. Die merkwürdigen Einrichtungen ihres Gemeinwesens bilden die Grundlage aller späteren militärischen Organisationen. Sie waren tapfer, ungestüm und, so lange sie ihren Sold erhielten, zuverlässig, aber auch wegen ihrer Rohheit und Beutegier gefürchtet und durch ihre Zügellosigkeit, namentlich im Trinken und Spielen, übel berüchtigt. Sie wurden in der Folge sowohl von deutschen, als von ausländischen Kriegsherren angeworben. Schon zu den Zeiten der Reformation war derjenige der mächtigste Fürst, welcher das meiste Geld hatte und die meisten Miethstruppen aufbringen konnte. Als Ludwig XII. von Frankreich im Jahre 1499 in Neapel erschien, bestand sein Heer vorzugsweise aus deutschen Landsknechten und Schweizern. Das von Gonsalvo von Cordova, dem großen Kapitain, am Ende des 15. Jahrhunderts gebildete und befehligte spanische Heer war ebenfalls aus ganz modernen Elementen, aus angeworbenem deutschen, italienischen und spanischen Fußvolk zusammengesetzt. Von der Mitte des fünfzehnten bis über die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hinaus bildeten deutsche Söldner einen Hauptbestandtheil der großen Heere des Kontinents.
Wenn nun die Landsknechte in den ersten Zeiten ihres Auftretens noch mit ehrbaren Elementen, wie wohlhabenden Bürgerssöhnen oder anständigen Handwerkern versetzt und deshalb eines gewissen, ehrenwerthen Sinnes nicht ganz baar waren, so arteten sie nur zu bald im Laufe der Zeiten in ein wüstes und raubgieriges, verkäufliches und gesinnungsloses Gesindel aus, das heute für und morgen gegen eine und dieselbe Sache, aber immer für fremde Interessen seine Haut zu Markte trug und stets da sich sammelte, wo lose Disziplin, gute Bezahlung und reiche Beute lockte. So begegnen wir ihnen denn von den Reformationszeiten an bis zum dreißigjährigen Kriege an der Seite der Schweizer in aller Herren Ländern und Diensten. Sie wurden mit jedem Jahre eine größere Landplage, die durch beständige Kriege genährt, sich heuschreckenmäßig über ganz Deutschland ausbreitete, dabei aber ein notwendiges Uebel, da die aufstrebenden Territorialherren, von der gewaltigen Wehrkraft der Bauern aus den Bauernkriegen her erschreckt, ihre Unterthanen zu bewaffnen fürchteten und deshalb in immer größerer Ausdehnung zu den Landsknechten ihre Zuflucht nahmen, die gerade durch die treulose Behandlung der Fürsten täglich mehr verdorben wurden. Diese fanden nämlich bei ihrer beständigen Geldnoth gar kein Bedenken darin, die armen Landsknechte durch Verschlechterung der Münze um die versprochene Löhnung zu kürzen, ja sie ließen zu ihrer Auszahlung besonders leichtes Geld schlagen und demoralisirten die armen Teufel, die sich nun wieder durch Plündern, Betrügen und Beraubung von Bauer und Bürger schadlos zu halten suchten „Ein Landsknecht muß Essen und Trinken haben, bezahle es der Küster oder der Pfaff.“ Im siebenzehnten Jahrhundert verlor sich der Name Landsknechte, weil fortan nicht mehr bloß der Knecht, der Angehörige des Landes, sondern Volk aller Nationen den Bestand der Söldnerheere ausmachte.
Zu seiner höchsten Blüthe gelangte dieses Söldnerwesen im dreißigjährigen Kriege, wo der Auswurf von ganz Europa gegen guten Lohn und reiche Beute Deutschland verwüstete. Außer denen, welche ein anderes Handwerk nicht gelernt hatten, zogen auch viele „freiledige Pursche“ der Werbetrommel nach; die bisher ein solches betrieben, muthige und unnütze Handwerksgesellen und anderes Gesindel, für welches sonst kein Platz in der Welt war, fanden freudiges Willkommen bei Feldwebeln und Hauptleuten. Dem armen Bauernvolke, wenn es von Freund und Feind rein ausgesogen worden, blieb oft schon in den ersten Jahren des Krieges nichts übrig, als die Pflugschaar in den Säbel zu verwandeln und, selbst ruinirt, Andere ruiniren zu helfen. Es ist allgemein bekannt, daß Wallenstein sich für unfähig erklärte, ein Heer von 20,000 Mann anzuwerben, daß er aber statt ihrer innerhalb dreier Monate 40,000 Mann auf die Beine brachte, weil, wie er bemerkte, sich diese durch Beute und Plündern selbst ernähren könnten. Bis auf 100,000 Köpfe schwoll dieses Heer an und mußte von den Landschaften, durch deren Gebiete es zog, unterhalten werden. Wenn die Schweden unter Gustav Adolph sich anfangs durch bessere Mannszucht, größere Sittlichkeit und eine höhere taktische Bildung auszeichneten, so verloren sie diese Vorzüge doch bald nach dem Tode des Königs, denn in der zweiten Hälfte des Krieges zählten sie ebensoviel verlaufenes und ruchloses Volk in ihren Armeen, als die Kaiserlichen.
Vom dreißigjährigen Kriege datirt für das ganze damalige Europa der Umschwung in seiner Heeresverfassung; aus ihm heraus bildeten sich die bisherigen nur für einen Feldzug angeworbenen Söldnerschaaren zu den auf längere Zeit geworbenen, darum stehenden Heeren um. Zwar waren diese schon damals vereinzelt vorgekommen. Im Osten Europas traten die Janitscharen des gegen den Westen vordringenden türkischen Reiches als die ersten stehenden Truppen auf. Im Norden hatte unter den tonangebenden Mächten Gustav Adolph das erste stehende Heer, und Schweden sowohl, als Türken zeigten sich durch diese Einrichtung denjenigen Staaten bedeutend überlegen, die mit ihren auf nur einen Feldzug angeworbenen Söldnern fochten. Allein erst in Folge des dreißigjährigen Krieges wurden die stehenden Heere zu einer beständigen Staatseinrichtung; die politischen Verhältnisse förderten ganz ungemein ihre allmälige Verbreitung, und namentlich bediente sich ihrer das vom Ausland in seinen Anmaßungen gegen Kaiser und Reich unterstützte Territorialfürstenthum zur Befestigung und Erweiterung seiner Macht.
Es ist jene traurige Periode, welche um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts beginnend, mit dem Ende des achtzehnten schließt und die Entwicklung und Blüthe des „Landesvaterthums“ bezeichnet. Der dreißigjährige Krieg hatte die nationale Kraft unsres Volkes gebrochen; sein mittelalterlicher Reichthum, seine persönliche und staatliche Selbständigkeit und sein reiches glänzendes Leben waren in Gräuel und Blut erstickt. Der Krieg hatte den deutschen Mittel- und Bürgerstand und damit die Energie der Nation wenn nicht vernichtet, so doch auf Jahrhunderte hinaus geknickt und lahmgelegt. Es trat zunächst eine allgemeine Zersetzung und erst allmälich ein Umbildungsprozeß unsres bürgerlichen und öffentlichen Lebens ein. Die politische Auflösung der Nation prägte sich erschreckend und deutlich in der täglich unbeschränkter und frecher auftretenden Viel- und Kleinstaaterei aus. Der Kleinstaat wurde zur individuellen Form und zum unverhüllten Ausdruck des deutschen politischen Elends. In unserer Nation hatte seit uralten Zeiten der Einzelne, das Individuum immer Alles gelten, immer selbstherrlich sein wollen. Jetzt aber war es die Nemesis der Geschichte, daß diese Tausende und Millionen von Selbstherrlichkeiten heruntergehetzt wurden zu macht-, recht- und willenlosen Menschenleibern, um als Waare auf dem Weltmarkte feilgeboten zu werden. Dieses Schicksal traf den Bauer wie den Bürger, den Adligen wie den Fürsten, den Einzelnen wie die Staaten, nur nicht zu gleicher Zeit und nur jeden in seiner Art. Das Ende aber war der allgemeine Zusammensturz. Aus den Ueberresten der verarmten, heruntergekommenen Bevölkerung wurde der gehorsame, in sein Schicksal ergebene und duldende Unterthan dressirt; der Staat war nichts als eine Domaine, welcher die Mittel für die Saturnalien und das bon plaisir des Landesherrn liefern mußte. Und wie klein, wie jämmerlich war dieses Landesvaterthum mit seinem Egoismus! Es gab kein Band politischer Macht und Einheit, welches, wie in Frankreich, Herrscher und Beherrschte verknüpft und dem Auslande geachtet und gefürchtet gegenübergestellt hätte. Das Land war in eine Unzahl kleiner Souverainitäten zersplittert und das Volk kam nur als Gegenstand des Seelen- und Quadratmeilen-Schachers in Betracht. Die rohen, unwissenden und habsüchtigen Territorialherren hielten durch ihre unsinnige und engherzige Politik, sowie durch ihre nationalökonomischen Verkehrtheiten das an sich so reiche Land in beständiger materieller Erschöpfung und schnitten ihm jede Gelegenheit zur Entwicklung seiner Hülfsquellen ab. Je ärmer und abhängiger das Volk, desto leichter ist es zu beherrschen, desto eher kann der Herr von Gottes Gnaden als ein Wesen höherer Art gelten, desto stolzer ragen also auch aus dem allgemeinen Schiffbruch die übriggebliebenen fürstlichen Spitzen hervor. Durch die Waffen und durch das Bündniß mit Fremden gegen Kaiser und Reich hatten sie ihre Stellung gewonnen; durch dieselben Mittel mußte diese erhalten und erweitert werden: das stehende Heer lieferte ihnen zunächst die Mittel zur Behauptung und Befestigung ihres Territorialbesitzes und zur Geltendmachung der ihnen vom westfälischen Frieden garantirten Souverainität.
Die neue Praxis schlich sich um so leichter und unbemerkbarer ins Leben ein, als seit Jahrhunderten schon Einzelne sich als Soldaten vermiethet hatten und als die Fürsten jetzt nur zu befehlen brauchten, was früher blos als ein freiwilliger Akt geleistet worden war. Dazu kam, daß seit der Krieg zu einem regelmäßigen Handwerk ausgebildet worden, diese Söldner eine nie aussterbende Klasse von Abenteurern, Landstreichern und gar Räubern ausmachten, die nach jedem Friedensschlusse ihrer Heimath wieder zur Last fielen und ihren verderblichen Einfluß auf die heranwachsenden Geschlechter ausdehnten. Es war also zunächst eine Wohlthat für das Land, wenn diese ruchlosen Banden durch die stehenden Heere möglichst unschädlich gemacht wurden. Uebrigens würde die neue Einrichtung trotzdem nicht sobald festen Fuß gefaßt haben, wenn sie nicht gleich im Anfange auch andere wesentliche Vortheile gewährt hätte. Sie brachte Ordnung in die Finanzen und sicherte die Ruhe während des Friedens. Sie schien also den Interessen der Unterthanen und Fürsten zu entsprechen; in der That aber hatten diese den wesentlichen Nutzen, jene aber nur neue Lasten davon. Der verarmte, ausschließlich mit seinen nächsten Sorgen beschäftigte Bürger ließ sich leicht einreden, daß ihm mit der Einrichtung der stehenden Heere, die ihn in seinem friedlichen Erwerbe schützen würden, eine große Last von den Schultern genommen werde. Die Fürsten selbst erhielten durch die stehenden Heere eine kaum berechenbare Machtverstärkung. Ihre eigenen Mittel reichten selten aus, eine nur halbwegs respektable Streitmacht ins Feld zu stellen; zu einem ordentlichen Kriegszug mußten sie sich von den Ständen Geld bewilligen lassen. Erlangte nun der Territorialherr das Recht, ein stehendes Heer zu halten, so konnte und mußte er dafür auch feste Steuern einziehen, wodurch er eine unendlich gesteigerte Verfügung über die Steuerkraft des Landes gewann. Dann aber gehörte ihm das Heer unbedingt, und es ließ sich damit jeder Widerspruch der eigenen Unterthanen zum Schweigen bringen.
Es dauerte nicht lange, so erklärte der Fürst das ganze Land für sein Eigenthum, mit dem er nach Belieben schalten und walten könne; er verlangte unbedingten Gehorsam und hob zuletzt jeden jungen Mann, der ihm zusagte, für Lebenszeit zum Kriegsdienste aus. Dahin ward die alte Heerbannpflicht verkehrt, welche mit Recht jeden freien Bürger zur Führung der Waffen für das allgemeine Beste, für den Staat verpflichtete. Jetzt war die fürstliche Domaine das allgemeine Beste, der Staat geworden, und an die Stelle jener politischen und sittlichen Pflicht trat die polizeilich brutale Pressung, die Aushebung der Landeskinder, mit welcher die freie Werbung der Fremden Hand in Hand ging. Das Landeskind war zwar billiger als der Fremde und einmal gehörig dressirt, auch für die Zukunft brauchbarer; allein der Fremde konnte nicht leicht entbehrt werden, weil die blos auf die Unterthanen beschränkte Werbung das Land leicht entvölkert hätte. Zudem gab es gewisse Exemtionen für die Vermögenden oder sozial oder amtlich höher Gestellten. Die Last der Dienstpflicht ruhte ausschließlich auf den Aermeren, den Bauern und den Ungebildeten. Uebrigens dauerte es noch geraume Zeit, ehe die Regierenden es wagten, jeden Mann aus dem Volke zu langjähriger Dienstpflicht heranzuziehen. Montecuculi, welcher zuerst den Habsburgern die Einführung stehender Heere klar zu machen trachtete, suchte mit höchster Sorgfalt nach Individuen, die man wohl zum Kriegsdienste verpflichten könne, ohne dadurch eigentlich individuelle Rechte zu verletzen und die Steuerkraft des Landes zu beeinträchtigen. Die Brutalität in der Rekrutirung stehender Heere wagte sich nur schrittweise heraus; Deutschland wurde erst allmälich in kaum scheinbaren Uebergängen das Jagdrevier, auf welchem die fürstlichen Jäger ihre Werbehunde auf das täglich wehrloser werdende Volk losließen.
Es ist vor Allem für das richtige Verständniß der hier in Betracht kommenden Epoche unerläßlich, sich diesen verhältnißmäßig neuen Ursprung der stehenden Heere und der damit verbundenen Mißbräuche zu vergegenwärtigen, umsomehr, da die Vertheidiger des kleinstaatlichen Gottesgnadenthums thun, als ob die Welt diese durchaus neue Einrichtung seit Jahrtausenden nicht anders gekannt habe und als ob nur die ungemüthliche Gegenwart ihre hohen Segnungen nicht zu würdigen vermöge. Es sei also gleich hier darauf hingewiesen, daß kaum die Großväter und Urgroßväter derselben Fürsten, welche den Soldatenhandel nach Amerika getrieben, es zu stehenden Heeren gebracht hatten, und daß das historische Recht, welches im Munde ihrer Vertheidiger die einzige Entschuldigung für jenen Unfug bildet, statt „keinen Datum nicht zu haben“ so modernen Ursprungs ist, daß man Jahr und Tag seiner Entstehung genau nachrechnen kann. Der älteste hessische Subsidienvertrag mit einem auswärtigen Fürsten ward 1676 vom Landgrafen Karl mit König Christian V. von Dänemark, also gerade hundert Jahre vor der uns beschäftigenden Zeit abgeschlossen. Der älteste Vertrag überhaupt, mittelst dessen deutsche Truppen in einer für sie ganz fremden Welt, an der äußersten Gränze Europa's gegen baare Bezahlung verwandt wurden, war der sächsische von 1685, in welchem Jahre der Kurfürst Johann Georg III. dreitausend sächsische Soldaten um 120,000 Thaler auf zwei Jahre an die Republik Venedig verhandelte. Diese schickte sie gegen die Türken nach Morea hinüber, wo während der Feldzüge 1685 und 1686 die meisten von ihnen elend zu Grunde gingen. Die Wenigsten fielen auf dem Schlachtfelde; die Meisten erlagen der Pest und rothen Ruhr, und nur 761 von den ausmarschirten 3000 Mann kehrten im August 1687 in die Heimath zurück.
Die Ausbildung der stehenden Heere begann mit dem Ende des siebenzehnten und vollendete sich im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts. Ludwig XIV., der für jeden kleinen deutschen Zaunkönig bald das leuchtende Vorbild staatsmännischer Hoheit wurde, bediente sich der kleineren Fürsten gern gegen Kaiser und Reich, und ließ es sich große Summen kosten, um bei seinen gegen Deutschland gerichteten Plänen ihrer Mithülfe sicher zu sein. Diese fremde Bundesgenossenschaft wurde auch für die anfänglich nicht bei ihr Betheiligten bald sehr einträglich, denn sie hatte zugleich den Vortheil, daß sie gute Angebote aus der Heimath verschaffte. Die Subsidien der fremden und einheimischen Mächte schmeckten vortrefflich. Das Subsidienwesen stand deßhalb auch schon zu Anfang des letzten Drittels des siebenzehnten Jahrhunderts in voller Blüthe. Als Großhändler unter seinen zahlreichen fürstlichen Konkurrenten ragt an der Schwelle dieser Periode der kriegerische Bischof von Münster, Bernhard von Galen (1650–1678), hervor, ein Autokrat von nicht gewöhnlichen Gaben, aber mit äußerst beschränkten Mitteln. In dem kurzen Zeitraum von zwölf Jahren (1665–1677) vermiethete er gegen entsprechende Subsidien seine aus allen Weltgegenden zusammengetriebene 6000–8000 Mann zuerst an England, dann an Frankreich, ferner an den Kaiser, darauf an Spanien und endlich an Dänemark, blieb aber am längsten der Vasall und Kunde Frankreich's.
Um also ihre Einkünfte zu vergrößern und ihr Ansehen unter ihres Gleichen zu erhöhen, vermietheten die Landesväter ihre Soldaten gern gegen reichliche entsprechende Bezahlung an den Meistbietenden. Was kümmerte es sie, wenn ihr ruchloses Thun Deutschland zu einem Menschenmarkte erniedrigte, wo gegen Geld und gute Worte immer Soldaten zu haben waren? Ueber solche, höchstens der Kanaille verzeihliche Vorurtheile, wie Vaterlandsliebe und das Gefühl politischer Würde war die Mehrzahl der Lenker deutschen Geschickes oder vielmehr Mißgeschickes vom dreißigjährigen Kriege an bis auf die französische Revolution erhaben.
Wer nicht genug Truppen hatte, um einen einträglichen Handel damit zu treiben, hielt sich wenigstens ein „stehendes Heer“, das oft freilich nur aus einer Handvoll Leute bestand. Während es im achtzehnten Jahrhundert kein oder im besten Falle ein erbärmliches Reichsheer gab, weil seine Aufstellung lediglich vom guten Willen der einzelnen Reichsfürsten abhing, hatte jeder kleine Reichsgraf oder Reichsfürst, das vom „grand Louis“ gegebene Beispiel ängstlich nachahmend, seine Trabanten, Hatschiere, Schweizer-Garden, Musketiere, Gardes du Corps und Gensdarmen, und wenn auch nicht alle diese Waffengattungen in Wirklichkeit existirten, so erzeugten doch die für dieselben Soldaten vorhandenen verschiedenen Uniformen den Schein der Wirklichkeit. So hielt — um hier aus den tausend Lächerlichkeiten nur ein paar herauszugreifen — der Landgraf von Hessen ein Dutzend Haiducken, mehrere lange Kammerhusaren und Leibjäger. Diese Leute steckten während des Exerzierens in der Montur des ersten Bataillons Garde und formirten das erste Glied der Leibkompagnie während des Vormittags, des Nachmittags aber erschienen sie wieder in der Hoflivree, warteten an der Tafel auf oder standen auf der Kutsche. Der Herzog Karl Eugen von Würtemberg hatte noch 1782 zwei Kavallerieregimenter, das Grenadierregiment zu Pferde, v. Phull, von dessen 150 Mann keiner beritten war, während vom Husarenregiment v. Bouwinghausen, das 250 Mann stark war, 50 beritten waren. Ein anderer kleiner Fürst — kaum wird man die Sache glauben, und doch ist sie wahr — hielt 50 Mann Leibgrenadiere, welche, um größer zu erscheinen, alle hohe Absätze tragen mußten und eine Zeit lang nur zwei Grenadier-Bärenmützen hatten, welche die beiden Schildwachen an dem Portal des Schlosses immer den sie Ablösenden überlieferten und gegen die Zuckerhüte (Blechkappen) austauschen mußten. Noch Einer gab seiner Garde drei verschiedene Monturen: als Grenadiere, Kuirassiere und Jäger, in welchen sie abwechselnd erscheinen mußten. Ein Dritter hielt einige Regimenter unberittener Dragoner, welche dann und wann die Kavallerie-Evolutionen zu Fuß machen mußten und wobei ihnen während des Chocks erlaubt war, gleich den Pferden zu wiehern.
Die größeren Fürsten brachten es aber bald dahin, daß es von Rußland bis Spanien, von den Niederlanden bis zur Türkei kaum einen Feldzug und eine Schlacht mehr gab, in welcher deutsche Hülfstruppen und Soldaten sich durch ihre Roheit und Beutegier, ihren Ungestüm und ihre Unverwüstlichkeit nicht hervorthaten. In der Regel wurden die Heere des achtzehnten Jahrhunderts durch Werbung zusammengebracht und ergänzt; nur Friedrich Wilhelm I. von Preußen hatte durch die Eintheilung seines Landes in abgegränzte Kantone, aus welchen seine Regimenter ihre Rekruten bezogen, eine gewisse territoriale Grundlage für seine Armee geschaffen. Den Hauptkern derselben bildete aber auch hier das angeworbene Volk. Die Werbeoffiziere trieben sich vorzugsweise in den geistlichen Fürstenthümern, den freien Städten, an den Gränzen verschiedener Staaten und in den kleineren Territorien herum. Wie wenig übrigens ein solcher Beruf als unehrenvoll galt, mag der folgende Auszug aus einem Brief zeigen, welchen der als Preußischer Major bei Kunersdorf rühmlich gefallene Dichter des Frühlings, Ewald v. Kleist, am 12. Juli 1752 an seinen Freund Gleim schrieb. „Wenn Sie, heißt es dort, im Zerbstischen, Sächsischen und Braunschweigischen oder anderen Orten, wo sie oft hinkommen, etwa große Leute antreffen sollten, die freiwillig und vor Handgeld Dienste nehmen wollen, so engagiren Sie sie doch vor mich; ich will sie gut halten und sie sollen gar nicht unglücklich durch mich werden, nur den Abschied kann ich ihnen nicht geben; doch wenn ihre Kapitulationsjahre um sind, sollen sie auf's Neue Handgeld haben, nebst einer neuen Kapitulation. Ersuchen Sie doch zum Spaß Ihre braunschweigischen Freunde auch, daß sie vor mich werben, wiewohl mir dieses nicht ganz Spaß ist. Der Zufall kann einem zuweilen einen Goliath zuführen, der Lust zum Dienen hat, und dem noch ein Gefallen damit geschieht, wenn man ihm Dienste schafft. Ich will zur Vergeltung für Sie und Ihre Freunde bei Gelegenheit Mädchen werben, in welcher Werbung ich glaube Praktik zu haben.“
Da die Bande, welche die geworbenen Soldaten an ihre Kriegsherren knüpften, vorzugsweise von der List und Gewalt geknüpft waren, also stets locker blieben, so entschied lediglich der persönliche Vortheil für ihr Bleiben und Gehen. Aus diesem Grunde tritt gewöhnlich die ganze Besatzung einer Festung oder ein großer Theil derselben, nachdem sie kapitulirt, in die Reihen der Sieger. Die Befehlshaber aufgelöster Heere trieben förmliche Spekulation mit kriegerischen Haufen und suchten durch allerlei Kunstgriffe die höchst möglichen Preise für ihre Waare zu erhalten. In der Regel bildeten darum auch die stehenden Heere des achtzehnten Jahrhunderts die Sammelpunkte des verworfensten Gesindels, das man sich nur denken kann. Es fehlte ihnen jedes nationale Element, jeder moralische Halt, und es galt als das größte Unglück für einen nur halbwegs anständigen Menschen, dem „Kalbfell folgen“ zu müssen. Die Behandlung des Soldaten war roh, die Bestrafung barbarisch, jedes Ehrgefühl wurde methodisch in ihm erstickt. Der Gemeine wurde vom Offizier, wie heute noch in England und den Vereinigten Staaten, verachtet, mißhandelt und durch eine unübersteigliche Kluft getrennt. Die Offiziersstellen wurden fast ausschließlich vom Adel bekleidet, wenn man die heruntergekommenen, verarmten und dadurch von den herrschenden Dynasten abhängig gewordenen Junker überhaupt Adel nennen darf. Er fand in dem Heere Ansehen, Ehre und Geld und konnte die verlorengegangenen Herrenrechte an den armen Soldaten im höchsten Maße ausüben. Natürlich war bei einem solchen Stoffe an individuelle Bethätigung des einzelnen Soldaten nicht zu denken. Dieses dünkelhafte System, welches nur durch Ehre und Ruhm für die Befehlenden, aber durch Zwang und Furcht für die Befohlenen zusammengehalten wurde, fand auch äußerlich in der Lineartaktik seinen Ausdruck und galt namentlich, seit es sich in der schöpferischen Hand eines Genies, wie Friedrich des Großen bewährt hatte, als das höchste Ideal eines Heerwesens, bis es zuerst in der amerikanischen Revolution den unordentlichen Massen schlecht ausgerüsteter und noch schlechter eingeübter Bürger und Bauern unterlag und schließlich bei Jena einen schmählichen Bankerott erlitt.
Das letzte Drittel des vorigen Jahrhunderts, oder vielmehr die Zeit vom Hubertusburger Frieden bis zur ebengenannten Schlacht bei Jena entwickelte dieses grausame und geistlose Kamaschenthum — denn etwas anderes war die damalige Heeresorganisation nicht — zu seiner höchsten Blüthe, und gerade die Werbungen für die nach Amerika bestimmten Truppen offenbarten schroffer als je zuvor oder später die Nichtswürdigkeit des Systems mit allen seinen Auswüchsen und Härten. Es würde heut zu Tage kaum noch möglich sein, sich einen nur annähernden Begriff von der Erhaltung und Vervollständigung der damaligen stehenden Heere zu machen, wenn es nicht eine bändereiche Literatur über die Rekrutenwerbung und die damit zusammenhängenden Dienstzweige gäbe.
Es ist zum Verständniß der uns beschäftigenden Epoche unerläßlich, wenigstens einen flüchtigen Blick in diesen nichtswürdigen gedruckten Schund zu werfen, der trotz seiner reichen Beiträge zur Erkenntniß der damaligen Zeit dem Kulturhistoriker, wie es scheint, kaum dem Namen nach bekannt geworden ist. Das Schinderhannesthum, auf Seiten der herrschenden Mächte in System und Ordnung gebracht, starrt uns aus diesen vergilbten Scharteken entgegen, die namentlich seit Mitte des vorigen Jahrhunderts zu jeder Ostermesse dutzendweise in Deutschland erschienen und vorzugsweise junge auf Beförderung hoffende Lieutenants zu Verfassern hatten.
Zum Beweise dessen mögen dienen: „Briefe des Herrn v.S., worin derselbe seinem in C. zurückgelassenen Freunde verschiedene Werbehistörchen nebst einigen seiner eigenen Begebenheiten bis zu seiner Vermählung vor Augen legt. Leipzig 1765, bei Johann Gottlob Rothen, Buchhändler in Kopenhagen.“ Herr v.S. ist einer jener zahlreichen und gewissenlosen Werbeoffiziere, welche von den Soldaten bedürftigen deutschen und selbst auswärtigen Staaten, z.B. England, in jeder günstig gelegenen, größeren Stadt unterhalten wurden und die Aufgabe hatten, mit List und Gewalt, Versprechungen und Geld, Wein und schönen Kleidern arme Teufel und leichtsinnige oder arglose junge Menschen als Soldaten anzulocken. Der Hauptheld dieser Werbehistörchen ist der Bursche des Herrn v.S., ein gewisser Schwarz, den sein Herr nicht müde wird, als ein Muster von Schlauheit, Verschmitztheit und Frechheit zu preisen. Der tugendhafte Schwarz bethört mit den gewöhnlichen Mitteln seine Opfer in den Wirthshäusern, entführt „wohlqualifizirte Subjekte“ mit Gewalt oder verkleidet sich selbst in einen Handwerksburschen und läßt sich von einem nichts Böses ahnenden, neben ihm sitzenden Schustergesellen an einen Werbeunteroffizier, der im Geheimniß ist, verkaufen, worauf dann Schwarz das Heft umkehrt und seine Beute desto sicherer packt. Natürlich jubelt Herr v.S. über den reichen Fang und schafft ihn, von seinem Vorgesetzten ob seines Diensteifers und Erfolges belobt, rasch nach der Garnison. Ein ander Mal beraubt Schwarz gemeinschaftlich mit zwei Unteroffizieren einen Handlungsdiener, dem von ihnen die Wahl zwischen Soldatwerden und Auslieferung seines Beutels gelassen wurde, um hundert Dukaten und andere Kostbarkeiten. Der Kaufmann beschwerte sich bei Herrn v.S. Was thut dieser? Er geräth in solche Wuth, daß er seinen an der Wand hängenden Degen ergreift und den herbeigerufenen, ihres Verbrechens geständigen Unteroffizieren einige zwanzig Hiebe aufzählt. „Weil man aber — erzählt Herr v.S. mit Selbstgefühl — überdies in's Geheim von einer gewaltsamen Entführung des Tanzmeisters zu zischeln anfing, Lucinde (die Maitresse) mir auch beständig in Ohren lag, und durch die Begebenheit mit dem Kaufmannsdiener meine eigene Gefahr zu blühen anfing, so entschloß ich mich, ohne Abschied zu nehmen, aus der Stadt zu gehen, und fuhr den dritten Tag mit Lucinden, meinem Kutscher und Schwarz, der mir ein ander Mal klüger zu werden und bessere Vorsicht zu gebrauchen angelobet, nach M. zu dem Regimente.“
So weit Herr v.S. Ein gewöhnlicher Mensch, der nicht adliger Werbeoffizier gewesen wäre, würde, wenn er sich wie Schwarz und Herr v.S. bei ähnlichen zur Nacheiferung empfohlenen Heldenthaten hätte ertappen lassen, sein Leben lang in die Eisen gekommen sein; aber Herr v.S. ist „Kavalier“ und wirkt als solcher für den allerhöchsten Dienst. Folgen wir nun dem in Schwarzischer oder Herr v.S.'scher Weise gestohlenen Rekruten an seinen Bestimmungsort, und lassen wir uns über seinen Transport dahin amtlich unterweisen. Wir finden diese Belehrung in dem Werke: „Unterricht für die Königlich Preußische Infanterie im Dienste der Garnison, auf Werbungen und im Felde. Berlin, in der Himburgischen Buchhandlung 1805.“ Dieses Buch, welches also wohlgemerkt, gerade ein Jahr vor der Schlacht von Jena erschien, ist ein merkwürdiges Zeichen von der erstaunlich raffinirten Schärfe, zu welcher sich der preußische Dienst damals ausgebildet hatte, aber auch von der ganzen herzlosen Grausamkeit, deren ein gemeiner, auf schnelle Beförderung im allerhöchsten Dienste sinnender Norddeutscher fähig ist. Da heißt es im vierzehnten Kapitel vom Transport der Rekruten wörtlich: „Der Unteroffizier muß außer einem guten Seitengewehr auf dem Transporte stets ein Terzerol bei sich führen; er muß den Rekruten nie hinter, sondern immer vor sich gehen, ihn nie nahe auf den Leib lassen, und ihn bedeuten, daß der erste falsche Tritt, den er thut, ihm das Leben koste. Er muß beim Transport das Gebiet des Landes vermeiden, wo der Rekrute gedient hat, oder auch manchmahl, und unter gewissen Umständen sogar, aus dem er gebürtig ist.
„Er muß das Transportiren durch große Städte und lebhafte Ortschaften, wo möglich, vermeiden. Des Nachts muß er solche Wirthshäuser zum Quartier wählen, wo er und andere Werber seiner Macht immer einkehren, und wo der Wirth auf seiner Seite ist. In dem Nachtquartier selbst muß er die möglichste Vorsicht zur Erhaltung des Rekruten anwenden, demselben sich ganz auszuziehen und niederzulegen befehlen, dessen, so wie seine eigene Kleider dem Wirth in Verwahrung geben, und sich neben ihn, vorne nach der Thüre zu, hinlegen. Beim Transport muß er nicht erlauben, daß der Rekrute sich sehr umsehe, stehen bleibe, noch weniger sich mit Reisenden und besonders gar nicht in einer fremden Sprache unterhalte. Er muß den Rekruten auf dem Transport so lenken, wie man mit dem Zügel ein Gespann lenkt; die Worte: Halt, Marsch, Langsam, Geschwinde, Rechts, Links, Geradeaus müssen von dem Rekruten auf dem Fleck befolgt werden, sonst ist dies schon ein übles Omen, und des Unteroffiziers Autorität ist verletzt.
„Nie muß der Unteroffizier da einkehren, wo es dem Rekruten etwa zu frühstücken beliebt, sondern wo er zu diesem Behuf einmahl für allemahl einkehrt.
„In solchen Wirthshäusern, wo der Transport zu Nacht bleibt, muß eine eigene, für die Werber und Rekruten bestimmte Gaststube sein, die, womöglich in einem Oberstock ist und deren Fenster mit eisern Gittern versehen sind. Nachts muß kein Rekrute aus der Stube zu gehen genöthigt sein, sondern ein Nachtgeschirr zu beiderlei Bedürfnissen sich im Zimmer befinden.
„Die ganze Nacht muß eine Lampe im Zimmer brennen und neben selbiger ein unangezündetes Licht stehen. Der Unteroffizier muß seine Waffen dem Wirth Abends übergeben, damit nicht der Rekrute gegen ihn, in der Nacht davon Gebrauch macht. Morgens muß er sie sich wiedergeben lassen, sie nachsehen, frisch laden, oder wenigstens frisch Pulver aufschütten, sich anziehen, reisefertig machen, und dann erst den Rekruten aufstehen heißen, und ihm seine Kleider zum Anziehen wiedergeben. Beim Hineingehen in ein Wirthshaus und Stube muß der Rekrute der erste, beim Herausgehen der letzte sein; im Wirthshause selbst muß der Werber vor, der Rekrute hinter dem Tische sitzen. Hat der Rekrute eine Frau mit, so muß der Werber seine Aufmerksamkeit verdoppeln, die Frau muß auf dem Marsche vor dem Manne, niemahls aber hinter demselben, oder gar hinter dem Werber gehen.
„Sie muß eben so denen Commando-Wörtern auf dem Marsche gehorchen als der Mann, ebenso in den Nachtquartieren beobachtet werden, sich eben so unterwegens, wenn der Unteroffizier zu frühstücken wo einkehrt, wie der Mann hinter den Tisch setzen, eben so des Nachts nicht das Zimmer verlassen. Daß ein transportirter Rekrute während seines Transportes keine Feder anrühren, keine Briefe schreiben, keine Schreibtafel sich halten, selbst keine Bleifeder nicht bekommen darf, ist natürlich, so wie daß man dem Rekruten und seiner Frau vor dem Antritt des Transports, alle gefährliche Waffen, Terzerols, große Messer u.s.w. abnehmen muß und während dem Transport nicht erlauben darf, daß der Rekrute so wenig wie seine Frau, einen Stock, Knüppel oder Stab tragen darf.
„Auch muß es dem Rekruten nicht erlaubt sein, seine Frau vom Transport oder Nachtquartier ab, wohin zu schicken, mit selbiger eine fremde Sprache zu reden, oder ein sachtes Gespräch zu führen. Alles dies muß nicht statt finden und überhaupt der Unteroffizier auf alle Vorsichtsmaßregeln beim Transport denken, auf alle Handlungen und Worte des Rekruten Acht geben und darüber seine Ueberlegungen anstellen. Ist der Rekrut nur irgend zweideutig, so muß er sich auf Befehl des Unteroffiziers, die Hosenriemen entzwei-, die Hosenknöpfe abschneiden und die Hosen in der Hand tragen.
„Hat er aber vollends einen Versuch gemacht, zu echappiren, so muß er ohne Gnade geschlossen, oder ihm die Daumschrauben angelegt werden. Es ist schon übel, wenn es der Unteroffizier dahin kommen läßt, von seinem Gewehr Gebrauch zu machen, und den Rekruten blessiren oder tödten zu müssen.
„Bei sehr schönen, scheinbar resoluten, den Unteroffizier an Kräften überwiegenden Rekruten wird der Offizier gewiß so vorsichtig und billig sein und zu dessen Transport zwei Unteroffiziere geben. Ueberhaupt ist es, wenn es nur irgend angeht, immer besser, wenn einige Rekruten zusammen transportirt werden, damit mit Recht bald ein paar Unteroffiziere mit auf den Transport können gegeben werden. Es ist wegen Krankheitsfällen, Nachtwachen, wechselseitiger körperlicher Unterstützung, Ueberlegung und Berathschlagung, wo Seelenkräfte wirken müssen, wegen Aufmerksamkeit und Vorsichtsmaßregeln, kurz, wegen aller möglichen auf dem Transport zu beobachtenden und vorkommenden Ereignisse besser, wenn, selbst bei unproportionirten Verhältnissen der Rekruten zu den Transportirenden, einige Unteroffiziers beisammen sind. So schwer, wie es bei gehörigem Diensteifer, wenn sich der Unteroffizier nicht auf's Glück verlassen will, es demselben wird, einen einzigen Rekruten allein zu transportiren, so können zwei Unteroffiziere doch schon drei bis vier Rekruten, mit wenigerer Gefahr, drei Unteroffiziere mit noch weniger Risiquo sieben bis höchstens neun Rekruten transportiren.
„Allein, daß ein Unteroffizier zwei Rekruten transportirt, muß nie der Fall sein. Macht die größte Noth diesen Fall unvermeidlich, so ist dies schon traurig und für den Offizier sowohl wie den armen Koporal ohne Grenzen risquant. Wenn es platterdings unmöglich ist, daß der Offizier die Rekruten, bis der Transport stärker wird, bei sich behalten kann und deren Absendung durchaus nothwendig ist, so muß der Offizier in diesem Falle Jemand dingen, der dem Unteroffizier transportiren hilft. Es ist besser auf Vorsichtsmaßregeln einige Ausgaben zu verwenden, als die Rekruten einzubüßen, und das Leben des Unteroffiziers unvermeidlicher Gefahr auszusetzen. So wie dem Offizier, um so mehr noch dem Unteroffizier ist ein tüchtiger Hund äußerst nützlich. Nur muß derselbe gehörig abgerichtet sein, keinen Stock in der Hand eines Rekruten leiden, sowie sich derselbe in der Nacht rührt, oder aufsteht, anschlagen und seinen Herrn wecken, auf dem Marsche den Rekruten, wenn er aus dem Wege herausgeht, wieder in den Weg treiben; fängt der Rekrute an zu springen, denselben packen und nur auf seines Herrn Wort wieder loslassen, nicht leidend, daß der Rekrute etwas von der Erde aufnehme und lauter Künste können, die auf das bessere Transportiren des Rekruten abzwecken und dem Unteroffizier den Dienst erleichtern.
„Mancher Rekrute — heißt es am Schlusse nach Aufzählung verschiedener Arten von Befreiungsversuchen — sucht dadurch seine Befreiung zu erlangen, daß er an einem Orte, wo viele Menschen versammelt sind, oder beim Durchgange durch eine Stadt, über Gewalt oder ungerechte Anwerbung schrie. Hier muß der Unteroffizier den Schutz der Obrigkeit erheischen, und wird selbigen auch nach Vorzeigung seines Werbepasses und der von Zeugen unterschriebenen Capitulation des Soldaten gewiß erhalten. Der Unteroffizier mit einem Wort muß sich nicht irre machen lassen, sich nicht das Herz abkaufen lassen, niemahls die Gegenwart des Geistes verlieren oder wohl gar unentschlossen handeln, welches noch schlimmer ist, als wenn er unrecht handelt. Versucht der Rekrute, unternimmt er nur das mindeste, so muß er geschlossen werden. Alle Kosten, die der Rekrute durch Desertions-Anschläge nöthig macht, muß er selbst tragen, und kann ihm der Unteroffizier bis zu seiner Ablieferung das Handgeld abnehmen. Von jedem, in einem Orte vorgefallenen Exzesso, von jeder Maßregel, die der Unteroffizier zu nehmen gezwungen ward, muß er sich, um sich bei seinem Offizier auszuweisen, von der Ortsbehörde ein Attest geben lassen.
„Besonders muß dies geschehen, wenn der Unteroffizier in die traurige Nothwendigkeit gesetzt ward, den Rekruten zu schießen, mag er ihn nun entweder blessirt, oder getödtet haben. Der Fall, daß ein Rekrute dem Unteroffizier entkomme oder entwische, wird garnicht als denkbar, also auch nicht zu attestiren angenommen.“
Endlich ist der Rekrute glücklich eingebracht und wird zum Soldaten gestoßen, gemißhandelt und geprügelt: eine gebrochene Existenz, wenn er noch einen Funken Selbstgefühl in sich bewahrt hat, oder eine willenlose Maschine, wenn er sich in seine neue Lage findet und pünktlich „Ordre parirt.“ Denn der Dienst wurde mit barbarischer Strenge und pedantischer Gewissenhaftigkeit, namentlich in den auf preußischem Fuß eingerichteten Heeren ausgeführt. „Es ist eine trostlose Sache, sich die Gefühle zu vergegenwärtigen, welche in Tausenden der gepreßten Opfer gearbeitet haben, vernichtete Hoffnungen, ohnmächtige Wuth gegen die Gewaltthätigen, herzzerreißender Schmerz über ein zerstörtes Leben. Es waren nicht immer die schlechtesten Männer, welche wegen wiederholter Desertion zwischen Spießruthen zu Tode gejagt oder wegen trotzigem Ungehorsam gefuchtelt wurden, bis sie bewußtlos am Boden lagen. Wer den Kampf in seinem Innern überstand, und die rohen Formen des neuen Lebens gewohnt wurde, der war ein ausgearbeiteter Soldat, das heißt ein Mensch, der seinen Dienst pünktlich versah, bei der Attacke ausdauernden Muth zeigte, nach Vorschrift verehrte und haßte und vielleicht sogar eine Anhänglichkeit an seine Fahne erhielt und wahrscheinlich eine größere Anhänglichkeit an den Freund, der ihn seine Lage auf Stunden vergessen machte, den Branntwein.“ (Freytag, Neue Bilder S. 320.)
Natürlich waren die Desertionen häufig, und je näher der Grenze, desto zahlreicher, trotzdem daß die aus aller Herren Länder zusammengetriebenen Soldaten sorgsam gehütet wurden. In Grenzfestungen, wie z.B. Wesel a.Rh., waren sie zu diesem Behufe in drei Klassen getheilt: Ganzvertraute, welche Pässe erhielten und vor die Thore gehen konnten, Halbvertraute und endlich Unsichere, die gar nicht oder nur mit seltenen Ausnahmen in Begleitung eines Unteroffiziers oder eines Ganzvertrauten aus der Stadt durften. Wurde ein Soldat vermißt, so erfolgten drei Allarmschüsse vom Wall der Festung. Auf dieses Zeichen mußten die Grenzbauern die Grenze besetzen und von Posten zu Posten patrouilliren. Dazu im Voraus kommandirte Offiziere mußten sich auf die in Bereitschaft gehaltenen Pferde setzen und an der Grenze die Bauernposten revidiren. Für jeden eingebrachten Deserteur ward ein Fanggeld von zehn Thalern bezahlt. Wurde der Deserteur nicht gefangen und gelangte er glücklich „auf die Freiheit“, d.h. über die Grenze, wo sich Wirthshäuser zur Aufnahme befanden, so ritt der nachsetzende Offizier dahin, um ihn unter Zusicherung völliger Straflosigkeit zur Rückkehr zu bewegen. Hatte der Ausreißer überhaupt die Absicht zurückzukehren, so stellte er seine Bedingungen — z.B. Ertheilung eines Trauscheines, d.h. die Erlaubniß, seine Liebste zu heirathen, oder Ertheilung eines Thorpasses &c. — was Verhandlungen zwischen ihm und der Kompagnie herbeiführte, die meist mit Zugeständnissen von Seiten der letztern endigten.
Der Rückblick auf diese Einzelnheiten des damaligen Werbegeschäfts war deshalb nothwendig, weil mehr als die Hälfte der nach Amerika verhandelten Truppen in solcher Weise zusammengebracht wurde, und weil ohne die Detailkenntniß des mit der Rekrutirung verbundenen Unfugs ein Theil der spätern Erzählung durchaus unverständlich bleiben würde.
Während die größeren deutschen Staaten, wie z.B. Preußen und Sachsen, sich hauptsächlich durch ihre Armeen und deren selbständige Verwendung zu europäischer Macht und Bedeutung emporschwangen, bedienten sich die kleineren Fürsten, wie Hessen, Braunschweig, Gotha, und Andere, ihrer Truppen, um ihre Einkünfte zu vergrößern und ihren Luxus zu befriedigen. Sobald nur ein Krieg drohte, boten sie den feindlichen Parteien ihre Truppen an und, je nach der Konjunktur des Marktes, erhielten sie höhere oder geringere Preise für ihre Waare. Bis zum siebenjährigen Kriege überstieg das Angebot meistens die Nachfrage, darum war der Artikel im Ganzen billig. Erst mit dem amerikanischen Kriege schlug das Verhältniß in sein Gegentheil um, so daß bei den täglich größer werdenden Ansprüchen an den Markt das Menschenfleisch immer theurer wurde. Wenn die großen Staaten untereinander und gegen dritte Subsidienverträge eingingen, so übernahmen die kleineren deutschen Fürsten für die kriegführenden Mächte einfach Truppenlieferungen gegen baare Bezahlung. Wenn auch jedes politische Moment von diesem Handel ausgeschlossen war, so nannten sie das schmutzige Geschäft doch des bessern Scheins wegen Subsidienvertrag oder versteckten es sogar hinter den komisch erhabenen Phrasen eines Schutz- und Trutzbündnisses. Unter den Ländern, welche trotz ihres verhältnißmäßig kleinen territorialen Umfanges, durch ihre politische Machtstellung ein entscheidendes Wort in der Politik jener Zeit zu sprechen hatten, standen Holland und später England oben an, und sie gerade waren wegen des eben bezeichneten Mangels zur Führung ihrer Kriege auf die Benutzung fremder Soldaten angewiesen. Holland zunächst hatte während des ganzen siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts sowohl deutsche Fürsten als Generale und deutsche Soldaten als Truppen im Dienst, ein Verhältniß, welches durch die oranischen Statthalter vermittelt und in ein System gebracht wurde. Selbst die mächtigen Nachbarn der Generalstaaten verschmähten es nicht, diesen für größere politische Zwecke ganze Regimenter leihweise zu überlassen. So gab Preußen während der ganzen Dauer des spanischen Erbfolgekrieges seine Regimenter 8. (v. Scholten, Stettin), 9. (v. Budberg, Hamm) und 10. (v. Romberg, Bielefeld) in holländischen Sold. Für unsern Zweck kommt jedoch nur England näher in Betracht.
Schon im Laufe des siebenzehnten Jahrhunderts hatte es in seinen Kriegen gegen Holland kontinentale Miethstruppen in Sold genommen. So nahm z.B. Karl II. im Juni 1665 das Anerbieten des obengenannten Bischofs Bernhard von Galen an, wonach dieser ihm gegen die Generalstaaten 20,000 Mann zu Fuß und 10,000 Reiter stellte und für die Anwerbung der „Armada“ 500,000 Thlr., während der Dauer des Krieges aber per Monat 50,000 Thlr. Subsidien erhielt. Doch erst nach seiner Revolution tritt England Ton angebend in die große europäische Kontinental-Politik ein, an der es sich früher nur in vereinzelten Fällen betheiligt hatte. Als Wilhelm von Oranien von den Whigs eingeladen wurde, nach England zu kommen und Jakob II. vom Throne zu stoßen, gewährte Wilhelms Onkel, der große Kurfürst von Brandenburg, die Mittel zur Unterstützung des Unternehmens, um England aus seiner schimpflichen Stellung als Vasallenstaat Frankreichs zu reißen. Er stellte 9000 Brandenburger zur Deckung von Holland; ein Brandenburgischer Feldmarschall befehligte das Heer, mit welchem Wilhelm in der Bucht von Torbay landete, das Regiment Brandenburg geleitete ihn nach dem Palast von St. James und nach Irland. Brandenburgische Truppen fochten unter dem Kommando Wilhelms bei Steinkirchen und Neerwinden, und ihnen dankte der König die Wiedereroberung von Huy und Namur. Der erste kontinentale Krieg, den England führte, war der spanische Erbfolgekrieg, in welchem Marlboroughs siegreiche Heere fast ausschließlich aus deutschen Hülfs- und Miethstruppen bestanden, wie denn überhaupt damals deutsche Truppen auf beiden Seiten kämpften: Hessen und Braunschweiger unter deutscher, englischer und holländischer Fahne, Bayern und Kölner unter den Franzosen. Der Handel, welchen die deutschen Fürsten zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts mit dem Leben ihrer Unterthanen trieben, war schon zu jener Zeit so schamlos, daß alle öffentlichen Blätter in England sie bitter tadelten und verspotteten, und daß die holländische Regierung ihren deutschen Bundesgenossen derb und verächtlich vorwarf, daß sie das Geld mehr liebten, als ihre Ehre.
Seit das Haus Braunschweig-Hannover den englischen Thron einnahm, wurden die englischen Beziehungen zur Kabinets-Politik des vorigen Jahrhunderts nur noch inniger. Die regierende Dynastie, welche überall ihr spezifisch hannöverisches Interesse in den Vordergrund drängte, konnte um so eher an allen europäischen Verwickelungen und Kämpfen Theil nehmen, als sie die Truppen ihres Stammlandes zur Disposition hatte und diese zugleich mit im englischen Interesse verwandte, oder sie im heimischen Interesse von England in Sold nehmen ließ. So sehen wir denn im Laufe des vorigen Jahrhunderts deutsch-englische Regimenter auf fast allen Schlachtfeldern Europa's, in Gibraltar und Minorka, ja in Madras und den übrigen englischen Kolonien kämpfen. Außerdem schlossen die Könige Georg I. und II. zur Erreichung ihrer politischen Zwecke in Deutschland Verträge mit ihren dortigen Nachbarn ab und zahlten bedeutende Summen, um ihrer Hülfe in jedem Augenblick versichert zu sein, wie z.B. im Jahre 1717 mit dem Landgrafen von Hessen, als Georg I. ein Bündniß mit Frankreich einging und verschiedene schwedische Besitzungen in Deutschland an sich zu reißen gedachte. Im Jahre 1739, nach der Kriegserklärung Englands gegen Spanien, zahlte Georg II., weil er persönliche Streitigkeiten mit Preußen hatte und deshalb für Hannover fürchtete, an Hessen und Dänemark Lstr. 260,000, damit sie 6000 Mann, wie es hieß, für England bereit hielten. Ein Jahr darauf, beim Ausbruch des österreichischen Erbfolgekrieges, zahlte derselbe König der Kaiserin Maria Theresia Lstr. 300,000 Subsidien, welche 1742 auf die ganze Dauer des Krieges ausgedehnt wurden. Im April desselben Jahres bewilligte das Parlament auf's Neue Gelder für dänische, hessische und hannöverische Truppen, um daraus ein Heer in Flandern gegen die Franzosen zu bilden. Wie bedeutend diese Summen waren, kann man aus dem einzigen Beispiel ersehen, daß der Landgraf Friedrich I. von Hessen, obgleich er in jenem Kriege seine Truppen an beide kriegführenden Theile vermietete, von 1730 bis 1750 Lstr. 1,249,699 von England bezogen hatte. Der Sieg des Herzogs von Cumberland bei Culloden, der 1746 den schottischen Aufstand dämpfte, war vorzugsweise dem tüchtigen Fußvolk zu verdanken, das aus 6000 Hessen bestand, die vom holländisch-englischen Heere aus den Niederlanden nach England eingeschifft worden waren. Im Jahre 1749 erhielt Maria Theresia noch nachträglich zur bessern Befestigung der Freundschaft zwischen beiden Höfen eine Summe von Lstr. 100,000. Einige Monate später schloß König Georg II. zur Förderung seiner politischen Zwecke in Deutschland einen Subsidienvertrag mit Bayern, welches gegen das Versprechen, 6000 Mann Hülfstruppen bereit zu halten und in den Reichsangelegenheiten mit Hannover zu stimmen, von 1750–1756 im Ganzen Lstr. 120,000 empfing. Unter denselben Bedingungen wurden Sachsen in den Jahren 1751–1755 von England Lstr. 128,000 gezahlt. Im September 1755, gleichzeitig mit dem Ausbruch des englisch-französischen Kolonialkrieges und kurz vor Anfang des siebenjährigen Krieges in Europa, schloß England einen Defensiv-Traktat mit Rußland, damit dieses zur Vertheidigung Hannovers gegen baare Bezahlung 55,000 Mann bereit hielte. Dieser Vertrag wurde zwar nicht erfüllt, da Rußland sich in der Folge mit Frankreich und Oesterreich verband, während England mit Friedrich II. in eine Allianz trat. Zu gleicher Zeit jedoch erhielten die kleinen deutschen Fürsten, wie Hessen, Gotha, Anspach und Würzburg bedeutende Summen, damit sie mit ihren Soldaten für England in's Feld rückten, Bayern nahm damals ebenfalls Lstr. 10,000 von England an, obgleich es von dessen Feinden schon gewonnen war und mit französischem Gelde 6000 Mann zu den Oesterreichern stoßen ließ. Um den Herzog von Braunschweig zu gewinnen, eröffnete ihm Georg II. die Aussicht auf die Vermählung seiner ältesten Tochter mit dem Prinzen v. Wales und erbot sich, seine Truppen gegen doppelt so hohe Zahlung in Sold zu nehmen, als der preußisch-französische Vertrag ihm gewährte. Natürlich war der Herzog nicht abgeneigt, nach Ablauf seines Vertrages mit Frankreich auf dieses Anerbieten einzugehen. Im zweiten Jahre des siebenjährigen Krieges zählte das englische Heer in Westfalen 48,000 Mann, darunter u.A. 20,000 Hessen, 6000 Braunschweiger und keinen einzigen geborenen Engländer. Aber Pitt brauchte keinen seiner Landsleute zu opfern, denn er fand gegen gute Bezahlung genug Ausländer, die, wie er ganz richtig berechnet hatte, in Deutschland für England's Besitzungen in Amerika und Ostindien kämpften. Die Bundesgenossenschaft Friedrich des Großen allein kostete England jährlich vier Millionen Thaler.