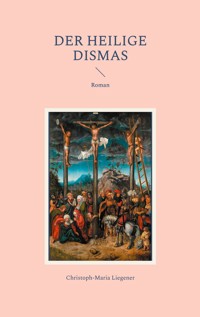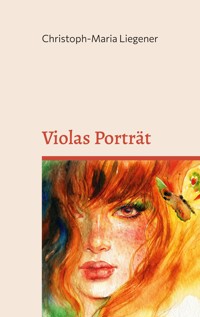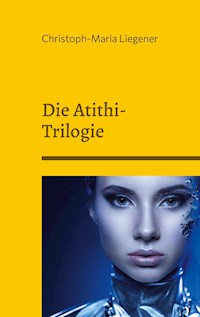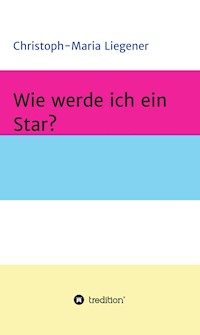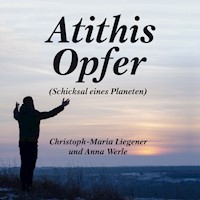3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dieser Literaturwettbewerb sollte in kleinem Rahmen all jenen, die gern schreiben, eine Möglichkeit geben, eine unter vielen, sich mit Gleichgesinnten zusammenzufinden und in einen zwanglosen Wettbewerb zu treten. Die Siegertextexte werden nun, zusammen mit einer umfangreichen Auswahl aus den eingereichten Werken, in der vorliegenden Anthologie veröffentlicht. In vielen Fällen sind zur Auflockerung kurze Kommentare zu den Werken beigefügt. Es liegt an der Qualität der Einsendungen, dass eine erfreulich bunte Mischung zusammengekommen ist. Es gab da sowohl die erfahrenen Autoren, die den Wettbewerb auf diese Weise unterstützten, als auch Neulinge, die mit viel Mut hier den Schritt in die Öffentlichkeit wagten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Christoph-Maria Liegener (Hrsg.)
1. Bubenreuther Literaturwettbewerb 2015
© 2015 Das Urheberrecht liegt bei den jeweiligen Autoren
Herausgeber: Christoph-Maria Liegener
Verlag: Tredition
ISBN:
978-3-7323-6681-1 (Paperback)
978-3-7323-6682-8 (Hardcover)
978-3-7323-6683-5 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autoren unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Vorwort
Die Siegertexte
Erster Platz
Zweiter Platz
Dritter Platz
Vierter Platz
Fünfter Platz
Weitere ausgewählte Werke
Sören Heim
Julia Briede
Ingrid Thiel
Bettina Henningsen
Mona Ullrich
Werner Siepler
Tessa Böhlke
Alexandra Huß
Alli Wolfram
Helmut Glatz
Eva-Jutta Horn
Christa Wagner
Molla Demirel
Ulrike Tovar
Cornelia Arbaoui
Eva Beylich
Lena Bachleitner
Marvin Jüchtern
Wilfried Flau
Kristin Kunst
Wolfgang Mach
Wolfgang ten Brink
Helmut Lohmüller
Thomas Talger
Bert Skodowski
Anna Nova
Marvin Neidhardt
Michael Lehmann
Wolfgang Rödig
Jana E. Hentzschel
Ingrid Schacht
Lucie Preißler
Christiane Schwarze
Sima Moussavian
Gianna Suzann Goldenbaum
Leonie Halter
Christina Klose
Sven Armin Domann
Patrick Aigner
Christian Knieps
Gerhard Goldmann
Sarah Wetterau
Heiner Brückner
Safak Saricicek
Margret Küllmar
Guido Blietz
Tina Klemm
Diana Kunzweiler
Angélique Duvier
Irene Diamantis
Florian A. N. Müller
Annelie Kelch
Sigune Schnabel
Udo Dickenberger
Susi Petersohn
Ingrid Achleitner
Karola Meling
Sonja Frenzel
Jürgen Rösch-Brassovan
Marco Frohberger
Micha Johannes Aselwimmer
Lisa Pond
Georg Fox
blume (michael johann bauer)
Kathrin B. Külow
Daniel Ritter
Fabienne Ferber
Thomas Anin
Yves Engelschmidt
Leander Beil
Ulrich Pistor
Sabine Kohlert
Hannelore Furch
Renate Maria Riehemann
Bernd Daschek
Elisabeth Junge
Roman Olasz
Angelika Schranz
Silke Vogt
Volker Maaßen
Inga Kess
Roswitha Springschitz
Stefanie Dominguez
Tanja Sawall
Vanessa Rauch
Regina Levanic
Heinz-Helmut Hadwiger
Horst Decker
Benjamin Baumann
Vorwort
Dieser Literaturwettbewerb sollte in kleinem Rahmen all jenen, die gern schreiben, eine Möglichkeit geben, eine unter vielen, sich mit Gleichgesinnten zusammenzufinden und in einen zwanglosen Wettbewerb zu treten. Eine einheitliche interne Beurteilung führte zu einer losen Rangfolge, aus der sich Sieger ergaben. Außer der Ehre gab es dabei nichts zu gewinnen. Die Beurteilung und Kommentierung der Werke war Sache des Herausgebers. Man möge mir verzeihen, dass ich mir angemaßt habe, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Rollen in dem Spiel sind austauschbar. Bei diesem Projekt hatte nun ich die Initiative ergriffen. Es war aber, wie gesagt, nur eine Aktion unter vielen.
Eine Auswahl aus den eingereichten Werken wird in der vorliegenden Anthologie veröffentlicht. Leider war es nicht möglich, alle Werke aufzunehmen. Es waren einfach zu viele. In vielen Fällen sind auch kurze Kommentare zu den Werken beigefügt. Das soll der Auflockerung dienen, auch wenn es nicht nach jedermanns Geschmack sein mag. Das Argument lautet einfach: Diejenigen, die keine Kommentare mögen, können sie überspringen, auch wenn sie abgedruckt sind. Wären sie dagegen nicht abgedruckt, könnten die anderen, die sie mögen, sie auf keine Weise lesen. Die Kommentare sind bewusst positiv gehalten, sie sollen nicht der Kritik dienen, sondern der Zerstreuung.
Es ging in diesem Wettbewerb um Gedichte und Kurzprosa. Beide Formen können ineinander übergehen; daher sollte hier keine Trennung vorgenommen werden. Sowohl für Gedichte wie auch für Prosa gilt jedoch, dass beide Gehirnhälften beteiligt sein müssen, die rechte, kreative, und die linke, strukturierende. Yin und Yang müssen sich zu einem Kreis schließen. Das bedeutet leider auch ein Mindestmaß an Sorgfalt: Mit einem genialen Geistesblitz oder einer Gefühlswallung allein ist es nicht getan. Solche Eingebungen sind nur das Material, aus dem ein Kunstwerk entstehen kann. Wie ein Tonklumpen: Er kann von Natur aus die schönsten Formen haben – man könnte ihn gar so, wie er ist, ausstellen. Das kann durchaus schön sein. Aber was man dann hat, ist Natur, nicht Kunst. Es geht nicht darum, was schöner ist, Natur oder Kunst. Es sind verschiedene Skalen, auf den gemessen wird, verschiedene Objekte, die verglichen werden, Äpfel mit Birnen. Kunst beinhaltet die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Material, die Formung des Tonklumpens zu einem Kunstwerk. Das ist genauso wichtig für das Werk wie für den Künstler: Er bringt sich ein, entwickelt seine Kunstfertigkeit, arbeitet, verwirklicht sich. Ja, in einem wirklichen Kunstwerk steckt viel Arbeit, auch wenn das Ziel ist, dass man von der Anstrengung und Arbeit nichts mehr sieht. So federleicht wirkt manch ein Gedicht, dass ein voreiliger Leser vermuten könnte, auch er könne auf die Schnelle so etwas fabrizieren. Vorsicht!
Zur Gestaltung der Anthologie: Die Gewinnergedichte wurden an den Anfang vorgezogen, alle anderen erscheinen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Da bei modernen Gedichten die Verfremdung der Orthografie zuweilen ein Stilmittel sein kann, wurde überall die ursprüngliche Orthografie der eingesendeten Texte ohne Korrekturen beibehalten. Zwar juckte es zuweilen in den Fingern zu korrigieren Es gab tatsächlich Texte, die auf einer heißen Tastatur getippt worden zu sein schienen. Dabei passte das manchmal derart zu den Texten, dass eine Korrektur alles verfälscht hätte. Also wurde (fast) immer konsequent eine einheitliche Linie durchgehalten: keine Korrekturen. Letztlich ist dies kein Museum mit perfekten Ausstellungsstücken, hier soll sich die reale Welt widerspiegeln, wie sie sich in unseren Mitstreitern bricht. Es galt, die Originalität, die Authentizität zu wahren. Dementsprechend liegt die Verantwortung für die Texte ausschließlich bei den Autoren.
Es liegt an der Qualität der Einsendungen, dass eine erfreulich bunte Mischung zusammengekommen ist. Das war nur möglich, weil so viele Autoren Beiträge eingesendet haben. Da gab es sowohl die erfahrenen Autoren, die den Wettbewerb auf diese Weise unterstützten, als auch Neulinge, die mit viel Mut hier den Schritt in die Öffentlichkeit wagten. Ihnen allen sei Dank gesagt.
Viel Spaß!
Dr. Dr. Christoph-Maria Liegener
Die Siegertexte
Erster Platz
Helmut Glatz
Der Pauli-Effekt
Der Wiener Physiker Wolfgang Pauli, von dem sein Mentor Max Born einmal sagte, er sei ein Genie, nur vergleichbar mit Einstein, entdeckte nicht nur den Kernspin zur Erklärung der Hyperfeinstruktur der Atomspektren, postulierte nicht nur das Vorhandensein des Neutrinos, dessen Existenz erst 26 Jahre später empirisch nachgewiesen werden konnte, er war vor allem bekannt für den sogenannten Pauli-Effekt, wofür er nachmals auch den Nobelpreis erhielt.
Dieses seltsame Phänomen zeigte sich, kurz gesagt, folgendermaßen: Wo Pauli auftauchte, ging alles schief. Physikalische Experimente misslangen, wertvolle Laboreinrichtungen gingen kaputt und komplizierte Versuchsanordnungen kollabierten, sodass er seinerzeit von dem Physikerkollegen Otto Stern sogar Laborverbot erhielt. Das auf dem Pauli-Effekt beruhende, schon damals berühmte Ausschließungsprinzip lautete folgendermaßen: Es ist unmöglich, dass sich Wolfgang Pauli mit einem funktionierenden Gerät im selben Raum befindet.
Mysteriös war ein Vorfall am physikalischen Institut zu Göttingen bei Professor James Franck: Ein wertvoller Apparateteil ging zu Bruch, ohne dass Pauli dabei anwesend war. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Professor, auf dem Weg von Zürich nach Hamburg, zur selben Zeit in Göttingen Station gemacht hatte.
Francks Vermutung, Pauli stecke hinter allem, war also nicht unbegründet. Pauli arbeitete damals übrigens daran, den nach ihm benannten Effekt weiter auszubauen. Und bald gelang es ihm, seine Kräfte auch ohne persönliche Anwesenheit, also auf die Entfernung, wirksam werden zu lassen. Mit anderen Worten: Wo immer in der Welt etwas kaputtging – dahinter steckte Pauli.
Eine unschätzbare Hilfe war ihm bei diesen Bemühungen der Tiefenpsychologe C.G. Jung, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband. Bei nächtlichen, feuchtfröhlichen Gesprächen erfanden die beiden den Begriff der Synchronizität und entwickelten die Vereinigung der kollektiven Psyche mit der Materie zu einer schlagkräftigen Methode. (Bei diesen Forschungen entdeckten sie übrigens, ganz nebenbei, das feminine Geschlecht des bisher als sächlich geltenden Kollektiven Unbewussten.)
Und wozu das alles? Natürlich ging es ihnen nicht um die Lust am Zerstören, um das Abreagieren aggressiven Potentials oder ähnlichen Unsinn. Nein, Pauli transponierte (heute würde man sagen: beamte) die entsprechenden, „kollabierten“ Gegenstände hinüber in eine der Hugh Everettschen Parallelwelten. Das heißt, während sie (die Gegenstände) hier in unserer Welt der Zerstörung anheimfielen, feierten sie dort fröhliche Urständ.
Und Pauli? Und C.G. Jung?
Sie hocken, während sich draußen die Berge der Abwrackautos türmen, in einer gemütlichen Parallelwelten-Bar und schauen dem Tanz der Kollektiven Unbewussten zu.
Kommentar: Gekonnter Übergang von der Anekdote zum Grotesken. Da freuen sich die Fermionen. Hurra!
Zweiter Platz
Heinz-Helmut Hadwiger
SOMMERABEND
Da brach ein Sommerabend an,
ein letzter, lauer, in den Straßen,
an dem wir noch im Gasthof saßen
im Freien, eh’ der Herbst begann.
Wir tranken Most, und dann und wann
war’s, dass wir Schmalz- und Speckbrot aßen.
Wir sprachen, was wir schnell vergaßen,
und dennoch hielt es uns in Bann.
Und wir erzählten, was da war.
Ich saß im Hintergrund und schrieb
und sah schon vieles nicht mehr klar.
Bis mir ein Hoffnungsschimmer blieb:
Im Schatten stand ein Liebespaar.
Die hatten sich vielleicht noch lieb…
Kommentar: Ein Sonett darf auch aus vierhebigen Jamben gestaltet werden. Dieses hier ist meisterhaft.
Dritter Platz
Marvin Jüchtern
Interpretation
Und ich erkannte und verstand,
obwohl noch beide deiner Lippen ruhten,
wie man in einem Wind sieht einen Strand,
bevor er untertaucht in vage Fluten,
die kommen oder wieder gehen,
so wie man in der Ferne Einen kommen sieht
oder gehen. Es zählt nicht, was wir sehen
oder was ich sehe – ob er von mir flieht
oder auf mich zu, wie diese Einsicht, kam.
Da saß auf deinen Lippen etwas Altes,
das ich dir nicht nehmen konnte, und nicht nahm;
so als ob ein streng und ungestaltes
Etwas dir in deinem Ausdruck lag,
vielleicht ein Tieferes, das lange schwieg;
vielleicht aus einem frühren, finstern Tag,
der aus dem Innren wieder auferstieg.
Kommentar: Kreuzreim, Enjambements. Rilke-Style. Klingt.
Vierter Platz
Bert Skodowski
Ihr Mann
Ich hock am Rhein am Saufen
und träume vor mich hin,
die Kellnerinnen laufen,
weil ich der Größte bin.
Sie bringen mir die Biere
und flirten mich voll an,
das Abendrot steht Schmiere,
und ich, ich bin ihr Mann.
Kommentar: Lokalkolorit vom Feinsten. Etwas prollig. Jargon. Tolles Bild: „Das Abendrot steht Schmiere“.
Fünfter Platz
Ulrike Tovar
Die Freiheit ist nass
Pitt, der kleine Kobold, saß in seinem Schaukelstuhl und hörte sein Lieblingslied: über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Mit dem linken Fuß wippte er dazu im Takt, mit dem rechten hielt er den Schaukelstuhl in Schwung. Durch das Fenster sah er nachdenklich auf die hellen Wolken am Himmel, über denen die Freiheit grenzenlos sein sollte.
Er wollte auch mal dorthin, hinter die Wolken. Als das Lied zu Ende war, beschloss er, den Versuch zu wagen. Wenn er auf die Mauer vor dem Haus kletterte und dann noch ein paar Meter sprang, müsste er doch eine Wolke zu fassen kriegen.
Die Mauer war sehr glatt verputzt. Also zerrte er aus seinen Hosentaschen seine Kletterausrüstung: die Hand- und Fußschuhe mit den Saugnäpfen und begann den Aufstieg.
Seltsam. Er hockte nun viel höher als vorhin in seinem Schaukelstuhl, aber die Wolken waren immer noch nicht erreichbar. Er sah sich um. Dort der Baum, der könnte hoch genug sein. Der Kobold kletterte bis in den obersten Wipfel. Nichts, er kam nicht näher. Was bildeten sich diese Wolken eigentlich ein? Resigniert verließ er die Eiche und wanderte zu der Trauerweide am See.
Er hangelte sich über die tiefhängenden Ruten ein wenig in die Höhe, ließ sich mit dem Wind hin und her pendeln, kletterte etwas weiter hinauf und übte verschiedene Kunststücke: mit einer Hand festhalten, mit Hand und Fuß wie im Trapez hängen und auf den nächsten Zweig springen.
Irgendwann hing er kopfüber an einem äußersten Wedel und blickte in den stillen See. Da waren sie ja, die Wolken. Und gar nicht mehr weit weg. Ein kurzer Sprung – es klatschte gewaltig.
Prustend und spuckend tauchte der Kobold aus dem See auf. „Himmel nochmal – kann der Singkerl nicht sagen, dass die Freiheit nass ist?“
Kommentar: Entzückende Kurzgeschichte mit lustiger Pointe. Auch auf metaphorischer Ebene interessant.
Weitere ausgewählte Werke
Sören Heim
barstuhl
ein barstuhl. unter seines gleichen
ragt er empor die bar ist leer
die barluft ist vom rauche schwer
man schlug den stuhl aus eichen
der den baum brach. vielleicht saß
der gestern hier trank schwitzte aß
hörte die zeit verstreichen
und zahlte dann. ich danke sehr
und auch der schraubte fräßte der
war hier vielleicht und trank ein glas
und rief - ich baut den stuhl dort seht
ging. fluchend auf die reichen
kalt ist die nacht fast heilig weht
vom fenster wind. ein zeichen ?
tagduft vergeht ein barstuhl steht
still unter seines gleichen
Kommentar: Interessante Reimstruktur (abba, ccad, dcea, eaea). Metrik variabel, Orthografie modern, Aussagen gut verständlich. Thema: Alltag hinterfragt.
Julia Briede
-Unfassbar-
Lass mich frei.
Der Schmerz,
der Diese,
Er mürbt in mir
Er zerrt an mir
Er raubt mir an Herz
Er lässt mich weinen
Tag und Nacht
und sagt mir das,
was ich wohl weiß.
Ich tue alles dagegen
Versuche zu vergessen
Alles hinter mir zu lassen
Doch,
Er wird bleiben.
Mein leben langbis
ins Grabe getragen.
Kommentar: Viele Anaphern, kreative Rechtschreibung („Mein leben langbis“ / „ins Grabe getragen“) passt zum Stil, authentisch, unbeschwert, frei, wurde so gelassen. Interessante Formulierungen („er mürbt in mir“, „er raubt mir an Herz“). Grammatisch fragwürdig, aber wohl trendy: „der Diese“. Die Autorin ist noch jung. Da schlummert viel Potential.
Ingrid Thiel
Über die Verwandlungskraft einer Chemotherapie
Als Antihelden schießen wir
hier eine fliegende Gewehrkugel
mit einer Anderen ab wobei
das Klangbild meiner Herzfermente
dazu die Pulsmusik schlägt
jede Unwägbarkeit ist auszuschalten
angesichts einer unbegreiflichen
Endlichkeit bin ich ein anderer
geworden meine vielstimmige
Herzkammermusik ist umgeschrieben
in hörbare Pausen vertieft
bis zur Leere aus der ich schöpfe gleich
einem Krug der zum Brunnen geht
verwandelt sind meine Alltagsworte
die mich über Dschungelkämpfe
flogen jetzt schleppen sie ihren Weg
als Gepäck auf dem Rücken und
versinken bei jedem Schritt im Morast
der Unverständlichkeit mein Lächeln
bessert die abgetragen Hoffnung aus
sie hält noch
bis zum Flohmarkt in Epikurs Garten
Kommentar: Zeilen, die von einem Kampf zeugen, Zeilen, die Mut machen. Eingefangene Gefühlswelten einer besonderen Situation.
Bettina Henningsen
kopfgeister
mit salz unter den füßen und
einem sack voller regeln auf der rückbank –
das sollte der anfang werden, von was-weiß-ich-was
[mit] der zeit wegfahren und doch alles festhalten
kennst du diese träume, wenn plötzlich
alle buchstaben aus dem papier fließen oder
du vergessen hast, wie man die beine bewegt
weglaufen geht nicht mehr und nicht
mehr weiter gehen geht auch nicht mehr
und wenn dann das von gestern einsteigt
zeigst du auf die vielen blätter, unbeschrieben,
hunderte, tausende von ihnen, eins für jeden
tag in deinem leben — deine kopfgeister
die eh alle machen was sie wollen
Kommentar: Schöne Sprache („buchstaben aus dem papier fließen“), unstrukturiert. Drei Strophen verschiedener Länge. Gedankenfetzen werden in Beziehung gesetzt.
Mona Ullrich
Macht die Friseusen reich!
Der Dichter Ovid hatte recht.
Was für eine wertvolle Kunst!
Ich ducke mich unter dem Klappern der Schere.
Trost kommt von ihr. Sie redet.
Kommentar: Die Autorin spricht hier von Ovid (ars amat. 3, 133-141), wo die Frisierkunst im Rom der Antike beschrieben wird.
Werner Siepler
Liebe
Eine Frau hatte er sich angelacht,
ihr mit Begeisterung den Hof gemacht.
Doch dabei ist es nicht geblieben,
nun macht er, von Liebe getrieben,
sogar noch über den Hof hinaus,
regelmäßig auch ihr Treppenhaus.
Kommentar: Auch Calau ist eine schöne Stadt.
Standesgemäßer Tod
Ein Vegetarier wird schmerzlich vermisst,
der äußerst überraschend gestorben ist.
Weil man ihn in einer Grünanlage fand,
die Todesursache eindeutig feststand.
So ließ man die Hinterbliebenen wissen,
er hat standesgemäß ins Gras gebissen.
Kommentar: Das ist so ähnlich und gefällt.
Volkssport für Snobs
Ein reicher Snob will Sport betreiben,
um körperlich recht fit zu bleiben,
drum stellt er Überlegungen an,
welchen Sport sein Körper leisten kann.
So sollen Übungen nicht quälen
und der Spaßfaktor darf nicht fehlen.
Sport ist für ihn auch Mittel zum Zweck,
im zähen Kampf gegen zu viel Speck.
Nun sucht der Snob ganz cool und gefasst,
nach der Sportart, die gut zu ihm passt.
Doch er war nie ein Sportfetischist,
so dass die Suche nicht so leicht ist.
Auf den Volkssport für Snobs fiel die Wahl,
ein Sport ohne Anstrengung und Qual.
Künftig wird er, um sich zu trimmen,
stets stilvoll in seinem Geld schwimmen.
Kommentar: Volkssport ist begrifflich etwas für die breite Masse. Schön wäre es ja, wenn jeder in Geld schwimmen könnte. Inhaltlich gehören diese Gedichte wegen ihres Humors eindeutig zu den stärkeren des Wettbewerbs. Durchgängig knackiger Paarreim. Hier geht es nicht um spitzfindige Formen, sondern um Pointen. Bei einem lustigen Gedicht ist vieles erlaubt. Die Werke sprechen einfach an.
Tessa Böhlke
Die Leiter zum Glück
Tief im Tal,
wo sich die Menschen nach Geborgenheit sehnen,
fließt ein Bächlein voller Qual,
sein Wasser bestehend aus Tränen.
Am Ufer sitzt ein kleiner Wicht,
vom Leben oft betrogen,
schaut mit traurigem Gesicht
auf die kleinen Wogen.
Als unverhofft ein Sonnenstrahl
Durch die Wolkendecke fällt,
der nicht nur das ganze Tal,
sondern auch des Wichts Gemüt erhellt.
Da nimmt dieser sein Glück in die Hand,
klettert an dem Sonnenstrahl empor.
Oben angekommen, erblickt er weites Land
Und ist zufrieden wie nie zuvor.
So ist das nun mal mit dem Glück
Jede Chance muss man nutzen- so wie der Wicht
Er kehrte nie mehr ins Tal der Tränen zurück.
Tut es ihm gleich, wenn die Sonne das nächste Mal durch die
Wolken bricht.
Kommentar: Kreuzreim durchgehalten. Anrührender Inhalt.
Alexandra Huß
RÜCKKEHR UNERWÜNSCHT
Ich habe heute ein paar Blumen nicht gepflückt, um dir ihr Leben zu schenken.
Christian Morgenstern (1871 – 1914)
November 1943
Ein finsterer, kühler Morgen erwartete mich. Und dieses Mädchen.
Hinter dem Drahtzaun, nähe Baracke Nr.L 410, saß sie im Dreck und spielte.
Mit winzigen Fingern zeichnete jenes Kind Figuren in den Staub, mal einen Kreis, den sie wegwischte, dann ein Haus, dass ihr besser zu gefallen schien. Sie lächelte. Die Kleidung, die das Mädchen trug, erinnerte mich an eine zerfledderte Vogelscheuche. Grober Stoff, aus dem man Kohlesäcke hätte anfertigen können. Sie kauerte da ohne Schuhe, das Haar wirr im Gesicht. Eben blickte sie auf, hatte mich bemerkt.
Ich flog hinüber, setzte mich auf den steinernen Pfosten, der den Zaun hielt, und zwitscherte.
Das Mädchen erhob sich, putzte mit dem Ärmel Rotz von der Nase. Blaue Kulleraugen blinzelten mich an. Ich spähte zurück. Sie wollte etwas sagen, öffnete einen kurzen Augenblick den zwergenhaft kleinen Mund, überlegte es sich anders, und schwieg.
Sie schien zu lauschen. Erneut sang ich mein Lied, sofort lachte das Kind. Sie begann, im Kreis zu drehen, den Kopf gen Himmel gerichtet. Beide Arme hielt sie in die Höhe.
Während das kleine Mädchen tanzte, besah ich mir diesen Ort. Unwirtlich kam mir zuerst in den Sinn. Das, was ich als Menschengestalt kennengelernt hatte, wirkte hier gespenstisch. Niedergebeugte Figuren, so hager wie der alte Apfelbaum, indem ich meine Brut pflegte. Brauner Staub überzog die Ebene, Schnee lag noch keiner. Die Häuser, die dort standen, Elend. Kahles Mauerwerk, nirgendwo ein Garten. Kein Baum, kein Gras, keine Blume.
An was für einen Ort hatte es mich verschlagen? Sollte ich dieses mickrige Kind fragen?
„Tanzt du mit mir?“, bat sie mich unvermittelt.
Die Tanzeinlage hatte sie erschöpft, aber wie jedes Kind, war das Mädchen aufgedreht. Sie schnappte nach Luft, grapschte in meine Richtung.
Ich war nicht gerade das, was man scheu nannte, doch dieser abrupte Angriff lies mich aufflattern. Ich breitete meine braunen Flügel aus, flog einen Kreis über den Kopf des Kindes. Sofort verzog sie das Gesicht.
Ich sann noch mal über diesen grausigen Ort nach, dann schwang ich mich wieder auf den Pfosten.
„Hier gibt es keine Schmetterlinge“, erklärte die Kleine, und setzte sich zurück auf den Erdboden.
„Ich bin kein Schmetterling“, insistierte ich. Plusterte mein Gefieder mächtig auf.
„Warum nicht?“ kam von ihr.
„Weil ich ein Vogel bin. Hast du noch nie einen gesehen?“
„Vogel, schönes Wort, Vogel“, wiederholte das Mädchen. Ihre Lippen rundeten sich.
„Wohnst du hier, was ist das für eine Stadt?“
„Mutter nennt es Theresienstadt, manchmal auch Scheißhölle, aber das Wort darf ich nicht sagen“, flüsterte sie. Dabei schaute das Kind sich um, als erwarte es etwas.
„Ich wohne schon immer hier, glaube ich.“ Dabei deutete die Kleine auf den Schauplatz hinter sich.
Und ohne Pause fragte es: „Und wie heißt du?“
„Nun, ich bin eine Nachtigall. Einen Namen habe ich nicht“, gab ich an.
„Dann, dann nenne ich dich Rosè“, überlegte sie laut. Den Zeigefinger hatte das Mädchen jetzt tief in die Nase gesteckt. Drehte besonnen darin herum.
Ganz langsam, sodass dieses winzige Kind verstehen konnte, sprach ich laut und deutlich:
„Erstens bin ich ein Männchen, und infolge dessen kann und werde ich nicht Rosè heißen! Sag mir lieber deinen Namen, Mädchen?“
„Ich bin VIII /1 386“, schrie sie wie aus der Pistole geschossen. Dabei salutierte sie.
„So nennt man doch niemanden. Was sagt denn deine Mutter zu dir?“ fragte ich.
„Rahel“, erneut sprach sie ängstlich, vorsichtig.
„Das ist ein wunderbarer Name. Rahel. Ich mag nun doch einen Namen tragen. Überlegst du dir einen?“ bat ich sie.
Rahel sprang auf, hüpfte fröhlich auf und ab.
„Das mach ich. Singst du noch einmal dein Lied? Dann muss ich zurück. Gleich kommen die Männer. Wenn ich fehle, sagt Mutter, komm ich in den Ofen. Was meint Mama damit? Ich kann keinen Ofen sehen?“ fragte Rahel.
„Das wird eine Redensart sein. Im Falle, dass meine Kleinen nicht gehorchen, drohe ich mit dem größten Raubvogel, den es gibt. Dem Habicht“, erklärte ich.
Dabei versuchte ich, die Größe dieses Tieres zu veranschaulichen, indem ich meine gesamte Spannweite ausbreitete.
„Sehen wir uns morgen wieder, Vogel?“ Rahel trat auf der Stelle. Staubwölkchen stoben auf, sie grinste.
„Aber sicher“, zwitscherte ich. Wieder ganz Vogel.
Der kommende Tag bescherte uns Sonnenschein, keine Wolke am rosaroten Firmament. Frostig war es dennoch. Die heftigen Verwirrungen der vergangenen Nacht waren endgültig gewichen. Dieser Ort hatte mir Albträume gebracht.
Ich schwang auf, segelte über die Häuser hinweg, schaute auf das Treiben unter mir. Es wimmelte von Menschen, teilnahmslose Gespenster, ohne jedwede Individualität. Graue Klumpen, in Reih und Glied.
Auf was warteten sie?
Stiefelgetrampel, mechanisches Klackern. Jemand brüllte gemeines Zeug. Dann folgten Schüsse.
Ich flog auf der Stelle, konnte den Blick nicht abwenden. Spielt man bei den Menschen solche Spiele? Auf dem Platz plumpsten alle in den Staub, ich zog weiter, um Rahel zu treffen.
Wie gestern saß sie im Staub und malte. Ich pflanzte mich auf den Pfosten. Als sie aufblickte, sah ich die Tränen.
„Warum weinst du, kleines Mädchen?“
„Ich bin nicht klein, stotterte sie. Mutter ist fort. Man hat die Frauen in den Zug gesteckt und weit weggebracht. Mama sagte, bis bald. Aber das glaub ich nicht. Niemand, der in den Zug muss, kommt zurück.“
„Du lieber Gott, Rahel.“ Ich flatterte auf ihre Schulter, spitzte den Flügel und wischte die Tränen weg. Sie zitterte am ganzen Leib.
„Fritz, ich möchte wegfliegen“, kam matt von ihr. „Nimmst du mich mit?“
Fritz dachte ich. Nicht besonders lyrisch, aber … Rahel unterbrach meinen Gedankengang.
„Schon heute?“
„Zum Fliegen braucht man Flügel, mein Kind. Aber weglaufen, wie wäre es damit?“ Während ich dies sagte, besah ich mir den hohen, mit spitzen Zacken bewaffneten Zaun. Da kam kein Kind rüber.
Ich fragte: „Wo ist denn hier der Eingang?
„Es gibt nur den Ausgang. Da, hinter Baracke 107 fährt der Zug hinaus. Aber die schießen dich Tod, wenn man näherkommt, sagte Mutter.“ Die Kleine deutete mir rot gefrorenen Händchen auf den grauen Berg, den sie Baracke nannte.
Ich wirbelte auf, flog in die Richtung. Und da sah ich den Ofen, von dem Rahel sprach. Auch dort, in Reih und Glied die ärmlichen Wesen. Einer nach dem Anderen wanderte geruhsam hinein. Es war totenstill. Der gesamte Ort schien im Nebel zu leben. Unsichtbar. Jetzt schloss man die Türe. Eine meterhohe Rauchsäule entstieg kurz darauf dem Schlot, der enorm in den Himmel reckte. Es roch entsetzlich.
Ich flog zurück.
„Wir werden Morgen aufbrechen, ich lass mir was einfallen Rahel. Versprochen.“
„Versprochen plapperte sie mir nach.“ Dann hielt sie die Nase in die Luft. „Es stinkt.“
Es war Freitagmorgen, recht früh. Das Pfeifen des Zuges hätte mich warnen müssen. Doch ich hatte ja keine Ahnung.
Frei von bösen Gedanken breitete ich die Flügel, entschwand zu Rahel.
Die letzten Mädchen zog man an den Haaren in den Zug. Rahel wehrte sich mächtig. Sie sah mich kurz an, rief: „Nicht schlimm, Vogel“, und verschwand hinter der eisernen Türe. Das Letzte, was ich hörte war ihr zartes Stimmchen:
Sag mir Stern, in jeder Nacht
Wohin wirst du ziehen,
Folgst du mir und bringst mich Heim,
Oder wirst du fliehen?
Sag mir Sonne, hell beglückt
Was ist deine Mär?
Stehst du auf, zu jeder Zeit
Gänzlich unverrückt?
Sag mir Mond, am Himmelszelt,
Kennst du mich vielleicht?
Sag mir bitte, wer ich bin
Habe ich dich erreicht?
Wild mit den Flügeln schlagend, versuchte ich den Riegel aufzubekommen, als der Waggon sich bewegte. Der Zug rollte los. Nach knapp drei Stunden, in denen ich die Bahn begleitete, kamen mir die unsinnigsten Gedanken. Was war hier los? Dann verlor ich die Kraft, stürzte zu Boden.
Das Letzte, was ich sah, gebe ich nun hier wieder.
Die Aufschrift, hinten am letzten Waggon.
Kindertransport VIII/1386. Auschwitz. R. U. Rückkehr unerwünscht.*
Vielleicht erging es dem Mädchen dort besser, hoffte ich. Mühsam flog ich in entgegengesetzte Richtung davon.
*Der Aktenvermerk „RU“ (Rückkehr unerwünscht) bei einem KZ-Häftling kam einem Todesurteil gleich.
Kommentar: Aus der „Vogelperspektive“. Ein trauriges Kapitel.
Alli Wolfram
Wunder der Nacht
Vom Wind umarmter Rosenduft
Schweift selig durch die Nacht
So zart entfaltet Nebelluft
Des Mondlichts süße Pracht
O bist du schön im Silbergrau
Du Wolkenschiff am Himmel
Der Brise - segensreich und lau -
Folgt nun ein Ross, ein Schimmel
Ja, sich das Bild gewandelt hat
Zu sechs umschäumten Wellen
Kein Mensch sieht sich daran wohl satt
An zahllos heil’gen Stellen
Es gibt kein Wirken hier wie dort
Von größerer Vollendung
Das sagt uns selbst des Schöpfers Wort
Ein weit’res wär Verschwendung
Kommentar: Reime und Metrik sind ansprechend. Unschön die Inversion am Anfang der dritten Strophe. An dieser Stelle bricht auch die Stimmung der ersten beiden Strophen, das Bild wird mystischer, eine weitere Ebene öffnet sich.
Helmut Glatz
Kennen Sie Kuibyschewsky?
Kennen Sie Kuibyschewsky? Kennen Sie Sokolov? Zwei Klassiker der Moderne im ausgehenden einundzwanzigsten Jahrhundert. Den Positivismus konsequent negierend, schufen sie den konstruktiven Negativismus, also die Lehre1 vom Nichts, vom gestalteten Nichts.
Sie schrieben nichts, sie malten nichts, sie komponierten und sangen nichts. Sie enthielten sich sogar der Sprache2 und setzten das Quantum ihrer Essrationen auf so etwas wie ein Bifi und einen Bio-Müsliriegel zurück.
Was ist das Nichts?, war ihre Ausgangsfrage, und als sie diese gelöst hatten, beschäftigten sie sich mit weitergehenden Problemen: Was ist Nichts plus Nichts? Was ist Nichts mal Nichts? Was ist Nichts hoch Nichts? Und dann die kühne Fragestellung: Ist Nichts minus Nichts ebenfalls Nichts – oder nichts?
Die beiden kamen schließlich zu dem Ergebnis, dass es zwei Qualitäten des Nichts geben müsse: Das qualitative Nichts und das unqualifizierte Nichts: Eines substantiell, das andere substanzlos, eines unangreifbar, das andere nicht fassbar, eines definierbar, das andere… Aber welches nun?
Vergegenwärtigen wir uns das Problem an einem Beispiel der Philosophen und stellen uns die Frage: Welche Farbe besitzt ein Kreis? Wir nehmen ein Blatt Papier, ergreifen einen Bleistift und malen einen Kreis. Dessen Farbe aber ist die Farbe des Papiers, sein Umkreis die Farbe des Bleistifts, aber was ist die Farbe des Kreises?
Also müssen wir uns das Papier, den Bleistiftstrich und alles andere wegdenken, Was bleibt? Nichts. Oder doch etwas: Der farblose, unsichtbare Kreis unserer Vorstellung. Mit den Worten der konstruktiven Negativisten: Das substantielle Nichts eines Kreises.
So gesehen gibt es unzählige Nichtse. Das Nichts eines nichtvorhandenen Hauses, das Nichts der untergegangenen Saurier, das Nichts des Neumonds.
Das substanzlose Nichts hingegen kommt ohne Saurier, ohne Neumond und ohne Häuser aus.
Ja, es existiert sogar ohne Worte. Eliminieren Sie das Wort Nichts aus Ihrem Bewusstsein!
Vernichten, vernichtsen Sie das Nichts! Verbrennen Sie diese sechs Buchstaben auf dem Altar Ihrer jämmerlichen Existenz! Schreien Sie Ihre Not hinaus! Brüllen Sie an gegen die Zeitenflut dieser Zukunft, wie einst Demosthenes gegen die Wellen schrie, bis Ihnen der Atem ausbleibt, bis Sie sich die Lunge aus dem Hals geschrieen haben!
Anhang: Die beiden konnten gerettet werden. Kuybischewsky befindet sich nunmehr in einem Salatorium am Schwarzen Meer, während Sokolov die Erfüllung seiner Existenz als Straßenkehrer in einer altindischen Kleinstadt gefunden hat.
1 Gelegentlich hier auch als „Leere“ bezeichnet.
2 Eine zweifelhafte Aussage, die im Widerspruch zum anschließenden Text steht.
Eva-Jutta Horn
Frage und Antwort
Fragst du mich
Nach dem Leben -
Ich liebe es erst
Seit ich dich sah.
Fragst du mich
Nach dem Tode -
Er schreckt mich erst
Seit ich dich kenne.
Wenn du mich
Nach der Liebe -
Wahr ist sie erst
Seit es dich gibt.
Christa Wagner
Wunnebar oder der Verrat
Es gibt Tage, an denen die Rätsel des Lebens, über die man wieder und wieder gegrübelt und für die man keine Erklärung gefunden hat, plötzlich schlüssig und gelöst vor einem liegen wie sperrige Puzzleteile, die von selbst auf ihren Platz gesprungen sind.
Ein solcher Tag war für die achtzigjährige Marie der erste Weihnachtsfeiertag. Sie saß festlich gekleidet inmitten ihrer Mitbewohner im Speisesaal des Betreuten Wohnens und lauschte einem Kinderchor, der nach dem Mittagessen die Senioren durch seine Darbietungen erfreuen wollte. Die Kinder trugen altbekannte Weihnachtslieder so gefühlvoll vor, dass der alten Dame vor Rührung die Tränen über die Wangen liefen. Als der Applaus fast schon abgeebbt war, rief Marie: „Wunne, wunne, wunnebar“. Dabei klatschte sie zu jeder Silbe kräftig in die Hände. Sie lachte verlegen, als sie merkte, dass viele Augen auf sie gerichtet waren. Selbst der sonst so verschlossen wirkende graubärtige Rollstuhlfahrer, dessen Namen sie nach den drei Wochen, in denen sie hier war, immer noch nicht kannte, schaute aufmerksam zu ihr herüber. Sie genierte sich fast. Es war Jahrzehnte her, seit sie sich zum letzten Mal zu diesem Ausdruck aus ihrer Kindheit hatte hinreißen lassen. Marie bemerkte, dass der Rollstuhlfahrer auf sie zuhielt. Er schaute sie an und sagte leise: „Entschuldigen Sie bitte, aber Sie erinnern mich an ein junges Mädchen, auch sie hatte vor Begeisterung genauso gerufen und geklatscht.“ Marie kam irgendetwas bekannt vor an dem kräftigen Mann mit der sanften Stimme. „Marie Seufert war ihr Name“, fuhr er fort, „ist schon über 60 Jahre her.“ „Aber Marie Seufert, so hab ich geheißen, vor meiner Heirat. Aus Markt Birkendorf!“ Sie merkte, wie seine Lippen zitterten. „Dann bist du es, Marie! Erinnerst du dich noch an mich? Leonhard Toppler. Leo!“
„Leo!“ Marie blieb fast der Name im Hals stecken. „Das gibt es doch nicht!“ Plötzlich wurde sie wieder lebhaft: „Seit wann bist du hier? Bist du allein? Wie geht es dir?“ Leo lächelte. „Typisch Marie, alles auf einmal. Bin seit zwei Jahren hier, versorg mich weitgehend selbst, geh nur hierher zum Mittagessen. Hör zu! Ich würde mich gern mit dir unterhalten. Hast du Lust zu kommen? Gegen 17 Uhr? Apartment 112, erster Stock.“ „112, erster Stock“, murmelte Marie. „Klar komm ich.“ Sie winkte ihm nach, als er zum Aufzug rollte, eilte in ihre Wohnung, legte sich aufs Bett und schloss die Augen.
Leo, mein Gott! Sie hatten nur drei gemeinsame Monate gehabt. Keinen Mann hatte sie mehr geliebt als ihn, keiner hatte sie mehr enttäuscht. Es war 1950 gewesen, einige Wochen vor Weihnachten, als der alte Dorflehrer sich das Bein gebrochen hatte. Der junge Leonhard Toppler kam als Vertretung ins Dorf und logierte im Gasthaus zur Linde, in das Maries ältere Schwester Siglinde eingeheiratet hatte. Marie selbst war damals 18 Jahre alt und wohnte bei ihren Eltern, die einen kleinen Bauernhof betrieben, der genau zwischen Wirtshaus und Schule lag. So konnte sie täglich mehrmals den jungen Mann am Hof vorbeigehen sehen. Er gefiel ihr ungemein: groß, kräftig, aber nicht dick, lockiges, braunes Haar, ein kurzgeschnittener Vollbart, sinnliche Lippen. Wenn sie ihn sah, rief sie fröhlich: „Grüß Gott, Herr Lehrer!“ Er hob die Hand und erwiderte: „Grüß Gott, mein Fräulein!“ Sie musste kichern, er grinste. Nach ein paar Tagen entgegnete er lachend: „Grüß Gott, Fräulein Marie!“ Ihre Schwester, die Wirtin, musste geplaudert haben. Natürlich hatte Marie aus derselben Quelle schon einiges über ihn erfahren: Er war 24 Jahre alt, stammte aus Nürnberg und war ledig. Auch die Schulkinder fragte sie über ihn aus. Sie waren begeistert. Endlich ein Junger, mit dem man viel öfter lachte als mit dem Dorflehrer.
Der Höhepunkt von Maries Tag war die Begegnung mit ihm. Sie trieb sich kurz nach Schulschluss im Hof oder auf der Straße herum, schippte Schnee, ging einkaufen, besuchte ihre Schwester. Sie plauderte fast täglich ein wenig mit dem jungen Mann, über dies und das, aber immer nur kurz, alles andere wäre unschicklich gewesen. Ihre Eltern hatten die Situation natürlich erfasst, die Mutter schimpfte: „Der Mann spielt doch bloß mit dir. Du machst dich vor dem ganzen Dorf lächerlich, begreifst du das nicht?“ Aber Marie war sich so sicher, wie es nur eine Achtzehnjährige sein kann, dass die Zuneigung eine gegenseitige war und wollte keineswegs ihre kurzen Treffen mit Leo, wie sie ihn schon heimlich nannte, einschränken.
Als die Schulkinder im Wirtshaussaal ihr Weihnachtsspiel aufführten, saß Marie in der ersten Reihe. Sie klatschte am Ende der Vorstellung vor Begeisterung dreimal in die Hände und rief dazu etwas zu laut:“Wunne, wunne, wunnebar“. Die Kinder kicherten und Leos Augen blitzten. Als der Saal sich leerte, drückte sich Marie noch ein bisschen herum. Leo sprach sie an, lud sie zu einem Bier ein. Mit Herzklopfen setzte sich Marie zu ihm. Sie hatte irgendwie das Gefühl, sich für ihr Verhalten entschuldigen zu müssen. Aber Leo legte kurz seine Hand auf ihre, lächelte und meinte. „Ich finde Sie wunnebar“. Seine Berührung und seine Worte gingen ihr durch und durch. Sie war unfähig, etwas Geistreiches zu sagen. Zum Abschied steckte er ihr heimlich ein flaches Päckchen zu. „Machen Sie es erst am Fest auf und denken Sie an mich!“
Das hätte er nicht zu sagen brauchen. Für den Heiligen Abend, bevor sie ins Bett ging, hob sie den köstlichen Augenblick des Öffnens auf. Mit zitternden Fingern löste sie vorsichtig das Geschenkpapier. Ein Schächtelchen kam zum Vorschein, in ihm lag ein feiner Silberarmreif. Glücklich küsste sie den Reif, probierte ihn an. Erst als sie das Geschenkpapier entsorgen wollte, sah sie die Weihnachtskarte. „Für Marie, das Mädchen, in das ich mich verliebt habe“. Marie war im siebten Himmel. Leo liebte sie!
Am ersten Feiertag trug sie den Armreif. Auf die Nachfrage ihrer Mutter antwortete sie mit Schweigen. Die Mutter schüttelte missbilligend den Kopf. Marie schwante Böses. Sie sollte sich nicht täuschen. Am Abend riefen ihre Eltern sie zum „ernsten Gespräch“ in die gute Stube. Beide waren sich einig: Der Lehrer würde ihr nur Unglück bringen. Selbst, wenn er es ernst meinen sollte, müsste Marie weg mit ihm aus dem Dorf, fort von allem, was ihr lieb und vertraut war, von einem Hungerlohn leben. Der sonst so stille Vater sprach entschlossen: „Du bist zu jung, Marie, um zu wissen, was für dich gut ist. Wir verbieten dir jeden weiteren Kontakt. Achte auf deinen Ruf. Wer von den Bauernburschen würde eine heiraten, die einem Hilfslehrer hinterherrennt?“ Aha, daher wehte der Wind. Marie wusste schon längst, dass ihre Eltern sie gerne mit Erhard, dem Nachbarssohn, zusammen sähen. Sie ließen keine Gelegenheit aus, ihn über den grünen Klee zu loben. Marie mochte ihn ganz gern, mehr aber auch nicht. Niemals würde sie sich von den Eltern abhalten lassen, das schwor sie sich. Was sollte sie jetzt tun? Sie brauchte eine Verbündete, Siglinde, ihre Schwester, die Wirtin. Gleich am nächsten Morgen vertraute sich Marie ihr an. Siglinde legte den Arm um Marie und versprach: „Klar kannst du dich auf mich verlassen.“ Sie zeigte Marie sogar Leos Zimmer. Er hatte viele Bücher, auf seinem Schreibtisch lagen Heftstöße herum. Marie roch an seinem Kopfkissen. Ihre Schwester lachte: „Dich hat’s ja schwer erwischt.“
Nach den Weihnachtsferien gelang es ihnen, sich dank Siglindes Verschwiegenheit meist täglich zu sehen, miteinander zu sprechen, sich verstohlen zu berühren. Einmal durfte sie mit ihrer Schwester ins Kino in die Kreisstadt. Leo war ebenfalls dort. An den Film konnte sich Marie nicht mehr erinnern, wohl aber an leidenschaftliche Küsse im dunklen Raum. Beim Faschingsball im Wirtshaussaal wenig später schaute das ganze Dorf zu, wie sie eng umschlungen tanzten und in der Bar schmusten. Gegen 23 Uhr hielt Marie es nicht mehr aus. Sie wollte mehr. Aufgeregt flüsterte sie Leo zu: „Geh in dein Zimmer. Ich komm in einer halben Stunde nach.“ Marie merkte, wie Leo erst fast etwas erschrocken wirkte, sie dann aber anstrahlte und rasch den Saal verließ. Marie plauderte noch etwas hier und da, tanzte sogar mit ihrem Nachbarn Erhard. Dann tat sie so, als ginge sie heim. Leise huschte sie die Treppe im Wirtshaus hoch und tippte mit dem Finger an seine Zimmertür. Sofort öffnete sie sich, Leo schien dahinter gewartet zu haben. Was folgte waren die seligsten Stunden ihres Lebens.
Gegen drei Uhr schlich sie sich heim. Am nächsten Morgen war der Teufel los. Die Mutter hatte bereits erfahren, was sich beim Ball abgespielt, und dass Marie den Saal schon vor Mitternacht verlassen hatte. „Ich habe dich gehört, du bist erst um drei Uhr hier gewesen, du elende…“ Die Stimme ihrer Mutter überschlug sich, ging ins Schluchzen über. Der Vater warf Leo Leichtsinn und Verantwortungslosigkeit vor. Auch ihrer Schwester Siglinde wollten die Eltern die Leviten lesen.
Erst drei Tage später schaffte es Marie, sich zu Leo zu stehlen. Sie sah bereits an seiner Miene, dass etwas nicht stimmte. Der alte Lehrer würde nach den Faschingstagen seinen Dienst wieder aufnehmen. Leo selbst war für das ganze restliche Schuljahr nach Neumarkt versetzt worden. Marie stand da wie vom Donner gerührt. Leo nahm sie in die Arme und flüsterte: „Warte auf mich. Ich komme zurück. Ich liebe dich. Du bist die Frau, mit der ich leben will.“ Sie vereinbarten, dass er bei ihrer Schwester anrufen und Briefe an sie schicken sollte. Seine neue Adresse, die er noch nicht kannte, würde sie auf diese Weise erfahren. Als Marie sich von Leo trennen musste, war ihr klar, dass es nur für kurze Zeit sein würde, dass sie ein gemeinsames Leben mit Leo vor sich hatte.
Aber Marie hatte nie mehr von ihm gehört. Kein Anruf kam, kein einziger Brief. Marie war fast verrückt geworden. Noch heute, über 60 Jahre später, konnte sie es nicht begreifen. Warum hatte er sie aus seinem Leben verbannt? Monatelang hatte sie sich gequält, war abgemagert. Mutter hatte die Erklärung: „Für ihn war es nichts Ernstes. Jetzt hat er eine andere. Sei froh, dass er weg ist!“ Langsam glaubte sie ihr. Wie konnte es anders sein?
Am nächsten Weihnachtsfest verlobte sie sich mit Erhard. Die Eltern waren begeistert. Sie heirateten im Sommer darauf, bekamen zwei Kinder. Erhard war ein guter, verlässlicher Ehemann und Vater, stets auf seine Familie aus. Als er vor einem Jahr starb, trauerte Marie aufrichtig um ihn. Die Kinder lebten beide woanders, und so hatte sie sich entschlossen, ins Betreute Wohnen zu ziehen.
Gegen 17 Uhr nahm Marie den Aufzug in den ersten Stock, suchte Leos Tür und klopfte. Ihr Herz schlug wie wild vor Aufregung. Reiß dich zusammen, du bist keine 18 mehr, schimpfte sie mit sich selbst. Leo saß am Tisch, eine Kerze brannte, ein Teller mit Plätzchen stand bereit, eine Flasche Rotwein daneben. Er hatte die Wohnung gemütlich eingerichtet, die Wände voller Bücher. Sie plauderten über das Heim, die Schwestern, das Essen. Leo war schon zwei Jahre da, seit dem Tod seiner Frau. Wegen seiner Arthrose war er auf den Rollstuhl angewiesen. Auch Marie erzählte ihre Geschichte. Dann wurden beide still. Marie nippte am Rotwein, aß ein Plätzchen. Sie schauten sich an.
Auf einmal flüsterte Leo: „Warum, Marie? Warum hast du dich damals verleugnen lassen? Warum wolltest du mich nicht mehr?“ Ungläubig schaute Marie ihn an. Hatte Leo noch seine fünf Sinne beieinander? „Aber es warst doch du, der mich verlassen hat. Du, der nicht angerufen und nicht geschrieben hat.“ Vor Aufregung war Marie immer lauter geworden. Sie sah, dass seine Unterlippe zitterte. „Aber Marie, das stimmt doch nicht. Deine Schwester hat mir mehrmals am Telefon gesagt, du willst nichts mehr von mir wissen. Viele Briefe hab ich geschickt, an Siglinde, auch an die Adresse deiner Eltern. Nichts. Zu Ostern hab ich dann noch einmal angerufen. Siglinde hat gesagt, du hättest dich mit Erhard verlobt. Ich sollte endlich Ruhe geben. Ich war verzweifelt, hab’s aufgegeben. Es hatte keinen Sinn mehr.“
Marie schüttelte den Kopf, packte seinen Arm, erzählte, wie’s wirklich gewesen war.
Hatte sie es nicht ein Leben lang tief in ihrem Innersten gespürt? „Aber warum hat deine Schwester das getan?“
„Ich weiß es nicht, kann sie nicht mehr fragen, sie ist seit fünf Jahren tot. Vielleicht haben meine Eltern sie stark unter Druck gesetzt. Sie wollten mich mit aller Macht im Dorf halten. Sie haben das als mein Bestes angesehen.“ Marie schluckte. Sie waren um die Chance gebracht worden, ihr Leben miteinander zu führen. Aber sollten sie jetzt darüber verbittert sein? Es nützte niemanden mehr. Waren sie nicht beide zufrieden gewesen mit ihrem Leben? Sollten sie nicht dafür dankbar sein?
Marie flüsterte: „Und heute, an Weihnachten, haben wir uns wie durch ein Wunder wiedergefunden. Dass ich das noch erleben durfte!“ Es war inzwischen dunkel im Zimmer geworden, nur die Kerze flackerte. Da hörten sie einen Posaunenchor draußen vor der Eingangstür spielen. Leo rollte zum Fenster und schaute hinunter. Marie schob ihren Stuhl dazu. Beim „O du fröhliche“ fanden sich ihre Hände. In Marie breitete sich ein tiefer Frieden aus, sie hatte das Gefühl, endlich angekommen zu sein.
Kommentar: Eine bitter-süße Romanze, bewegend.
Molla Demirel
Die Liebe rot
Die Sonne ergießt ihr Feuer
Von der Jahreszeit ist‘s Juli
Die Datteln rot.
Ihre blauen Augen starren in meine
Zur Blume erwacht das Herz erneut
Wie Äpfel so scheinen
Die Wangen rot.
Ihr Haar, dem Wind anvertraut
Das Lächeln, wie eine Sternschnuppe
Zerteilt die Dunkelheit
Die Lippen rot.
Sie hängt sich bei mir ein
Wir leisten einen Eid
Freiheit duldet kein Zögern
Die Liebe rot.
Kommentar: Die Epiphern erklären den Titel. Poetisch.
Ulrike Tovar
Rollt doch
„Mama“, bettelte das 1000-Füßlerkind. „Ich möchte bitte Rollschuhe!“ Die 1000-Füßlermutter starrte ihr Kind sprachlos an. Nach einer Weile begann sie, nervös von einem Bein auf das andere zu treten – 500 mal.
Der 1000-Füßlervater kam hereingestürmt und fragte, was dieses unerträgliche Getrampel zu bedeuten habe? Die Mutter zeigte zitternd mit ihren ersten 72 Paar Füßen auf das Junge und flüsterte:“ Es möchte Rollschuhe haben!“
Dem Vater blieb vor Staunen der Mund offen stehen. Er fing an, mit ungefähr 280 Füßen auf den Tisch zu trommeln. Nach einiger Zeit haute er mit 720 Füßen darauf und brüllte:“ NEIN!!“
Mit allen Füßen auf einmal stampfte das 1000-Füßlerkind auf:“ Und warum kann ich keine Rollschuhe haben?“ schrie es. Dann kringelte es sich zusammen und schluchzte jämmerlich.