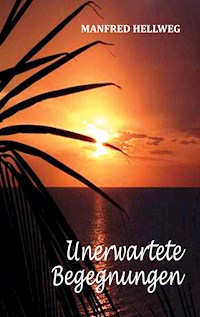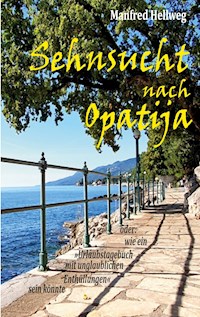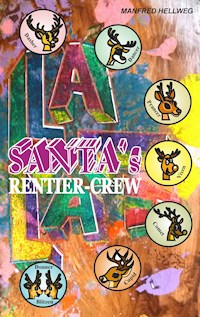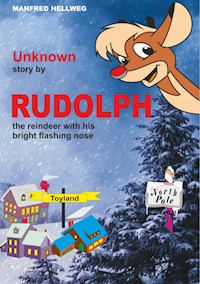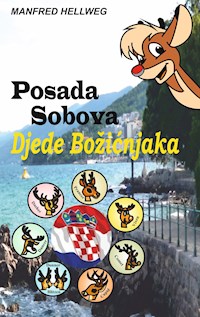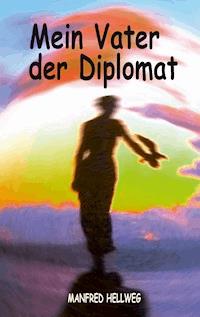Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1961 für 12 Monate zum Wehrdienst in der Bundeswehr eingezogen. Zwei Mal wurde das Gesetz für den Wehrdienst geändert, am Ende waren es 18 Monate Wehrdienst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
9. Mai 1941, im »Zweiten Weltkrieg« geboren. Genau 4 Jahre alt war ich, als am 9. Mai 1945 die offizielle Kapitulation in Moskau, durch die russische Armee bekannt gegeben wurde.
An diese Zeit als kleiner Junge habe ich noch viele Erinnerungen. Mit meiner Oma, und meiner Mutter, suchten wir während der Luftangriffe sehr oft Schutzräume im Keller auf, um uns vor den Bomben der Alliierten zu schützen.
Das schönste Erlebnis hatte ich am 9. Mai 1945, als ich die ersten Panzer der Amerikaner sah, die durch unsere Straße rollten. Ein unbeschreiblicher Jubel begleitete sie. Der Krieg war zu Ende.
16 Jahre später wurde ich zur Bundeswehr eingezogen und hatte mir geschworen, niemals werde ich mich mit dieser Bundeswehr einverstanden erklären. Die ersten vier Jahre meiner Kindheit hatten einen bleibenden, schrecklichen Eindruck hinterlassen.
Unfreundliche Worte meines Vaters gingen mir nicht mehr aus dem Kopf:
„Dieser Idiot, der hat doch keine Ahnung wie es damals war. Er hat nie eine Uniform getragen und setzt sich auf einmal für die Gründung einer Bundeswehr ein. Der ist doch nicht mehr ganz dicht im Kopf!“
Die Gründung einer Bundeswehr, und dadurch die zwangsweise Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland am 5. Mai 1955, führten zu erheblichen innenpolitischen Auseinandersetzungen.
Vor allem zwischen der SPD und der CDU über die Frage, ob es moralisch zu verantworten sei, dass Deutschland, nach der Hitler-Diktatur, jemals wieder über Streitkräfte verfügen sollte.
Adenauer, und seine Verbündeten setzten sich nach heftigem Widerstand durch, und am 12. November 1955 wurden die ersten 101 Freiwilligen Soldaten vereidigt.
Ich hatte gerade eine Lehre als Buchdrucker angefangen. Mein Vater war strikt dagegen, dass ich jemals zur Bundeswehr sollte und eine Waffe in die Hand bekam. 1956 jedoch trat das Gesetz in Kraft, dass jeder Bundesbürger zur Wehrpflicht herangezogen werden konnte.
Darüber ärgerte sich mein Vater sehr und verfluchte diesen Konrad Adenauer. Für ihn stand fest, seine Söhne müssen zur Bundeswehr.
Noch machte ich eine Lehre als Buchdrucker. In dieser Zeit brauchte ich mir keine Gedanken machen auch zur Bundeswehr eingezogen zu werden. Es stand fest, dass während einer Ausbildung kein Deutscher Dienst in der Bundeswehr leisten muss.
Allerdings, was kommt danach? Drei Jahre Ausbildung hatte ich, danach konnte ich endlich richtig Geld verdienen, dachte ich. Das war mein wichtigstes Ziel. Darum habe ich mich für das »Grafische-Gewerbe« entschieden denn ich wusste von meinem Onkel, der Schriftsetzer gelernt hatte und einem anderen Onkel der Buchbinder war, im »Grafischen-Gewerbe« gut verdienen zu können.
Dadurch konnte ich auch meine Eltern unterstützen, denn mein Vater war oft sehr krank und das Geld reichte so gerade zum Leben. Nach meiner Gesellenprüfung verdiente ich für die damaligen Verhältnisse als Buchdrucker gutes Geld, und konnte einen Teil an meine Eltern abgeben. Das Geld konnten sie gut gebrauchen. In den folgenden Jahren sah ich immer wieder, wie einige meiner Freunde und Schwimmkameraden zum Wehrdienst bei der Bundeswehr eingezogen wurden.
Ich glaube für einige von ihnen war es das Richtige, denn sie brauchten dringend eine bessere Erziehung. Den militärischen Drill dort konnten sie gut gebrauchen.
Anderen wieder ging es genau wie mir, sie wurden für eine unnütze Sache einfach aus ihrem Beruf gerissen. Sie sahen das aber auch genauso. Als ich 18 Jahre alt war wechselte ich in eine andere Druckerei um mich weiterzubilden.
Es war eine Herausforderung, dort wurden hochwertige Kunstdrucke hergestellt. Gerade das machte mir viel Spaß und ich lernte eine Menge dazu. Das war aber für mich noch nicht genug.
Deshalb bewarb ich mich mit 19 Jahren bei einer anderen Druckerei. In einem kleinen Café trafen wir uns zu einem Bewerbungsgespräch. Der Besitzer, ein ihm befreundeter Druckermeister, und ich. Hier erfuhr ich, dass der Besitzer eine kleine Druckerei aufgekauft hatte.
Der Besitzer selbst, war nur ein ganz einfacher Kaufmann wie ich später erfuhr, und hatte vom »Grafischen-Gewerbe« überhaupt keine Ahnung.
Sein Freund stellte ihm seinen Titel als Druckermeister zur Verfügung, denn ohne diesen Titel hätte er damals keine Druckerei führen können. Als beide von mir hörten was ich in meiner jetzigen Arbeitsstelle an Kunstdrucken erstellen konnte, sahen sie das als großen Vorteil an, und so kamen unsere Lohnverhandlungen schnell zu einem Abschluss.
3,10 DM als Stundenlohn konnte ich aushandeln, das waren ca. 0,30 DM mehr als mein jetziger Tariflohn. Für die damalige Zeit und besonders für mich, schon ein halbes Vermögen. Als ich meinen Arbeitskollegen davon erzählte wurden sie richtig neidisch.
In der neuen Druckerei sollte ich die gesamte Organisation übernehmen, das war die Vereinbarung. Es machte mir viel Spaß, doch nach einiger Zeit bekam ich vom Kreiswehrersatzamt meinen Musterungsbescheid.
Auweia, jetzt haben sie mich am Arsch, dachte ich. Zur Musterung muss man erscheinen, denn sollte ich mich weigern, konnten sie mich wegen Wehrdienstverweigerung sofort verurteilen. Davor allerdings hatte ich viel zu viel Angst. Ich hoffte ja immer noch, dass man bei der Musterung feststellte, dass ich wehrdienstuntauglich bin.
Weit gefehlt, folgendes wurde festgestellt: ich war »tauglich«, sogar Tauglichkeitsgrad 1. Die Musterung fand im hiesigen Kreiswehrersatzamt statt und wurde von Ärzten der Bundeswehr durchgeführt.
Es war nichts Besonderes, ich musste nur einige Fragen über mich ergehen lassen.
Die körperliche Untersuchung allerdings war der Witz. Sie schauten mir nicht nur in den Hals, sondern auch in den Hintern, fertig war ich. Da ich Wettkampfschwimmer war und eine gute Kondition hatte, war ich natürlich »tauglich«.
„Der ideale Kampfschwimmer“, sagten sie. Der Einberufungsbescheid ließ daher nicht lange auf sich warten.
Ende 1960 bekam ich die Einberufung und die Aufforderung mich bei den Panzergrenadieren in Hemer, Nordrhein-Westfalen zu melden. Da wollte ich aber nicht hin. Endlich, endlich verdiente ich in meinem Beruf richtig gutes Geld, konnte meine Eltern weiter unterstützen, und dann sowas. Nein, sagte ich, schrieb einen Brief an das Kreiswehrersatzamt, und bat um Verschiebung des Termins.
Als Grund gab ich an, ich müsse meine Eltern wegen der Krankheit meines Vaters, finanziell unterstützen. Zum Heer, und dann ausgerechnet noch zu den Panzergrenadieren, wollte ich aber überhaupt nicht.
Vom Kreiswehrersatzamt bekam ich den erhofften Aufschub, jedoch dauerte es nicht lange, und der nächste Einberufungsbescheid flatterte mir ins Haus. In dieser Zeit zogen die Kreiswehrersatzämter alle wehrpflichtigen Jugendlichen so schnell wie möglich ein.
Aus dem erneuten Einberufungsbescheid ging hervor, dass ich schon Mitte des Jahres wieder zu den Panzergrenadieren sollte, also wieder zum Heer. Anscheinend hatten sie es eilig mit mir. Ich gab aber nicht auf und stellte nochmal einen Antrag auf Verschiebung. Das klappte tatsächlich wieder, aber nur für kurze Zeit.
Der nächste Einberufungsbescheid kam prompt. Dieses Mal war er auf den 2. Oktober 1961 terminiert, aber nicht mehr als Panzergrenadier zum Heer, sondern zur Luftwaffe nach Pinneberg, in die Nähe von Hamburg.
Diesen letzten Bescheid konnte ich leider nicht mehr verschieben lassen. Das ließ das Gesetz nicht zu. Meine Eltern waren darüber natürlich sehr enttäuscht, mein Vater kochte vor Wut, denn er hatte für so einen Unsinn überhaupt kein Verständnis.
Auf meiner Arbeitsstelle waren sie auch sehr enttäuscht, konnten aber dagegen nichts ausrichten. Es war die Zeit der »Wehrpflicht«. Keiner konnte sich dieser Pflicht entziehen. Manche versuchten es mit einer Heirat und dachten, dann können sie nicht eingezogen werden. Das ging aber erst in späteren Jahren.
Die einzige Alternative die es damals gab, bestand darin, den Wehrdienst zu verweigern. Als Ersatz musste jeder Wehrdienstverweigerer Zivildienst leisten. Die Voraussetzungen, als Zivildienstleistender anerkannt zu werden, waren nicht leicht.
Einige schafften es aber doch, mussten dafür zwei Jahre Zivildienst leisten. Eingesetzt wurden sie dann als Hilfskraft in Krankenhäusern oder karikativen Einrichtungen.
Damit konnte ich mich aber schon gar nicht identifizieren, das war nichts für mich. So blieb mir nichts anderes übrig, als meinen Wehrdienst anzutreten. Als »W12« wurde ich bei der Bundeswehr geführt. Das heißt Wehrpflichtiger für zwölf Monate.
Es passte mir zwar nicht, aber dann sagte ich mir: Dieses eine Jahr schaffst du auch. Sie wollen mich unbedingt, dann sollen sie doch sehen was sie davon haben.
Mit dieser Einstellung ging ich am 2. Oktober 1961, früh morgens zum Hauptbahnhof. Vor dem Bahnhof warteten schon mehrere Jugendliche die ebenfalls einberufen waren.
Viele wurden von ihren Eltern am Bahnhof verabschiedet. Meine Eltern hatten keine Zeit, ich wollte sie aber auch nicht dabeihaben.
Von jetzt an war ich auf mich allein gestellt. Von einem Bundeswehrsoldaten wurden wir kurz und militärisch begrüßt. Anschließend verschiedenen Gruppen zugeordnet. Dieser Soldat zeigte uns durch sein Auftreten, was wir bei der Bundeswehr zu erwarten haben.
Später erinnerte ich mich daran, dass dieser »Idiot« ein Unteroffizier der Militärpolizei war. Diese »MP´s«, so wurden sie kurzer Hand von allen genannt, hatten keinen guten Ruf und waren nicht viel älter als wir.
Mit mir fuhr nur noch ein anderes, »armes Schwein« Richtung Pinneberg. Alle anderen wurden in verschiedene Zugabteile gesteckt. Ich glaube ich war der Einzige, der ohne Koffer und ohne Aktentasche zum Bund ging. Auf die Frage wo meine Utensilien sind, zückte ich nur die Schultern und dachte, die werden mir schon eine Uniform geben.
Mein, in deren Augen respektloses Verhalten, passte dem »MP´ler« nicht, denn er schaute mich strafend und missbilligend von der Seite an. Ich aber lachte in mich hinein und dachte, mich kriegt ihr nicht klein.
Die Zugfahrt nach Pinneberg dauerte fast den halben Tag. Auf fast jedem Bahnhof stiegen neue Bundis dazu, die in ihre Kasernen fuhren.
Endlich, am Bahnhof in Pinneberg angekommen, wurden wir von mehreren Soldaten in Empfang genommen. Sie hatten Listen dabei, riefen laut und deutlich unsere Namen auf, und ab ging`s auf die verschiedenen Bundeswehr-LKW`s. Dann fuhr der »Gefangenen-Transport« Richtung »Eggerstedt Kaserne in Pinneberg«.
Ein riesiges Areal lag vor uns. Am Kasernentor mussten wir aussteigen und wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die Soldaten, die uns hier in Empfang nahmen, waren schon viel älter als wir. Mir fiel dabei auf, seit 5 Jahren gab es erst die Bundeswehr, da müssen die ja noch beim »Barras« gewesen sein, so alt waren sie.
So führten sie sich aber auch auf. An den Befehlston werden wir uns wohl noch gewöhnen müssen, oder auch nicht, dachte ich. Barras, den Ausdruck kannte ich noch von meinem Vater. Er benutzte ihn immer, wenn er von der alten Wehrmacht des 2. Weltkriegs unter Hitler sprach.
Kaum waren alle Neuankömmlinge in Gruppen aufgeteilt, ging schon der militärische Drill los. Ein junger Soldat, mit 2 Streifen auf jedem Arm, brüllte und schnauzte uns unentwegt an. Einige zuckten richtig zusammen, andere wiederum ließ das Geschrei völlig kalt.
Hier konnte man schon erkennen, wer sich vor den »Idioten« fürchtete, oder aber von ihnen begeistert war. Ich jedenfalls war es nicht. Wir mussten uns in einer 2er-Reihe hintereinander aufstellen. Schon allein das war für viele ein Fiasko. Die meisten wussten gar nicht was der Soldat von ihnen wollte.
Auf seinem Gesicht war Wut und Überheblichkeit zu erkennen. Er wurde sogar handgreiflich in dem er unseren Arm packte, und zeigte wie und wo wir uns hinstellen sollten.
Als unsere Gruppe es dann endlich verstanden und geschafft hatte, schrie er uns an: „Stillgestanden!“ An unserem Gemurmel und Gelächter merkte er, dass wir ihn nicht so richtig ernst nahmen und nicht verstehen wollten.
Er lief rot an und schnauzte: „Euch werden wir schon Beine machen! Wartet mal ab, ihr seid hier nicht auf einem Kaffeekränzchen! Ihr seid hier in der Grundausbildung! Die vor euch liegenden drei Monate werdet ihr das tun was ich von euch will! Habt ihr das verstanden?“
Dann schnauzte er: „Achtung! Im Gleichschritt marsch!“ Das hätte er auch freundlicher sagen können, denn niemand wusste genau wie das laufen sollte. So ein Durcheinander kann sich keiner vorstellen. Im Fernsehen habe ich schon einmal Soldaten marschieren sehen, doch das, was sich hier abspielte war ein Witz.
Auf seinen Befehl gingen wir alle gleichzeitig los. Schon nach dem ersten Schritt gab es ein heilloses Durcheinander. Es wurde geschubst, gestolpert und gelacht.
Der »2-Streifen-Soldat« schüttelte den Kopf, marschierte vor uns her und führte uns zu einem großen Bau inmitten der Kaserne. Es war das erste Haus sofort rechts. Ein langer Bau, 2-stöckig, ca. 80 bis 100 Meter lang.
Davor sollten wir stehen bleiben und uns im Karree aufstellen. Mit dem »Stehenbleiben« klappte es noch einigermaßen, es sah aber aus wie ein »Soldaten-Auflauf«.
Im Karree aufstellen allerdings funktionierte nicht. Keiner wusste, was er damit meinte. Dieser »schlaue 2-Streifen-Soldat« wusste sich aber zu verständigen.
Auf einmal hatte er ein Blatt Papier in der Hand, darauf malte er etwas. Dann kam er mit seiner Zeichnung zu uns und zeigte jedem in der Gruppe wie ein Karree aussieht.
Sofort bellte er uns wieder an: „Habt ihr Schlaumeier jetzt gesehen was ich meine? Jetzt aber zackig!“
Ich dachte nur, das ist schon eine besonders intelligente Sache, dass uns ein junger Schnösel, nicht älter als wir, mit seiner Schulbildung die Grundausbildung erklären soll. So sieht also das »Strammstehen und der Gleichschritt« aus?
Sein Gebrüll übertönte alles, denn ein Karree zu bilden wie er es wünschte, war für »Ungeübte« nicht so einfach. Dann wollte er ja auch noch, dass wir uns der Größe nach aufstellten. Das mach aber mal, wenn du nicht weißt, wie groß dein Nebenmann ist.
Es dauerte lange, bis wir endlich sein geliebtes Karree gebildet hatten. Zwar schief und krumm, doch das Karree stand. Aus diesem Bau kam dann ein etwas älterer Uniformierter, mit einem Winkel auf dem Arm und einer Kordel am Ärmel.
Der schien nicht ganz so blöd zu sein wie sein kleiner Gehilfe. Er konnte auch mit normaler Stimme zu uns sprechen indem er sagte: „Hallo Flieger, ihr seid hier in der »Eggerstedt Kaserne in Pinneberg«, und werdet eine 3-monatige Grundausbildung durchlaufen. Danach werdet ihr in entsprechende Kompanien abkommandiert für die restlichen 9 Monate eurer Militärzeit.
Übrigens, mein Name ist Bucher. Ich bin ab sofort euer Spieß. Ihr werdet jetzt auf eure Stuben verteilt. In einer halben Stunde treffen wir uns hier unten wieder.
So plötzlich, wie er auftauchte, verschwand er auch wieder. Unser »2-Streifen-Soldat« kam mit einer Liste zu uns, rief unsere Namen auf und die entsprechende Stubennummer. Auf jede Stube verteilte er 8 Mann. Sobald diese zusammen waren, konnten wir abtreten und auf unsere Stube gehen.
In dem Gebäude waren in der 1. Etage ca. 40 Räume und in der unteren ca. 20 Räume. Der Rest der Zimmer war für das Ausbildungspersonal bestimmt sowie Geschäftsräume, die wir nur nach Aufforderung betreten durften.
Meine Stube musste ich mir also mit den anderen Kameraden teilen. Die Größe war ca. 6 x 5 m, darin 4 Doppelstockbetten aus Metall, zu jedem Etagenbett gehörte ein Doppel-Spind mit abschließbarem Safe. In der Mitte der Stube stand ein Tisch an dem wir gerade zu 8 sitzen konnten, und entsprechende Stühle. Das war`s.
Toiletten und Waschräume befanden sich auf der gleichen Etage des Hauses. Wer nachts zur Toilette ging musste immer über den Flur laufen. Unser Etagenbett teilte ich mir mit einem Kollegen, mit dem ich mich sofort gut verstand. Das obere Bett war für mich, das Untere nahm Hannes.
Wir waren uns sympathisch. Sein Name war Hans Hansen und er kam aus Flensburg. Die anderen 6 Soldaten kamen aus ganz Deutschland, auch aus Bayern. Die Bettenverteilung war für uns beide kein Problem.
Ok. die halbe Stunde war um, wir sollten uns wieder draußen vor der Tür versammeln. Bis aber alle im Karree standen verging tatsächlich eine ganze Stunde.
Unser Schreihals wartete schon ungeduldig auf uns, schnauzte uns aber schon wieder an: „Das üben wir noch, ihr seid hier nicht zum Vergnügen!“ Die Gruppe musste sich wieder in 2er-Reihen aufstellen und ab ging es im Gleichschritt zur Kantine.
Inzwischen war es Abend geworden, mein Magen meldete sich, denn ich hatte außer einem Brötchen, und einer Frikadelle seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Die Kantine war ein ziemlich großer Raum, in dem sogar die Tische in 2er-Reihen hintereinander angeordnet waren und Platz boten für jeweils ca. 10 bis 12 Personen.
Das gleiche Schema wie bei der Aufstellung, als wir in Gruppen eingeteilt wurden. Der »2-Streifen-Möchtegern-Soldat« schnauzte schon wieder:
„Schaut euch genau um, habt ihr verstanden worum es geht? In derselben Aufteilung wie ihr marschiert seid, werdet ihr hier sitzen. Ist das zu schwer für euch? Das werdet ihr noch kapieren, wenn nicht, üben wir das bis zum Umfallen. Wir haben hier kein Kaffeekränzchen wie zu Hause. Aus euch werden wir noch »Richtige Soldaten« machen.“
Er drehte sich um, und ich hatte das Gefühl, dass er in sich rein grinste. Der Kerl ging mir gehörig auf den Keks. Dieser »Möchtegern« wird mich nicht klein kriegen, dachte ich.
„Essen fassen“, tönte es durch die Kantine, und schon rannten die ersten los zur Essensausgabe. Hinter einer langen Theke standen Soldaten, die für die Essensausgabe zuständig waren.
„Kommando zurück“, hörten wir ihn wieder schreien. „So geht das nicht, Disziplin ist angesagt, immer der Reihe nach. Immer der erste Tisch, dann der zweite und immer so weiter. Sehe ich etwas anderes, gibt es kein Essen und wir treffen uns draußen wieder!“
„Ist der doof“, hörte ich meinen Nachbarn sagen, „der hat doch nicht alle Tassen im Schrank“, „das macht der nicht lange mit uns, glaub mir.“ Ich sah meinen Nachbarn an und sah in das Gesicht meines Zimmergenossen Hannes.
„Du hast Recht“, antwortete ich ihm, und wir grinsten beide. Da habe ich schon mal den richtigen Kumpel gefunden, dachte ich, der denkt genau wie ich. Klasse!! Wir ließen uns nur nichts anmerken, »er« sollte nicht direkt auf uns aufmerksam werden.
Das Essen in der Kantine war in Ordnung, es gab fast alles. Sogar eine deftige Erbsensuppe am Abend. Zu trinken gab es Tee, Kaffee, Sprudel und Apfelsaft. An ein Glas Bier war nicht zu denken.
Im hinteren Teil der Kantine sah ich noch einen Tresen mit Zapfhähnen. Anscheinend konnte man aber hier doch Bier bekommen. Während des Essens wurden wir dann von dem »2-Streifen-Soldaten« in ganz normaler Lautstärke aufgeklärt, dass wir, wenn unser Dienst zu Ende ist, in der Kantine auch andere Lebensmittel kaufen könnten. Dazu gehörten auch Bier und Wein, jedoch nur in Maßen. Alkoholleichen würde es in seiner Kompanie nicht geben.
Allerdings nur gegen Bares. Wir sollten als »W12er«, die stolze Summe von 69.00 DM im Monat bekommen und das musste für unsere Bedürfnisse reichen. Für alle anderen Sachen war die Bundeswehr zuständig. Da brauchten wir uns keine Sorgen machen, wurde uns vorher bei der Musterung mitgeteilt.
Im Augenblick dachte ich nicht groß darüber nach, ich musste mich erst an die »Freiheitsberaubung« gewöhnen. Nachdem dann alle mit dem Abendessen fertig waren, stellten wir uns wieder vor der Kaserne in 2er-Reihen auf um geschlossen zur Kleiderkammer zu marschieren.
Sie befand sich nur einen Block weiter. Schlange stehen war angesagt, jeder kam an die Reihe, man musste nur Geduld haben. Fleißige Soldaten hinter den Schaltern bemühten sich redlich, alles für uns zu finden.
Als erstes erhielten wir einen Seesack. Dann kam die Frage: „Größe?“ Mit geübtem Blick wurden wir von oben bis unten »gescannt«. Was dann an Klamotten an uns übergeben wurde, konnte ich nicht glauben.
Unterwäsche in Olive-grau, Socken, Trainingsanzug, Turnzeug, Kampfanzug, Ausgehuniform, Hemden, Schirm-Mütze, Schiffchen, Stahlhelm, Gasmaske, Taschentücher und noch einige Kleinigkeiten. All diese Sachen mussten wir in den Seesack packen. Aus dem Hintergrund hörten wir nur: „Wenn es nicht reingeht, habt ihr nicht richtig gepackt. Das üben wir dann noch!“
Noch hatte ich keine Stiefel, keine Uniform-Schuhe, keine Sportschuhe und keine Arbeitsschuhe. Der, ich sage mal »Einkleider«, war im hinteren Teil der Kleiderkammer verschwunden und suchte für mich die passenden Schuhe. Er hatte meine Schuhgröße geschätzt und brachte mir das erste Paar in Größe 44, nur war das nicht meine Größe.
Ich schob sie ihm zurück und sagte: „Da kann ich nichts mit anfangen ich habe Größe 47.“ „Haben wir nicht“, hörte ich nur. „Die müssen wir erst anfordern, kannst morgen wiederkommen, kann aber auch länger dauern.“
Schöne Scheiße, dachte ich nur. Wenn die hier meine Schuhgröße nicht haben, kann ich ja gleich wieder nach Hause fahren. Ein Lächeln huschte über mein Gesicht. „Das kannst du dir gleich abschminken“, hörte ich ihn sagen „wir haben bisher noch jeden eingekleidet.“ Als wenn er meine Gedanken gelesen hätte, auch auf seinem Gesicht war ein Lächeln.
Na dann, dachte ich, bleiben mir nur meine alten abgewetzten Schuhe die ich trage. Das wird ja eine super Zeit, aber mir soll`s egal sein. Die ganze Einkleiderei dauerte so ca. 2 Stunden. Dann ging es zurück zur Unterkunft.
Wir hatten den Rest des Abends damit zu tun unsere neuen Kleider in unserem Spind unterzubringen, was nicht einfach war. Jeder verstaute seine Klamotten, seiner Ansicht nach, so gut es ging. Außerdem musste das Bett noch »gebaut« werden. Natürlich machte jeder sein Bett so wie er es für richtig hielt, oder gewohnt war.
Müde, oder besser gesagt kaputt waren wir, da hörten wir den Spieß auf dem Flur schreien: „Zapfenstreich.“ Das Licht erlosch.
Wir wollten uns noch ein wenig über den Tag unterhalten, waren aber so müde, dass wir einfach einschliefen.
Ich hatte das Gefühl, in der Nacht gar nicht geschlafen zu haben als ich entfernt hörte: „Kompanie aufstehen, raustreten, vor der Stube aufstellen!“ Noch konnte ich mit dem Gehörten nichts anfangen.
In unsere Stube kam Bewegung. Einige meiner Kameraden standen schon neben dem Bett, andere schliefen noch, sie hatten den Krach noch nicht gehört. Ziemlich benommen krabbelte ich aus dem Bett und wäre fast meinem Nachbarn Hannes in den Nacken gesprungen. Ich hatte nicht mehr daran gedacht, dass ich doch in der oberen Etage schlief.
Hannes aber machte das nichts aus, denn er winkte nur ab. Im Schlafanzug gingen wir auf den Gang und stellten uns, verschlafen wie wir noch waren, direkt vor unserer Stube auf.
Der Spieß, und seine »unterbelichteten Helfer« gingen nervös auf dem langen Flur hin und her, schrien alle Männer vor ihren Stuben an:
„Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Ihr habt in einer Reihe stramm zu stehen und Meldung zu machen!“ Etwas leiser hörten wir den Spieß sagen: „Diese verfluchten Neulinge, das wird ja wieder ein Spaß denen Manieren beizubringen, verdammt! Das üben wir noch!“