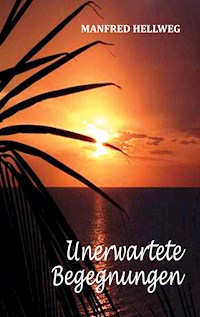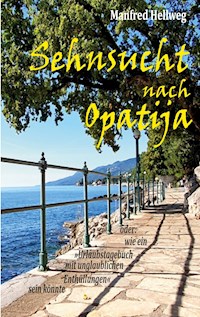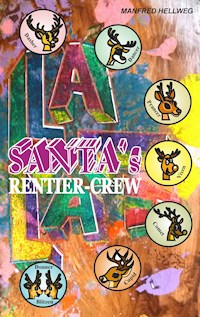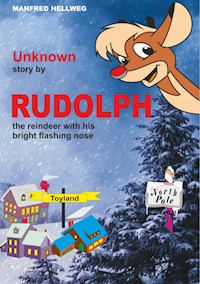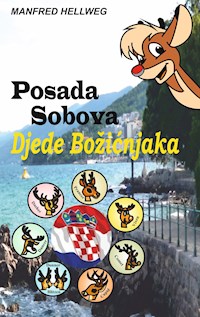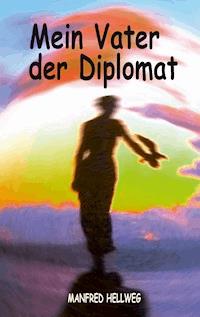
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem meine Mutter verstorben war, hatte ich die Aufgabe ihren Nachlass zu sichten. Dabei entdeckte ich, dass ich außer meinem verstorbenen Ziehvater, einen leiblichen Vater habe. Einen russischen Diplomaten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als meine Mutter sich aus meinem Leben verabschiedete, erlebte ich eine der größten Überraschungen meines Lebens. Es war nicht einfach, aber ich musste ihren Nachlass durchsehen und ordnen.
In ihren Unterlagen fand ich Liebesbriefe aus denen hervorging, dass ich einen Diplomaten als leiblichen Vater habe. Das war Schock und gleichzeitig Ansporn für mich, herauszufinden wer dieser Fremde war, und ob ich noch Kontakt zu ihm aufnehmen kann.
Vorwort
Bis heute nahm mein Leben einen ganz normalen Verlauf. In meiner Jugend profitierte ich, wie jedes Kind, von der Unbekümmertheit und nahm alles so leicht, wie Kinder es in dem Alter tun. Danach erlernte ich einen Beruf, lernte meine Frau kennen und wir bekamen zwei wunderbare Söhne. Unser Leben war perfekt, bis auf die Katastrophe, als mein Vater an unserem dritten Hochzeitstag verstarb.
Als meine Mutter mich dann schließlich mit achtundsiebzig Jahren auch noch verließ, hatte ich keine Bezugsperson mehr, außer meiner Familie. Wie das Leben ohne meine Mutter weitergehen sollte, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Dann erfuhr ich, dass ich doch noch einen Vater habe, und hoffte einer schöneren Zeit entgegen zu gehen.
Ein Traum von kurzer Dauer.
Mein Vater der Diplomat
Als meine Mutter im Jahr 1975 verstarb, war es meine Aufgabe, ihren Nachlass zu ordnen. Dabei habe ich Unterlagen entdeckt, die mich schier zur Verzweiflung brachten. Ich konnte es nicht glauben! Vom einfachen Notizzettel, über Liebesbriefe, Geburts- und Sterbeurkunden, handgeschriebene Ahnentafeln, bis hin zur Eintrittskarte für die »Olympischen-Sommer-Spiele-1936« in Berlin, war alles vorhanden.
Jedes Teil fein sauber geordnet und beschriftet. Das habe ich meiner Mutter nicht zugetraut, sie musste aber einen wichtigen Grund haben, mir den Nachlass so zu übergeben. Sie kannte mich zu genau, denn diesen »Kram« würde ich eigentlich ohne Hintergedanken, kurzerhand entsorgen. Damit wollte ich wirklich nichts zu tun haben, doch eine Sache machte mich stutzig.
Beim Durchstöbern fiel mir zufällig meine Geburtsurkunde in die Hände. Es war nichts Besonderes, aber ich sah sie jetzt zum ersten Mal. Und neugierig wie ich nun einmal war, schaute ich sie mir genauer an. Ich fand nicht meinen jetzigen Vornamen darin, über meinem Geburtsdatum stand ein anderer Name: »Alexander«!
Das haute mich fast um. Das Geburtsdatum stimmte, der Name meiner Mutter war eingetragen, doch als Vater war nicht mein mir bekannter Vater eingetragen, sondern ein für mich völlig Fremder. Was hatte das nur zu bedeuten? Erklären konnte ich es mir nicht. Für mich stand auf einmal fest, dass ich nicht der bin, für den ich mich hielt.
Nachdem ich meiner Frau die Neuigkeit mitteilte, schaute sie mich völlig ratlos an und sagte: „Wenn das zutrifft was da steht, bin ich mit einem total Unbekannten verheiratet!“ Schaute mich weiter an und lachte plötzlich lauthals los: „Sind wir rechtlich überhaupt verheiratet, oder leben wir schon jahrelang in »Wilder-Ehe«?“, prustete sie weiter und ihre Augen blitzten mich schelmisch an.
Nach einer kurzen Verschnaufpause überlegten wir beide, wie wir mit dieser Neuigkeit umgehen sollen. Wer konnte uns darüber Auskunft geben? Keiner meiner älteren Verwandten lebte noch, und ob wirklich jemand darüber Bescheid wusste, steht in den Sternen. Aber wie konnte meine Mutter meinen bisherigen Vater so hinters Licht führen?
Hat er wirklich nichts davon gewusst? Ich konnte mir das nicht erklären. Das konnte nur mit dem Krieg zusammen hängen. Meine Eltern haben während des Krieges geheiratet, ich aber kam schon 6 Monate später auf die Welt. Hat meine Mutter meinen Vater davon überzeugt, dass ich eine Frühgeburt war? Ich kann es kaum glauben.
Die Liebesbriefe sah ich mir daraufhin genauer an. Liebesbriefe meines Vaters, und die meines Erzeugers, hatte meine Mutter in getrennten Hüllen aufbewahrt. Schön säuberlich verpackt und mit einer Kordel zusammengebunden. Aus den Liebesbriefen meines »Erzeugers« ging eindeutig hervor, dass sie meinen Zieh-Vater noch gar nicht kannte. Zu der Zeit war sie mit einer Freundin in den Niederlanden, als »Au-pair-Mädchen«, bei einer wohlhabenden Familie angestellt.
Bei einer internationalen Veranstaltung in Maastricht lernte sie einen jungen Mann kennen, der ihr durch seine sportlichen Erfolge auffiel. Er war Russe und Offizier der russischen Schwarzmeerflotte, stammte aus einem kleinen Dorf im Kaukasus, in der Nähe des »Schwarzen Meeres«.
Sie haben sich auf Anhieb sofort verstanden, zum Glück sprach er ein wenig Deutsch. Es war das Jahr 1933. Michail gehörte einer Sportlergruppe an, die diplomatische Immunität genoss. Ihre Freundin, Aupair bei einer anderen niederländischen Familie, konnte nicht begreifen, dass sie sich mit einem Russen abgab. Russen waren nicht gern gesehen und hatten keinen guten Ruf in der Bevölkerung.
Meiner Mutter war das wohl egal. Ich kann mir vorstellen, warum ein Russe aus einem kleinen Dorf im Kaukasus, sich in sie verguckt hatte. Sie war eine Schönheit. Weiter konnte ich in den Briefen lesen, dass sie sich fast jeden Tag sahen, denn Michail war als Militärberater in der Botschaft der Sowjetunion in Maastricht tätig.
Während ich die Liebesbriefe durchlas, erinnerte ich mich an die Aussagen meiner Mutter, sie erzählte immer gerne von den »Olympischen Spielen«. Sie sprach dann von den »Spielen in Berlin«, weil sie dort als Zuschauerin war und es ein sehr wichtiger Punkt in ihrem Leben gewesen ist.
Sie hatte mit Michail eine Vereinbarung getroffen. Beide wollten zu den »Olympischen Sommer-Spielen« 1936 nach Berlin fahren, sich dort treffen um sich die Spiele gemeinsam anzusehen. Nur zu diesem Treffen kam es nicht mehr. Das Hitler-Regime wollte die Sommer-Spiele in Berlin für seine Propagandazwecke missbrauchen. Deshalb hat die Sowjetunion, im Dezember 1935, ihre Teilnahme an den Spielen abgesagt. Darüber waren beide sehr traurig, meine Mutter aber fuhr damals nach Berlin, und hat die Olympiade allein live erlebt.
Nachdem sie dann nach Beendigung der Spiele wieder bei ihrer Gastfamilie in Maastricht war, konnte sie ihren Freund nicht mehr so oft sehen. Sie stellte dann fest, dass sie schwanger war. Sie schrieb einen Brief an Michail und wollte ihm von dieser freudigen Nachricht berichten, er war nur nicht mehr zu erreichen. Auf Nachfrage in der russischen Botschaft teilte man ihr lediglich mit, dass Michail plötzlich abberufen wurde. So schickte sie den Brief nicht ab, da sie ja keine Adresse hatte.
Bei den Unterlagen fand ich auch noch einige handgeschriebene Notizen, aus denen hervorging, dass meine Mutter noch mehrmals versuchte bei der Botschaft in Erfahrung zu bringen, wohin man ihren Michail versetzt hatte. Die Mitarbeiter in der Botschaft gaben ihr aber klar zu verstehen, dass sie nicht gern gesehen war und keinen weiteren Kontakt zu ihr wünschten.
Mehr konnte ich bei der Sichtung nicht finden. Ich musste mich jetzt damit abfinden, mein Vater ist nicht mein leiblicher Vater! Den Briefen konnte ich aber entnehmen wie sein richtiger Name war. Er hieß Michail Cheraskov. Der Name des Wohnortes »Medoveevka« war mir nicht bekannt. Medoveevka lag nahe der Grenze zu Georgien, mitten im Kaukasus, und ca. 50 km vom »Schwarzen Meer« entfernt.
Das war vorerst alles was ich herausfand. Es war schon ein sonderbares Gefühl. Mit dem Tod meiner Mutter änderte sich in meinem Leben einiges. Jetzt wollte ich herausbekommen wer mein leiblicher Vater war, ob er noch lebte, wie er aussah und ob er überhaupt von meiner Existenz wusste.
Meine Frau und ich beschlossen sofort gezielte Nachforschungen anzustellen. Sogar eine Reise in den Kaukasus würden wir machen, wenn es denn sein sollte. Da gab es nur ein großes Problem. Die UDSSR konnte man nicht so ohne weiteres besuchen. Es gab den berühmt/berüchtigten »Eisernen Vorhang«.
Wir überlegten tagelang wie wir in die UDSSR kommen konnten. Von 1968 an verbrachten wir unseren Jahresurlaub immer in Jugoslawien, einem Staat des „Warschauer Paktes“, hatten also Erfahrung mit sozialistischen Ländern. Jugoslawien dagegen, war das einzige Land, das wir ohne Schwierigkeiten besuchen konnten.
Jugoslawiens damaliger Machthaber Tito, war sehr westlich orientiert und hatte sein Land als erstes Land des »Warschauer Paktes« dem Westen geöffnet. In die DDR, auch ein Mitglied des »Warschauer Paktes«, sind wir einige Male gefahren und haben dort Bekannte und Verwandte besucht. Deshalb kannten wir die vielen Schikanen, die uns eventuell erwarteten, bei einer Einreise in den Ostblock.
Jugoslawien war da wirklich eine rühmliche Ausnahme. Unser Urlaubsziel in Jugoslawien war Opatija. Dort in der Kvarner-Bucht trafen wir auf Urlauber aus den Niederlanden, England, Belgien, Dänemark. Einige Male hatten wir auch Kontakt mit Menschen aus dem Ostblock. Sie kamen aus der Tschechoslowakei, aus Polen, Ungarn und Rumänen und durften dort Urlaub machen. Nur Russen trafen wir nie. Durch Gespräche mit ihnen erfuhren wir einiges über das kommunistische System hinter dem »Eisernen Vorhang«.
Daraus folgerten wir, es würde nicht einfach sein in den Kaukasus zu gelangen. Mit dem Auto schon gar nicht. Wir waren davon überzeugt, dass es uns nicht so leicht gemacht würde wie es nach Jugoslawien möglich war. Auf dem Weg dorthin mussten wir durch Österreich, oder aber durch Italien fahren. Dabei waren allerdings auch einige Tunnel zu durchfahren, und Alpenpässe zu überwinden.
Wir gingen in ein Reisebüro und ließen uns beraten. Es gab ein deutsches Reiseportal, das sich auf Ferienreisen in die UDSSR spezialisiert hatte. Das ließen wir uns genauer erklären, nahmen den Katalog mit nach Hause und machten uns kundig.
Wir entdeckten darin eine 14-tägige Flugreise ans »Schwarze Meer« direkt in die Stadt Sotschi. In einem alten Schul-Atlas suchten wir im Kaukasus nach der Geburtsstadt meines Vaters. Medoveevka lag wirklich nicht weit von Sotschi entfernt. Damit hatten wir ein Ziel! Unser nächster Urlaub sollte eine Reise nach Sotschi werden.
Eine Menge Arbeit lag vor uns. Bei unserer Sparkasse erkundigten wir uns nach dem Wechselkurs des Rubels. Dabei erfuhren wir, dass es verboten war, Rubel mit ins Land zu nehmen. In der UDSSR gab es eine Umtauschpflicht für das Zahlungsmittel. Man durfte und musste nur in Russland Geld tauschen.
Der Umtauschkurs war sehr schlecht. Für 100 DM gaben sie uns nur 30 Rubel. Wir entschieden uns dann für Neckermann-Reisen. Sie sorgten auch für das dringend benötigte Einreisevisum in die UDSSR. 14 Tage sollten es sein, ein längerer Aufenthalt in Sotschi war nicht möglich und kostete schon eine Menge Geld.
Nachdem wir die Reise gebucht hatten, merkte ich dass ich langsam aber sicher immer nervöser wurde. Ich stellte mir manchmal die Frage: „Ist das, was du vorhast, auch wirklich das Richtige?“ Doch, das wollte ich auf jeden Fall!
Für den Umtausch von DM in Rubel war ich gar nicht zu begeistern. Bei unserer Sparkasse würde ich einen weit besseren Umtauschkurs haben und für 100 DM =100 Rubel bekommen. So spielte ich mit dem Gedanken, Rubel von Deutschland mit in die UDSSR zu nehmen.
Es war schon verlockend, und es kribbelte mir in den Fingern. Ich hatte aber Familie und wusste nicht, ob ich vielleicht einen Fehler machte, und dann in Sibirien landen würde. Meine Frau hatte auch Angst dabei erwischt zu werden, obwohl wir in Jugoslawien immer ohne Probleme privat getauscht haben, DM gegen Dinar. Die Angst dabei erwischt zu werden schreckte mich dann doch davon ab, und ich ließ es sein.
Der Reisetermin kam näher und näher. Der Flug nach Sotschi ging von Frankfurt aus mit der russischen Fluggesellschaft Aeroflot. Vorgesehen war eine Zwischenlandung auf der Krim. Ich hatte schon viel von der Krim gehört. Die Krim war für mich etwas Besonderes, warum wusste ich aber nicht.
Der Flug mit einer alten russischen Iljuschin-Maschine dauerte ca. zweieinhalb Stunden. Die Verpflegung an Bord war »atemberaubend«. Wir bekamen Tee zu trinken und als Beigabe noch einige Bonbons. In meinen Gedanken war ich schon in dem Dorf meines Vaters. Ich stellte mir Medoveevka als ein von der Außenwelt abgeschnittenes, uraltes, russisches Dorf vor. Natürlich auch ohne Elektrizität und ohne Wasseranschluss.
Wie konnte mein Vater es schaffen russischer Offizier zu werden, und dann auch noch Diplomat in den Niederlanden? Der langsame Sinkflug der Maschine riss mich aus meinen Gedanken. Unter uns sahen wir das »Schwarze Meer« und die ersten Häuser von Sewastopol. Das war der internationale Flughafen der Halbinsel Krim.
Kaum hatte die Maschine Bodenkontakt, klatschten die meisten Passagiere. Es waren hauptsächlich deutsche Urlauber an Bord. Deshalb nahm ich an, sie wollten sich bei dem Kapitän dafür bedanken, dass er sicher gelandet war. Die Maschine rollte und rollte, es wollte kein Ende nehmen. Endlich erreichte sie ihre Endposition. Wir konnten aussteigen und betraten zum ersten Mal russischen Boden.
Jetzt kamen die strengen Einreisekontrollen auf uns zu, vor denen wir einen großen Bammel hatten. Von den Jugoslawien-Urlaubern, aus dem Ostblock, hatten wir so einiges über die Sicherheitskontrollen in Russland gehört. Überall standen Sicherheitsbeamte und schauten mit Argusaugen auf die Reisenden. Für uns war das das reinste Spießrutenlaufen.
Ich wusste zwar, dass ich nichts zu befürchten habe, aber die Angst verhaftet zu werden, und in Sibirien zu landen, war da. In Gedanken redete ich mit mir: „Bleib ruhig, reg dich nicht auf, die können dir nichts!“ Es ging auch alles gut. Wir wurden zu einer kleinen Maschine gebracht, die uns nach Sotschi bringen sollte.
Es war eine Propellermaschine mit ca. fünfzig bis sechzig Plätzen. Einige Deutsche, die mit uns aus Frankfurt kamen, nahmen ihre Plätze ein, die restlichen Plätze wurden von Russen belegt. Sogar aus Moskau kamen sie und hatten Gepäck und Beutel voller Waren dabei, die sie wohl in Moskau gekauft hatten.
Uns gegenüber saß eine alte Frau mit einem Vogelkäfig voller Küken, die sie mit nach Sotschi nehmen wollte. Es war schon ein seltsames Völkchen auf dem Weg nach Sotschi.
Das laute Dröhnen der Propeller signalisierte uns, dass es jetzt weiter ging. Wir hatten mit vielem gerechnet, nur nicht mit so einer alten, russischen Klapper-Kiste. Die laute Unterhaltung der russischen Passagiere ließ uns schnell die Zeit vergessen, denn nach ganz kurzem Flug landeten wir in Adler, dem Flughafen von Sotschi.
Der Pilot brachte die Maschine direkt vor dem Flughafengebäude in die Parkposition. Mit unserem Handgepäck verließen wir die Maschine und erreichten nach kurzem Fußweg das Flughafengebäude. Dort wurden alle deutschen Passagiere von einer netten jungen Frau in Empfang genommen und zu einem Bus geführt. Die Fahrt vom Flughafen zu unserem Hotel dauerte nicht mehr lange. Das Gebäude war ein altes, großes Hotel, hatte den für mich schwer auszusprechenden Namen Primorskaja. Über die Strandpromenade hinweg sahen wir schon das Meer.
Unser Zimmer lag in der ersten Etage. Es war ein großer Raum mit alten, dunklen Möbeln. So stellte ich mir einige Wohnungen in der UDSSR vor. Einfach, ärmlich und primitiv. Um von der Rezeption zu unserem Zimmer zu gelangen, galt es einige Schwierigkeiten zu überwinden. In diesem Hotel gab es nicht nur Hotelgäste, nein, es wohnten in der ersten Etage auch viele Einheimische. Auf dem Flur kamen wir an deren Wohnungen vorbei. Die unbekannten Gerüche nahmen uns den Atem.
Das Hotel war karreeförmig gebaut und hatte einen riesigen Innenhof. Um zu unserem Zimmer zu kommen, wurden wir von einer Etagenfrau, einer Russin kontrolliert, die nur Hotelgäste weitergehen ließ, die einen Hotelausweis für diese Etage hatten.
Kontrolle gut und schön, aber immerzu - nein danke. Seit wir das Flugzeug verlassen haben, sahen wir an jeder Ecke Männer stehen, die sich total »unauffällig« die Gegend ansahen. Das kannten wir schon durch die Verwandtenbesuche in der DDR. Das kommunistische System hat den Vorteil, dass man überall in den Ländern der UDSSR sofort gefunden wird. Die Geheimdienste aller sowjetischen Länder haben die wohl am besten ausgebildeten Geheimagenten. Das meine ich einmal gelesen zu haben.
Nachdem wir uns etwas frisch gemacht haben, gingen wir zur Rezeption um zu erfahren, wo wir den Speisesaal finden. Zu ebener Erde befand sich ein großer Speisesaal. Alle westdeutschen Urlauber aber mussten in die erste Etage in einen Raum, der aussah wie eine riesige Theater-Loge. Dort konnten wir unsere Mahlzeiten einnehmen. Und über die Brüstung hatten wir einen schönen Blick auf den großen Speisesaal und konnten die Menschen dort unten beobachten.
Es war unser erster Abend und wir staunten nicht schlecht, was sich unten im Speisesaal abspielte. Es spielte eine Kapelle und an langen Tischen saßen die Gäste, aßen und tranken, zwischendurch gingen sie auf die Tanzfläche und tanzten einige Runden. Hatten sie genug, gingen sie wieder an ihre Plätze und aßen und tranken weiter. Wir konnten nicht verstehen wie man lauwarmes Essen genießen kann. Aber dieser Wechsel: Essen, Trinken, Tanzen dauerte fast die halbe Nacht.
Hier oben im »kapitalistischen Speiseraum« sah es anders aus. Es waren nur einige Tische die für uns bestimmt waren. An unseren Tisch setzte sich ein älteres Paar und wir erfuhren, dass sie in der Nähe unserer Stadt wohnten. Wir konnten à la carte bestellen, nur Getränke oder Sonderwünsche gingen zu unseren Lasten.
Die Kellner waren freundlich, sprachen sogar einige Brocken Deutsch, ließen uns aber nicht aus den Augen. Dort war sogar eine »Oberaufsicht«, die besonders unseren Tisch im Blick hatte. Von unseren Besuchen in der DDR war ich so manches gewohnt, doch hier in diesem Hotel war ich davon überzeugt, dass wir beschattet werden.
Die Oberaufsicht war eine ältere Russin so zwischen 50 und 60 Jahre alt, und hatte besonders meine Frau und mich im Auge. Das bemerkte ich schnell und meine Alarmsirenen schrillten. Zu unserem Essen bestellten wir eine Flasche Krimsekt, mit Eiswürfeln, und meine Frau eine Portion Kaviar, den echten russischen „Beluga-Kaviar“.
Wie ich schon vermutete, wurden wir von der Oberaufsicht bedient. Auf ihrem Namensschild las ich Natascha und stellte fest, dass sie meine Frau so »besonders« ansah. Dabei hatte ich ein seltsames Gefühl. Als ich mit meiner Frau darüber sprach meinte sie zu mir: „Meinst du das wirklich? Was will die alte Frau denn von mir? Ich habe das nicht bemerkt, aber du hast schon immer einen Blick für Auffälligkeiten. Ich werde sie beobachten.“
Mit unseren Tischnachbarn Paul und Paula freundeten wir uns schnell an, denn sie würden ja die nächsten Tage immer an unserer Seite sein. Nach dem Essen wollten wir noch einen Rundgang machen und uns in der Nähe des Hotels einiges ansehen. Paul und Paula schlossen sich uns an und gingen mit. Als wir die Uferstraße am Schwarzen-Meer entlang schlenderten, in Richtung Innenstadt, bemerkte ich den ersten »Begleitschutz«.
Vor und hinter uns beobachtete ich einige Männer in Mantel und Hut, die sich unbeobachtet fühlten. Geschickt die Seite wechselten, mal zurückfallen ließen, plötzlich verschwanden um an anderer Stelle wieder zu erscheinen. Typisch für ein Beschattungsteam! Ich hatte sofort den Verdacht, dass es mit mir zu tun habe, denn vor der Reise versuchte ich etwas über meinen Vater im Kaukasus zu erfahren. Was sollten diese Aufpasser auch sonst von uns wollen?