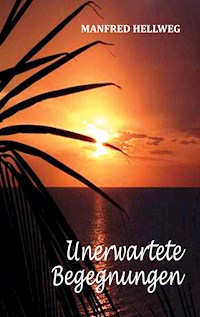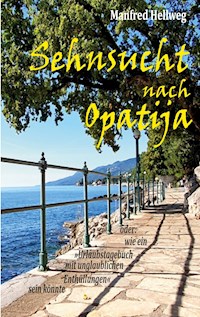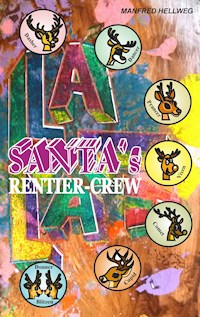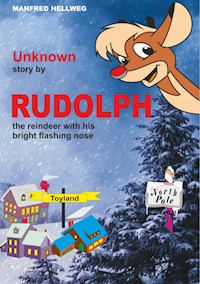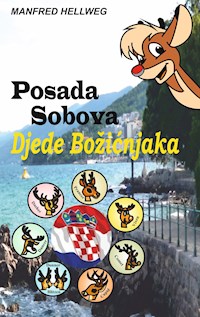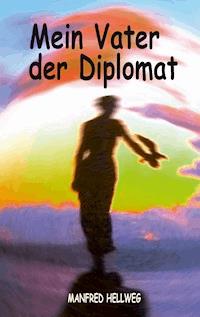3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Damals, um 1945, es war schon eine ver-rückte Zeit, gerade darüber fallen mir immer wieder Episoden ein, über die ich gerne erzählen möchte. In Zukunft kann ich mich vielleicht nicht mehr so genau erinnern, weil mein Ge-dächtnis nicht mehr mit mir einverstan-den ist, oder aber, es ist peinlich, mir so banale Ereignisse, die schon mehr als 70 Jahre zurückliegen, noch ins Gedächtnis zu rufen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Diese Geschichten widme ich meiner Familie.
Ich bedanke mich bei ihnen und allen, die diesen Geburtstag mit uns gefeiert haben.
Inhaltsverzeichnis
Erinnerungen
Die letzten Tage – es war mein vierter Geburtstag
Das war eine herzliche Begrüßung!
Neuanfang Mai 1945
Kohlenklau auf der Zechenbahn
Eine Straßenbahnfahrt in die Nachbarstadt Datteln
Erntezeit - Einkellerungszeit
Barfuß durch den Schnee
Herbst-Zeit – Windvogel-Zeit
Ähren auf abgeernteten Feldern sammeln
Rauchen in Jupp`s Garten
Eisenbahnschienen für den Klüngelkerl
Was gab es denn schon?
Gleisdreieck
Kinder-Schützenfest – zur damaligen Zeit eine Tradition
Schützenkönigin
Das Schwimmbad der Schlegel-Brauerei
Schwimmvereine
Und ob ich wollte!
Brennball, so haben wir das genannt
„Pinnchen“ schlagen
Pitschendopp-Schlagen
Säckeln
Knickeln
Erinnerungen
Damals, um 1945, es war schon eine verrückte Zeit, gerade darüber fallen mir immer wieder Episoden ein, über die ich gerne erzählen möchte.
In Zukunft kann ich mich vielleicht nicht mehr so genau erinnern, weil mein Gedächtnis nicht mehr mit mir einverstanden ist, oder aber, es ist peinlich, mir so banale Ereignisse, die schon mehr als 70 Jahre zurückliegen, noch ins Gedächtnis zu rufen.
Es waren die letzten Wochen vor Ende des 2. Weltkriegs.
Erinnern kann ich mich aber noch sehr genau. Den ganzen lieben langen Tag hörten meine Mutter und meine Oma, wie fasziniert, dem Sprecher im „Volksempfänger“ zu.
Der „Volksempfänger“ war die einzige Nachrichtenquelle, die wir hatten, und mit der die Bevölkerung informiert wurde. Zeitungen gab es kaum noch, deshalb blieb uns als einzige Quelle dieses Gerät zur Information übrig. Wie gebannt saßen wir davor, obwohl ich überhaupt nicht verstand, was ich aus dem Radio hörte.
Diese Nachricht heute musste aber wohl so besonders sein, denn beide weinten plötzlich. In der letzten Zeit erlebte ich immer wieder, dass beide nach einer Nachricht weinten.
Ich glaube, sie waren traurig. Darum weinte ich wohl aus Sympathie gleich mit. Beide nahmen sie mich in den Arm und versuchten mich zu trösten.
Es war aber, so glaube ich, gar nicht so einfach mich zu beruhigen. Immer wieder fragte ich meine Mutter, manchmal auch die Oma, warum sie weinten, wenn sie Radio hörten?
Die letzten Tage – es war mein vierter Geburtstag.
Dann sagten sie mir immer: „Junge, es ist doch Krieg, aber unser Herrgott wird uns alle beschützen.“
Ich konnte mir in diesem Alter nicht vorstellen, was Krieg ist. Während des Tages, und sogar nachts gingen manchmal die Sirenen los. Dann hörten wir Flugzeuggeräusche über uns am Himmel. Meistens rannten Mama und Oma wie wild durch die Gegend, wenn sie die Sirenen hörten, schnappten sich hastig einige Sachen zu Essen und Trinken, nahmen mich an die Hand und zusammen rannten wir so schnell wir konnten in unseren Keller. Nicht in unseren eigenen, nein in den Gemeinschaftskeller den „Luftschutzbunker“.
Nach und nach kamen alle Hausbewohner hier unten an. In der beunruhigenden Stille falteten die meisten ihre Hände, einige zogen einen Rosenkranz aus ihrer Tasche und beteten ohne Unterbrechung. Da war ein Gemurmel, das ich nicht verstand.
Über uns hörten wir die Maschinen fliegen. Einmal kam ein lauter Knall, alle erschraken und weinten plötzlich los. Stille! Eine lange Zeit Stille. Die ersten Frauen verließen den Keller und kamen laut weinend zurück. Im Nebenhaus war eine Bombe eingeschlagen.
Es war unser aller Glück, denn nur 10 oder 11 Meter weiter und sie wäre in unserm Haus eingeschlagen. Ich glaube, von uns wäre nichts mehr übriggeblieben. Nach und nach verließen wir alle den „Luftschutzkeller“.
Als wir auf die Straße kamen, sahen wir die Bescherung. Das Haus nebenan war halb zerstört. Es lag in Schutt und Asche. Nur eine Hälfte stand noch. Niemand wurde verletzt, doch die Wohnungen waren ein Trümmerhaufen.
Das Erlebnis mit der Bombe war für meine Mama und Oma wohl wichtig. Beim nächsten „Bombenangriff“, so bezeichneten sie den „Fliegeralarm“, immer wenn die Sirenen heulten, schnappten sie die wichtigsten Sachen und Decken, verließen das Haus, und wir rannten über die Straße, in das auf der anderen Straßenseite liegende Straßenbahndepot.
Die Angst im Nacken trieb alle immer zur Eile. Das Depot war nicht weit entfernt, doch von unserer Wohnung aus, über die Straße, entlang des Gartens bis zum Depot schätze ich mal, waren es wohl mindestens 200 Meter.
Bei einem Fliegeralarm sollten wir, so schnell wie nur eben möglich, in einem Luftschutzkeller vor explodierenden Bomben Schutz finden. Dabei hatten wir das ganze Gebäude des Depots zu umlaufen, denn der Schutzbunker lag am äußersten, hinteren Ende, nahe der Bahngleise.
Das Depot war so lang, dass dort zwei Straßenbahnwagen hintereinander hineinpassten. Nebeneinander war Platz für ca. 8 bis 10 Straßenbahnen.
Bis wir letztendlich den Schutzraum erreichten, verging viel Zeit, in der wir von herunterfallenden Bomben hätten getroffen werden können. So schnell wie die vom Himmel fallen, konnten wir nicht von der Wohnung bis zum Schutzraum laufen.
Ich kann behaupten: „Wir hatten immer riesiges Glück, dass wir auf dem Weg nicht getroffen worden sind.“
Als wir in den Raum kamen, waren wir nicht die Einzigen. Fast alle Bewohner der Castroper Straße von Anfang bis hinunter zur „Sanders Wiese“ trafen sich hier. Es war, trotz allem, immer ein großes „hallo“. Es kannten sich alle. Der Schutzraum war groß genug.
Jeder hatte, selbst in der Eile, für die kurze Zeit etwas mitgebracht, und gab, ohne zu fragen, seinem Nachbarn davon etwas ab. Es war einfach eine Gemeinschaft. Gemeinsam fieberten wir dann während des Bombenalarms, immer in der Hoffnung, nicht von einer Bombe getroffen zu werden.
Es dauerte nicht lange, bis sich auch in diesem Schutzraum das Beten aller Nachbarn fortsetzte. Sie konnten wohl nicht anders. Ihren Gesichtern konnte ich, schon als Kind, ansehen, wie verzweifelt sie waren. Einige schüttelten mit dem Kopf, konnten nicht verstehen was da über sie hinweg flog und schon gar nicht „warum“?
Nach einer langen Zeit hörten wir, dass Ruhe eingetreten war. Die Gesichter entspannten sich und Hoffnung breitete sich aus.
Besonders vorsichtig wurde die schwere Tür des Schutzraumes geöffnet und nach draußen geschaut. Wenn von den Fliegern nichts mehr zu hören war, atmeten alle tief durch. Draußen schauten sich alle erst einmal um, ob das Gelände vor dem Depot noch so aussah wie vorher.
Es war unheimlich still. Nachdem jeder sah, dass der Luftangriff hier nichts zerstört hat, atmeten sie auf und verließen schnellen Schrittes das Gelände. Wieder in unserer Wohnung, versuchten wir das erstmal wieder zu vergessen.
Es half ja auch nichts, der nächste Angriff konnte jeden Moment erfolgen. Damals wusste ich nicht, dass wir genau in einer für die Bomber wichtigen Gegend wohnten. Im Umkreis von nur wenigen hundert Metern war unsere Wohngegend das Hauptziel ihrer Zerstörungen.
Um die Ecke befand sich die Schlegel-Brauerei und uns genau gegenüber das Straßenbahndepot. Einige hundert Meter weiter der Hauptbahnhof. Drei wichtige Standpunkte, die aus Sicht der Alliierten zerstört werden mussten.
Meine Mutter schaltete sofort das Radio ein, und wir lauschten gespannt den Nachrichten, die über den Luftangriff berichteten. Wir hatten wieder einmal Glück, in unserer direkten Umgebung wurden die Gebäude von Bomben verschont. Daraufhin zündeten Mama und Oma Kerzen an, holten ihren Rosenkranz heraus und beteten.
Ich schaute mal wieder betreten zu, verstand nicht, warum sie beten, wenn eine besondere Situation eintrat. Nach einer Weile hörten wir die Straßenbahnen vor unserem Fenster rangieren. An dieses Rangiergeräusch waren wir gewöhnt. Es begleitete mich von früh morgens bis zum Abend.
Der „Volksempfänger“ brachte die neuesten Nachrichten, die ich damals noch nicht verstand. Meine Mama allerdings war der Meinung, wenn sie den „Volksempfänger“ einschaltete, würde sie hören, ob vielleicht mein Papa bald nach Hause kommt.
Meine Oma aber wollte immer wissen, wann der nächste Alarm losgeht. Vielleicht hätten wir dann mal genug Zeit in den Keller zu gehen, oder, wenn es sogar schlimmer würde, wieder hinüber rennen zu müssen in den Luftschutzbunker hinten im Straßenbahndepot.
Aus den Gesprächen mit den Nachbarn hatte ich erfahren, dass fast jede Familie so einen „Volksempfänger“ hat. Da war es auch klar, warum alle Nachbarn fast zur gleichen Zeit die Schutzräume aufsuchten.
Manchmal fragte ich auch Mama nach meinem Papa. Immer hob sie die Schultern und konnte mir nicht sagen, wann wir ihn wiedersehen werden.
An ein Ereignis kann ich mich ganz besonders erinnern, ich machte irgendwann mit meiner Mama eine lange Reise mit dem Zug, um Papa zu besuchen.
Die Reise dauerte viele Stunden, so dass ich einen Teil der Reise verschlafen habe. Erst kurz vor dem Ziel bin ich aufgewacht und es war nicht so sehr weit zu laufen, bis wir an der Nordsee waren.
Da war ein riesengroßer Hafen mit vielen Schiffen. Zum allerersten male habe ich Schiffe gesehen. Für mich waren diese so hoch wie ein Haus. Ich war noch keine 4 Jahre alt, aber das weiß ich noch genau. Es war nämlich kurz vor meinem Geburtstag. Aufgeregt sah ich mich um, sah aber nur Schiffe, von Papa keine Spur.
Meine Mama hatte meine Hand fest in ihrer und zog mich immer weiter, obwohl ich mir lieber noch die Schiffe angucken wollte. Doch ich musste mit, bis wir vor einem großen Steinbecken standen, das voller Wasser war.