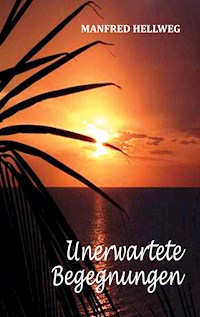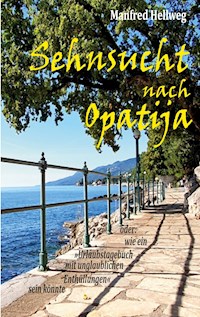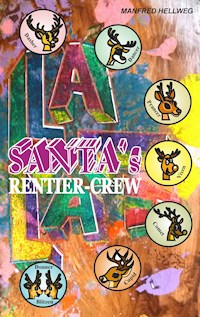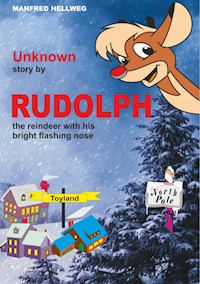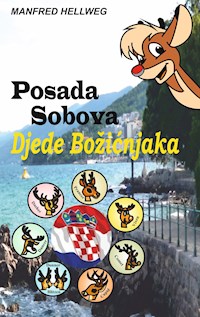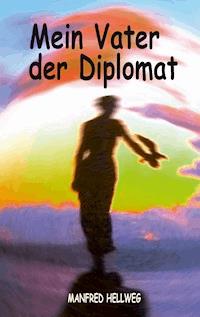Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viele Jahre quälte mich ein Traum von einer Zwillingsschwester. Immer und immer mehr hat dieser Traum mein Leben bestimmt. Das Gefühl, nicht allein auf der Welt zu sein, habe ich schon seit meiner Kindheit. Zu erfahren dass am anderen Ende der Welt noch jemand ist, der meine Gefühle teilt, ist eine echte Sensation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Viele Jahre quälte mich ein Traum von einer Zwillingsschwester. Immer und immer mehr hat dieser Traum mein Leben bestimmt.
Das Gefühl, nicht allein auf der Welt zu sein, habe ich schon seit meiner Kindheit. Zu erfahren dass am anderen Ende der Welt noch jemand ist, der meine Gefühle teilt, ist eine echte Sensation.
Zu schön um wahr zu sein,
eine fiktive Geschichte.
Personen und Handlungen sind frei erfunden.
Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden
Menschen sind rein zufällig
und nicht beabsichtigt.
Vorwort
Als ich kurz nach der Jahrtausend-Wende von meiner Leukämie-Erkrankung erfuhr, erinnerte ich mich an einen ganz bestimmten Gedanken der mich nicht mehr los ließ: „Sollte mich in den nächsten Jahren auch einmal dieser teuflische Krebs erwischen, werde ich mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diesen Bastard zur Wehr setzen. Mich wirst du nicht klein kriegen!“
Seit der endgültigen Krebs-Diagnose gebe ich ihm keine ruhige Minute mehr. Mehrmals täglich spreche ich mit meinen roten Blutplättchen und fordere sie auf sich die Parasiten, wie ich die Leukozyten nenne, vom Hals zu halten. Nur sie können diese Parasiten vernichten. Sobald sie neue Leukozyten entdecken ist es ihre Aufgabe sie zu eliminieren.
Ich will schließlich trotz allem ein hohes Alter erreichen.
Der gestohlene Zwilling
Der zweite Weltkrieg bestimmte in meinen ersten Jahren unser aller Leben. Meine Eltern hatten eine kleine 2-Zimmer-Wohnung direkt an der Hauptstraße, genau gegenüber eines Straßenbahn-Depots.
Manchmal wussten wir nicht was lauter war, der Rangierlärm der ein- und ausfahrenden Straßenbahnen oder der Lärm der aufheulenden Sirenen wenn es mal wieder am Himmel dunkel wurde und die fremden Flugzeuge über uns hinwegdonnerten und ihre Bomben abwarfen.
Wenn die Sirenen aufheulten war es sogar schon vorgekommen, dass wir es nicht mehr schafften den rettenden Luftschutzbunker auf der anderen Straßenseite zu erreichen, der sich unter dem Straßenbahn-Depot verbarg. Um dort hinzukommen, mussten wir über die Straße, dann über den sehr großen Vorplatz laufen, auf dem die einzelnen Straßenbahnen abgestellt waren. Immer weiter bis hinter die große Halle, um durch die versteckte Tür an der Rückseite den rettenden Luftschutzbunker zu erreichen.
Ich war noch zu klein um selbst dorthin zu gehen, so war ich auf meine Mama oder meine Oma angewiesen, die mich trugen. Sie hatten mich in dicke Decken gehüllt, bestimmt damit ich den Fliegerlärm und die lauten Detonationen der explodierenden Bomben nicht hören sollte.
Einen anderen Grund konnte es eigentlich nicht geben, es sei denn, es war kalt. Es kam auch öfter vor, dass wir den rettenden Straßenbahn-Bunker nicht mehr erreichen konnten, dann blieb uns nichts anderes übrig, als in unseren Keller zu eilen, denn da gab es auch einen extra gesicherten Raum, der Luftschutzbunker genannt wurde.
Ob nun der eine oder der andere Luftschutz-Bunker wirklich Schutz boten, sei dahin gestellt. Denn, ich erinnere mich ganz genau, an diesen einen, besonderen Tag, als direkt an der Ecke unseres Hauses eine Bombe einschlug. Sie verwüstete den gesamten Schreibladen, der sich dort befand. Unsere Wohnung befand sich direkt daneben und durch die Detonation war alles von den Wänden und vom Tisch gefallen, so stark war die Druckwelle.
Als dann am nächsten Tag wieder Ruhe eingekehrt war, schlich ich mich heimlich aus unserer Wohnung um mit anderen Kindern in den Trümmern dieses Schreibwarenladens nach etwas Brauchbarem zu suchen. An das, was wir dann alles gefunden und mitgenommen haben, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Für uns Kinder war ja alles wichtig, denn wir konnten damals aber auch jedes noch so unwichtig erscheinende Teil gebrauchen, zum Spielen oder Basteln. Es gab doch sonst nichts.
In dieser Zeit machte ich mir um mein Umfeld noch keine Gedanken, deshalb war mir auch nie aufgefallen, dass es bei uns noch ein kleines Mädchen gab, welches genauso viele weiße Locken auf ihrem Kopf hatte wie ich und abwechselnd bei meiner Mutter oder bei meiner Oma war.
Ich wusste nicht einmal wie das Mädchen hieß. Ich war einfach zu jung. 1941 im Mai wurde ich geboren und war gerade einmal 3 Jahre alt. Da ist man zwar neugierig und will sehr viel wissen, doch an dieses kleine Mädchen hatte ich kaum eine Erinnerung.
An ein besonderes Ereignis kann ich mich aber noch genau erinnern. Wir hatten in unserer kleinen Wohnung sehr oft Besuch von einer Tante, die aus der Nachbarstadt kam. Es war immer fröhlich und lustig, alle saßen um den Kaffeetisch, scherzten und die Erwachsenen erzählten uns Geschichten, tratschten über andere Leute während sie mit einem Ohr immer auf die Sirenen und das Fliegergeräusch von draußen hörten. Dieses Treffen verlief aber ganz anders.
Ich weiß noch wie sich meine Eltern von dieser Tante verabschiedeten und plötzlich alle weinten. Ein in dicke Decken gehülltes Bündel wurde der Tante übergeben und es wurde über die Amerikaner gesprochen.
Das war es dann auch. Von dieser Tante habe ich jahrelang nichts mehr gehört. Auch meine Eltern und meine Oma sprachen mit keiner Silbe von ihr.
Es muss so in den letzten Kriegswochen gewesen sein, denn meine Mutter war mit mir auf dem Weg meinen Vater an der Nordsee zu besuchen. Ich erinnere mich deshalb so genau, weil das Schiff, auf dem mein Vater stationiert war, in einem großen offenen Container lag, ohne Wasser.
Schiffe sollten für mich auf dem Wasser schwimmen und nicht in einem Container liegen. Über eine schmale Brücke konnten wir zu dem Schiff gelangen und mein Vater schaute aus einem kleinen Fenster uns entgegen und freute sich riesig, das sahen wir ihm an.
Später erfuhr ich von meiner Mutter, dass diese kleine Kammer hinter dem Fenster die Kombüse des Schiffes war und mein Vater als Koch darin arbeitete. Es waren spannende Stunden mit meinem Vater auf dem Schiff.
Später habe ich dann von meinem Vater erfahren, dass er bei der Marine stationiert war und zwar, wie er immer so schön sagte, beim Himmelfahrts-Kommando. Dieses besagte Himmelfahrts-Kommando war ein Minensuchboot der Deutschen Marine.
Im Nachhinein ist mir klar, dass das Schiff an der Nordsee, das dort im Trockendock lag, ein Minensuchboot gewesen sein muss.
Dass die Arbeit auf solch einem Boot sehr gefährlich sein sollte, konnte ich mir als Kind nicht vorstellen. Ich freute mich einfach meinen Vater in Uniform auf einem Schiff gesehen zu haben.
Dass der Krieg dann einen Tag nach meinem 4. Geburtstag zu Ende war, habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß nur noch, kurz vor meinem Geburtstag gab es vor unserem Haus, mitten auf der Kreuzung, vor der Brauerei eine große Bücherverbrennung. Von unserem Schlafzimmerfenster konnte man das gut beobachten. Meine Mutter war nicht zu Hause, und so machte ich einfach das Fenster auf und stieg hindurch auf den Bürgersteig. Dadurch hatte ich einen guten Blick auf das Geschehen.
Da ich überhaupt nicht wusste, was dort auf der Straßenmitte vor sich ging, staunte ich nur über den Lärm und das Gejohle einiger Menschen, sah aber fasziniert den Flammen zu. Solch ein großes Feuer hatte ich vor kurzem schon einmal gesehen, als ich mit meiner Mutter und meiner Oma auf dem Fritzberg war, denn da wurde ein riesiges Feuer angezündet und die Menschen sangen fröhliche Lieder.
Ich sah meine Mutter nach Hause kommen und sofort kletterte ich wieder in das Schlafzimmer zurück, verschloss das Fenster, so als wäre nichts geschehen. Aber meine Mutter roch sofort, dass ich das Fenster geöffnet hatte, denn den beißenden vom Qualm verursachten Geruch konnte man deutlich im Zimmer riechen.
Sie fragte mich, was ich verbrannt hätte, doch ich hatte ja gar nichts mit dem Feuer zu tun. Was sie dann tat, ist mir auch erst viele Jahre später wieder ins Gedächtnis gekommen. Sie schaute in unserem Wohnzimmerschrank in eine bestimmte Schublade, in der sich viele Fotos befanden. In dieser Schublade war auch eine Blechdose, und diese interessierte sie sehr, denn dort hinein schaute sie ob die speziellen Fotos noch unversehrt waren.
Da ich vor einiger Zeit diese Bilder in der Blechdose gesehen hatte, war das nichts Besonderes für mich. Nur eines fiel mir auf, das Bild eines kleinen Mädchens mit hellen blonden, lockigen Haaren nahm meine Mutter an sich, drückte es an ihre Brust und küsste es.
Das hatte ich schon einige Male in der letzten Zeit beobachtet, wusste aber nicht, was es zu bedeuten hatte. Meine Gedanken beschäftigten sich immer mehr mit diesem kleinen blonden Mädchen.
Einige Tage später wurde es sehr laut vor unserem Haus. Es war der 9. Mai 1945. Ohrenbetäubender Lärm war zu hören. Alle Nachbarn öffneten deshalb ihre Fenster und Türen und schauten interessiert dem Spektakel zu. Ich habe mich genauso gefreut wie diese Nachbarn, allerdings wusste ich nicht warum.
Aus Richtung Innenstadt kamen viele große Fahrzeuge, die auf Ketten fuhren und fremde Soldaten saßen auf ihnen mit Gewehren und Fahnen, die sie hin und her schwenkten. Alle Nachbarn, wie ich sehen konnte, winkten ihnen freudestrahlend zu, manche tanzten sogar auf dem Bürgersteig vor lauter Freude.
„Wir sind frei, wir sind frei“, hörte ich die Rufe der Menschen um mich herum. „Die Amis sind da, das sind Amis“, kamen die Stimmen von der anderen Seite. Ein unbeschreiblicher Jubel brach aus. Ich bestaunte diese großen Fahrzeuge und erfuhr dann von einigen größeren Kindern auf der Straße, dass die Fahrzeuge amerikanische Panzer waren.
Sie bogen auf das Betriebsgelände des Straßenbahn-Depots ein und parkten da. Die Kinder aus unserer Nachbarschaft versammelten sich vor unserer Haustür. Der Werner aus unserem Haus und der Jupp aus dem Haus nebenan, in dem meine Oma wohnte, kamen und wir gingen hinüber auf das Straßenbahngelände. Wir waren so neugierig wollten wir doch genau wissen, was die Soldaten mit ihren Panzern auf dem Betriebsgelände machten.
Dort sahen wir die amerikanischen Soldaten die mit den Straßenbahnschaffnerinnen tanzten und sich umarmten. Unsere Straße war voller Menschen und alle freuten sich und tanzten auch. So viele fröhliche Menschen hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aus allen Richtungen kamen sie und wollten die Amerikaner sehen um sich bei ihnen zu bedanken.
„Der Krieg ist aus, es ist zu Ende, wir sind endlich frei“, das waren die Rufe, die ich hörte. „Danke Amerika, danke!“, riefen sie immer wieder. Dass der Krieg zu Ende war, sagte mir gar nichts. Ich konnte damit nichts anfangen. Was mir aber auffiel, die Sirenen heulten nicht mehr und wir mussten nie wieder in den Luftschutzkeller gehen.
Aus östlicher Richtung schallte Glockengeläute. Es waren die Kirchenglocken unserer Gemeinde. Das Glockenläuten hörte sich fröhlich und befreiend an, nicht so traurig, wie wenn jemand verstorben war.
Nachdem die Glocken verklangen hörten wir auch keine Flugzeuge mehr, die über uns hinwegdüsten, und das Schönste, es fielen keine Bomben mehr. Sogar ich bemerkte diese Ruhe. Einige Tage später, ich kann nicht mehr genau sagen wann, kam mein Vater wieder zurück nach Hause, aber nicht mehr in Uniform. Er war einfach daheim. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich das vorher schon erlebt hatte. Er war ganz einfach da. Für alle begann jetzt ein anderes Leben, ohne Angst. Wir spielten wieder auf dem Straßenbahngelände, obwohl das verboten und sehr gefährlich war, die ein- und ausfahrenden Straßenbahnen hätten uns beim Rangieren erwischen, verletzen und sogar töten können.
Solch ein Unfall mit diesen Bahnen war bestimmt schlimm. Aber wir Kinder hatten einfach keine Angst, die Neugierde war größer als die Angst. Mein Kumpel Jupp und ich stöberten immer auf dem Gelände herum. Manchmal schafften wir es auch in die Hallen zu kommen, in denen die Straßenbahnen abgestellt und repariert wurden. Das war ein riesiger Spaß.
Wir kletterten in die Montageschächte und konnten von unten die Bahnen sehen. Am Rande dieses Geländes hatten einige Nachbarn sich kleine Schrebergärten angelegt, die von der Straßenbahngesellschaft geduldet wurden.
Jupp`s Eltern hatten hier auch einen kleinen Garten, sogar eine Laube. Darin konnten wir uns dann verstecken, wenn wir doch einmal von den Schaffnern oder von der Aufsicht entdeckt wurden. Hier trauten sie sich nicht hinein. Diese Schrebergärten gehörten ihnen ja nicht.
Auf diesem Gelände waren allerdings auch einige richtig tiefe Löcher, in die wir hineinklettern und uns verstecken konnten. Wir wussten aber nicht, dass da in diesen Löchern manchmal Bomben lagen, die noch nicht explodiert waren. Teilweise waren sie mit Sand oder Abfall bedeckt, was uns aber nicht davon abhielt auf ihnen herum zu klettern.
Das durften wir niemandem erzählen, wir wussten auch nicht wie gefährlich das war. Einige Jahre später erfuhren wir, als unsere Straße und das ganze Gelände abgesperrt wurden, dass die Bomben in den Löchern Blindgänger waren, die dann von Spezialisten direkt vor Ort entschärft wurden.
Der Krieg war zwar zu Ende, doch was hätte alles geschehen können, wenn eine oder mehrere dieser Blindgänger durch unsere Kletterei explodiert wären? Ich durfte gar nicht daran denken, denn bis zu diesem Tag hatte ich mit meinen vier Jahren eine unbeschwerte Kindheit.
Einmal abgesehen von den Sirenen und dem Bombenalarm der uns vorher Angst machte. Um das alles abzuschätzen, war ich noch viel zu jung. Später, wenn ich darüber nachdachte, war ich froh, dass nichts passiert war.
Während des Krieges hatten die „Alliierten“ dieses Straßenbahn-Depot wohl als wichtigen Punkt angesehen und ihre Bomben darüber abgeworfen. Doch es passierte manchmal auch, dass umliegende Gebäude getroffen wurden, wie unser Eckhaus.
Mitten auf dem Gelände waren zwei kleine, etwa 1,50 m hohe, Schuppen. Es war allerdings kein Dach darauf. Dort trafen und versammelten sich die Fahrer und Schaffnerinnen, wenn sie eine Pause einlegten und rauchen wollten.
Wahrscheinlich war das Rauchen in den großen Hallen bei den Straßenbahnen verboten. Mein Freund Jupp und ich konnten aber einmal beobachten, wie eine Schaffnerin und ein amerikanischer Soldat darin verschwanden. Neugierig wie Kinder sind, schlichen wir uns an diese Abstellräume heran und konnten beobachten wie der Ami hinter der Schaffnerin stand und sie immer nach vorne schupste. Erst wussten wir nicht was sie da machten, doch Jupp, er war ja schon ein Jahr älter als ich, erklärte mir dann, dass die beiden wohl Sex hatten. Schön und gut, aber was ist Sex?
Im Nebenhaus in der ersten Etage wohnte meine Oma, genau unter der Wohnung von Jupp`s Eltern. Vor dem Schlafzimmer meiner Oma war ein kleiner Balkon direkt an der Straße, von dort aus hatte ich eine tolle Aussicht auf das Straßenbahngelände auf der gegenüberliegenden Seite.
Wenn ich mal in das Zimmer durfte, habe ich immer durch die Scheiben versucht einen Blick darauf zu werfen, und speziell auf die Schuppen. Von hier oben konnte ich gut hinein schauen, doch ich habe dieses Geschupse mit einer Schaffnerin nie wieder gesehen.
In der Wohnung meiner Oma wohnte auch noch ein Bruder meiner Mutter mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn. Die Wohnung bestand aus einer großen Küche, einem Schlafzimmer mit Balkon und einem zweiten Zimmer, das ich nicht betreten durfte.
Weil ich aber neugierig war, schlich ich mich einmal dort hinein, es sah aber nicht viel anders aus als die anderen Räume. Warum ich dort nicht hinein sollte, war mir ein Rätsel. Später erfuhr ich, dass es das Zimmer meines Onkels war der dort heimlich Schwarzarbeiten machte.
Er war Buchbinder und arbeitete an Büchern, die er mit Goldbuchstaben versah. Er band die Unterlagen dafür mit einer Fadenbindung zusammen, ganz wie er es nach altem Brauch gelernt hatte. Später hat er mir dann auch einmal gezeigt, wie das geht. Es war auch ein kleiner Ofen darin, eine kleine Druckmaschine, einige Regale mit großen Setzkästen, die voller kleiner Bleilettern waren.
Er nahm einen Winkelhaken, solche Winkelhaken benutzten die Schriftsetzer um den Text für die Bücher oder Zeitungen zusammenzustellen, setzte einen Namen aus Bleilettern, klemmte ihn fest und legte den Winkelhaken einige Zeit in den warmen Backofen. Vor ihm auf dem Tisch lag ein Buch mit einem Ledereinband auf das er eine Folie aus Blattgold legte.
Nach einiger Zeit zog er sich Handschuhe an, nahm den Winkelhaken aus dem Backofen und presste diese Buchstaben in das Blattgold, das auf dem ledernen Buchumschlag lag. Kurz danach entfernte er wieder den Winkelhaken, nahm mit einer Pinzette den Rest des Blattgoldes vom Leder und bürstete leicht über den Schriftzug. Fertig war die Goldprägung.
So entstand heimlich ein gebundenes Buch mit Ledereinband und Goldprägung, das er dann an den Auftraggeber verkaufte. Schwarzarbeit deshalb, weil es keiner wissen durfte und er auch dafür Geld bekam. Im grafischen Gewerbe war Schwarzarbeit in der damaligen Zeit strengstens verboten. Mein Onkel hätte dadurch seine Arbeit verlieren können.
Das war aber nicht der einzige Grund warum ich nicht in das Zimmer sollte. Neben den Büchern, die mein Onkel herstellte konnte er auch Bilder rahmen. Kleine, große, gedruckte und gemalte, alte Motive und moderne. Wunderschöne Bilderrahmen im Barockstil waren seine Spezialität. Sogar diese Rahmen verschönerte er mit Blattgold und an den Wänden dieses Zimmers hingen wirklich viele dieser Bilder.
Je ein Bild seiner vielen Geschwister hing auch an der Wand. Dazwischen auch ein Bild eines kleinen Mädchens mit blonden, lockigen Haaren und auffallend blauen Augen. Meine Oma hatte, so wurde mir das später erzählt, 12 Kinder. Einige davon waren als Kinder gestorben oder sind im Krieg geblieben. Der Rest traf sich ab und zu bei meiner Oma zu bestimmten Anlässen, es war dann immer sehr lustig.
Es kamen mein Onkel und meine Tante aus Köln, andere Verwandte aus Suderwich, einem kleinen Dorf und aus Antwerpen in Belgien. Es wurde meistens gefeiert bis zum nächsten Morgen. Aus Antwerpen kam mein Onkel Hans mit Frau und Tochter. Er war wohl während des Krieges in Belgien stationiert, hatte dort seine Frau kennengelernt. Es wurde immer davon gesprochen, dass er nie wieder nach Deutschland zurückkommen würde.
Irgendwann einmal hatte meine Mutter mit mir darüber gesprochen warum er in Belgien geblieben ist. Es muss wohl etwas beim Militär gewesen sein, denn nach dem Krieg hatte er sich nicht getraut ohne weiteres in seiner Heimat aufzutauchen.
Bei diesen Feiern war meistens auch unser Pfarrer Tensundern anwesend. Da meine Oma und meine Eltern erzkatholisch waren, eigentlich kein Wunder. Ich hatte bei einem dieser Treffen Seltsames mitbekommen. Da wurde über ein kleines Mädchen gesprochen, das während des Krieges mit Hilfe dieses Pfarrers Tensundern einer Tante aus Marl übergeben wurde.
Warum, das konnte ich nicht erfahren, denn keiner erzählte etwas darüber. Ich dachte mir damals nichts dabei, denn dieses Mädchen war ja nicht da. Es muss schon etwas sehr Schlimmes gewesen sein, denn es wurde gebetet und alle Verwandten haben geweint.
1947 kam ich dann in die Schule. Mein Cousin Karl und meine Cousine Gertrud wurden gleichzeitig mit mir eingeschult. Eine katholische Schule, logisch, und wen bekamen wir als Religionslehrer, natürlich Pfarrer Tensundern, ausgerechnet ihn.
Und während einer Unterrichtsstunde in der über die Menschen gesprochen wurde, rutschte ihm dann heraus, dass Zwillinge sich unglaublich ähnlich sehen und auch in Gedanken immer zusammen sein würden, auch wenn zum Beispiel der eine Zwilling in Kanada lebte und der andere Zwilling hier in der Klasse säße.
Hallo, was war das denn? Ein Zwilling lebt in Kanada und der andere hier? Dabei schaute er mich so intensiv an, als wenn ich irgendetwas wüsste und sagte: „Was meinst du dazu?“
Ich erinnere mich noch genau, dass ich total blöd aus der Wäsche geschaut haben muss. Ich wusste auch gar nicht wie ich mich meinen Klassenkameraden gegenüber verhalten sollte. Einige schauten mich komisch von der Seite an, andere wiederum machten kleine Späße, so als wenn sie mehr wüssten. Ich natürlich wusste von nichts und als ich dann wieder zu Hause war, erzählte ich davon sofort meinen Eltern.
Sie sahen mich mit großen Augen an und wollten wissen, was er noch so erzählt habe. Aber da war nichts mehr. Mir kam das alles sehr komisch vor. Da sie aber weiter nicht nachfragten, hatte ich die Äußerung von Pfarrer Tensundern auch sehr schnell wieder vergessen. Ich machte mir weiter keine Gedanken darüber, für mich war das Leben in Ordnung.
Nachdem ich etwas älter geworden war und wir in der Schule im Geografie-Unterricht auch über Nordamerika und Kanada sprachen, merkte ich dass mich gerade diese beiden Staaten besonders interessierten. Da wollte ich irgendwann unbedingt mal hin.
Mir machte es Spaß die Namen der 50 Staaten der USA auswendig zu lernen. Damit ich sie auch wirklich alle aufzählen konnte, half mit das Alphabet dabei, denn in alphabetischer Reihenfolge vergaß ich nie einen Staat. Ich wunderte mich immer, wenn meine Eltern einen Brief aus Kanada bekamen und darin einige kanadische Dollar lagen.
Ich weiß noch, dass der Kurs des kanadischen Dollars gegenüber der D-Mark riesig war. Für einen kanadischen Dollar bekam man hier in Deutschland ca. 4,30 D-Mark. Das Geld konnten meine Eltern gut gebrauchen so kurz nach dem Krieg. Mein Vater hatte zwar einen sicheren Beruf als Maurer und verdiente auch einigermaßen, aber er war auch oft krank.
Manchmal waren auch Fotos aus Kanada dabei und ich sah in den Augen meiner Eltern große Freude beim Anblick dieser Fotos. Ich habe sie auf diese Fotos angesprochen, die sie mir dann zeigten. Ich sah die Tante und den Onkel aus Kassel. Weiter erinnerte mich noch schwach, dass sie mit einer Tante Kontakt hatten, die wir immer Tante Trautchen nannten.
Auf den Fotos waren auch ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen zu sehen und schöne Landschaften aus Kanada und der Provinz Vancouver. Nie wurde über das kleine Mädchen gesprochen. Tante Trautchen besuchte uns ab und zu und es wurde viel über Kanada und ihre Kinder gesprochen. Sie muss mit einem Maler verheiratet gewesen sein, denn im späteren Wohnzimmer meiner Eltern hing über der Couch ein großes Bild, das meine Eltern von ihr bekommen hatten, und beide liebten das Bild sehr.
In den Anfangsjahren, meine Eltern haben 1939 geheiratet, hatten wir auf der Castroper Straße nur eine kleine 2-Zimmer-Wohnung. Um zur Toilette zu gelangen, mussten wir den wohl sechs Meter langen Flur entlang gehen, an einer anderen 2-Zimmer-Wohnung vorbei, in der Familie Krisenbach wohnte. Mit ihnen mussten wir uns Bad und Toilette teilen. Das war nicht gerade berauschend, denn es ging schon manchmal recht eng zu, aber früher war das nichts Besonderes.
Weiter erinnere ich mich noch genau, dass mein Vater seine Zeichnungen auf einem Zeichenbrett in der Wohnküche anfertigte für seine Meisterprüfung. Das Zimmer war sehr klein, vor dem Fenster stand ein Sofa, in der einen Ecke ein kleiner Tisch mit einem Radio, dem sogenannten „Volksempfänger“.
An den anderen Wänden jeweils ein Küchenschrank und daneben, direkt hinter der Tür ein alter Ofen mit einem Gestänge rundherum. Dieser Ofen hatte oben eine blankgeputzte Herdplatte und an einer Seite eine große Öffnung, die man mit mehreren Ringen verschließen konnte. Hier konnte meine Mutter kochen und braten, auch auf offenem Feuer, in dem sie einzelne Ringe entfernte.
Einen Backofen hatte dieser Herd auch. Darin lagen immer zwei rote Backsteine die zu jeder Zeit herausgenommen werden konnten. Meine Eltern wickelten sie in ein Handtuch und legten sie ans Fußende der Betten, dadurch hatten sie im Winter wenigstens ein warmes Bett.
Ich fand den Backofen genial, denn wenn im Winter Schnee lag, schickte meine Mutter mich manchmal mit nackten Füßen in den Schnee vor dem Haus. Nach einigen Minuten holte sie mich wieder ins Zimmer und ich durfte meine eiskalten Füße auf die offene Backofenplatte legen zum Wärmen. Wenn es dann in den Füßen richtig kribbelte meinte sie, das sei gut so, dann bekäme ich keine Erkältung.
Mein Vater war derjenige, der das Feuer in diesem Ofen angezündet hat. Dazu benötigte er altes Zeitungspapier welches er zerknüllte. Darauf legte er kleine, vorher gespaltene Holzscheite. Mit einem Streichholz wurde das Papier in Brand gesetzt und wenn dann das Holz richtig brannte, legte er Kohle-Briketts darauf. Später wurde dann mit einer Kohlenschütte Kohle über die Briketts geschüttet. Meistens hielt das Feuer im Herd dadurch den ganzen Tag und das Zimmer war schön warm.
Ich habe oft zugeschaut, wenn mein Vater den Ofen anlegte und er hat mir genau erklärt wie ich das tun sollte. Denn wenn über Tag einmal das Feuer ausgehen sollte, war ich ja da und konnte es wieder anzünden. So mussten wir nicht warten und frieren bis er von der Arbeit kam.
Eine Heizung gab es damals nicht und so war auch nur diese Wohnküche warm. Das andere Zimmer gegenüber war eiskalt im Winter. Es war das Schlafzimmer, in dem wir schliefen, deshalb die heißen Steine im Bett.
Einen Kühlschrank besaßen wir auch nicht, im Winter war dieses Zimmer kalt wie ein Kühlschrank. Im Sommer dagegen brachten wir alle Speisen und Getränke, die gekühlt werden sollten hinunter in unseren Keller, denn da war es sogar kühl wenn es draußen warm war. Meine Mutter hat immer viel eingekocht, so war das früher kurz nach Kriegsende. Früchte, Beeren, Gemüse und auch Suppen befanden sich in den Einmachgläsern. Auch sie lagerten im Keller in einem Regal. Sie waren beschriftet, damit man nicht lange suchen musste wenn wir etwas Bestimmtes brauchten.
Eines Tages, ich war ca. 8 ½ Jahre alt, kam mein Vater zu mir ans Bett mit einer Überraschung. Er lächelte und sagte zu mir, dass ich ein kleines Brüderchen bekommen habe. Mein Spruch darauf war: „Gott sei Dank, ein Junge und keine Schickse“! Warum ich das sagte weiß ich heute nicht mehr. Eigentlich liebäugelte ich immer damit, eine kleine Schwester zu haben. Mein Wunsch war ja auch berechtigt, wie sich viel später herausstellen sollte.
Ich wurde gefragt, ob ich einen schönen Namen für mein Brüderchen wüsste. Spontan fiel mir nur der Name Raimund ein, Raimund deswegen, weil meine Eltern mit mir manchmal Tante und Onkel in Solingen-Gräfrath, in der Nähe von Wuppertal, besuchten und diese einen kleinen Sohn hatten, der Raimund hieß.
Und wirklich, mein Brüderchen bekam den Namen Raimund und sein Geburtsdatum kann ich auch nie vergessen, der 12. 12. 49. Ein Datum, das sich mein Leben lang in mein Gedächtnis grub.
Als meine Mutter einige Tage nach der Geburt mit meinem Bruder wieder zu Hause war, wurde er nach einiger Zeit sehr krank. Es stand sehr schlecht um ihn. Der alte Pfarrer Tensundern kam immer öfter zu uns und betete mit ihr. Manchmal habe ich die Gespräche belauscht und dabei erfahren, dass meine Mutter während meiner Geburt, oder kurz danach einmal Probleme gehabt haben muss, denn sie unterhielten sich darüber, dass das Kleine ja auch überlebt habe.
Von mir war nicht die Rede, es muss sich bestimmt um das kleine Mädchen aus Kanada gehandelt haben. Es war wirklich schlecht um meinen Bruder bestellt. Von Oma hatte ich dann einmal gehört, dass sie bereits alle Hoffnung aufgegeben hatten. Es ist aber dann doch gut gegangen, denn mein Bruder lebt und ist mittlerweile 66 Jahre alt.
Er war in den zurückliegenden Jahren oft krank, vielleicht liegt das ja in den Genen, denn Vater war häufig sehr krank. Er quälte sich mit Magengeschwüren herum, war viel in Krankenhäusern und ist dann auch sehr früh verstorben. Die Magenprobleme und noch einige andere Krankheiten hat Raimund auch. Vielleicht doch Vererbung?
Mit Mutter, Tante Maria, Tante Hanna und Onkel Josef, die alle streng katholisch waren, habe ich viele Tagesreisen gemacht. Sie nannten das „Wallfahrten“ nach Kevelaer, Billerbeck oder Neviges. Es wurde in der Kirche gebetet und ich habe zufällig mit angehört, als Tante Maria leise betete: „Mein Gott, warum musstest du das zulassen dass die beiden getrennt wurden? Sie sehen sich so ähnlich und jetzt ist der Junge alleine!“.
Da war es wieder, das Gefühl! Ich konnte es damals in der Schule nicht beschreiben, aber ich spürte Sehnsucht und Fernweh. Mädchen meines Alters, besonders wenn sie blond waren und Locken hatten, schaute ich immer besonders sehnsüchtig nach. Etwas zog mich zu ihnen hin, nur ich war viel zu schüchtern sie auch nur anzusprechen.
Es vergingen einige Jahre, die Familie Krisenbach, die die hinteren 2 Zimmer bewohnte, war ausgezogen und meine Eltern konnten die 2 Zimmer dazu mieten, so dass wir jetzt wie viele andere Familien, eine abgeschlossene Vier-Zimmer-Etagenwohnung hatten.
Das Schlafzimmer, in dem ich sonst mit meinen Eltern gemeinsam schlief wurde nach hinten verlegt. Unsere Küche ebenfalls und ich bekam vorne mein eigenes Zimmer. Da war ich bereits ca. 11 oder 12 Jahre alt und schon mitten in der Pubertät.
Überall, wo ich Mädchen sah oder ihnen begegnete, wurde meine Sehnsucht stärker. Ich wusste damals nicht, was das zu bedeuten hatte. Vielleicht war ich ein frühreifer Junge und sah alle Mädchen mit forschenden und verlangenden Augen an?
Aufgefallen ist mir das bei einem Besuch mit meiner Mutter in Solingen-Gräfrath bei ihrer Freundin, Tante Lucy und ihrem Mann Heinz. Sie wohnten in einem kleinen Fachwerkhaus. Wenn wir dort einige Tage zu Besuch waren, konnte ich im Dachgeschoß, im Zimmer ihres Sohnes schlafen. Im Nebenzimmer schlief Tochter Mechthild, die 2 oder 3 Jahre älter war.
Zwischen beiden Zimmern gab es eine Durchreiche mit einer kleinen Schiebetür. Wenn wir abends ins Bett mussten, alberten und blödelten wir meistens noch durch diese kleine Schiebetür, bis alle einschliefen.
Ich allerdings war noch gar nicht so müde, denn meine Neugierde war geweckt. Indem ich langsam und leise das Türchen zu dem Nebenzimmer öffnete und Mechthild dabei beobachtete, wie sie sich auszog. Sie hatte schon frauliche Formen.
Dass Mechthild meine Blicke gesehen hatte, bemerkte ich nicht. Sie kam ganz dicht an die Durchreiche, streckte mir die Zunge heraus und meinte: „Erwischt! Hättest auch gerne ein Schwesterchen gehabt, vielleicht sogar eine Zwillingsschwester, oder?“
Sie überraschte mich mit dem Spruch: „Ich hätte auch gerne einen Zwillingsbruder gehabt, mein Bruder ist ja viel zu jung, und dann ist er auch noch blöd. Du bist ganz anders, du gefällst mir und dich nehme ich ernst. Was hältst du davon wenn wir beide von jetzt an, nur für uns, Zwillinge sind?“
Was sollte ich davon halten? Ich fand das toll! Das war es, was mir gefehlt hatte. Wir lachten und blödelten noch eine ganze Weile. Wir stellten uns vor wie dumm alle aus der Wäsche schauten, wenn wir morgen so nebenbei erzählten, wir wären die neuen Zwillinge.