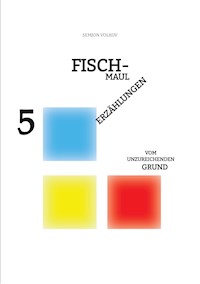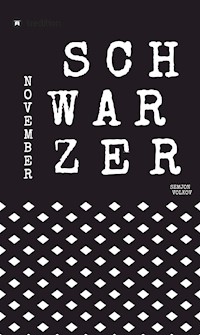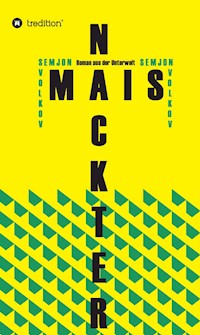2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Und immer steht man Schlange. In der Kälte, im Schlamm. In Lumpen und Decken - eine schmutzige zerlumpte Schlange, die ansteht. Für etwas Warmes. Für einen Funken Hoffnung. Für alles, was eine Spur von Leben verspricht. Es gibt keinen Strom, keine Heizung, keine Schuhe und keine Klamotten mehr in Lager 07. Die Latrinen werden täglich gekalkt, einmal die Woche ausgehoben. Von den Lagerbewohnern. Mit Schaufeln und Eimern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
SEMJON VOLKOV
- SCHATTEN DER MIGRATION -
© 2018; Semjon Volkov
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359
978-3-7439-5655-1 (Paperback)
978-3-7439-5656-8 (Hardcover)
978-3-7439-5657-5 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
- Lagerkoller -
Mabrouk, der Araber steht im Hof, sieht zu den Männern am Zaun. Sie stehen reglos, starren übers Feld und in die Sonne. Ihre Gesichter sind leer, ihre Finger verkrallen sich im Zaun.
Am Anfang gab es keinen Wachdienst, gab es nur einen Aufsichtsposten am Tor, an dem die Lagerbewohner sich an- und abmeldeten.
Am Anfang war Auffanglager 07 offen, der Ausgang frei. Bis letzten Herbst.
Dann kamen immer mehr Flüchtlinge ins Lager. Von Monat zu Monat. Und je mehr Flüchtlinge kamen, umso angespannter und gereizter wurde unter den Lagerbewohnern die Stimmung.
Auffanglager 07 liegt außerhalb der Stadt.
Am Anfang spendetet die Bevölkerung aus der nächsten Ortschaft und Stadt für die Bewohner von Lager 07 Klamotten, Schuhe und Spielzeug für die Kinder.
Am Anfang gab es regelmäßige Hilfslieferungen und üppige Mahlzeiten. Am Anfang kamen noch irgendwelche Politiker und andere Schlipsträger, ließen sich fleißig und gut gelaunt ablichten. Vor der Kulisse von Auffanglager 07. Beim gemeinsamen Mittagessen mit den Flüchtlingen. Bei der Besichtigung der Latrinen.
Das hat sich gründlich geändert. Seit letztem Herbst. Mittlerweile platzt Lager 07 aus allen Nähten.
Mabrouk, der Araber lebt jetzt seit über zwei Jahren in Auffanglager 07, sitzt hier fest.
Er gehörte zur zweiten Welle der Flüchtlinge, die über den Balkan nach Europa kam und in einem der vielen Auffanglager steckenblieb.
Mabrouk wohnt in Container 37, zusammen mit elf andern jungen Männern.
Am Anfang hat Mabrouk selbst am Zaun gestanden, hat solange in die Sonne gestarrt, bis er fast erblindet ist. Seit diesem Sommer trägt Mabrouk ständig eine Sonnenbrille, und er beobachtet nur noch, was ringsum abläuft.
Letzten Herbst sind einige Lagerbewohner über die noch unreife Maisernte vor den Lagertoren hergefallen. Einige einheimische Frauen außerhalb des Lagers wurden belästigt, eine Frau aus der nächsten Ortschaft sogar von mehreren Flüchtlingen vergewaltigt.
Gleichzeitig gab es im Lager mehrere Schlägereien und Messerstechereien. Erst letzte Woche wurde wieder ein Lagerbewohner im Streit getötet.
Ein Afghane. Erstochen.
Von einem Landsmann. Mit einem Schraubenzieher.
In Brust und Hals.
Eine persönliche Sache - verletzte Ehre.
Kein Wunder, seit einem Jahr sitzt man hier eng auf eng, hat keinen Meter Freiraum.
Die Lagerverwaltung hat auf die tödliche Auseinandersetzung sofort reagiert, die Ausgangssperre erweitert. Nach 22.00 Uhr müssen die Bewohner von Lager 07 in ihren Barracken bleiben.
Wer danach noch draußen erwischt wird, bekommt gekürzte Rationen.
Die Spenden und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für die Flüchtlinge von 07 haben längst aufgehört. Von der ursprünglichen Solidarität ist nicht mehr übrig geblieben als tote Erinnerungen. Das Mitgefühl längst Misstrauen. Die Nahrungsversorgung hat sich stark verschlechtert. Das Tor wird bewacht von einer Wachmannschaft.
Die Behörden sind überfordert, haben die Bewohner von Lager 07 sich selbst überlassen. Das rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen dürfen nur noch unter Auflagen ins Lager. Es gibt nur noch das Nötigste an Versorgung. Und gnadenlos treibt die Wirklichkeit ihre Keile zwischen die Menschen - zwischen die Bevölkerung und die Lagerinsassen. Zwischen die Besitzenden und Besitzlosen, das Misstrauen und die Verzweiflung.
Man hat Angst - vor ihnen, im Lager.
Man hat die Zäune höher gebaut, das Tor, hinter dem sie alle festsitzen, verriegelt. Die Bevölkerung verdrängt ihre Anwesenheit, versucht das hässliche Lager 07, das vor der Haustür der Stadt liegt, zu vergessen.
Letzten Monat sind gerade mal hundert Leuten aus dem Lager abgereist. Nachts, und wie immer ganz plötzlich. In zwei Bussen.
Dafür sind seither über tausend Neue eingetroffen. Von überall. Und es kommen immer mehr. Jetzt schon wöchentlich. Die Opfer von Flucht und Verfolgung nehmen kein Ende. Kommen. Wie pausenlos produziert am Fließband.
Ist es nicht Krieg, ist es Hunger. Sind es nicht Krieg und Hunger, ist es Terror, der sie vertreibt.
Das nackte Recht auf Leben lässt nicht mit sich reden. So wenig wie Hunger, Krieg und Terror.
Man hat Lager 07 ausgeweitet, hundert neue Container aufgestellt. Der Platz für die Masse an Menschen reicht trotzdem vorne und hinten nicht.
Inzwischen geht ihre Zahl auf die Zehntausend.
Vor ungefähr zwei Monaten ist die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen.
Jetzt kommen täglich mehrere Tankwagen, und das Rote Kreuz verteilt täglich Suppe.
Aber wie lange noch? Wie lange?
Und immer steht man Schlange. In der Kälte, im Schlamm. In Lumpen und Decken - eine schmutzige zerlumpte Schlange, die ansteht. Für etwas Warmes. Für einen Funken Hoffnung. Für alles, was eine Spur von Leben verspricht.
Es gibt keinen Strom, keine Heizung, keine Schuhe und keine Klamotten mehr in Lager 07.
Die Latrinen werden täglich gekalkt, einmal die Woche ausgehoben. Von den Lagerbewohnern. Mit Schaufeln und Eimern.
Aber wie lange noch?
Mabrouk, der Araber kennt die Situation. Wie alle, die hier ausharren. Hier kann man nie abschalten. Nicht am Tag und nicht in der Nacht.
Jemand heult, jemand brüllt, jemand dreht durch, schlägt wahllos um sich oder zündet sich an.
Hier muss man auf alles gefasst sein. Auf alles.
Dass es morgen nicht mal mehr Suppe gibt. Dass sich morgen wieder jemand, den man kennt, umgebracht hat. Dass gegen alle, die aus 07 zu fliehen versuchen, Schießbefehl erteilt wird.
Hier kann man nicht leben, kann man nur dahinsiechen und auf Dauer selbst verrecken.
Jeder will hier raus. Weiter.
Nach Norden.
Ins gelobte Land.
Auch Mabrouk.
Im gelobten Land gibt es alles in Hülle und Fülle. Gibt es Brot und Butter, Sicherheit und Komfort, Arbeit und Wohlstand. Und es gibt dort saubere Zimmer, saubere Betten - Pfirsiche mit Sahne.
Aber das gelobte Land erreichen … Daraus wird so bald nichts werden. Wahrscheinlich … sogar fast sicher nie.
Die Umstände werden Mabrouk weiterhin hier festhalten. Sie alle. Das ist Politik.
Familien und Mütter mit Kindern haben noch die besten Chancen das Lager zu verlassen.
Aber Mabrouk weis, Tatsachen sind stärker als jede Sehnsucht, Kälte stärker als Vertrauen, Hunger stärker als jede Hoffnung.
Junge Männer wie Mabrouk hängen ab, stehen am Zaun, haben keine Beschäftigung oder Aufgabe, kriegen den Lagerkoller. Man wartet, wartet, wartet. Tag für Tag. Wartet auf die Genehmigung 07 endlich zu verlassen, wartet … Man wartet vergeblich.
Die Verzweiflung wächst.
Man gehört einfach zu den Verdammten, von denen dort draußen niemand mehr etwas wissen will. Gehört zu den Fremden, von denen man dort draußen nur Schlechtes erwartet. Gehört zu den Gefährlichen, die das Zusammenleben der alteingesessenen Bevölkerung bedrohen. Deshalb der Zaun, die Sicherheitsvorkehrungen, die Wachmannschaft …
Mabrouk ist einen Schritt zurückgetreten vom Zaun, sieht nur noch mit Sonnenbrille zur Sonne.
Hier wartet man vergeblich. Viele werden nirgends mehr hinkommen, werden sterben …
Was kann, was muss man nur tun, um das gelobte Land zu erreichen? Rauskommen … rauskommen muss man … Ganz klar. Egal wie. Aber nur draußen sein hilft einen Dreck. Man braucht auch einen Plan wie man sicher hinkommt - ins gelobte Land.
- Ein Ausweg -
In Lager 07 gibt es einen ärztlichen Notdienst und einen Arzt. Aber dieser Arzt ist nicht immer vor Ort, höchstens zweimal die Woche. An seiner Stelle gibt es einen Hilfsarzt, der dauerhaft in der kleinen gemauerten Baracke neben dem Lagertor wohnt.
Sein Name ist Essam. Auch ein Araber.
Mit Essam kommen alle Lagerbewohner in Kontakt. Wenn auch nur zur ersten Impfung oder halbjährigen Routineuntersuchung.
Mabrouk hat seine Fühler ausgesteckt, sich umgehört. Hinter vorgehaltener Hand geht schon länger das Gerücht, dass der Hilfsarzt Beziehungen hat, Leute aus dem Lager schleusen kann.
Mabrouk hat sich entschlossen. Aber bevor er in Aktion tritt, kontrolliert er erst seine stillen Ressourcen. Er hat sie gut vergraben. Neben dem Schutthaufen hinter Container 37. Hat die Stelle markiert. Ein Kratzer am Container, dazu eine Fußlänge Abstand.
Mit einem zerbrochenen Stück Ziegel, gräbt Mabrouk jetzt die Tüte mit seinen Euro aus. Noch da.
Er versteckt die Tüte wieder. Diesmal an einer anderen Stelle. Man weis ja nie … Dann schneidet er sich mit seinem Taschenmesser in den Handrücken.
Mit dieser Verletzung geht er zum ärztlichen Notdienst. Zum Hilfsarzt. Macht dort vorsichtige Andeutungen.
Essam, der Hilfsarzt verbindet Mabrouks Hand.
Essam ist ein verständiger Mann. Er lächelt und lässt durchblicken:
Sicher, man kann da schon etwas tun - falls man genug Geld hat. Die Flucht müsse organisiert werden. Und das sei riskant, koste. Dazu müssten aber erst genügend Leute beisammen seien. Dann könne man die Sache angehen und etwas anleiern - mit genug Geld.
Bis jetzt habe der Hilfsarzt erst fünf Leute, die den hohen Preis … Es müssten aber mindestens zwanzig sein, sonst könnten die Partner nicht … Er selbst könne leider nicht anwerben. Die Behörden! Aber wenn vielleicht Mabrouk noch andere Leute fragen könnte, ob sie … Vorausgesetzt, das Geld … Genug hier, genug da …
Mabrouk schaltet:
Wenn er werben soll, was springt dann für ihn dabei raus? Immerhin ist auch das Arbeit. Wenn er dem Hilfsarzt zehn Leute bringt, die dafür zahlen …
Essam lacht.
Der Schlaue erkennt den Schlauen an seinen Hintergedanken. Wie der Hund sein Herrchen am Geruch.
Wenn Mabrouk dem Hilfsarzt zehn Mann bringt, kann er gratis mitkommen. Falls noch andere … damit es mindestens zwanzig …
Und wenn Mabrouk ihm alle bringt, die zur Flucht noch fehlen?
Essam ist begeistert.
Wenn er ihm alle bringt, also fünfzehn oder mehr, bekommt er einen Anteil vom Geld. Und zwar für jeden, den er anwirbt. Das wird der Hilfsarzt mit seinen Partnern draußen für ihn regeln.
Mabrouk ist einverstanden.
Er weis, es gibt viele Verzweifelte im Lager - viele, die am Zaun hängen, bis zur Erblindung in die Sonne starren, verzweifelt genug sind, damit sie für eine Flucht ins gelobte Land ihre versteckten Euro geben.
Der Hilfsarzt und Mabrouk kommen überein.
Mabrouk wird ihm die Leute nach und nach schicken.
Und zwar so schnell es geht.
Und die Sache geht schnell.
Mabrouk, der die Leute kennt, bei den Lagerbewohnern sofort den richtigen Ton trifft, leistet ganze Überzeugungsarbeit. Schon in den nächsten Tagen erscheinen beim Hilfsarzt mehrere Lagerinsassen mit ganz verschiedenen Verletzungen und Beschwerden.
Mabrouk wartet. Ende der Woche kommt er wieder zum Hilfsarzt, erkundigt sich nach seinen erfolgreichen Anwerbungen.
Genug?
Genug! lacht Essam, erneuert Mabrouk den Verband, gibt ihm den Auftrag die Leute noch einmal zu ihm zu schicken.
Sie sollen das Geld zur Flucht zu ihm bringen. Dann kann er aktiv werden. Und schon nächste Woche mit seinen Partnern einen Termin für die Flucht ausmachen. Das mit seinen Partnern hat der Hilfsarzt geregelt. Mabrouk bekommt für seine Hilfe zehn Prozent. Gut?
Mabrouk ist einverstanden.
Und alles läuft reibungslos.
Das Geld kommt, der Fluchtplan steht.
Man flieht abends.
Dreißig und ein Flüchtling schlüpfen durch den aufgeschnittenen Zaun an der Ostseite des Lagers. Hinter den Latrinen.
Dort steht ein Fluchthelfer, winkt und scheucht die Männer, Frauen, Kinder durchs angrenzende Kornfeld, führt die Gruppe in die Dunkelheit.
Zwei Wochen später und dreihundert Kilometer nördlich: Auf einer Autobahnraststätte, direkt an der Grenze zum gelobten Land, findet der Straßenkontrolldienst einen verlassenen LKW.
Man steigt aus, will den LKW kontrollieren. Aber schon im Näherkommen dreht man sich fort. Man wankt, muss würgen, weis sofort bescheid.
Mal wieder!
Man hat in den letzten Monaten schon Erfahrung gesammelt. Vor allem an den Grenzübergängen zum gelobten Land.
Es hilft nichts. Nichts hilft. Man muss den LKW aufbrechen. Trägt dabei Mundschutz, aber atmet trotzdem ausschließlich durch den Mund.
Und kaum geöffnet, starrt die Sonne einmal mehr auf dreißig Leichen. Männer, Frauen, Kinder. Erstickt und bereits am Verwesen.
- der Rote und der Blaue -
Ein alter Transporter mit dem Aufdruck einer Gärtnerei braust eine schäbige Vorortstraße entlang.
Am Ende der Straße steht ein runtergekommenes Haus. Dort fährt der Transporter auf den Gehweg, hält an.
Während der Motor weiterläuft, wird von innen die Schiebetür aufgerissen.
Zwei Afrikaner springen schwerfällig aus der offenen Schiebetür auf den Gehweg. In Trainingsklamotten, mit großen Rucksäcken und übermüdeten Gesichtern - Neuankömmlinge. Einer mit roter Strickmütze, der andere mit blauer Basecap.
Sofort knallt hinter den beiden die Schiebetür wieder zu. Und schon braust der Transporter ab, lässt beide zurück. Vor dem runtergekommen Haus in der schäbigen Vorortstraße.
Es ist ein trüber Nachmittag und alles nass. Bis vorhin hat es noch geregnet.
Einen Moment sehen die beiden Neuankömmlinge noch dem Transporter nach, der eilig in der Ferne verschwindet. Dann wandern ihre Blicke über die Umgebung. Eine Straße - leer. An den Straßenrändern Autos - geparkt.
Und in die übermüdeten Gesichter der beiden Neuankömmlinge bläst ein feuchter Oktoberwind.
Man ist angekommen. Im gelobten Land.
Est-ce que c’est la maison, Didier? fragt die rote Mütze seinen Reisegefährten, sieht dabei unruhig zu dem runtergekommen Haus - auf die zerfallene Fassade, die Graffiti, das Unkraut, die versteinerten Hundehaufen.
Man ist angekommen. Gut.
Statt zu antworten, kramt die blaue Basecap einen zerknautschten Zettel aus der Hosentasche.
Während der Blaue den Zettel prüft, geht er langsam zur verschrammten Haustür, sieht nach. Aber er findet nirgends eine Hausnummer. Denn das Haus hat keine Hausnummer mehr. Auch keine Namensschilder. Es gibt nämlich auch keinen Klingeltafel mehr. Und keine Klingeln. Denn das Hauptkabel für die Klingeln hängt direkt aus einem Wandloch, auf das der Blaue glotzt.
Didier? ruft der Rote wieder, diesmal ungeduldig, weil der Blaue den Kopf schüttelt. Dafür bekommt der Rote einen ungehaltenen Blick zugeworfen.
Der Rucksack ist so schwer - direkt vorm Ziel.
Der Rote stöhnt, schnallte den Rucksack ab, will sich ausgiebig strecken -
Allons, Robert! Vas-y! ruft der Blaue.
Man ist angekommen, muss hier richtig sein.
Der Blaue hat das offene Tor zum Innenhof entdeckt, geht voraus. Bis er verärgert bemerkt, dass der Rote absichtlich trödelt und zögert.
Est-ce tu essûrque c’estl’entrée? La numéroDidier - juste? ruft der Rote.
Oui oui, Robert! Elle est juste, elle est juste! beruhigt der Blaue den Roten, der widerwillig seinen Rucksackwieder überstreift, schiebt ihn genervt durch den offenen und ausgeleierten Torflügel in einen Durchgang.
Dort hängt eine Doppelreihe Briefkästen - verbeult, unnütz. Denn auch hier gibt es keine Namen, kommt keine Post mehr an.
Der Rote spielt an einem Briefkasten, lässt sein Türchen quietschen.
Robert!
Mit entschlossenem Schritt tritt der Blaue in den Innenhof, sieht. Auf dem Boden liegen Brocken von Putz - von den Wänden abgefallen, liegen gelassen. Und überall sind Wäscheleinen, ziehen sich durch den ganzen Innenhof - kreuz und quer, von Mauer zu Mauer. Wie ein wirres Spinnennetz. Sinnlos. Denn hier wird keine Wäsche mehr aufgehängt. Namen, die es nicht gibt, hängen nämlich keine Wäsche auf. Aber die Leinen hängen trotzdem voll.
Mit Regentropfen.
Der Blaue sieht sich wieder um. Er sucht, sieht zu seinem Begleiter, verdreht genervt die Augen. Der Rote lächelt, tippt behutsam jede einzelne Wäscheleine an, lässt reihenweise die Regentropfen fallen.
Robert!
Verlegen sieht der Rote zum Blauen, der längst zum Tor sieht. Dort kommt jemand. Ein kleiner Mann. In Anzug und mit gepflegtem Spitzbart. Flink, geschmeidig. Geschäftsmann. Auch Afrikaner. Zwei Goldringe an der rechten Hand, die er hebt, lächelt, die Neuankömmlinge grüßt:
Hällow, my friends.
Einen Moment mustert der Spitzbart beide Neuankömmlinge, entscheidet sich für den Blauen.
Are you the new guys, jäh? fragt er.
Er lächelt immer weiter, wartet auf die Antwort.
Der Blaue zeigt ihm den zerknautschten Zettel, erklärt:
We want to meet …
Aber der Spitzbart sieht überhaupt nicht auf den Zettel, nur auf den Neuankömmling.
Währenddessen betrachtet der Rote nur die Schuhe, die der Spitzbart trägt - schöne schwarzen Halbschuhe.
Der Spitzbart lächelt noch stärker, nickt, geht schon los.
You come with me. Come. I know, I know where you want to go, ruft er, winkt den Neuankömmlingen, ist schon aus dem Innenhof, durchs Tor.
Der Blaue folgt. Schnell und entschlossen.
Robert!
Didier?
Der Blaue schnauft, sieht vorwurfsvoll zum Roten, der wieder zögert, noch immer im Innenhof steht.
Didier, Didier, äfft Didier, klatscht zweimal in die Hände: Ah, Robert, froussard!
Und er befiehlt: Vas-y, tout de suite!
Der Rote folgt, trottet dem Blauen hinterher. Aber nur mit Bauchweh. Die Sache ist irgendwie komisch, gefällt ihm ganz und gar nicht.
Der Spitzbart wartet auf die Neuen, hält die Haustür offen, peilt dabei unentwegt über Straße und Gehweg.
Schweigsam geht es zu dritt durchs halbdunkle und schäbige Treppenhaus. Links und rechts je eine Tür. Stumm, dunkel, unbelebt.
Es geht bis ganz nach oben. Dritter Stock. Vorneweg der Spitzbart, der vor der linken Wohnungstür stehenbleibt, anklopft.
Didier?
Que? zischt der Blaue grimmig zurück.
J’aipeur, Didier!
Hinter der Wohntür tut sich was. Schritte.
Calmes toi, Robert, schüttelt der Blaue die lästige Hand des Roten von seinem Arm.
Die Wohnungstür geht auf. Dort steht ein Kerl wie ein Schrank. Lederjacke, Jeans. Mustert einen Moment die Versammlung. Erkennt den Spitzbart, beäugt argwöhnisch die beiden Figuren in Trainingsklamotten.
And who ah these geis?
It’s all-right, all-right … Your boss is waiting, erklärt ihm der Spitzbart, klingt nur gereizt von der Verzögerung, lässt für eine Sekunde das falsche Lächeln fallen.
Und prompt räumt der Schrank die Tür frei, öffnet sogar sperrangelweit die Wohnungstür, lehnt sich an die Wand, wartet, bis alle an ihm vorbei sind, bevor er die Tür wieder schließt.
Der Rote klebt am Blauen, drückt gegen seinen Rucksack, sieht mulmig zur stechenden, nackten Glühbirne, die im Gang von der Decke hängt.
Der Gang ist lang, die Wohnung groß, hat mehrere Türen. Eins, zwei, drei … Und alle sind geschlossen, dunkel und stumm.
Endlich kommt man an.
Man sieht schon das Licht, den Lichtschlitz unter der Tür. Dort, hinter der letzten Tür im Gang muss die Zuflucht, die neue Freiheit, das Zentrum des gelobten Landes liegen - muss …
Hier klopft der Spitzbart an, wartet kurz. Aufs Kommando von drinnen.
Und mit der Tür, die der Spitzbart öffnet, fällt grelles Licht in den düsteren Gang, blendet die Neuankömmlinge. Aber der Spitzbart geht nicht ins Zimmer, steht auf der offenen Türschwelle, verkündet nur eilig:
Your new guys are here.
Damit dreht er sich um, lächelt, nickt den beiden Neuen zu, klopft ihnen auf die Schulter - und macht sich schnell davon. Und alles in einem Aufwasch.
Come in!
Das Kommando beendet die Verwirrung der Neuen.
Und der Blaue geht vor. Wie immer. Mitten ins grelle Zimmerlicht.
Man ist angekommen.
Direkt im Zentrum der neuen Freiheit. Und der Macht.
- der Boss -
Das Zimmer ist groß. Und fast leer. Bis auf: eine grelle Stablampe, eine fette Blondine, eine silberglänzende Sonnenbrille und eine silberne Schale.
Das alles fällt den Neuen sofort ins Auge. Blendet. Irritiert. Bevor man die Dinge im Zimmer sortiert und angeordnet, gestellt und gesetzt hat: Die Stablampe neben das verrammelte Fenster. Die fette Blondine in einen Sessel in die rechte Zimmerecke. Die silberne Sonnenbrille hinter einen Schreibtisch. Und die silberne Schale mit den Trauben Schale auf den Schreibtisch.
Eins ist den Neuen aber sofort klar: Hinter der Sonnenbrille am Schreibtisch sitzt der Boss. Ein Zwerg in einem weißen Anzug. Goldkette um den Hals. Auch Afrikaner. Sitzt ausdruckslos. In seiner silberglänzenden Sonnenbrille spiegeln sich die verblüfften Gesichter der beiden Neuen.
I’m de boss, erklärt plötzlich der Boss. Mit heller Kinderstimme. Und er fragt: So, you two will work for me?
Wie? Was?