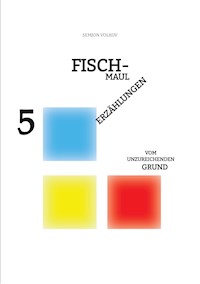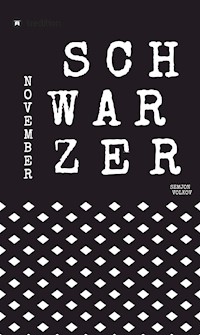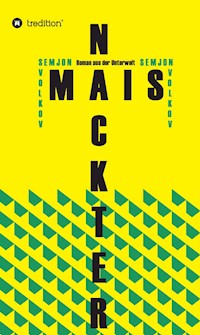3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Tamtam ist ein Anfänger im Wackeln mit den Ohren. Um das Wackeln richtig zu lernen, lebt er bei dem alten Friedhofswärter Erdmann, einem Meister der Ohren. Obwohl Tamtam ständig den Schikanen von Erdmann, einem Menschenschinder ausgesetzt ist, gibt er nicht auf. Statt seinem Gehilfen aber die richtige Technik beizubringen, erzählt ihm Erdmann immer nur alte Familiengeschichten. Bis zur letzten: Der erfolgreichen, aber unglücklichen Lebensgeschichte von Jonas Hauff, einem vergessen Altmeister der Ohren. Wird Tamtam die letzte Lektion seines Meisters begreifen? Kann auch er zu einem Meister der Ohren werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
© 2012/2013; Semjon Volkov
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
978-3-7345-2779-1 (Paperback)
978-3-7345-2780-7 (Hardcover)
978-3-7345-2781-4 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
LEHRPLAN:
DIE MEISTEROHREN VON ALTHOFEN
AVE AURIS
Jehova wackelt nicht
Mordstitten für Krüger
Wenn Ohren glühen
Der Fluch des Onkel Hugo
Sehen und Zeigen
Der Ruf aus der Kaffeekanne
Saul der Ohrenzieher
Eva geht baden
Hey! Hü-hott! Und ab die Mutter!
Die Sauren Scheiben der Venus
Das Ohr des Glücks
Meine, deine, irgendeine ‚scheiß‘ Burg
Das Maß ist voll!
Schwanzfieber
Im Reich der Frösche
Gonzo, blas deine Trompete
Der Schatten der Ohren
Eine erleuchtende Gleichung
Der Affe, die Bienenkönigin und das Geld
Brenne!
DER MAGISCHE MOMENT DER OHREN
DIE MEISTEROHREN VON ALTHOFEN
Du willst mit den Ohren wackeln? Geh zuerst durch den Dreck.
Erdmann zu Tamtam
Wir stehen auf einem Feldweg in der Provinz, sehen uns um.
Überm vollen Weizen hängt die Mittagshitze.
Daneben flimmert die Autobahn. Kein Lüftchen geht, die Grillen zirpen und wir schwitzen.
Steht nicht so rum!
Los, kommt.
Gehen wir. Okay?
Es ist nicht weit.
Kommt, vorbei an diesem Feld.
Mit seinem alten Nussbaum.
Wir sind gleich dort.
Beim Friedhof.
Dort warten schon Erdmann und Tamtam.
Denn dort wird gleich eine Urne versenkt.
Alles wartet auf uns, alles ist bereit.
Zum letzten Gang für ein Häufchen Asche.
Seht ihr die Leute, die langsam die Trauerhalle verlassen? Fünf Leute, und sie kommen den Weg entlang.
Kommt, wir schließen uns an!
Das da vorne, direkt vor den Trauergästen, das ist Erdmann, der Friedhofsangestellte. Kann euch sagen, ein alter Scheißkerl. Da, schaut wie er schreitet und seine Arme mit der Urne weit ausgestreckt. Ganz gemessen, Storch im Salat, hebt Erdmann seine Füße. Noch heute Morgen hat er seine Schuhen frisch geputzt. Genauer gesagt, hat sie putzten lassen von Tamtam, seinem Gehilfen.
Seht ihr den Jungen, der mit seinem Spaten hinter der Ulme, etwas abseits vom offenen Loch steht?
Das ist Tamtam.
Er hat das Loch geschaufelt, beobachtet, lernt von Erdmann die komplizierten Abläufe der verschiedenen Bestattungsarten. Schon seit drei Jahren, seit er Erdmanns Obhut anvertraut worden ist. Vom überfüllten Jugendheim der Stadt.
Erdmann, der Säufer, kennt die Abläufe genau.
Er ist seit über dreißig Jahren Angestellter beim hiesigen Friedhofsamt. Er ist gegenwärtig Tamtams Ziehvater.
Gewissermaßen.
Da schreitet er hin mit seiner verwüsteten Visage und ist doch ganz in seine Aufgabe versenkt.
Tamtam sieht jetzt zu, wie die vier Trauergäste vor der Ulme einbiegen, tritt schnell die Kippe in den kleinen Haufen Erde und scharrt sie zu.
Dann nimmt er Aufstellung, wird steif wie der Spatenstiel in seinen Händen und zum Standbild. Nur seine Augen bewegen sich in vorsichtiger Neugier über die vier Trauergäste.
Drei von ihnen gehen, einer sitzt im Rollstuhl.
Der Alte im Rollstuhl hat den Kopf tief gesenkt, trägt einen schwarzen Hut, Sonnenbrille. Fast alle tragen Sonnenbrillen.
Auf den weißen Kaschmirschal des Alten läuft stumm der Rotz. Der Alte weint lautlos durch Nase und Mund.
Unter seiner Sonnenbrille sickern die Tränen durch.
Hinterm Rollstuhl, in dem ein Greis sitzt, geht eine junge Pummlige. Ihr Gesicht ist blass und angestrengt. Mühsam schiebt sie den Rollstuhl über den sandigen Seitenweg.
Der Friedhofsteil ist neu angelegt.
Die Verwaltung hat hundert Kubikmeter Sand zusätzlich angefordert, um vorläufige Seitenwege anzulegen.
Aber der März dieses Jahr, der Regen hat die vorläufigen Wege schon abgetragen und aufweicht, in die Breite geschwemmt und verdünnt. Der Juli die dünne Sanddecke endgültig ausgetrocknet und zerbröselt. Mittlerweile ist der Sand auf den Seitenwegen so weich wie Sand im Sandkasten.
Die Seitenwege sind keine Wege mehr.
Man versinkt in eine dünne Sanddecke.
Jeder Schritt der Trauergäste hinterlässt Spuren, der Rollstuhl zieht Linien.
Hinter der Pummligen kommt eine zierliche Frau um die vierzig. Asiatisches Aussehen.
Ihr Gesicht ist verhärtet, die Lippen zusammengekniffen.
Sie trägt einen teuren Kranz, zwei Bänder dran.
Den Abschluss der Trauergäste macht ein glatzköpfiger Hüne mit verweinten Augen. Der einzige ohne Sonnenbrille.
Und alle folgen der Urne, die in Erdmanns Händen dahin schwebt.
Die Urne schimmert, hält inne und hängt einen Moment starr in der Luft.
In seiner grauen Uniformjacke und den schwarzen Faltenhosen steht Erdmann direkt vorm Loch, an dem noch die Grabeinfassung fehlt, steht stramm.
Genau wie Tamtam, der ihn nachahmt.
Langsam atmet Erdmann ein, verzögert das Geschehen. Verzögert das Gedächtnis, steht stamm. Und da! Seht den Meister! Und seid verblüfft, seid erschüttert, betroffen. Seht, er tut es! Wackelt mit den Ohren. So ganz beiläufig, so einfach… und wie sachkundig, lässig…
Tamtam versucht ihn nachzuahmen - und scheitert. Wie üblich. Aber die Enttäuschung übers misslungene Wackeln versteckt er hinter seiner strammen Haltung.
Stattdessen schielt er jetzt unauffällig nach den Trauergästen. Die Urne hängt bewegungslos in Erdmanns Händen, steht in die Luft, direkt überm Loch.
Der Alte im Rollstuhl atmet besonders heftig, hat mühsam seinen Hut abgezogen. Aus seinem Hals kommt ein kurzer Würgelaut.
Doch Erdmann beginnt mit fester Stimme:
“Vater Unser…”
Der Alte hebt mechanisch den Kopf. Der Hüne hält seinen schwitzenden Glatzkopf in sichtlicher Trauer gesenkt. Die Frau um die vierzig sieht stur geradeaus. Die Pummlige auf den Hinterkopf des Alten.
Dann beten sie mit. Alle. Erdmann und der Alte, gleichartig sachlich und laut. Die Pummlige und die Vierzigjährige etwas leiser.
Tamtam schweigt beim Gebet, aber er senkt den Blick, seine Hände halten den Spatenstil.
„…in Ewigkeit. Amen“, ruft Erdmann, begleitet von den vier Trauergästen
Aber sie bekreuzigen sich nicht. Keiner. Lassen die Arme unten. Alle.
Und endlich beugt sich Erdmann über Tamtams vorbereitetes Loch, beugt sich vor in berechnetem Abstand. Wie beim Sprung vom Beckenrand. (Nicht so einfach für einen Säufer! Übung! Ihr sagt es.)
Die Urne wird versenkt. Professionell.
Während der Alte energisch anfängt den Kopf zu schütteln, gleiten Erdmanns Hände - Erdmanns Hände in den engen, grauen Handschuhe gleiten ins Loch.
Dann steht er auf, macht einen Schritt rückwärts, dreht sich halb vom Grab, macht zwei weitere Schritte rückwärts, drückt die Brust raus und erstarrt. Wie Tamtam neben ihm.
- Offizieller Salut mit abgesetztem Spaten.
Den Rest übernehmen die Trauergäste.
Es wird gemurmelt. Der Kranz abgelegt, die Nasen geputzt, die Augen gewischt.
Ausdruckslos und unbeteiligt stehen Erdmann und Tamtam neben dem Grab und warten, bis die Trauergäste abziehen.
Der Alte schüttelt noch immer unentwegt seinen Kopf.
Die Pummlige wischt ihm jetzt den Rotz ab. Von Oberlippe, Kinn und seinem weißen Seidenschal. Die Rotze verschmiert, weil der Alte beim Abwischen den Kopf schüttelt.
Sie setzt ihm seinen Hut auf, flüstert, redet auf ihn ein, will den Rollstuhl anschieben. Fort. Aber der Alte sperrt sich.
Unter seinem Kopfschütteln wackelt der Hut.
Einen Moment murmelt und schnauft er, schüttelt weiterhin den Kopf. Er will nicht fort, gibt seinen sanften Widerstand doch schließlich auf.
Und so ziehen sie ab:
Die Vierzigjährige voraus. Der Hüne, Glatzkopf hoch und mit letztem tiefen Atemzug, hinterher. Zum Schluss die Pummlige, die den Rollstuhl fortschiebt und jetzt plötzlich noch einmal den Kopf dreht. Zu Erdmann.
„Auf Wiedersehen.”
Erdmann nickt. Er und Tamtam beobachten wie sie den Alten zurück zum Hauptweg schiebt, vorbei an der leeren Trauerhalle. Noch immer, seit der Urnenversenkung wackelt der Hut auf seinem Kopf.
Bis der Rollstuhl mit seinem Anhang außer Sicht ist.
Nachdenklich steckt Tamtam sich jetzt eine neue Zigarette an. Die merkwürdigen Trauergäste, besonders der Alte beschäftigen ihn.
Ha! Ihr fragt euch vielleicht, genau wie Tamtam: wer waren denn all die Trauergäste? Keine Sorge, ihr werdet sie kennenlernen.
Bald.
Tonlos zieht Erdmann die Handschuhe aus, geht in die Hocke. Aus der Jacke nimmt er Pfeife und Tabakdose.
„Ein bekannter Mann, weit gekommen, große Nummer in unsrer Gegend oder was man so nennt”, meint Erdmann ungefragt, stopft sich dabei seine Pfeife und nickt. „Geschäftsführer, Aufsichtsrat. Vielleicht einer von den letzten, die’s von unten bis ganz nach oben geschafft haben.”
„Wer war der alte Wichser?” fragt Tamtam.
Er fragt für uns. Auch wir wollen wissen, wer die merkwürdigen Trauergäste waren. Und besonders der Alte.
Wir sind jetzt Tamtam, der achtzehnjährige Ziehsohn eines griesgrämigen Säufers, der einen kleinen Ortsfriedhof in einem Kaff am Arsch der Welt verwaltet.
Oder besser: Tamtam ist wir. Alle und jeder.
Und Erdmann, am Stopfen, antwortet Tamtam/uns:
„Ich kenn fast jeden Wichser, der hier eingegraben wird. Ein Friedhof ist ein offenes Buch voller Namen. Das solltest du langsam wissen. Kinder, Eltern. Meine Mutter is auch dabei, hm.. Und Wichser sagt man übrigens nicht, Tamtam.“
Endlich, Erdmann, der Meister der Ohren hat das Pfeifchen in seinem Maul. Er denkt kurz nach, nimmt sie wieder raus:
„Hat seinen Eltern damals ‘n Riesengrab da drüben gebaut, vier Meter auf vier Meter und ‘n Alabaster von zwei Tonnen drauf. Seiner eigenen Alten auch, erklärt er Tamtam/uns. „Aber anscheinend backt er jetzt kleinere Brötchen”, deutet er aufs neue Urnengrab. „Das hier war sein Jüngster.“
„Was? Der alte Mann da? So reich?”, fragen Tamtam/wir, stoßen den Spaten in den kleinen Erdhaufen.
„Anscheinend gewesen”, meint Erdmann.
„Erzähl mir”, gehen Tamtam/wir neben Erdmann in die Hocke.
Endlich steckt Erdmann seine Pfeife an. Doch statt uns zu antworten, greift er in den Sand.
„Scheiß Verwaltung. Aber wissen ja alles besser…“, redet er mit sich selbst, sieht zu uns: “Sei froh, das du kein Christ bist.”
Ruckartig, mit spöttischem Grinsen, steht Erdmann auf.
„Mach fertig hier. Zuschaufeln! hopphopp”, wedelt er mit der Hand und treibt uns zurück an seinen Spaten. „Bringt Unglück über Leute zu reden, die noch nicht eingegraben sind. Auch wenn’s bloß Asche in einer Urne is.”
„Du bist abergläubisch?” lächeln wir über Erdmanns ernstes Gesicht.
„Nein, nur vorsichtig. Ich weis auch nichts von Geistern, wenn du das meinst, nur wie man einen Toten einbuddelt. Da kenn ich nur Wurzeln und Erde. Deshalb bin ich hier ja der Friedhofswärter und der Helfer. Also, los jetzt!”
Also schaufeln wir das kleine Loch zu. Das geht schnell. Aber wir werden immer schneller, stampfen plötzlich mit hastigen Bewegungen und verkniffenen Gesicht die Erde fest.
„Was is?” fragt uns Erdmann.
„Was?” sagen wir.
Wir müssen!
„Ja”, lacht Erdmann, „kannst ja gleich. So, und jetzt glatt ziehen. Außen festklopfen und dann den Kranz gegen das Kreuz. Sonst sieht das aus wie drauf rum getrampelt”, weist Erdmann uns an und beaufsichtigt unsere Arbeit, bevor wir zum Abschluss den Kranz ans vorläufige Holzkreuz lehnt.
Und wir treten zurück von der Grabstelle, sehen Erdmann mit fragendem Ausdruck aus: “Gut?”
Der nuckelt an seiner Pfeife, brummt und nickt.
Wir schultert den Spaten, nehmen von ihm die Schlüssel und springen los. Mit verkniffenem Gesicht und Schritt.
„Wirst noch mal oberster Grabpfleger”, ruft Erdmann uns nach und lacht wieder. „Und was trinken muss ich auch”, tritt er seine Schuhsohlen ab an der Einfassung vom Nachbargrab. Dann folgt er uns zu seinem Häuschen, dem Häuschen des Friedhofswärters.
Das Häuschen ist niedrig, abgeschieden, das letzte am Ortsrand. Es ist ein alter Betonbau, der aussieht wie wie eine Schuhschachtel, sein Flachdach übersät mit Flechten.
Ringsum läuft eine zerfressene Regenrinne. An den undichten Stellen der Rinne wachsen Rostflecken in die Hausmauer.
Inzwischen haben wir uns rundum erleichtert.
Jetzt, nach dem Begräbnis, machen wir auf einem alten E-Herd Glühwein heiß.
Für unsren Ziehvater.
Das machen wir immer, seit wir bei unsrem Ziehvater wohnen. Nach jedem Begräbnis.
Unser Ziehvater hat nach jedem Begräbnis erhöhtes Verlangen nach Glühwein. Auch oder vor allem im Sommer.
Bei dreißig Grad Außentemperatur.
Das knallt.
Wir machen den Glühwein unseres Ziehvaters aus billigem Landwein, nehmen immer einen Beutel.
Der Liter im Beutel zu neunundneunzig Cent.
Den, und nur den schätzt unser Ziehvater.
Dazu benutzen wir einen kleinen Henkeltopf, immer denselben. Auch für Fertigsuppen und gefrorenes Gemüse.
Für alles.
Und Erdmann schlürft den Liter Glühwein schnell und kochend heiß.
Das wirkt. Immer.
Auch zum Saufen wollte unser Ziehvater Tamtam/uns ursprünglich bekehren. Aber die standhafte Höflichkeit, mit der Tamtam/wir unsre Verzichtserklärung abgaben, hat ihn zum Einlenken gebracht.
Unser Verhältnis hat dadurch übrigens keinen Schaden genommen. Im Gegenteil. Erst seitdem genießen wir wirklich uneingeschränktes Vertrauen.
Unser Ziehvater hat uns nämlich einen eigenen Zweitschlüssel zum Häuschen machen lassen.
Bevor wir bei Erdmann eingezogen sind, hatte Erdmann zur Gesellschaft einen Hund, einen Dackel.
Doch der Hund und unser Ziehvater konnten nicht miteinander. Wenn unser Ziehvater mit sich selbst redete und plötzlich fluchte, bekam der Dackel Angst.
Dem Dackel rutschte der Schwanz zwischen die Beine und er verzog sich blitzartig hinter die Fenstertruhe.
Stundenlang.
Das war das eine Problem.
Das andere: unser Ziehvater konnte dem Dackel nicht abgewöhnen unter den Sessel zu scheißen. Immer schiss der Dackel unter den Sessel. Selbst dass Erdmann den Sessel umstellte half nichts.
Irgendwann fraß der Dackel ein Stück Fleisch mit gesplitterten Knochen und verreckte. Damit waren beide Probleme dann auf einmal gelöst.
Das war kurz bevor das Arbeitsamt uns unsrem Ziehvater als Grabgehilfen aufs Auge drückte.
Für einen Euro die Stunde. Dafür kamen wir angelatscht.
Nur damit uns unser Ziehvater beschäftigte.
Mit dem Auskratzen von Unkraut und Moos auf alten Kriegsgräbern. Dem Abwaschen und Bürsten von Grabsteinen.
Das Muster - griesgrämiger alter Säufer trifft grünen Jungen - erfüllte sich.
Am Anfang stauchte uns Erdmann bei jeder Gelegenheit zusammen, hoffte wir würde schlapp machen.
Trotzdem kamen wir jeden Morgen wieder.
Punkt acht Uhr klingelten wir bei Erdmann und nahmen gleichmütig jede Dreckarbeit hin.
So verging ein ganzes Jahr.
Dann ließ Erdmann uns jeden Tag seine Toilette putzen. Doch damit bekam er uns nicht los.
Die Verwaltung meldete sich. Auftrag: ‚Alte Gräber.‘ Auftrag ‚Alte Gräber’ kam Erdmann gerade recht.
Es musste Platz geschaffen werden, die Pacht für einige Gräber war abgelaufen.
Aber selbst die Exhumierungen schreckte uns nicht ab.
Erdmann saß persönlich auf einem kleinen Bagger, riss die abgelaufenen und teils verwilderten Grabstellen auf.
Er baggerte die Grabsteine und Deckplatten frei, grub ab, schickte uns in die Löcher. Ausbuddeln. Die verfaulten Reste, Stücke von vermoderten Särgen, Knochen.
Und er wartete darauf, dass wir kotzen würden.
Und wir kotzten. Einmal. Dann nicht mehr, zeigten keine Spur mehr von Ekel.
Teilnahmslos, vermummt mit einem nutzlosen Halstuch gegen den Gestank, verpackten wir emsig und sorgsam die verrotteten Überreste in bereitgestellte große Passkartons.
Siebenundfünfzig!
Diese Karton wurden abgeholt vom städtischen Krematorium. Zur endgültigen Verbrennung.
Aber uns belastete das alles nicht.
So verging das zweite Jahr.
Es gefiel uns bei Erdmann. Und wir, unsere Hartnäckigkeit und Ausdauer beeindruckten Erdmann schließlich.
Am Anfang wollte Erdmann uns fertigmachen. Aber wir ließen uns nicht fertigmachen. Wir bissen, blieben eisern. Bis wir Erdmann auf unsrer Seite und einen neuen Ziehvater hatten.
Zwei Wochen nach der Großexhumierung oder zwei Jahre, nachdem wir Erdmann aufgezwungen wurden, wohnten wir schließlich bei ihm.
Wir brachten nicht viel mit, nur eine Sporttasche mit Wäsche, eine Stange Zigaretten (Magnum 100er).
Erdmann wies uns die Matratze neben dem Scheißhaus zu. Das Hundeeck.
Dort lagen wir gut. Wie in einer gepolsterten Badewanne.
Wie sich bald herausstellte, waren wir und unser Ziehvater uns ziemlich ähnlich - ähnlich nervös, ähnlich ruhelos und ähnlich angespannt.
Unsre Beziehung in dem engen Häuschen wurde mit der Zeit immer enger.
Wir passten so gut zu unsrem Ziehvater und seinen vergilbten Tapeten. Vergilbt von unsren gemeinsamen Anstrengungen, unsrer pausenlosen Raucherei.
Draußen war noch Winter. Fingerdick hingen die Eiszapfen vor Erdmanns Schlafzimmerfenster.
Weil die Heizung verreckte, hockten wir tagelang mit Handschuhen, in Wollmützen und Mänteln im eiskalten Wohnzimmer. Unser Ziehvater fluchte, telefonierte mit der Stadt, fluchte, hielt verbissen das kaputte Fußgebläse auf seinen Knien und schraubte. Verbittert, ruppig.
Aber wir zeigte keine Spur von Ärger, so stark wir auch froren, machten keinen unwilligen Mucks.
Wahrscheinlich glaubten wir mittlerweile fest an eine Art Lehrling-Meister Verhältnis.
Es sah ganz so aus. Wir sahen ganz so aus, wenn wir unsren Ziehvater betrachteten. Wenn unser Ziehvater uns betrachtete. Hier voller Vertrauen und Respekt, dort voller Entgegenkommen und Zuversicht
Wenn wir gemeinsam ins Kaff und einkaufen gehen, folgen wir unsrem Ziehvater wie dessen eigener Schatten.
Wir selbst sprechen kein Wort, hören nur zu, immer hinter ihm, dabei unerschütterlich geduldig, konzentriert.
Unser Ziehvater zahlt, mault an der Kasse über die Preise. Hat er einen im Tee und sein Geiz gibt kurz nach, schenkt er uns sogar eine Tafel Schokolade.
Aber das wollte noch nicht viel heißen. Auch seinem Dackel hatte unser Ziehvater gelegentlich einen Kauknochen spendiert.
Seinen gammligen Trott behielt unser Ziehvater trotzdem lange bei. Ob jetzt ein junger Kerl oder ein Hund seine Wände teilte, seine Haltung nahm noch keine Wendung.
Erst als er uns vor ein paar Wochen plötzlich einen Zug von seiner Pfeife anbot. Da wussten wir, dass wir in den Augen unsres Ziehvaters aufgestiegen waren.
Dabei ist unser Ziehvater bescheiden, sehr bescheiden. Seine ganze Freunde, das ist die Pause bis zum nächsten Pfeifchen. Seine Leidenschaft der billige Liter Glühwein, den er täglich säuft. Seine Erwartung ans Leben nur noch der nächste Butzen, den er sich aus der Nase zieht.
Wie gesagt, er ist bescheiden, sehr bescheiden.
Andere würden sagen, er ist vom Leben verbittert. Die Leute im Kaff sagen so. Aber wir, wir sagen, er ist der perfekte Lehrmeister, der ideale Ausbilder für uns. Andere würden sagen, er ist ein altes Ekel und ein gehässiger Schweinehund. Die Leute im Kaff sagen so. Aber wir, wir sagen, unter seiner rauen Schale schlägt doch ein menschliches Herz. (Und was für eins… in der Tat!)
Andere würden sagen… ach, scheiß drauf! Vergessen wir endlich die anderen und was sie sagen. Wir sind wir und nicht die anderen. Die anderen sind und tun, was die die anderen sind und tun. Wir sind und tun, was wir sind und tun.
Ganz einfach. Und ja! Er ist ein altes Wrack und ein Widerling, ein Schweinehund und ein Tyrann, ein Säufer und Scheusal. Aber er kann etwas, das fast niemand kann! Er kann es. Er kann mit den Ohren wackeln. Hört ihr uns? Ihr anderen?Daskann er! Unddasbeherrscht er vollkommen.
Nur soviel dazu.
Mittlerweile hat unser Ziehvater seinen Liter Glühwein intus, liegt wie üblich besoffen auf dem Sofa und pennt.
Somit haben wir Freizeit, können uns in Ruhe umsehen.
Unterm Teppichboden faulte seit kurzem das Holz, in der Küchennische kommt der Schimmel durch, in der Diele eiert die Waschmaschine. Daneben lehnen die ganzen verdreckten Geräte, die Spaten, Besen und Laubrechen. Noch verdreckt von ihrem Einsatz heute vormittag.
Das ganze Häuschen riecht nach runtergekommener Vergangenheit, nach lange geschiedenem Mann mit Schweißfüßen und löchrigen Socken, Schmutz und Vernachlässigung.
Wir merken, langsam bekommen wir ein besseres Bild von unserem Ziehvater.
Aber wir können nicht tatenlos rumsitzen, solange unser Ziehvater seinen Rausch ausschläft. Von unsrem Ziehvater auf Arbeit getrimmt, brauchen wir Beschäftigung. Zumindest Bewegung.
Also gehen wir alleine spazieren.
Vorm Friedhof sind Felder, Feldwege.
Dort steht der alte Nussbaum, steht mitten im Weizenfeld.
Der einzige Baum weit und breit.
Ihr erinnert euch?
Heute treten wir durch den Weizen an den Baum und betrachten ihm genauer. Von oben bis unten und allen Seiten.
Zum ersten mal überhaupt.
Und wir entdecken etwas.
Auf der Kehrseite vom Feldweg hat der Baum ein Astloch.
Auf Kopfhöhe, ungefähr so groß wie eine Kinderfaust.
Natürlich sind wir jetzt neugierig, und wir sind mutig, fassen ins Astloch.
Wir tasten, spüren.
Da ist etwas Glattes, ziehen es aus dem Astloch.
Es ist ein Stein, den wir in der Hand halten.
Ein eigentümlicher Stein, den wir da betrachten.
Auf der einen Seite glatt wie ein flacher Kiesel, auf der anderen rau. Auf seiner glatte Seite sind deutlich drei kleine Buchstaben plus Additionszeichen eingeritzt:
G+E+R
Die Mühe, mit der jemand Buchstaben und Zeichen in den Stein geritzt hat, ist erkennbar.
Wir überlegen.
Drei Initialen, drei Menschen, drei Namen.
Und wir rätseln, stecken den Stein in die Hosentasche und nehmen ihn mit.
Als wir zurückkommen ins Häuschen… nein!
Bei unsrer Rückkehr… auch nicht!
Wir gehen heim… ja! Wir gehen heim zu unsrem Ziehvater, der gerade aus seinem Glühwein-Nickerchen erwacht.
Neugierig setzen wir uns auf den Sessel gegenüber, warten bis er halbwegs zu sich kommt.
Aus seinem Rausch vom billigen Wein im Beutel.
Unser Ziehvater hat natürlich seinen üblichen Brummschädel und noch Standgas.
Er reckt sich vom Sofa, hält sich die Stirn, stöhnt.
Trotzdem wollen wir wissen. Und wir fragen:
„Sag, wer war der alte Mann heute?“
„Wer? A so… gibst aber auch keine Ruhe, was?“ grummelt unser Ziehvater, lächelt mühsam und greift nach seiner Pfeife. Das ist das Signal.
„Ja, ‘n Riesengrab hat der Alte sich bauen lassen. Heißt Hauff, Jonas Hauff. Kommt von hier, aus unsrem Kaff“,„Du hast doch schon die Villa da draußen am Fußballplatz gesehen? Dort, wo jetzt das Kinderheim ist, ja? Hat er mal bauen lassen. Die Hauff, also die Familie…“, beginnt unser Ziehvater. Und wir denken: Oh je, wieder so eine alte Familiengeschichten. Hoffentlich nicht so langweilig wie die letzte. Da hat unser Ziehvater nämlich nur gefaselt. Von einem Kerl, der sich erhängt hat.
Mensch, war das langweilig! Das dauerte ewig, bis der Kerl endlich mal von seinem Kellerbalken baumelte.
Und dann tat das nicht mal jemandem leid.
Im Verlauf der letzten drei Jahre hat unser Ziehvater uns jede Menge alte Geschichten erzählt. Oh, womit hat uns der alte Scheißkerl nicht schon vollgequatscht… mit was für abgeschmackten Mist! Aber das Geheimnis, die richtige Technik und hohe Kunst, wie man fachgerecht mit den Ohren wackeltdas hat der alte Scheißkerl immer schön für sich behalten.
Aber abwarten. Hören wir weiter.
„…also das waren eigentlich Bauern“, erzählt unser Ziehvater. „Man hat mir gesagt, auch er konnte…“, wackelt er plötzlich mit den Ohren, „das.“
Und da! Wir sehen, sind schlagartig gebannt, sind ganz Ohr, wir lauschen und wissen: Das kann schon keine schlechte Geschichte mehr sein. Denndashat unsere Neugier selbstverständlich gepackt. Wer, er? Wer ist er? Wer ist dieser andere, derdaskann oder konnte?
Aber unser Ziehvater:
„Der hatte ‘ne Schwester… soll ein ziemliches Luder gewesen sein… die Titten, Zucker. Der Arsch, Zucker. Hat angeblich ‚angeblich’ jeden Kerl nicht nur um den Finger gewickelt, sondern…“
Titten? Ärsche?
Womit will der Alte uns jetzt wieder verkohlen? Titten, Ärsche? Was soll der Quatsch?
Wir/Tamtam verziehen nur das Gesicht, werden ungeduldig.
Was kümmern uns bitte Ärsche und Titten?
Hier gehts um die Meisterschaft der Ohren!
Das,und nurdaskümmert uns. Nur davon wollen wir hören! Nur deshalb sind wir noch bei dir, du altes Scheusal, erdulden schon drei Jahre Pein!
Umdaszu lernen.
Nicht für Titten und Ärsche!
Unwillig sehen wir zu, wie unser Ziehvater, den Daumen in der Pfeife, nach passenden Worten für sein Arsch- und Zuckerweib ringt, uns dann ansieht und lebhaft ausruft: „…sondern entmündigt! Jawoll, entmündigt!“
So? Na, und? zucken wir nur mit den Achseln, fixieren unsren Ziehvater.
Jetzt schiebt er sich auch noch das stinkiges Pfeifchen in sein Maul! Mensch, steck das Stinkding endlich an und leg los. Von ihm, derdasauch mal… denken wir.
„Auch mein Bruder war in sie verknallt…”
Was zum… Am liebsten würden wir jetzt aufspringen, unsren Ziehvater bei den Schultern packen, ordentlich durchschütteln und ihm in seine versoffene Visage schreien: Ist gut, Alter! Ist gut! Hör endlich auf von irgendwelchen überflüssigen Püppchen zu faseln. Das kratzt jetzt keine Sau.
Kapiert!
Uns steht nicht der Schwanz! Nur die Ohren, die du scharf gemacht hast mit deinemdas. Komm gefälligst zum Punkt und erzähl uns von diesem anderen, derdasauch konnte!
Aber so ruppig sind wir natürlich nicht.
Schließlich haben wir den Dreck nicht so lange ertragen, damit wir es uns jetzt noch versauen.
Die geheime Meisterschaft im Ohren-Wackeln - wir wollen es wissen! Denn hört: Wir suchen… die vollkommene Beherrschung unsrer Ohren.
Also bringen wir unsren Ziehvater sachte zurück in die Spur, fassen uns uns an die Ohren, lassen sie mittels Daumen und Zeigefinger wackeln. Und ganz höflich und leise fragen wir:
„Und er? Was war mit ihm?“
„Der? Ach so, ja…“
Vielleicht verplappert unser altes Scheusal sich ja.
Vielleicht verrät er uns diesmal ganz aus Versehen endlich die richtige Technik…
Wenn er schon über einen anderen Meister redet, derdasauch kann oder konnte: so meisterhaft mit den Ohren wackeln…
Also, Schnauze und zuhören!
AVE AURIS
Das Wackeln mit den Ohren ist kein kindischer Unfug, keine Angeberei und keine Show.
Das Wackeln mit den Ohren ist eine seltene Gabe,eine ernsthafte Meisterschaft und Gnade.
Es ist der Ausdruck von Freude oder Hoffnung, der übergeht von Mensch zu Mensch.
Lukas, das Ohr, 21. Jhd.
Lumpensammler und Schüler des Justus.
Jehova wackelt nicht
(Oder doch?)
Ganz gewiss sind die Ohren immer Voraussetzung fürs optisch perfekte Wackeln.
Leute, die blanke Anatomie, Größe, Form und Wuchs des Zielorgans, hat selbst keine Bedeutung beim Erlernen dieser artistischen Kunst. Dafür vergrößert oder verringert sie bei sachgemäßer Ausführung allerdings den Effekt auf mögliche Zuschauer.
Dass diese Kunst nichts mit Kleingeistern anzufangen weis, sehen wir gleich an Torben Hauff, dem ältesten Sohn unsres noch unbekannten Meisters. - Also, Film ab.
Lassen wir die Ohren sprechen.
Da kommt das kleine Auto. Pünktlich. Und Torben Hauffsiehtdas Kind, hinten im Kindersitz. Und sofort weis er bescheid. Eine junge Familie, die noch auf weiteren Zuwachs baut. So wie seine eigene.
Eine Familie am Wachsen, das bringt immer den Wunsch nach Raum und Entfaltung.
Am besten in weiten, ländlichen Räumen.
Damit war die Sache längst beschlossen.
Für Torben Hauff.
Er wird diesen Leuten sein Elternhaus vermieten.
Heute. Gleich.
Die tausend Euro mehr im Monat werden Torben gewaltig Luft verschaffen, werden das kleinliche Genörgel seiner frommen Frau Andrea merklich besänftigen.
(Übrigens hat er kleine Ohren, die Ohrläppchen eng angewachsen. Schon ihre Erscheinung ist wenig geeignet zum beeindruckenden Wackeln. Aber selbst vom Wackeln weis er nichts. Alles, was ihn kümmert sind Status und die Belange seiner verrückten Ehefrau. Dazu gleich mehr.)
Torben ist eine Pfennigfuchser, gönnt sich kaum was. Zuhause steht Torben Hauff massiv unterm Schlappen. Da braucht er jeden Cent. Er ist immer auf Abruf, immer erreichbar. Für seine Frau. Sie klingelt ihn an. Dreimal täglich. Obwohl sie sich jeden Abend sehen, schreibt sie ihm ständig Mitteilungen. Und er spielt mit, rotiert, schuftet und kämpft. Seit Jahren am Anschlag, im Hamsterrad.
Für sie, für die Kinder, den Sinn, den die Vaterschaft, die Ehe einem Mann geben kann. Erst recht mit Jehovas Segen.
Wie aus einer Zitrone presst Torben diesen Sinn aus der gegenwärtigen Situation. Er weis, Jehova hat seine Augen und Ohren überall. Und sie, seine Frau ist beides, beobachtet scharf die lauten Tischgebete, sorgt für die Einhaltung der häuslichen Regeln.
Denn Torben ist bei den Zeugen, und überall lauern kleine und große Sünden, kleine und große Verlockungen.
Das Seelenheil ist ein weißes Hemd, das den Körper einschließt, und schnell kommen Flecken drauf. Unbedachte Flüche, das kleine Bier, das Torben nach Feierabend heimlich an der Bude vorm Baumarkt abkippt.
Sie riecht es, riecht alles. Immer ist sie wach.
Manchmal staunt Torben nur noch über ihr Gespür. Als hätte Jehova ihr für treue Dienste einen siebten Sinn verliehen.
Die Frömmigkeit kostet Torben viel Energie. Aber sein Weg ist längst der Weg seiner Frau. Sie gibt vor, er folgt. Er glaubt es mittlerweile mit ganzer Hingabe. Was beide verdienen verwaltet seine Frau. Sie teilt ein, teilt zu, überwacht. Aber der Geldbeutel lässt schon lange keine Extratouren mehr zu. Obwohl beide voll arbeiten.
Die Kinder, der Kombi, das neu gebaute Haus in der Vorstadt - das zieht und zerrt, das zehrt und frisst. Und kostet: Ausdauer, Geduld und Nerven. Trotzdem wollen beide noch immer mehr. Noch ein Auto, neue Möbel, Ansehen in der Gemeinschaft der Zeugen.
Natürlich ganz für die Kinder. Versteht sich.
Jetzt ist endlich die Gelegenheit.
Jehova hat nichts gegen Geschäfte, die Verdammnis kennt keine Zahlen. Selbst Jehova kann seine Kinder nicht mit reiner Erleuchtung ernähren, selbst er muss einsehen, dass die, die seine Botschaft erkennen, nicht ohne Brot...
Für weitere tausend Euro wird der wachsame Glaube nicht leiden. Er darf. Der Rat der Zeugen hat es auf der letzten Sitzung erlaubt. Und allen kommt es zu Gute, vor allem da der Beitrag seit ihrem dritten Kind wieder mal angestiegen ist.
Das ungenutzte Elternhaus vermieten ist die Gelegenheit.
Der kleine Wagen parkt. Das junge Paar, seine potentiellen Mieter steigen aus. Er zielstrebig, sie ruckartig, schwanger.
„Morgen, Herr Ewald... Frau Ewald…!” begrüßt Torben jetzt die junge Familie. Den jungen Vater, die junge Mutter per Handschlag, ihren kleinen Jungen mit einem Zwinkern.
Torben trägt seinen besten Anzug, das Klemmbrett samt Mietvertrag untermArm und zieht die Hausschüssel vor.
Als Kaufmann läuft das Gespräch für ihn von selbst. Torben ist geschult, seit zehn Jahre Filialleiter eines Baumarkts. Das bringt Routine. Ob Käufer, Mieter oder Kunden. Das ist eine Soße. Alles Idioten. Mit Freundlichkeit erlegt man sie alle. Dagegen ist kein Kraut gewachsen.
Genau wie gegen Idioten.
Die jungen Leute mit ihrem kleinen Jungen sind wie maßgeschneidert, entsprechen haargenau der leisen Erwartung, die er von ihnen hatte.
Mit einem Grinsen öffnet Torben die kleine Hoftür im meterhohen Tor, lotst das junge Paar in den riesigen Hof.
Die Besichtigung kann beginnen.
Der Kleine kommt Torben direkt hinterher, springt sofort quer durch den Hof und schießt seinen mitgebrachten Fußball ab.
Haus und Hof sind vernachlässigt.
Zwischen dem Kopfsteinpflaster sprießt Moos. V
om Tor blättert die hellblaue Farbe, das Vordach des ehemaligen Viehstalls ist baufällig, die Balken verwittert.
Torben weis, der Zustand des Mietobjekts wird etwas den Mietpreis drücken.
Andererseits ist da die Weiträumigkeit, der Platz. Perfekt für Kinder. Das ist die Trumpfkarte. Hat er erst mal ‚Sie‘ in der Tasche, kriegt er auch ‚Ihn‘ und folglich alle.
Er wird die tausend Euro schon aus dem Pärchen kitzeln.
In jedem Fall tausend.
Sonst macht ihm seine Andrea zuhause die Hölle heiß.
Der Fußball prallt hart gegen das hintere Scheunentor.
Die Tauben, eingenistet unterm Dach des Hühnerstalls flattern auf.
„Felix”, ruft die junge Frau.
„Ja, die Tauben... Sie müssten hier natürlich einiges tun”, erklärte Torben Hauff und zeigt mit gefälligem Lächeln auf Viehstall und Scheune.
„Viel Arbeit, bevor sie alles nutzen können.
Der Garten beginnt übrigens direkt hinterm Hühnerstall und zieht sich bis zur vorderen Hausecke”, fährt Torben den Arm aus, erklärt. „Ein bisschen verwildert. Aber im September können sie Mirabellen pflücken. Und Zwetschgen auch.
Es stehen zwei Bäume. Mit dem Hühnerstall müssen sie ‘n bissel aufpassen. In der Decke und im Boden sind ‘n paar Bretter morsch.”
Unbeirrt am Reden schreitet Torben aufs Haus zu.
Der Fußball fliegt inzwischen durch den Hof, prallte wieder gegen das Scheunentor.
„Felix! Hierher!” ruft jetzt der junge Mann.
„Das Haus ist innen eigentlich in gutem Zustand. Da dürften also kaum nennenswerte Renovierungen notwenig sein. Ich würde ja selbst drin wohnen, schon wegen der Kinder. Für Kinder ist es toll hier. Wenn für mich nur nicht die lange Fahrerei jeden Morgen wäre. Trotzdem bin ich ziemlich regelmäßig hier. Allein schon wegen der Heizung und Wasseranschlüsse”, schließt Tropen die Haustür auf. Ganz beiläufig bemerkt er wie im Gesicht der jungen Frau das anfängliche Staunen in leichte Begeisterung übergeht.
Torben erkennt: das war’s. Die Sache ist geritzt. Noch vorm Eintritt ins Haus. Er hat ‚Sie‘ in der Tasche, folglich hat er alle.
Ihr Blick, mit dem sie wiederholt den Hof mustert, ist das vorzeitige Versprechen, dass die Unterschrift auf den Mietvertrag bringt, der auf seinem Klemmbrett steckt.
„Wirklich, viel Platz” nickte der junge Mann und ruft den Jungen, der noch immer durch den Hof springt.
Torben führt das Paar ins Haus.
Aufgedreht stürmte der Junge ihnen nach. Mit Ball.
„Den Ball festhalten”, ordnet die junge Frau an.
„Das Haus ist direkt nach dem ersten Weltkrieg gebaut worden”, erklärte Thorne weiter. „Fragen sie mich nicht von wem genau. Damals gab’s im Ort ‘ne ganze Reihe Bauern. Natürlich wurde das Ganze bis in die Achtziger immer wieder modernisiert, obwohl keiner drin gewohnt hat. Schon dreißig Jahre hat hier keiner mehr gewohnt. Üble Nachgerüche von unbequemen Vormietern sind somit auszuschließen.”
Mit selbstgefälligem Ausdruck steht Torben in seinem Anzug in der Hausdiele, spult sein Programm ab, schnippt dabei immer wieder aufs Klemmbrett und verdeckt mit ständigem Grinsen seine Ungeduld.
Die Formalien langweilen ihn.
Die Sache ist schließlich längst erledigt.
Die Frau hat es ihm gezeigt.
Ihr Blick.
„Ihre Eltern waren Landwirte?” fragte ihn jetzt der junge Mann.
„Nein, nur die Großeltern. Mein Vater hat das Haus geerbt, aber wollte nicht drin wohnen, wollte in die Stadt. Seitdem hat hier niemand mehr richtig gewohnt. Aber, wie gesagt, ich bin eigentlich alle Vierteljahr mal hier, um nach dem Rechten zu sehen. Die Heizung ist trotzdem auf dem neusten Stand, natürlich nicht technisch, aber voll funktionstüchtig“, gibt Torben Auskunft.
Aber seine Erklärungen und Auskünfte werden mühsamer.
„Darf man sich umsehen?” fragt ihn die junge Frau.
„Bitte, nur zu. Sehen Sie sich in Ruhe um“, seufzt Torben verhalten. „Oben sind vier Zimmer und ein Bad, voll gefliest, mit Dusche. Gleich die erste links.”
Die junge Frau gab ihrem Partner mit den Augen ein Zeichen, nahm den Jungen bei der Hand.
Die Treppenstufen knarren.
Langsam schlendern die Männer inzwischen weiter durch die unteren Räume, schweigen.
Wieder schnippt Torben gegen das Klemmbrett, sieht unauffällig auf sein Handgelenk.
Er hat doch keine Zeit, muss weiter.
Er wippt, seine gepflegten Schuhe glänzen auf den staubigen Holzdielen.
So langsam könnte die Unterschrift auf den Vertrag. Schon allein, weil Torben Hauff keine Lust auf eine erneute Führung hat. Keine Lust anderen Leuten noch einmal das gleiche zu erklären.
Plötzlich bleibt der junge Mann stehen.
„Sagen Sie, Herr Hauff, warum hat dieses Haus bis jetzt noch keiner gemietet?”,
Seine Hand fährt über die kahle Wand. An manchen Stellen der Wand kleben noch winzige Tapetenreste.
Von oben kommt das Geräusch der Wasserleitung.
„Bis jetzt hatte ich es nicht angeboten. Wir wollten eigentlich keine Mieter hier, also keine Fremden. Aber jetzt hat sich meine private Situation verändert”, lässt Torben Hauff den Spanner am Klemmbrett schnalzen, rückt ruhelos die Papiere gerade, räuspert sich.
„Wie auch immer, tausend Euro sind sicher nicht unangemessen. Immerhin hundertzwanzig Quadratmeter Wohnfläche. Und dann das Übrige. Noch mal knapp vierhundert. Ich weis selbst, tausend Euro sind kein Pappenstiel. Besonders für eine junge Familie heutzutage. Aber alte Häuser haben schließlich auch etwas für sich.Und für weniger möcht’ ich’s auf keinen Fall vermieten. Das wäre lächerlich.”
„Ich hab kein Problem mit alten Häusern. Nur weis man oft nie, was einem blüht.”
„Machen sie sich da mal keine Sorgen wegen der Wartungskosten. Das übernehme ich.”
„Rohrbruch?”
„Auch, ganz normal.”
„Zu schön um wahr zu sein.”
„Sie haben schlechte Erfahrungen gemacht, wie?”
„Leider. Aber das gehört hier nicht her. Das einzige, was mich interessiert, ist der Platz.
Unsre Wohnung, die wir jetzt in der Stadt haben, hat knapp sechzig, ist direkt unterm Dach.”
„Nicht so ganz geeignet für ein Kind.”
„Überhaupt nicht. Vor allem im Sommer. Da geht man fast ein.
„Hier ist es auch im Sommer angenehm. Immer kühl. Und im Hof können mit ihrem Sohn ungestört bolzen.”
„Genau” lächelte der junge Mann.
Von oben hören sie Schritte. Die Schritte sind hastig, kehren mehrmals zurück. Dort wird gründlich inspiziert.
„Tja, spontan würde ich ja sagen“, meint der junge Mann. Aber erst müsste ich mir noch die Heizung und den Keller ansehen.”
„Gut, dann darf ich Sie mal bitten” macht das Klemmbrett eine einladende Geste.
Es geht in den Keller. Torben voran, mit genervtem Gesichtsausdruck, versteckt vor seinem potenziellen Mieter.
Als die beiden wieder raufkommen, warten die Frau und der Junge bereits im Flur.
Es wird geküsst, untergefasst.
„Und? Hast du dir oben alles angesehen, Schatz?”
Torben lauert. Der überzeugte Blick, den die Frau ihrem Partner zuwirft, sagt alles.
Und Hauff atmet innerlich durch. Jehova und seine Frau werden vorerst besänftigt sein. Das Geschäft wird zustande kommen. Jetzt gleich. Jede Sekunde. Die Unterschrift muss endlich unter den Vertrag.
Nur noch ein Detail.
„Der Garten?” fragte die junge Frau.
„Ja, richtig.”
Torben lacht, marschiert in geschwätzigem Eifer schnurstracks los. „Kommen Sie, hier entlang. Aber schütteln sie bitte noch nicht die Bäumchen”, witzelt er.
Sie treten durch die Hintertür in den Garten.
Dreißig Jahre hat Jehova beide Bäume wachsen lassen, damit sie den ungestört verwilderten Garten mit seinem Unkraut überragen.
Bäume, die ihm jetzt helfen, das Haus zu vermieten. Die Mirabellen und Zwetschgen sind noch grün, aber sie reifen. Einträchtig. Wie im Paradies.
„Wir nehmen’s!”
Torben übergibt das Klemmbrett, lächelt.
Tausend Euro Monatsmiete sind eine süße Frucht.
Sein Ansehen wird wachsen.
Zuhause. In der Gemeinschaft.
Einträchtig.
Wie gewünscht.
Hier, direkt unterm Mirabellenbaum kommt es zur Unterschrift, kommt es zum Handschlag zwischen dem jungen Paar und ihrem neuen Vermieter.
Einträchtig.
Wie im Himmel.
Vom Gehweg draußen ist davon nichts zu sehen.
Man hört nur das heitere Geplauder mehrerer Stimmen.
Andrea Hauff hat lange überlegt.
Wochenlang.
Der Reisebus beherrschte sie.
Der Reisebus nach Tirol.
Der Reisebus, der am Steinabhang zerschellte.
Die Meldung kam in den Nachrichten.
Keiner überlebte.
Tagelang hatte Andrea Hauff das Bild vor Augen, erlebte alles nach. Als Mitreisender im Moment des Unglücks.
Von zuhause aus.
Live.
Schwanger mit ihrem dritten Kind.
Sie saß dabei, sah den vollbesetzten Reisebus über die Felsen krachen und zerschellen.
Sie zerschellte, schwanger mit ihrem dritten Kind.
Alles zerschellte.
Wieder und immer wieder zerschellte der Bus.
Mit ihr an Bord.
Die Fernsehbilder sprachen eine deutliche Sprache, ätzten sich abgrundtief in die Seele von Andrea Hauff und hinterließen dort ihre Wirkung. Schock, Schauer, Angst, Ratlosigkeit. Der Bus war nicht nur ein Wrack, sondern sah aus, als käme er direkt aus der Schrottpresse.
Noch Wochen später fuhr ihr der Bus durchs Hirn, durchbrach zum hundertsten mal die Leitplanke, zerschellte zum hundertsten mal am Steilhang.
Andrea Hauff verbrachte schlaflose Nächte, kam und kam davon nicht los.
Von der Nachricht, den Bildern, von der Wechselwirkung ihrer eigenen Empfindsamkeit und Einbildungskraft.
Dazu kam, dass jeder ihrer Bekannten sie anfangs tatsächlich für tot hielten. Denn niemand wusste vom Buchungsfehler, der einer Angestellten im Reisebüro unterlief.
Ganz versehentlich wurde das Reisedatum vom Dienstag zum Donnerstag, vom Vierzehnten zum Sechzehnten.
Dass ihr Mann zuerst nachhaken wollte und sie es ihm ausredete, erschütterte Andrea Hauff hinterher umso mehr.
Sie überlegte, suchte noch immer eine Erklärung, aber das Ergebnis blieb immer das gleiche: sie hätten tot sein müssen, unbedingt, unabänderlich, auf der vorgesehenen Reise am Vierzehnten Januar.
Am Tag vor ihrem dritten Hochzeitstag hätten sie sterben müssen. Genau wie die anderen einundvierzig Passagiere. Es war unfassbar, zum Verrückt werden.
Die Fernsehbilder sprachen eine zu deutliche Sprache.
Andrea Hauff rief ihren Mann, starrte in den Fernseher, zitterte vor dem, was unfassbarer blieb. Selbst Minuten nachdem ihr Mann unter Schweigen den Fernseher ausgeschaltet hatte, saß sie wie gelähmt auf dem Sofa.
Dann klingelten ihre beiden Handys.
Andrea Hauff konnte nicht rangehen, hörte aber wie ihr Mann irgendetwas sagte, leise, ganz leise dem Anrufer ein Lebenszeichen hauchte. Sie hörte das Wort Mutter, unterschied die Namen einiger Freunde. Es kam ihr vor, als wäre alles verblasst, das Zimmer, ihr eigenes Leben, selbst ihr Verstand, der ihr sagte, das sie auf einem Sofa saß.
Das Geschrei des Säuglings brachte Andrea zu sich. Wacklig stand sie auf, suchte Halt.
Doch der Boden, der Teppich und Läufer, auf denen sie zu ihrem Mann ins Nebenzimmer trat, bot ihr keinen festen Untergrund mehr, bewegte sich. Sie sah auf ihn, auf Julia, ihr zweites und jüngstes Kind., das er jetzt wickelte.
Mit schnellen Schritten verließ sie das Kinderzimmer, lief zur Haustür, riss sie auf und blieb stehen in der Kälte.
Die Sonne blendete sie, aber der Druck auf ihrer Brust ließ schlagartig nach.
Und alles war da, unverändert, wie immer.
Der Vorgarten, die Straße, der Himmel…
Andrea Hauff blickte sich um.
Nichts war anders, aber doch verändert - verändert von einer unbekannten Kraft.
Undeutlich kam ihr das Sprichwort mit der Blindheit in den Sinn, dann Gott.
Angestrengt sah Andrea zur bleichen Sonne, fror.
Bis ihr Mann sie sachte am Rücken berührte.
Wortlos drehte sie sich um, presste sich an seine Schultern. Mit ihrem linken Ohr.
(Andrea Hauff hat größere Ohren als ihr Mann. Der Effekt, den sie damit beim Wackeln erzielen könnte wäre bei Frontalansicht allerdings unschön. Denn ihr linkes Ohr misst im Durchmesser vier Millimeter mehr, als das rechte. Nur ganz nebenbei. Außerdem würde sie das Wackeln mit den Ohren als anti-religiöse Praktik ablehnen. Lassen wir die Frau getrost in ihrem Irrglauben! Vielleicht wackelt Jehova ja doch?)
Ihre Finger krallten sich in seinen Rücken, der Teil eines Wunders war. Sie, er, der Vorgarten, die Straße….
Alles war ein Wunder, und ein Wink des Schicksals, das Andrea Hauff in tiefe Unsicherheit, tiefe Zweifel stürzte.
In allem braucht das Leben Grund und Sinn.
Warum?
Und je mehr wir denken, wir könnten Gründe fürs Unverständliche finden, umso wichtiger machen wir uns selbst.
Andrea Hauff lies den einfachen Zufall nicht gelten.
Der Bus war zerschellt.
Ohne sie.
Ganz allmählich verlor das gemeinsame alte Leben mit ihrem Mann und den Kindern seinen Wert.
Im ihrem Freundeskreis erledigte sich das Thema nach kurzer Erwähnung von selbst.
Mit den Augen.
Sie waren noch da, gesund.
Aber der Gedanke, dass über ihrer Familie eine Bestimmung schwebte, beschäftigte Andrea immer weiter.
Die einundvierzig Toten, die sie zu ihren Verbündeten machte, waren starke Verbündete.
Das nacherlebte Unglück erschütterten ihren Verstand, die Trümmer hinterließen ein Trauma.
Ihr Mann, sie und das Kind in ihrem Bauch…
Im Grund hätten sie alle tot sein müssen, waren tot.
Sie, Torben, der vierjährige Leo.
Alle tot.
Nichts weiter als zerquetschte Fleischklumpen.
Ihr Mann war nur ängstlicher Zuschauer in der nacherlebten Bustragödie der Andrea Hauff. Mit Logik, mit Bitten und Zuspruch suchte er Zugang zu ihrer Vernunft.
Vergeblich.
Zuviel sprach dagegen.
Schon vorher waren in Andrea Hauff die Ansätze zur Gläubigkeit. Zwar ging sie nicht in die Kirche, betete und bekannte sich nicht. Trotzdem neigte sie zum Glauben an eine unbekannte Kraft, die sie als Gott anerkannte.
Das abgewendete Unglück bestärkte sie.
Etwas hatte das Unglück abgewendet, sie geschützt.
Fieberhaft, wie andre ihren Geldbeutel, suchte Andrea Hauff den großen Zusammenhang hinter dieser verkorksten Welt.
Aufwachen!
Ihre Kinder, ihr Mann, dass sie Mutter, Sekretärin bei Holzmann & Dobi, dem Maklerbüro in der Innenstadt war - das alles bedeutete plötzlich nur noch einen Fliegenschiss gegen die unbekannte Größe und Macht, der sie ihre wundersame Rettung verdankten.
Dann, ganz plötzlich, kam die Kehrtwende: der Glaube, das Bekenntnis, später die Läuterung.
Es war am ersten Tag nach Andreas Urlaub.
Morgens, um halb acht fuhr ihre S-Bahn. Und Andrea mit an Bord, dicht gedrängt mit anderen Mänteln.
Die Bahn fuhr durch den dunklen Wintermorgen, vorbei an grauen, dreckigen Bauten. Zum Hauptbahnhof.
Dort stieg Andrea wie gewöhnlich aus, kam mitten im Pulk die schäbige Treppe der Unterführung runter, vergrub ihr milchweißes Gesicht kläglich in den Mantelkragen.
Andrea ging langsam, blickte zur Seite, zu Boden.
Blind drückten sich die Mäntel an ihr vorbei, laut trampelten die Füße um sie vorwärts.
Die Wandfließen der Unterführung hatte die Farbe von vergilbten Gardinen, die fahle Farbe des Todes.
Aufwachen!
Langsam kam sie die Unterführung hoch, war schon auf der anderen Seite. Beim Ausgang. Nur einen Moment hob sie den Kopf, und ihr forschender Blick fiel auf die altbekannte, selbstverfasste Aufschrift.
Der Bus in ihrem Hirn legte eine Vollbremsung hin, stoppte direkt vorm Abhang. Sie stoppte, blickte in die steinige Tiefe und hörte dabei deutlich den freundlichen Rufvon oben, den Ruf der Bestimmung.
Sie warauserwählt.
Sie und ihr Mann.
Ganz langsam und quer zur kopflos dahineilenden Masse ging Andrea Hauff auf das Pappschild zu. Und nichts stand mehr zwischen oben und unten, zwischen ihr, der freundlichen Stimme und dem tödlichen Abhang.
Der Bus in ihrem Hirn stand still, sie stand still, direkt vor dem erhobenen Pappschild. ERWACHET!
Mordstitten für Krüger
(DER mit den Segelohren)
Es kommt vor allem auf die innere Einstellung an, Leute.
Jemand, der ständig mit einem Ständer in der Hose rumläuft, etwas Absolut nimmt oder spezielle Ansprüche ans Leben stellt, folgt nicht der persönlichen Entsagung: dem Weg zur Meisterschaft.
Schon gar nicht folgt er der Meisterschaft in etwas „scheinbar“ Nutzlosem.
Wir können das hier bestens beobachten.
Gleich an mehreren jungen Leuten.
Am besten an Eva Hauff, der Schwester von Jonas Hauff. Außerdem taucht unser Meister im Wackeln mit den Ohren zum ersten mal persönlich auf.
Eva: Sie steht am offenen Fenster, jeden Sonntag Abend.
Das Zimmer ist erleuchtet.
Das Licht fällt auf seine spärliche Einrichtung.
Ein schmales Bett, ein paar nagelneue Liebesromane auf Evas Nachttisch.
Hinten, an der Wand das handgroße, versilberte Kreuz.
Nur Evas Kleiderschrank ist überfüllt. Ihr Kleiderschrank explodiert. In einer wahllosen Masse hängen Kleider und Röcke an den überladenen Schranktüren.
Und da ist die Büchse, die silberne Metallbüchse, die oben auf dem Schrank steht und aufblitzt.
Eva steht in vollem Licht, beugt sich über die Fensterbank, neigt den Kopf, streicht die schwarzen Haare hinters Ohr.
(Was für schöne Ohrmuscheln! Doch nicht geeignet zum langen und qualvollen Studium im Wackeln mit den Ohren. Eva Hauff hört nur, was sie hören will. Und Dinge, die nicht sofort zum gewünschten Ergebnis führen langweilen sie. Was man tut muss sich schließlich umgehend auszahlen und lohnen.)
Sogar Gaab, der an der Straßenecke gegenüber steht, kann Eva sehen. Denn die Gardinen sind aufgezogen, der Klappladen offen. Sie sehen von der Straße in ihr Zimmer.
Gaab, Krüger, all die Jungs. Genau wie sonst, wenn sie halb auf dem Fensterbrett sitzt, mit ihnen redet.
Manchmal ist es nur einer, der kommt.
Der lange Krüger.
(Der lange Krüger! Vergessen wir seine Ohren schnell, und ihn gleich dazu mit seiner ganzen Länge. Der lange Krüger hat nämlich nur eins im Sinn: Mädchen. Ihnen gilt seine ganze Leidenschaft. Was sich natürlich bestens reimt mit seinen beiden Längen. Am Weiher wissen alle längst bescheid.)
Manchmal kommt der lange Krüger allein an Evas Fenster. Manchmal sind es mehrere Jungs, die kommen. Mal zusammen, mal nacheinander. Nur Gaab, der Eigenbrötler, kommt nie.
(Mit Gaab ist es besonders tragisch. Zwar hat er ausdrucksvolle Segelohren, aber seine Ohrmuscheln sind steif wie Blech und regen sich nachweislich nie. Selbst bei Wind keinen einzigen Millimeter. Außerdem ist Gaab nicht auf einem völlig anderen Trip. Gaab ist ein heimlicher Götzenanbeter: sein abgrundtiefer Götze heißt Eva Hauff.)
Am Anfang ist Gaab morgens oft an Evas Haus vorbeigegangen. Absichtlich. Scheu, verstohlen und heimlich verliebt in Eva, das Objekt seiner Anbetung.
Den Rucksack mit Zirkel, Tuschfüllern und Schablonen auf seinem krummen Rücken, ging er, unterwegs zur Schule für Bauzeichnungen, am geschlossenen Fenster vorbei.
Mittlerweile weis Gaab, dass er Eva am ehesten sonntags sehen und beobachten kann.
Der lange Krüger und die andern Jungs reden offenen mit ihr, wollen, dass Eva rauskommt, wollen mit ihr Eis essen, spazieren gehen, ins Kino.
Krüger und die andern Jungs kommen ans Fenster, trinken Evas Blicke, fressen sie mit den Augen.
Gaab nicht.
Er beobachtet von Weitem, atmet aufgeregt durch den Mund. Wenn er doch mal zufällig auf der Straße ihren Weg kreuzt, spannt er die Muskeln, sieht er mit hartem Blick stur an ihr vorbei.
„Wann dann?” fragt Krüger Eva.
Hinter ihr, auf dem Schrank blitzt die Metallbüchse.
Wie gewöhnlich lackiert Eva ihre Fingernägel, unterdrückt ihr Gähnen, während die Jungs sich einen abbrechen, den Mund fusslig reden, ihr schmeicheln, schöne Dinge versprechen. Sie hat kein Interesse an Krüger, an keinem von den Jungs. Ihre Erwartungen sind größer als was man ihr bietet. Da ist nichts, was ihr Vorteile oder sie weiterbringt.
Wenn Eva anfängt ihre langen, schwarzen Haare zu kämmen, ist das ein sicheres Zeichen für ihr Desinteresse.
Dann dauert es nicht mehr lange, höchstens eine Minute, und sie schließt das Fenster. Knallhart, egal wer von den Jungs auch draußen steht.
Das Fenster geht zu.
Dann ist Gaab erleichtert.
Sobald sie schließt, kann er gehen.
Für die Tochter eines Bauern ist Eva verteufelt hübsch.
Das sagt jeder.
Sie weis es.
Das mit dem Fenster fing an, als sie im Vorjahr die Ehrenurkunde mit der höchsten Punktzahl aller Mädchen der Schule bekam. Über dreihundert Mädchen.
Vielleicht gab das den Ausschlag, dass sie nie rauskam zu einem der Jungs, die bei ihr unentwegt baggerten.
Sie war ausgezeichnet, prämiert.
„Weis nicht, keine Ahnung... keine Ahnung. Ich hab überhaupt wenig Zeit”, zuckte Eva mit der Schulter.
Es ist immer das Gleiche:
„Und später?… Und morgen?…. Und nach der Schule?“
„Nach der Schule muss ich arbeiten. Wenn ich nicht arbeite, ruh ich mich aus.”
„Du kannst dich auch ausruhen, wenn wir zusammen fortgehen. Das ist ja keine Arbeit.”
„Aber das strengt trotzdem an. Wenn ich frei hab, will ich mich entspannen. Also, mach’s gut.”
„Wart doch!”
„Ne, ich mach jetzt zu”, lacht Eva kurz. „Bis dann.”
Sie erfindet weder Ausreden noch vertröstet sie einen der Jungs. Aber sie jagt sie auch nicht fort. Sie bleibt immer vage, hält die Jungs hin, gewährt die Annäherung und genießt die Bewunderung. Aber verweigerte die Verbindung.
Sie schlägt jede Einladung aus, geht mit keinem von ihnen aus, ganz gleich, welche Komplimente oder Versprechungen sie ihr machen.
Es ist immer das Gleiche.
Nach einer Weile schließt Eva irgendwann dann doch wieder das Fenster. Aber die Jungs sind hartnäckig, kommen immer wieder. Der lange Krüger, die anderen und Gaab, von dem keiner was was.
Gaab, der fast jeden Abend an der Ecke stand, bis er den Sonntag, das offene Fenster und Licht entdeckte, die Präsentation und Stunde der vergeblichen Annäherung.
Der lange Krüger hat es unzählige male probiert, so oft, als wäre sie im ganzen Ort das einzige Mädchen, das mit fünfzehn seine ausgeprägte körperliche Reife betont. Als wären die Merkmale körperlicher Reife der einzige gültige Ausweis, der aus einem Mädchen eine Frau macht.
Unzufrieden steigt Krüger auf sein Mofa, tritt wütend durch und braust davon.
Es ist nichts Neues für ihn, dass Eva ihn abweist.
Nur eins ist neu.
Diesmal grübelt Krüger nicht. Nicht mehr. Diesmal bekommt er ein merkwürdiges Gefühl, hört auf sein Gespür.
Und je mehr er auf sein Gespür achtet, umso deutlicher wird dieses merkwürdige Gefühl zur seiner Überzeugung.
Es passt so gut zu den anderen Gelegenheit. Wenn er Eva mal zufällig in der Schule, statt an ihrem Fenster sieht.
Is in Ordnung, wenn sie mich an der Nase rumführt. Kann über mich lachen, is in Ordnung, dachte Krüger.Aber so von oben runter. Billiges Moped hat se gesagt. Hinten drauf hocken auf das alte Ding... alt, also wertlos - will die ‘n Prinz?!
Der lange Krüger ist schwer gekränkt.
Grimmig kriecht er am nächsten Tag beim Schulhof ins Gebüsch, kommt zu Jonas, Evas Bruder.
Jonas ist dreizehn, steckt aber immer mit den Älteren zusammen. Sein aufgeweckter Blick, der immer nach etwas sucht, schweift unaufhörlich zwischen den Mitschülern umher. Jonas selbst spricht nicht sehr viel, hört ihnen oft nur zu. Ganz Ohr.
(Da haben wir unsren späteren Meister! Dazu mit ganz unauffälligen Durchschnittsohren. Er wackelt selten mit den Ohren und noch ungeschickt. Aber er wackelt bereits, ist schon als Junge ein Autodidakt. Selbst den schwersten Weg scheut er nicht, hat alles, was jede Meisterschaft erfordert, hat Hirn und Geduld, Ausdauer und Hingabe.)
Im Gebüsch der Schule wird heimlich geraucht.
Billige Kippen.
Im Gebüsch hocken und sich vor den Lehrern verstecken, das bedeutet hier den Pfad der Regeln zu verlassen, bedeutet den Eintritt in die Wildnis des Lebens.
Stümperhaft wird im Gebüsch der erste, irgendwo geklaute Schnaps gekippt. Es wird aufgeschnitten, unverblümt vom Wichsen und Ficken geredete.
Man foppt sich gegenseitig, nimmt sich in den Schwitzkasten, brennt sich mit Zigaretten, sucht Initiationsriten.
Der lange Krüger, der Ältere, nimmt Jonas beiseite, gibt ihm von sich aus eine Zigarette.
Jonas trägt plumpe Schuhe, schon abgewetzt, obwohl sie noch eine Nummer zu groß sind. Jonas trägt viel zu große Kragenhemden, Cordhosen.
Alles Klamotten seines Vaters.
Umgenäht, gekürzt.
Seine Mutter kauft alle Schaltjahre mal Schuhe. Für ihn, seine beiden Schwestern und sich selbst.
Mehr gibt sein Vater, einer der letzten Bauern der Region, nicht für Klamotten aus.
Die Wirtschaft, das Vieh schlucken fast alles.
„Ich muss dir mal sagen, deiner Schwester regnet’s aber ganz schön in die Nase. Warum is die so eingebildet?” fragt Krüger jetzt Jonas.
Wegen der Zweige und des Gestrüpps steht Krüger nach vorne gebeut, steht leicht geduckt. Seine Stimme klingt erbittert. Jonas steckt sich inzwischen die geschenkte Zigarette an, zieht, sieht auf.
In seinem Gesicht sprießt noch kein einziges Haar.
„Is sie? Kann sein. Bist du abgeblitzt, ja?”
„Wenn ich eine will, krieg ich se. Aber die, die is ja voll kalt. Bei euch daheim redet sie wenigstens noch, aber wenn ich die hier auf’m Gang seh’ und anquatsche, sagt die keinen Ton. Geht einfach so vorbei. Na, jetzt sag, is das ‘ne Art! Bin ich ‘n Dreck, oder was?”
„Nein, aber vielleicht verliebt”, meint Jonas unbefangen. Er blinzelt und grinst den älteren Krüger an, schnippt mit dem Zeigefinger die Asche von der angehobenen Zigarette, raucht Kreise.
„Ach, verliebt”, wirft Krüger abfällig das Kinn, sieht die Spielerei. „Hör auf mit dem Quatsch! Und hör zu“, drückte er Jonas’ Arm nach unten, sieht ihn eindringlich an. „Du kapierst das nicht, Großer. Du kapierst nicht wie das is, wie man sich da vorkommt.”
„Ne, weis ich nicht.Ich les’ lieber“, erwidert Jonas, lächelt und sieht Krüger erst freundlich ins Gesicht, dann zu Boden, „und kauf mir bald gescheite Schuhe.”
Krüger seufzt.
„Sag mir lieber, lässt die überhaupt einen ran? Kommt mir nicht so vor. Oder?”
„Einen Freund hat sie keinen, wenn du das meinst. Vielleicht da, wo se arbeitet. Aber…”
„Ja?” fragte Krüger unsicher und runzelt die Stirn. Sein Gesicht weicht etwas zurück, um den Jüngeren zu mustern.
Jonas setzt erst eine nachdenkliches Gesicht auf.
Als er die Wirkung erkennt, die sein ‚Aber‘ auf Krüger macht, beginnt er zu lachen.
„Aber… was lachst du!“ knurrt Krüger.
Angespannt,zwischen Unsicherheit und Ärger, betrachtet er Jonas, wartet und kaut an seiner Unterlippe.
„Nein, nein. Ich bin mir sicher”, nickte Jonas überzeugt. “Sie hat keinen. Nein. Ich müsst’s ja wissen.”
„Eben”, bestätigt Krüger altklug. „Aber da stimmt doch was nicht. Hab ich nicht recht?”
„Du hockst doch dauernd bei ihr, nicht ich.”
„Was redest du? Eben nicht. Ich steh nur vor euerm scheiß Fenster, so wie alle andern. Und weiter geht’s nicht. Ich komm mir ja schon vor wie ‘n Hund, der bettelt!“ meint Krüger wütend.
„Wenn ich so nachdenk’…“ meint Jonas, „seh’ ich se eigentlich auch nicht oft. Nur beim Mittagessen und wenn se mal ‘n bisschen in den Stall kommt und melkt. Das war’s dann schon. Halt, stimmt nicht. Morgens, unten in der Küche.”
Der lange Krüger hört ihm zu, aber verkneift nur die Mundwinkel.
Die Antworten gefallen ihm nicht, klingen alle wie sinnloses Geschwätz. Das Gespräch mit dem kleinen Hauff bringt ihn seinem Ziel keinen Deut näher. Noch immer ist Eva in unerreichbarer Ferne, befeuert seine Phantasie.
Eva: da liegt sie, liegt nackt in ihrem Bett, besorgt es sich selbst und dreht ihm eine Nase, hält ihn zum Besten.
Und nichts bringt ihn näher - an diese Haut, diese Brüste, diesen Hintern - an diese Rundungen und Vertiefungen. Weich, groß und rund. Nichts gibt ihm die Hoffnung irgendwann die Sperre ihrer kalten Schulter zu durchbrechen.
Die Laute, der Atem dieses schönen Mädchens… sie schmecken und trinken…
Da steht ihr Bruder, grinst ihn an und lässt ihn zappeln. Genau wie sie selbst. Es ist zum Haarraufen, zum Verzweifeln! Verschmähung und Sehnsucht.
Was für ein grausamer Scherz!
Es ist soweit.
Der lange Krüger wird vehement.
Der Ärger überwältigt ihn, und er zieht vom Leder:
„Jetzt langt’s mir aber. Tut mir leid, Großer, aber die bringt’s nicht, auch wenn se deine Schwester is. Wenn die meint, sie is ne Königin und kann mir von oben runter kommen, dann hat se sich geschnitten!“ fährt er den Zeigefinger aus, zieht den erbitterten Schlussstrich.
„Und noch eins, das kannst du ihr mal sagen: Leute, die so sind, fliegen irgendwann immer auf die Schnauze. Schönen Grüß von mir!“
Krüger dreht sich ab, will fort.
„Moment, was meinst du?”
Jetzt fasste Jonas nach Krügers Arm.
„Was ich meine?“ erwidert Krüger verächtlich, stellt die Augen. „Ich meine so ‚abgehoben‘. Die denkt doch, sie wär was besseres. Oder nicht?”
„Glaub ich nicht. Glaub nicht, dass sie das denkt. Aber wenn du das glaubst”, meint Jonas überzeugt.
„Was ich glaube? Ich merk’s doch genau.”
Der lange Krüger ist erbittert. Aber die Hoffnung lässt ihn doch nicht los. Sein Verlangen ist größer als seine Einsicht.
Er steht noch immer da, sieht auf Jonas, der plötzlich erkennt, dass Krüger am Haken hängt.
Jonas schnauft und schaltet. Entschlossen wirft er die Kippe fort. Dann steckte er die Hände in seine Hosentaschen.
„Also, was soll sie bringen?”
„Wie?“
„Du sagst, sie bringt’s nicht. Also, was soll sie bringen?
Krüger wird schon verlegen, stammelt:
„Ich weis nicht, so ‘n bisschen freundlicher vielleicht. Und mal was von sich zeigen”, schiebt er nach.
„Hmmm…“, denkt Jonas kurz nach.
Da kommt ihm schon eine Idee. Die Idee.
„Komm am Sonntag!” schlägt er Krüger vor.
„Wieder ans Fenster, ja? Und dann?”
„Wart’s ab, ich denk mir gerade was aus. Aber das kostet dich fünf Mark.”
„Fünf Mark? Hast du noch alle!”
„Nein, ich fang erst an. Also, fünf Mark. Sonst kann ich wirklich nix für dich tun.”
Krüger ist aufgebracht. Aber Jonas, der völlig selbstsicher bleibt, nimmt ihm sofort den Ärger.
„Du meist, du kannst se damit überreden, dass se mit mir rausgeht? Für fünf Mark? Ist das so eine?”
Krüger lacht. Er lacht ungewohnt laut, während Jonas keine Miene verzieht.
„Vielleicht“ sagt Jonas ernst. „Aber bei der Sache gibt’s auch kein Risiko für dich. Man kann ja fast alles kaufen. Und wenn’s nicht klappt, kriegst du am Sonntag deine fünf Mark wieder. Garantier ich dir.”
„Fünf Mark…“
Krüger grübelt noch. „Das is ‘n Haufen Geld, Großer. Dafür muss ich beim alten Bartsch ‘n ganzen Tag Mopeds reparieren…“
Krüger grübelt, aber das eigene Verlangen…
„Gut, ich geb’ se dir”, fasst Krüger in die Tasche seiner Lederjacke, holt sein riesiges Portemonnaie vor. Einzeln zählt er vier Münzen in Jonas’ offene Hand, musterte zum Abschluss nochmals misstrauisch dessen Gesicht.
Jonas schließt die Hand zur Faust.
„Passt”, lächelt er Krüger an, schiebt dabei die Faust zur Hosentasche, lässt die Münzen in seine Tasche gleiten.
„Also, bis Sonntag, Großer”, schiebt Krüger sich über den Trampelpfad aus dem Gebüsch, dreht sich noch einmal um. Seine Lederjacke schrammt an den Zweigen entlang.
Er droht:
„Ich verlass mich auf dich. Und verarsch mich nicht. Sonst stopf ich dich im Schulhof in eine von den Mülltonnen, klar?”
Aber Jonas lächelt. Er nickt gelassen:
„Darfst du - gern.”
Draußen knattert Krügers Mofa.
Vorm Mond wandern Wolken.
Als Krüger zum Fenster tritt, ist kein Licht im Zimmer, das Zimmer stockdunkel. Die Klappläden sind zwar offen und die Gardinen zurückgezogen, aber das Zimmer so dunkel wie ein schwarzes Loch.
Auf dem Fensterglas schimmert nur die Straßenlaterne.
Neugierig stellt sich der lange Krüger auf die Zehenspitzen. Zuerst legt er die Hände ans Glas, versucht durchs Fenster zu sehen. Aber er kann nichts erkennen.
Das Zimmer bleibt schwarz, ein schwarzes Viereck, das ihn enttäuscht und verärgert. Er schnauft, er knurrt, pocht vorsichtig gegen das geschlossene Fenster. Nichts.
Mit verkniffenem Mund steht er schließlich auf dem Gehweg vor Evas Fenster, kommt sich verarscht vor und fluchte leise.
Und auf einmal ist Licht.
Das Fenster, das Zimmer plötzlich grell erleuchtet.
Der lange Krüger steht, blinzelt, sieht unvorbereitet durchs Fenster und wird überrumpelt. Seine Augen werden größer, starren einen Moment reglos, in völligem Erstaunen, durchs Fenster.
Was er schon lange sehen wollte, trifft ihn.
Was er schon lange begehrt hat, packt ihn.
Was er sieht - es schnappt ihn am Hals, packt ihn.
Ganz kurz prallt der lange Krüger vom Fenster zurück.
Er fängt sich tritt näher, folgt ihren Bewegungen vom Lichtschalter durchs Zimmer, von dem er nichts wahrnimmt. Zerstreut und verwirrt gleitet sein Blick über ihr schönes und ausdrucksloses Gesicht - Evas Gesicht, das Krüger seit Monaten verfolgt. Ihr Gesicht mit seinem kühlen und herablassenden Ausdruck, der Krügers Verlangen nur gesteigert hat. Kühl, herablassend und stolz.
Eva ist geschminkt, hat ihr schwarzes Haar geöffnet.
Eine schwarze Welle, die sachte über ihre nackte Schulter gleitet. Sie ist ein Hingucker, groß und sportlich, jede ihrer Bewegungen durchdacht.
Bedächtig bewegt sie sich durchs Zimmer.
Krüger steht da wie angewurzelt, gafft.
Überwältigt, entwaffnet.
Ganz Auge und viel zu überrascht, als dass sein Schwanz reagiert und er einen Ständer bekommt. Ein Gefangener des uralten Spiels von Verlockung und Verlangen, gefangen in der Anspannung des Zuschauers, gefangen im ewigen Spiel der Geschlechter, das hier stattfindet in seiner reinsten Form.
Krüger schluckt, bricht der Schweiß aus, seine Fingerspitzen kribbeln, sein Bauch wird taub. Und seine krachende Lederjacke, sonst immer in Bewegung, am Krachen - sie verstummt. Dafür reagieren sein Mund, seine Achseln, seine Fingerspitzen und sein Bauch.
Mit mulmiger Miene steht er vor Evas Fenster und sieht zu, wie Eva überall Gänsehaut bekommt.
Im schwarzen Schlüpfer stelzt Eva durchs kalte Zimmer, kommt näher, entfernt sich, geht zum Schrank, zum Nachttisch.
Dazwischen macht sie Hüftposen - albern, provokant, wie sonst vorm Spiegel. Die geschwungene Linie ihrer Haut, ihres Körpers wiegt sich und schreitet.