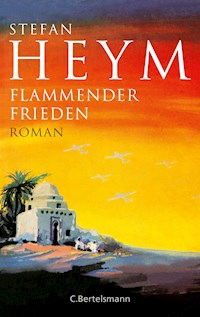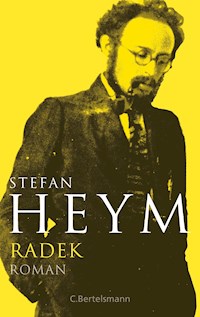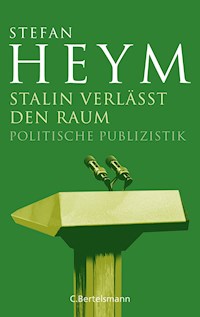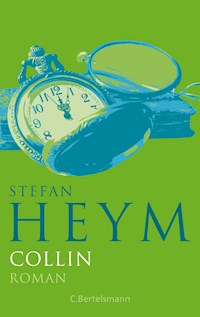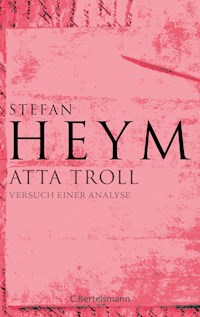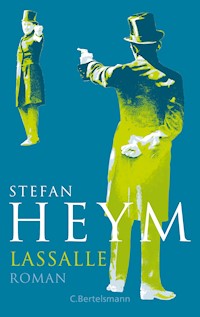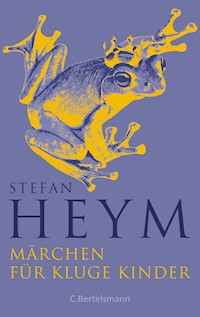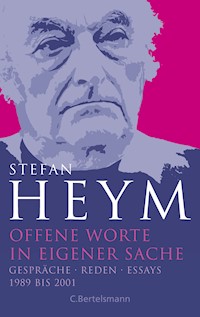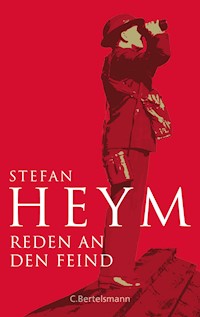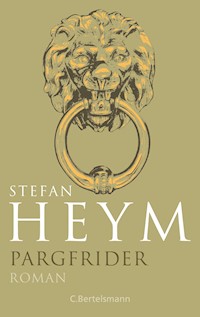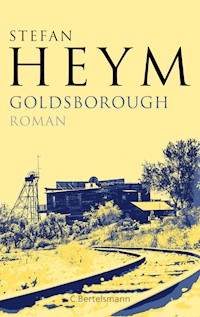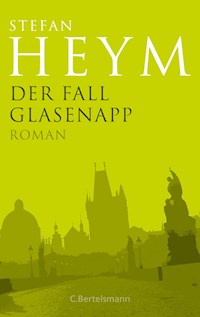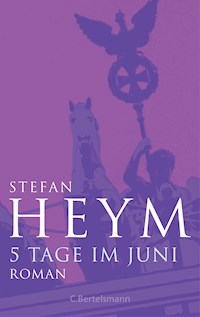
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane
- Sprache: Deutsch
»Ein aufregendes, wichtiges und unbequemes Buch.« Süddeutsche Zeitung
Es ist 1953. Die DDR besteht seit vier Jahren. Martin Witte, Gewerkschaftsführer des größten Ost-Berliner Industriebetriebes, ist überzeugter Kommunist, doch als die Partei eine Normerhöhung von zehn Prozent einfordert, äußert er seine Bedenken. Witte wird suspendiert, doch die Arbeiterschaft stellt sich nun auch gegen die Parteilinie. Versuche, den Protest einzudämmen, scheitern, und die Belegschaft strömt auf die Straßen – wo russische Panzer auf sie warten ...
Anhand von zeitgenössischen Dokumenten erzählt Heym die Geschehnisse um den 17. Juni 1953. Ein packender Zeitroman, der als das bekannteste Werk des großen Schriftstellers gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Ost-Berlin 1953. Die DDR besteht seit vier Jahren. Martin Witte, Gewerkschaftsführer des größten Industriebetriebs der Stadt, ist überzeugter Kommunist, doch als die Partei eine Normerhöhung von zehn Prozent einfordert, äußert er seine Bedenken. Witte wird suspendiert, doch die Arbeiterschaft stellt sich nun auch gegen die Parteilinie. Versuche, den Protest einzudämmen, scheitern, und die Belegschaft strömt auf die Straßen – wo russische Panzer auf sie warten ... Anhand von zeitgenössischen Dokumenten erzählt Heym die Geschehnisse um den 17. Juni 1953. Ein packender Roman, der als eines der bekanntesten Werke des großen Schriftstellers gilt.
Stefan Heym großer Zeitroman über den Arbeiteraufstand in der DDR, dessen Jahrestag in der BRD bis zur Wende der »Tag der deutschen Einheit« wurde, bei C. Bertelsmann erstmals erschienen 1974, nun auch Teil der digitalen Werkausgabe.
»Ein aufregendes, wichtiges und unbequemes Buch.«Süddeutsche Zeitung
»Heym war die bekannteste Unperson der DDR.« B.Z.
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1952 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
5 Tage im Juni
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © 1974 by Inge Heym
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1974 by C. Bertelsmann Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagmotiv: © Hafen Werbeagentur, Hamburg
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27834-2V002
www.cbertelsmann.de
Aus demStatut der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,angenommen auf deren IV. Parteitag im April 1954, Unterabschnitt »Die Parteimitglieder, ihre Pflichten und Rechte«, Absatz 2 (h)
Das Parteimitglied ist verpflichtet: … die Selbstkritik und Kritik von unten zu entwickeln, furchtlos Mängel in der Arbeit aufzudecken und sich für ihre Beseitigung einzusetzen; gegen Schönfärberei und die Neigung, sich an Erfolgen in der Arbeit zu berauschen, gegen jeden Versuch, die Kritik zu unterdrücken und sie durch Beschönigung und Lobhudelei zu ersetzen, anzukämpfen …
Vorspiel
Sonnabend, 13. Juni 1953
14.00 Uhr
sagte Banggartz: »Entweder du hältst dich an die Parteibeschlüsse, Genosse Witte, oder du ziehst die Konsequenzen. So einfach ist das.«
Witte hatte Verständnis für seinen Parteisekretär. Banggartz glaubte an das, was er sagte; nur war das, was Banggartz sagte, zu oft das, was er zu glauben wünschte.
»Tut mir leid, Genosse Banggartz«, erwiderte er, »aber für mich ist es nicht so einfach.«
Banggartz zog ein paar Blätter aus seiner Mappe. Witte erkannte den Bericht, den er selber geschrieben und an den Genossen Dreesen gesandt hatte. Daß der Bericht in irgendeiner Form auf Banggartz’ Tisch landen dürfte, hätte er eigentlich voraussehen können. Und daß zusammen mit der Frage: Bitte, was sagst du dazu? die Anweisung an Banggartz ergehen würde: Kläre die Angelegenheit.
Dr. Rottluff schaltete sich ein. »Natürlich kann jede Frage Anlaß zu Meinungsverschiedenheiten geben. Auch die der Normerhöhungen.« Er säuberte seine Brille und schob sie zurück unter die dünnen grauen Augenbrauen. »Wir alle kennen doch die Schwierigkeiten. Es macht mir kein Vergnügen, sagen zu müssen, daß wir kaum die Kosten decken. Da hätten die früheren Eigentümer ganz andere Maßnahmen ergriffen. Wir müssen die Arbeitsproduktivität steigern. Nicht nur hier bei VEB Merkur. Überall.«
»Selbstverständlich«, nickte Witte.
Er brauchte nicht überzeugt zu werden, auch nicht von Dr. Rottluff, der sich, was ihm anzurechnen war, nach 1945 zu den neuen Eigentümern, den Arbeitern, bekannt hatte und nun Werkleiter war.
»Die zehn Prozent Normerhöhung lassen sich verkraften«, sagte Dr. Rottluff. »Es gibt Leute bei uns, die schaffen hundertfünfzig, hundertsechzig Prozent ihrer Norm.«
»Und es gibt andere«, sagte Witte.
»Das Ganze ist eine Frage der politischen und ideologischen Erziehung.« Banggartz hob die Stimme. »Wir, die Partei, sind die Triebkraft, der Vortrupp der Massen. Willst du, daß wir hinterherhinken, es uns leichtmachen, Auseinandersetzungen vermeiden?«
»Ich will«, erwiderte Witte, »daß wir differenzieren zwischen denen, die ihre Norm erhöhen können, und denen, die es nicht können, weil die Voraussetzungen dafür nicht vorhanden sind. Ich will, daß wir nicht anordnen, sondern überzeugen. Ich will, daß wir zumindest die einflußreichsten Arbeiter im Betrieb für die Sache gewinnen, statt alle gegen uns aufzubringen.«
»Du hältst die Weisungen von Partei und Regierung also für falsch?«
»Ein Hennecke, der unter ganz speziellen Bedingungen das Drei- oder Vierfache seiner Norm erfüllt, macht noch keinen Frühling. Vielleicht überschätzen wir den Bewußtseinsstand der Arbeiter.«
»Ich habe dir eine konkrete Frage gestellt, Genosse Witte. Wie stehst du dazu, und wo stehst du?«
Die Worte hingen in der stickigen Luft.
Witte sagte: »Wenn du dich erinnern möchtest – vor wenigen Tagen erst haben Partei und Regierung eine ganze Anzahl von Maßnahmen für überspitzt erklärt und zurückgenommen und einen neuen Kurs verkündet.«
»Und jetzt willst du auf der ganzen Linie zum Rückzug blasen, ja?« Banggartz lehnte sich herausfordernd über den Schreibtisch. »Von einer Rücknahme der Normerhöhungen war nirgendwo die Rede.«
»Rückzug … Ich sage euch, diese Normerhöhung läßt sich nicht auf dem Verwaltungsweg machen. Das führt zum Rückzug, wenn nicht sogar zu einer Niederlage.«
»Zur Niederlage führen deine ewigen Zweifel. Zur Niederlage führt, wenn einer zurückweicht, wo die Partei Härte von ihm verlangt.«
Witte stand auf. Durch das offene Fenster hindurch sah er die schmutzgraue Mauer der gegenüberliegenden Werkhalle, von der der Putz abbröckelte. Unten auf der Werkstraße lachten Arbeiterinnen. Sein ganzes Leben lang hatte die Partei Härte von ihm verlangt. Und er war hart gewesen, sich, seiner Frau, allen gegenüber. Er war auch jetzt hart: wie leicht wäre es, sich mit einem kleinen Kompromiß seine Ruhe zu verschaffen.
»Du bist doch selber in die Werkhallen gegangen« – Dr. Rottluff mühte sich wirklich – »zu den Arbeitern und hast ihre Selbstverpflichtungen zurückgebracht, sehr schöne darunter, mit mehr noch als zehn Prozent Normerhöhung!«
»Ich habe auf die Leute eingeredet wie auf störrische Esel«, sagte Witte vom Fenster her, »bis sie unterschrieben haben, schon um mich loszuwerden. Dabei ist mir klar geworden, daß es so nicht geht. Ich habe darüber in der Parteileitung gesprochen. Und dann habe ich meinen Bericht geschrieben.«
Banggartz erregte sich. »Dein Bericht gibt ein völlig falsches Bild, von unserer Parteiarbeit, von den Kollegen im Betrieb, im Grunde von unserer Arbeiterklasse überhaupt. Und wer ihn liest, der merkt, was du eigentlich willst: die Mängel deiner politischen Arbeit verdecken.«
»Mein Bericht schildert die Lage, wie sie ist, weiter nichts.«
»Wem nützt du denn, Genosse Witte? Ein Mann mit deiner Bildung und deiner Parteierfahrung! Du hast dir doch schon genug Schwierigkeiten gemacht in der Vergangenheit.«
»Du kennst meine Kaderakte besser als ich.«
Banggartz verzog keine Miene.
»Dann wirst du auch wissen, Genosse Banggartz, daß ich nicht in der Partei bin, um Karriere zu machen.«
Dr. Rottluff musterte einen Riß im Fußbodenbelag.
»Ich frage dich«, sagte Banggartz heiser, »wirst du die Normerhöhung unsern Arbeitern gegenüber vertreten oder nicht?«
Witte spürte den plötzlichen Schmerz in der Hüfte, der sich einstellte, wenn etwas an seinen Nerven zerrte: die Frage hatte ihn schon beschäftigt, bevor er dem Genossen Dreesen seinen Bericht übergab.
»Nun?«
Witte ging langsam zu Banggartz’ Schreibtisch zurück. »Die Normen müssen erhöht werden, Genosse Banggartz. Normen sind erhöht worden, seit der erste Neuerer unter den Höhlenmenschen einen Stein an ein Stockende band und sich das erste Werkzeug schuf.«
»Dein Höhlenmensch kann mir gestohlen bleiben!« Banggartz zügelte sich. »Mir genügt, was das Politbüro beschließt. Aber ich bin dir dankbar, daß du uns endlich zustimmst und –«
»Nur können die Normen nicht zu dieser Zeit und nicht auf die jetzt vorgesehene Weise erhöht werden.«
Banggartz’ Stirnader trat hervor. »Eigentlich hatte ich vor, dich zu bitten, morgen auf dem Betriebsausflug die Rede zu halten und dabei die Notwendigkeit der Normerhöhung zu betonen. Aber das wird wohl nun nicht möglich sein.«
»Kaum«, sagte Witte.
»Der Vorsitzende der Betriebsgewerkschaftsleitung, der sich gegen die Parteibeschlüsse stellt: vielleicht solltest du dir überlegen, Genosse Witte, ob du noch der Mann für deine Funktion bist.«
»In meiner Funktion kann ich verhindern helfen, daß die Fehler in der Normfrage zu schlimmen Folgen im Betrieb führen.«
»Ob du in deiner Funktion bleibst, entscheidest nicht du.«
»Das entscheidet die Partei«, bestätigte Witte. »Und die Gewerkschaft.«
Banggartz lächelte. »Machst du dir etwa Illusionen, wie diese Entscheidungen ausfallen werden?«
Witte blickte ihn an. »Die Partei besteht nicht nur aus Wilhelm Banggartz.«
»Muß denn das sein?« sagte Dr. Rottluff gequält. »Können wir uns nicht einigen?«
Witte erhob sich. »Darf ich dich bitten, Genosse Banggartz, mir meinen Bericht zurückzugeben?«
»Den muß ich behalten.« Banggartz legte die Blätter in sein Schubfach. »Den werden wir noch brauchen.«
Aus dem Beschluß des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 28. Mai 1953 über die Erhöhung der Arbeitsnormen
Der von der II. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei gefaßte und von der gesamten werktätigen Bevölkerung begrüßte Beschluß zur Schaffung der Grundlagen für den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik erfordert die Stärkung der sozialistischen Industrie … Ein großer Teil der Arbeiterschaft hat erkannt, daß die gegenwärtigen Normen größtenteils den Fortschritt hemmen. In vielen Betrieben sind deshalb die Arbeiter dazu übergegangen, ihre Normen freiwillig zu erhöhen … Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik kommt gleichzeitig dem Wunsche der Arbeiter, die Normen generell zu überprüfen und zu erhöhen, nach … Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hält dazu für erforderlich, daß die Minister, Staatssekretäre sowie Werkleiter alle erforderlichen Maßnahmen zur Überprüfung der Arbeitsnormen durchführen. Das Ziel dieser Maßnahmen ist, die Arbeitsnormen mit den Erfordernissen der Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Senkung der Selbstkosten in Übereinstimmung zu bringen und zunächst eine Erhöhung der für die Produktion entscheidenden Arbeitsnormen um mindestens 10% bis zum 30. Juni 1953 sicherzustellen … Die zuständigen Ministerien und Staatssekretariate haben für jeden Betrieb Kennziffern für die Erhöhung der Arbeitsnormen festzulegen … Die neuen erhöhten Arbeitsnormen sind entsprechend den Ergebnissen der Überprüfung der Arbeitsnormen so festzusetzen, daß in jedem Betrieb die festgelegten Kennziffern mindestens erreicht werden … Alle erhöhten Arbeitsnormen sind durch den Werkdirektor unterschriftlich zu bestätigen, vor ihrer Einführung bekanntzugeben und für alle Arbeiter verbindlich zu erklären …
Aus dem Kommuniqué des Politbüros des Zentralkomiteesder SED vom 9. Juni 1953
Das Politbüro des Zentralkomitees der SED hat in seiner Sitzung vom 9. Juni 1953 beschlossen, der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die Durchführung einer Reihe von Maßnahmen zu empfehlen … Das Politbüro des ZK der SED ging davon aus, daß seitens der SED und der Regierung der DDR in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlern begangen wurden, die ihren Ausdruck in Verordnungen und Anordnungen gefunden haben, wie z. B. der Verordnung über die Neuregelung der Lebensmittelkartenversorgung, über die Übernahme devastierter landwirtschaftlicher Betriebe, in außerordentlichen Maßnahmen der Erfassung, in verschärften Methoden der Steuererhebung usw. Die Interessen solcher Bevölkerungsteile wie der Einzelbauern, der Einzelhändler, der Handwerker, der Intelligenz wurden vernachlässigt …
Aus dem Kommuniqué über die Sitzung des Ministerrats der DDR vom 11. Juni 1953
Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 11. Juni 1953 eine Anzahl von Maßnahmen beschlossen, durch welche die auf den verschiedensten Gebieten begangenen Fehler der Regierung und der staatlichen Verwaltungsorgane korrigiert werden …
Ereignisse
1Sonnabend, 13. Juni 1953
19.00 Uhr
lag Witte auf seinem Bett, halbnackt, das Kissen zerknüllt von seinen ruhelosen Kopfbewegungen. Der Wind, der gegen Abend aufgekommen war, hatte keine Abkühlung gebracht. Der Wind trug den Staub von den Ruinen an der Straße durch das offene Fenster herein, dazu die Straßengeräusche – ein Wochenendsäufer, der aus einer Kneipe grölte, ein paar Weiber, die von Balkon zu Balkon schnatterten.
Möglich, daß er ein Verfahren bekam. Aus Banggartz’ Andeutungen sprach schon die Anklage: Mißachtung von Parteibeschlüssen, Verstoß gegen die Parteidisziplin, Mangel an Vertrauen zur Parteiführung. Und dann würde alles wieder aufgebrüht werden – der leidige Fall Kasischke, der zu einem Fall Witte hochgespielt worden war; seine Bekanntschaft mit Genossen, die aus schwer ersichtlichen Gründen in Verruf geraten waren; bis zurück in die Zeit noch vor Hitler, ins Jahr 1932, wo er sich, seine Jugendsünde, geweigert hatte, Seite an Seite mit den Faschisten Streikposten zu beziehen gegen die sozialdemokratischen Verkehrsarbeiter. Nein, das würden sie wohl doch übergehen; der Verkehrsstreik war inzwischen stillschweigend als Fehler anerkannt worden.
Er entschloß sich aufzustehen. Ein sehr müdes Gesicht, Schatten unter den Augen, starrte ihm aus dem Spiegel entgegen. Die Stunden, die er wach gelegen, hatten einen stumpfen Schmerz im Kopf hinterlassen; er preßte die Fingerspitzen gegen den Schädel; dann strich er sich durch das Haar, das an den Schläfen schon grau wurde. Einundvierzig erst, dachte er; aber da waren Jahre gewesen, die für zehn zählten.
Er rasierte sich, obwohl er keine Pläne für den Abend hatte. Die Wand zum Nebenzimmer war dünn; dort wurde ein Kommodenfach aufgezogen und wieder zugeschoben. Er hörte die Schritte der jungen Frau. Anna hieß sie und war die Schwiegertochter der Frau Hofer, bei der er zur Untermiete wohnte. Manchmal, heute zum Beispiel, war es ihm tröstlich, daß ein anderes menschliches Wesen in der Nähe existierte – hustete oder gähnte oder einen Pantoffel zu Boden fallen ließ.
Natürlich konnte er sich aufmachen und zu Greta gehen. Greta würde überrascht sein, sehr zurückhaltend, würde ihn aber auffordern einzutreten, in die Wohnung, wo es nach Essen roch und nach frischer Wäsche. Die Kinder würden sich freuen, besonders die Kleine, Claudia, die so nach Zärtlichkeit hungerte; der Junge zeigte seine Gefühle weniger, aber auch der hing schon, mehr als gut war, an ihm; arme Kerlchen, beide, der Vater vermißt irgendwo bei Witebsk und die Mutter auf Arbeit bei VEB Merkur. Man würde vom Betrieb sprechen, von den Dingen des täglichen Lebens, vielleicht auch von der Partei, und das Persönliche sorgfältig vermeiden. Greta hatte nie Ansprüche gestellt, nie von einer gemeinsamen Zukunft gesprochen; dennoch wuchs ihm die Sache über den Kopf; plötzlich war da eine Verantwortung: eine gute Frau und Genossin, warmherzig und verständnisvoll, sie verdiente einen guten Mann.
Witte wusch sich die Reste des Rasierschaums vom Gesicht. Einmal, die Aussprache hatte schon stattgefunden, sagte sie ihm: Teil doch wenigstens deine Sorgen mit mir. Aber wie viele Erklärungen würden nötig sein, ihr begreiflich zu machen, was da zwischen ihm und Banggartz stand. Und warum in Gretas so kürzlich erst ausgerichtete politische Welt neue Unsicherheit bringen? Außerdem würde er sie ja auf dem Betriebsausflug morgen sehen; sehen müssen.
Der Alkohol prickelte auf der Gesichtshaut. Die Hosen müßten mal gebügelt werden, dachte er. Auf dem Weg zur Küche, sich seinen Tee zu brühen, wäre er fast mit der jungen Frau zusammengestoßen. »Entschuldigen Sie«, sagte er. Er wußte nicht, sollte er an ihr vorbeigehen oder noch ein paar Worte mit ihr sprechen – da lebt man Wand an Wand mit Menschen und redet kaum je mit ihnen, vielleicht war es nicht richtig.
Sie lachte: ein angenehmes Lachen. »Die Birne im Korridor ist kaputt«, sagte sie, »meine Schwiegermutter spart überall.« Was ihm in Erinnerung rief, daß sie verheiratet war; allerdings hatte er den Mann noch nie zu Gesicht bekommen.
Seine Augen hatten sich dem Halbdunkel angepaßt. Er konnte erkennen, daß sie die Teedose in seiner Hand und den Teller mit Butter und Brot und Wurst betrachtete.
»Mein Abendbrot«, erläuterte er.
Sie öffnete ihm die Küchentür. Er ging zum Herd und setzte Wasser auf. Sie blieb in der Tür stehen, unschlüssig.
»Haben Sie schon gegessen?« fragte er.
Sie nickte.
»Kann ich Sie zu einer Tasse Tee einladen?«
Sie trat in die Küche. »Soll ich Ihnen nicht helfen?«
»Großer Gott, nein, danke schön.« Er sah die Härchen, die sich an ihrem Nackenansatz kräuselten. »Ich habe sieben Jahre allein gelebt und habe gelernt, wie man Wasser kocht.«
Er holte Geschirr aus dem Küchenschrank, deckte den Tisch für sie beide, sprach vom Wetter, von einem Konzert, das er besucht hatte, leider habe er zu wenig Zeit für derlei Dinge, liebte sie auch Musik, ja, welche, moderne, klassische, und Theater? – was man so redet, bis der Tee gezogen hat.
Dann goß er ein. »Stark genug?«
Sie kostete, nickte.
Vom Wohnzimmer her die nörgelnde Stimme der Witwe Hofer: »Anna – was treibst du da in der Küche?«
Ihr Lächeln erstarb. »Ich trinke Tee.«
Die Witwe kam hereingeschlurft, verquollenes Gesicht, papierne Lockenwickler.
»Guten Abend, Frau Hofer«, grüßte Witte.
»Guten Abend«, erwiderte die Witwe. Und zu der jungen Frau: »Ich dachte, du wolltest spazierengehen!«
»Ich habe mir erlaubt, Ihre Schwiegertochter zum Tee zu bitten«, erklärte Witte.
Die Witwe warf ihm einen scheelen Blick zu. »Sie kriegt bei mir genug zu essen.«
»Ich arbeite, und ich zahle für mein Essen!« Anna war aufgesprungen.
»Das nennst du Arbeit, was du da in deinem HO-Laden machst?« Die Witwe wandte sich an Witte. »Die arbeiten ja heute nicht mehr. Früher, da war das anders.« Und wieder zu Anna: »Aber wenn der Heinz zurückkommt, wird er dir schon die Meinung sagen, und nicht nur zu dem Punkt!«
Sie preßte die Lippen zusammen, ein Schlußstrich, und zog sich zurück, wobei sie etwas über Untermieter murmelte, die einem aufgezwungen wurden; dann warf sie die Tür hinter sich zu.
»Entschuldigen Sie«, sagte Anna. »Eine alte, unzufriedene Frau.«
»Setzen Sie sich doch wieder.« Witte bot ihr Brot an und Butter. »Wir wollen uns nicht den Appetit verderben lassen.«
Sie trank nur Tee.
»Wo ist Ihr Mann eigentlich?« fragte er, seine Scheibe Brot bestreichend.
Sie zögerte. »Ich weiß es nicht.«
»Drüben?«
»Ich weiß es wirklich nicht.«
»Weiß sie?«
»Ich vermute. Aber sie sagt es mir nicht.«
»Jedenfalls vertritt sie seine Interessen.«
»Ich glaube, ich muß jetzt gehen.«
»Ich war wohl sehr ungeschickt.« Er blickte sie an. »Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als mischte ich mich in Ihre Angelegenheiten.«
Sie hatte eine Stirn, die zu hoch war für den Rest ihres Gesichts, und viel zu große dunkelbraune Augen, und weiche volle Lippen, und ein kleines Kinn, wohlgerundet. Sonderbare Proportionen, dachte er, ein Gesicht, das einen nur schwer wieder losließ.
»Schönen Dank für den Tee«, sagte sie.
»Sie haben ja nicht mal ausgetrunken.«
»Vielleicht sollte ich Ihnen doch helfen.« Sie wartete keine Antwort ab, sondern stellte Teller und Tassen aufeinander und trug sie zum Abwaschbecken.
Schließlich wuschen sie beide das Geschirr, trockneten es, stellten es in den Schrank. Von dem dumpfen Druck in seinem Kopf war nichts geblieben, nur war ihm die Zunge auf einmal wie ausgetrocknet, und er befürchtete, seine Stimme könnte heiser klingen.
»Und was jetzt«, sagte er, tatsächlich heiser, »nachdem wir uns gemeinsam häuslich betätigt haben?«
Sie hängte das Geschirrtuch an den Haken.
»Wollen wir auch gemeinsam spazierengehen?«
»Eine Weile wird es wohl noch hell sein«, sagte sie.
An der Wohnungstür trafen sie sich und gingen nebeneinander die Treppen hinunter. Er bemühte sich, sie nicht merken zu lassen, daß ihm sein Bein wieder zu schaffen machte. Er haßte es, mit Rücksicht behandelt zu werden, konnte aber nicht verhindern, daß sie ihren Schritt verlangsamte.
»Das Geländer müßte auch endlich in Ordnung gebracht werden«, bemerkte er. »Das ganze Haus verfällt und verfault.«
»Der Krieg …«, sagte sie gleichmütig.
»Man kann nicht alles auf den Krieg schieben«, widersprach er. »Sehr vieles liegt an uns selber!« Und dachte: was predige ich schon wieder.
Dann war ein Hof zu überqueren, vorbei an den Teppichstangen und den Aschkästen, aus denen es roch. Ein Torweg führte unter den Resten des Vorderhauses hindurch; auf den Trümmern wuchsen Sträucher und sogar eine junge Birke.
Ihre Hand legte sich leicht auf seinen Ellbogen. »Ihr Bein«, sagte sie. »Sie waren verwundet?«
Er sah den Karren vor sich, mit Steinen beladen, der sich den ausgemergelten Händen entriß und auf ihn zugerollt kam, im Lager Mauthausen. »Nein«, sagte er, »gebrochen. Der Knochen ist schlecht verheilt, sagen die Ärzte.«
Nach einer Weile fragte sie: »Warum leben Sie so allein?«
»Meine Frau ist gestorben«, sagte er, schroffer als beabsichtigt. Greta erwähnte er nicht.
»Waren Sie lange verheiratet?«
»Wenn Sie meinen: habe ich lange mit ihr gelebt? – nein. Das hat der Hitler verhindert. Und dann, als wir wieder zusammen waren und als das Leben endlich besser zu werden versprach, da ist sie gestorben.«
Anna schwieg. Er betrachtete sie von der Seite her. Ihre Brüste hoben sich unter der Bluse ab.
»Ich möchte lieber von Ihnen hören«, sagte er.
»Was ich da zu berichten hätte, würde Ihnen kaum gefallen.«
»Weshalb?«
»Ich vermute, Sie beurteilen die Menschen – eben anders …«
»Ach so …« Er verstand. »Das ist nun leider eine der Freuden unseres Lebens. Zuerst dachte ich, ich würde es nicht aushalten, immer wieder mit Menschen zu tun zu haben, die mich gestern mit Handkuß umgebracht hätten und mich morgen mit ebensolchem Vergnügen umbringen würden, wenn sie nur könnten. Aber man gewöhnt sich.«
»Ich – ich gehöre nicht zu der Sorte.«
»Sie dürfen mir Ihre Hand ruhig wieder auf den Arm legen«, sagte er. »Es ist mir nicht unangenehm.«
Sie lachte verlegen. »Aber daran geglaubt habe ich auch«, gestand sie dann. »Es gab ja nichts anderes. Wie sollten wir’s denn besser gewußt haben?«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.«
»Nein?« Sie überlegte. »Ich befürchte, Menschen wie Sie sind eine einzige Anklage.«
Er verzog das Gesicht. »Wahrscheinlich wäre es für den inneren Komfort einer ganzen Anzahl von Zeitgenossen besser, Leute wie ich wären sämtlich umgekommen. Wir sind zu dauerhaft. Und wir sind unbequem, weil wir das Denken der Menschen zu verändern suchen.«
»Ich habe so einen gekannt«, sagte sie lebhaft. »Er hatte eine Auffassung von den Dingen und eine Art zu sprechen, daß man unter seinen Einfluß geriet, selbst wenn man dagegen war.«
»Wann ist das gewesen?«
»Kurz nach Kriegsende.«
»Erzählen Sie.«
Witte war ein guter Zuhörer; die Menschen, ihre Gefühle, ihre Reaktionen interessierten ihn.
Sie kam aus einer kleinen Stadt in Thüringen, die Tochter kleiner Leute. Man stellte dort Spielzeug her. Die Stadt lag hoch im Gebirge, von Wäldern umarmt; es gab dort nur diese eine Industrie; die Einwohner arbeiteten in einem halben Dutzend Klitschen oder daheim, und die Kinder halfen mit, sobald sie ihre Finger richtig zu bewegen gelernt hatten. Diesen kleinen Leuten wurde erzählt, sie wären vom Schicksal erwählt, die Welt zu beherrschen. Viele von ihnen glaubten es auch – der Gedanke, daß sie etwas Besseres sein sollten, als sie waren, machte ihnen den kleinlichen Alltag erträglicher. Und dann kam die Niederlage.
»Wie alt waren Sie damals?« wollte er wissen.
»Siebzehn«, sagte sie, »aber man kann mit siebzehn schon recht erwachsen sein.«
In dieser kleinen Stadt nun hatte sich ein Wehrmachtslazarett befunden, für Rekonvaleszenten. Die Amerikaner, die als erste die Gegend besetzten, kümmerten sich nicht darum; als aber die Russen das Gebiet übernahmen, übernahmen sie auch das Lazarett und befahlen den Einwohnern, die verwundeten deutschen Soldaten in ihre Häuser aufzunehmen, bis zur Genesung. Im Haus ihrer Eltern wurde ein schon älterer Mann einquartiert, sehr abgemagert, sehr blaß, aber von fiebernder Lebhaftigkeit. Ich sollte längst hinüber sein, erklärte er allen, die es hören wollten, aber Kommunisten sterben nicht so schnell und so leicht.
Anna hielt inne: Witte hatte vorhin Ähnliches gesagt. Dabei glich er dem Soldaten überhaupt nicht; dieser war klein gewesen, mit breiten Backenknochen und niedriger Stirn; nur in der Sprechweise beider Männer lag etwas Verwandtes.
Was ich durchgemacht habe, hätte den meisten gelangt, pflegte der Soldat zu sagen, ließ sich aber im einzelnen nicht darüber aus. Von seinen Ansichten dagegen sprach er häufig und offen. Es war klar, daß er sterben würde, er hustete viel, spuckte Blut und verfiel sichtlich. Aber solange Leben in ihm war, nahm er Anteil an seiner Umwelt und stellte den Leuten Fragen über ihre Arbeit und wie sie sich die Zukunft vorstellten.
»Als ich erfuhr, daß ein Kommunist in meinem Bett schlief, heulte ich vor Wut«, sagte sie.
Sie vermied es, fuhr sie fort, mehr als das Nötigste mit dem Mann zu sprechen. Eines Tages jedoch erlitt er direkt vor dem Haus einen seiner Hustenanfälle. Sie half ihm die Treppe hinauf. Als sie die Tür öffnete zu ihrem Mansardenzimmerchen, das jetzt ihm gehörte, sah sie, daß er nichts darin verändert hatte; nur gewisse Bilder hingen nicht mehr an der Wand, und auf der Kommode lagen Bücher.
»Was für Bücher?« wollte Witte wissen.
»Er hat mir ein paar davon geborgt, später. Die Titel weiß ich nicht mehr. Ich habe auch nur die Hälfte verstanden, was da gedruckt war.«
»Und was hat er Ihnen gesagt?«
Er wisse, daß es nicht leicht wäre für sie; und hatte hinzugefügt, noch schwerer würde es allerdings sein, hätten die Deutschen den Krieg gewonnen. Das wollte ihr nicht einleuchten, und sie hätte gerne mehr erfahren; aber er war erschöpft von dem Anfall. Er sprach noch mehrmals mit ihr, obwohl sie sich ihm zu verschließen suchte. Er stellte Fragen, durch die er Antworten erzwang, auf die er seine nächsten Fragen gründete. Er trieb sie in die Enge mit seiner Logik und mit Tatsachen, die er ihrem eignen Leben und dem Leben der Menschen in der Stadt entnahm. Es schien ihn zu reizen, die großen Worte zu zerstören, die man ihr beigebracht hatte und die ihr Schutz waren gegen die überall so spürbare Niederlage.
»Am Ende«, schloß sie ein wenig pathetisch, »ließ er mir nichts, an das ich mich halten konnte.«
Witte lächelte. »Aber Sie leben doch ganz fröhlich.«
»Fröhlich?«
Sie waren in einen kleinen Park gelangt, ein Stückchen grüner Rasen, einem Ruinenfeld entrissen, und setzten sich auf eine Bank. Witte schloß die Augen, obwohl die im Dunst untergehende Sonne ihn nicht mehr blendete. Durch die Worte dieser jungen Frau, deren Nähe er spürte, hatte er wieder das Gefühl, daß er Teil einer durch Zeit und Raum reichenden menschlichen Kette war, wie auch der Kranke, der in das kleine Haus in der kleinen Stadt gekommen war und bis zuletzt versucht hatte, die Welt zu verändern.
»Am nächsten Morgen war er tot«, berichtete sie. »Es war Winter, Eisblumen standen am Fenster, alles glitzerte. Er lag ausgestreckt auf seinem Bett, die Hände auf der Brust gefaltet, so als ob schon jemand dagewesen wäre, um ihn herzurichten.«
2Sonntag, 14. Juni 1953
12.00 Uhr
sagte Dronke: »Na komm schon, Greta!«
Sie war nicht in Stimmung. Die bunten Kleider um sie herum, die Sonntagsausgehanzüge der Männer, die laute Musik, das Lachen vertieften nur das Gefühl, daß sie allein war.
»Walzer!« sagte Dronke. »Spiel nicht das Mauerblümchen.«
Sie blickte sich um nach Witte. Der saß an einem Tisch in der Nähe des Wassers, den Kragen offen, trank Bier mit ein paar Kollegen und deren Frauen und schien gelöst und heiter.
»Also gut«, sagte sie und ließ sich von Dronke in den Strudel hineinziehen. Dronkes rundes gutmütiges Gesicht, das anderthalb Kopf über ihr schwebte, legte sich in angestrengte Falten, die breiten Schultern ruckten auf und ab, dazu stampfte er mit dem Fuß.
»Trauerst ihm immer noch nach?« fragte er.
Sie wurde sofort reserviert. »Wir sind gute Freunde.«
»Du brauchst einen Vater für deine Kinder.« Dronke stampfte stärker, schwenkte sie herum, daß sie gegen Karlchen Mielich und seine Paula prallte. »Bist doch eine fesche Frau, Greta, mit allem dran an dir, was ein Mann sich nur wünschen kann.«
Das hatte sie auch geglaubt. Und hatte sich noch dazu bemüht, Witte geistig etwas zu bedeuten, hatte Kurse besucht, Bücher gelesen, sich eingeprägt, was er zu den komplizierten Fragen der Weltpolitik und der gesellschaftlichen Entwicklung zu sagen hatte. Bis sie eines Tages das Bild seiner verstorbenen Frau fand, das er in seiner Brieftasche trug, und erschrak: so also mußte man sein, um seinem Wesen zu entsprechen. Ruth war eine zierliche Frau gewesen, mit klugen, etwas traurigen Augen – Lehrerin von Beruf, hatte er auf Fragen hin berichtet, aber die Nazis verboten ihr das, erstens, weil sie Halbjüdin war, und zweitens wegen ihrer Politik.
»Roeder zum Beispiel«, sagte Dronke. »Der liebt dich.«
Laß uns Freunde bleiben, Greta, hatte er gesagt. Ich achte dich sehr, Greta, du bist ein guter Mensch, aber das ist nicht genug, fürs Leben. Da können wir beide nichts dafür, wir haben’s schließlich versucht. Und besser jetzt Schluß als in ein paar Monaten, schon wegen der Kinder … Die Musik dröhnte im Ohr, aber sie hörte den Ton noch immer, in dem er gesprochen hatte, ruhig, freundschaftlich, bedauernd.
»Die rechte Seite vom Gesicht«, sagte Dronke, »nun gut, das ist der Krieg. Aber von links! Ich wünschte, ich sähe halb so gut aus wie Roeder von links.«
Das Orchester endete mit einem letzten Aufquietschen der Trompete. Dronke stand schwer atmend still. Greta lachte: »Warum willst du mich verkuppeln? Was ich brauch, verschaff ich mir schon.«
Sie fühlte sich aber nicht so selbstsicher, als sie zwischen den Biertrinkern und Wurstessern an ihren Tischen hinabging zum Seeufer. Vertäut an der Landebrücke lagen die beiden weißen Dampfer, die Titania und die Urania, und dahinter die glitzernde Fläche, über die sie gekommen waren: Arbeiter an einem friedlichen Sommersonntag.
Sie gab sich einen Ruck und wandte sich dem Tisch zu, an dem Witte saß. Der rückte zur Seite, lud sie zum Sitzen ein, schob ihr ein Glas Bier zu. Jemand verteilte Papiermützen; Greta erhielt einen Admiralshut, der ihr aufs Ohr rutschte.
»Stimmt etwas nicht?« fragte sie ihn. »Ich höre, Banggartz soll heute sprechen. Warum nicht du?«
»Arbeitsteilung«, sagte Witte. »Ich gebe die Bons aus fürs Essen, und er hält die Rede.«
Der alte Schreyer von der Reparaturwerkstatt wieherte; Roeder verzog die linke Gesichtshälfte. Plötzlich stellte sich auch Kallmann ein, bieder, rosig von der Sonne, und prostete, daß alle es hörten: »Unser Witte, das ist doch ein Mann, ein richtiger!«
Witte stellte sein Glas hin. »Woher die plötzliche Erkenntnis?«
»Nur so«, sagte Kallmann, »nur so …« Und entfernte sich wieder.
Dr. Rottluff trat an den Tisch, schüttelte Witte betont kollegial die Hand, begrüßte alle, stellte seine Frau vor. Zwei Stühle wurden gebracht. Man parlierte, über das Wetter, über die Fahrt, und daß man doch sehr gedrängt gesessen hätte, aber besser eng und gemütlich. Frau Rottluff trug ein geblümtes Kleid und weiße Sommerhandschuhe.
Ein Tusch.
»Kollegen und Kolleginnen!« Das war Leonhard Lehnert, Vorsitzender der Abteilungsgewerkschaftsleitung von Halle sieben.
Pappkartons wurden herbeigeschleppt. Wieder setzte die Trompete zum Tusch an.
Lehnert nahm die Papiermütze vom Kopf und strich sich über das silbergraue Haar. »Kollegen und Kolleginnen! Ich begrüße euch im Namen der Betriebsleitung von VEB Merkur und der Partei- und Gewerkschaftsorganisation zu unserm alljährlichen Sommerfest mit Dampferausflug …«
Witte schien die Blicke, die sich auf ihn richteten, nicht zu bemerken.
»… und wünsche euch allen viel Vergnügen bei Speis und Trank und Tanz und Gesang.«
Greta suchte Wittes Hand und drückte sie impulsiv.
»Und jetzt«, verkündete Lehnert, »bevor wir uns dem Unterhaltungsteil zuwenden, ein paar Überraschungen!«
Die Kartons wurden geöffnet; zum Vorschein kamen aufblasbare Ballons, Papptrompeten, hölzerne Klappern, ein ganzes Sortiment von Scherzartikeln. Witte sah schwarz, was Banggartz’ Rede betraf. Banggartz kam vom Buffet her, im dunklen Anzug, einen Zettel in der Hand, offensichtlich sein Konzept. Die Verteilung dauerte. Lehnert trat zu Banggartz; sie verhandelten flüsternd; schließlich zuckte Banggartz die Achseln und sah sich nach einem Platz um, wo er sich hinsetzen könnte. Sein Blick fiel auf Dr. Rottluff; doch dann bemerkte er Witte, wandte sich ab und nahm Zuflucht bei der Jugend, die, im Blauhemd, soeben heranzog, um unter Panowskys Leitung das Sommerfest durch gesangliche Darbietungen zu verschönern. Zusammen mit den jungen Leuten kehrte Banggartz zurück zur Tanzfläche, trug selbst ein paar Stühle beiseite, sah beifällig zu, wie die Sänger je nach Stimmhöhe Aufstellung nahmen, und ermutigte Panowsky durch einen Schlag auf die Schulter.
Witte war jede Art von organisiertem Singen zuwider; auch kannte er die Lieder aus einer Zeit, wo sie einen anderen Symbolwert hatten und anders wirkten. Dr. Rottluff applaudierte laut; seine Frau entnahm ihrer Handtasche ein Tüchlein und betupfte sich damit die Oberlippe.
»Also ich«, sagte der große Klaus, »liebe Gesang. Aber ich liebe Gesang, der dem Menschen ans Herz greift.«
»Gesang«, kam das Echo von seinem Namensvetter, dem kleinen Klaus, »ist eine Sache, Politik eine andere. Jedes an seinem Platz.«
»Es gibt kein unpolitisches Lied«, sagte Witte.
Frau Rottluff lächelte fein. »Eine Mutter, die ihr Kind in den Schlaf singt – was ist daran politisch?«
»Die Bombe, die auf Mutter und Kind fällt«, sagte Greta. »Oder auf ihren Mann.«
»Ja so –«, sagte Frau Rottluff, »natürlich.«
Vom Nachbartisch her rief Karlchen Mielich: »Ich weiß ein Lied, da ist garantiert nichts Politisches dran« – und intonierte, Paula Priest um die Hüfte greifend:
»Bier her, Bier her!
Oder ich fall um …«
Zischen und Ruhe-Rufen halfen nicht lange. Witte litt für Panowsky, der sich da abmühte mit seinen Sängern; er selber hatte Panowsky dazu gewonnen, in der Jugendorganisation zu arbeiten. Panowsky war im zweiten Teil seines Programms von den alten Kampfliedern zu neuen übergegangen, gedichtet und komponiert von namhaften Künstlern der Republik. Allmählich ertrank der Chorgesang in Gesprächen und Gelächter.
Witte hoffte, Banggartz werde danach auf seine Rede verzichten. Banggartz war nicht zu sehen. Dr. Rottluff und seine Frau verabschiedeten sich: er wolle sich noch umtun; eine solche Gelegenheit, menschliche Kontakte zu pflegen, biete sich nur selten. Auch Witte empfand die innere Unruhe, die Dr. Rottluff forttrieb; dabei war er noch nie von so vielen so herzlich begrüßt worden wie heute, sogar von Leuten, an deren freundschaftlichen Gefühlen zu zweifeln er Gründe hatte. So ließ er denn Greta in der Gesellschaft Roeders und der andern am Tisch zurück und ging gleichfalls.
Dronke winkte ihm, lud ihn zu sich. Dronke war echt, alle zweihundert Pfund, davon das meiste Muskel und enorme Knochen. Dronke gegenüber saß Kallmann, griente freundlich und sagte lauter als notwendig zu seiner Frau: »Kuck mal, Dora, da ist der Kollege Witte, von dem ich dir erzählt hab, ja, wenn sie alle so wären wie der.« Witte wußte, Kallmann genoß Ansehen unter den Arbeitern, ein zuverlässiger Kollege, im Betrieb seit zwanzig Jahren, gute Zeiten und schlechte.
Witte setzte sich auf den freien Stuhl neben Frau Kallmann.
Dronke, mit großer Armbewegung, rief der Kellnerin zu: »Bier und einen Klaren, für die ganze Runde!«
»Sieh mal einer den Dronke« – eine Stimme vom Tischende her, beinahe krähend – »hast wohl überflüssiges Geld, auch bei den neuen Normen noch?«
Das war doch der Wiesener, dachte Witte, Maschinenschlosser, früher hatte er mal eine Werkstatt besessen, irgendwo im Polnischen.
»Wiesener«, sagte Dronke, »ich werde immer genug verdienen, um meinen Freunden eine Runde zu spendieren.«
»Das kommt, weil er in der Partei ist«, sagte einer, der hieß Csisek.
»Wieso?« wollte Witte wissen. »Wird er deshalb besser bezahlt?«
»Das nicht«, gab Csisek zu. »Aber es hilft eben doch.«
»Keine Politik!« mahnte Kallmann. »Heute ist Sonntag und außerdem Sommerfest.«
»Und was meinst du dazu, Kollege?«
Das war an den Mann schräg gegenüber gerichtet, der ihn amüsiert, aber auch abwägend beobachtet hatte. Gadebusch, Fred, erinnerte sich Witte; ein stiller Mensch, sorgfältig und korrekt, hieß es; Junggeselle.
»Ich?« sagte Gadebusch. »Was soll ich dazu meinen?«
Aber Csisek hatte nun das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. »Immer muß man sein Wort auf die Goldwaage legen«, klagte er. »Hab ich was dagegen, wenn einer in der Partei ist? Für mich ist der Mensch Mensch, wir haben alle nur ein Leben, warum sich’s unnötig schwermachen?«
»Na denn prost!« sagte Dronke, da die Getränke gekommen waren.
»Prost!« antwortete vom andern Tischende her der Dreher Bartel, schüttete sich seinen Korn in den Rachen und biß in seine Bockwurst, daß der Saft spritzte. Dann, mit dem Rest der Wurst gestikulierend, verkündete er: »Was man im Bauche hat, kann einem keiner wegnehmen.«
»Das ist die Wahrheit!« bestätigte der einäugige Pietrzuch, den Widerschein der Sonne in seinem Glasauge. »Mensch ist Mensch und Bauch ist Bauch, da kann niemand ran mit irgendwelchen Normerhöhungen.«
Wieder waren sie beim Thema, und wieder entglitt es Witte.
»Mensch ist Mensch!« rief der Dreher Bartel begeistert. »Und keiner ist mehr als der andere. Das sagt ja auch die Partei. Ich zum Beispiel bin Sportler gewesen, 1936 haben sie über mich in der Zeitung geschrieben, Olympiadematerial wäre ich; aber dann habe ich meinen Bruch gekriegt, und aus war’s.« Er kicherte vor sich hin. »Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen …«
Csisek erhob sich. »Was redest du da! Unser Kollege Witte, der kennt deine Weisheiten längst. Der weiß überhaupt Bescheid, und er macht sich Sorge um die Menschen, weil er nämlich ein Herz hat für was uns bedrückt. Stimmt doch, Kollege Witte, oder?«
Witte war unbehaglich zumute. Wieder die plötzlichen Freunde, und so demonstrativ! War etwas nach außen gedrungen von seiner Auseinandersetzung mit Banggartz?
Er wandte sich an seine Nachbarin, die, sichtlich verschüchtert, die ganze Zeit über geschwiegen hatte. »Das ist aber schön, Frau Kallmann, daß Ihr Mann Sie mitgebracht hat. Das machen nicht alle Männer!«
»Beinahe wäre ich ja auch nicht gekommen …« Hastig fügte sie hinzu: »Es ist wegen dem Jungen. Der ist so – so unselbständig.«
»Der Junge?« Frau Kallmann, Gesicht und Figur nach zu urteilen, mußte an die sechzig sein. »Wie alt ist denn der Junge?«
»Fünfunddreißig.«
Kallmann fuhr dazwischen. »Das sind unsre Sorgen, Dora. Damit belästige den Kollegen Witte mal nicht, der hat auch sein Päckchen zu tragen –«
Tusch.
Da haben wir Schränke voll Kaderakten, dachte Witte, und wie wenig wissen wir.
Tusch. Lehnert erteilte Banggartz das Wort. Banggartz ließ den Blick von Tisch zu Tisch schweifen, zog seine Notizen aus der Tasche, begann schließlich, obwohl noch geredet und gelacht wurde. Die Stimme trug, stellte Witte fest; Banggartz war einst Seemann gewesen und hatte gelernt, in den Wind zu rufen.
Banggartz sprach von den Schönheiten der Natur, in welche sie der Betriebsausflug geführt hatte, und kam von diesen auf die allgemeinen sozialen Errungenschaften, die das Ergebnis der dauernden Sorge um den Menschen seitens Partei und Regierung und ein wesentlicher Bestandteil sozialistischer Politik waren. Eine solche Politik wiederum war nur möglich dank der Freundschaft der großen Sowjetunion, mit deren Hilfe auch die Wiedervereinigung Deutschlands unter sozialistischem Vorzeichen zustande kommen würde; wie verfault das kapitalistische System war, sah man besonders in Amerika, wo die herrschende Klasse dabei war, zwei unschuldige Menschen, die Rosenbergs, auf den elektrischen Stuhl zu schicken. Bei uns dagegen war der neue Kurs verkündet worden, der auf wichtigen Gebieten große Erleichterungen bringen und ein noch schnelleres Ansteigen des Lebensstandards der Werktätigen zur Folge haben würde, wofür eine der Voraussetzungen allerdings die Erhöhung der Normen war, die jetzt in Kraft trat.
Stille, plötzlich.
Banggartz blickte auf von seinem Zettel. Das Schweigen, unterbrochen nur von dem leisen Klirren der Biergläser, die irgendwo gewaschen wurden, war schlimmer als die Lärmkulisse, gegen die er angekämpft hatte. Er suchte nach Worten.
Er wußte, sie standen auf seinem Zettel, sorgfältig ausgewählte, hundertfach als richtig erwiesene, stichhaltige Worte; er brauchte nur nachzulesen. Er sah Witte, winzig, wie durch ein umgekehrtes Fernrohr. Witte saß da und fischte etwas aus seinem Bierglas, eine Fliege wohl. Ein Gefühl des Zorns stieg auf in Banggartz und drückte ihm von innen her gegen den Schädel.
In diesem Augenblick segelte ein Ballon, prall aufgeblasen, durch die Luft, schwankte im Zickzack und hauchte, ein obszönes Geräusch produzierend, sein Leben aus.
Kichern und Prusten. »Karlchen«, kreischte Paula Priest, »hach, Karlchen, hör bloß auf.«
Ein zweiter Ballon schwirrte hoch, dann mehrere. Banggartz’ Stimme war plötzlich schrill: »Ich muß doch sehr bitten, Genossen und Kollegen, ja?«
O Gott, dachte Witte – warum fängt er das nicht mit einem Witz auf, warum kann er nicht lachen, jetzt hat er alle gegen sich.
Langsam, widerwillig, ließ das Gelächter nach. Banggartz spürte den Zettel zwischen seinen Fingern, aber der bot auch keine Garantie mehr. »Ich wollte sowieso Schluß machen«, sagte er heiser.
Beifall schlug ihm entgegen.
Er lächelte verwirrt. Zu spät merkte er, daß das Klatschen nicht ihm galt, sondern Mosigkeit. Willy Mosigkeit, der Komiker des Betriebs, Mittelpunkt und Seele aller Kulturprogramme, kam trotz seines Fetts mit geradezu elegant wirkender Beweglichkeit angehüpft, das Handwerkszeug seiner Zauberkunst überm Arm. Bevor Banggartz zurücktreten konnte, hatte Mosigkeit ihm ein schwarzweißes Kaninchen unter der Jacke hervorgeholt.
Bravorufe.
»Willst mich wohl lächerlich machen!« fauchte Banggartz.
Mosigkeit hielt das zappelnde Tier in die Höhe. »Sei mir lieber dankbar«, sagte er zu Banggartz, »daß ich dir aus der Patsche geholfen hab.«
Aus einer Erklärung von Jakob Kaiser, Bundesminister für Innerdeutsche Fragen, vom 24. März 1952
Es liegt durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß der Tag X rascher kommt, als Skeptiker zu hoffen wagen. Es ist unsere Aufgabe, für die Probleme bestmöglich vorbereitet zu sein. Der Generalstabsplan ist so gut wie fertig …
3Sonntag, 14. Juni 1953
16.00 Uhr
kehrte Heinz Hofer, Ehegatte der Anna Hofer, nach Ost-Berlin zurück und betrat die Wohnung seiner Mutter, der Witwe Hofer. Anna war zu der Zeit abwesend. Die Begrüßung von Mutter und Sohn war tränenreich von ihrer, äußerlich herzlich von seiner Seite. Im Wohnzimmer dann servierte die Witwe französischen Kognak, den er mitgebracht, und Zigarren, die sie für eine solche Gelegenheit aufgehoben hatte, sowie Schokoladenplätzchen. Hofer versicherte ihr, es sei ihm, wie sie selbst sehen könne, im Westen nicht schlecht ergangen; er habe drüben vom ersten Tag an gut verdient; man wisse dort tüchtige Leute zu schätzen; auch reise er viel. Weshalb er viel reise und durch welche Arbeit er sein Geld verdiene, erklärte er nicht; auch befragte die Mutter ihn dieserhalb nicht, sondern erging sich in Klagen; über Anna; über den Untermieter, einen Kommunisten, mit dem Anna übrigens gestern ausgegangen wäre; über die Behörden, die einen des Rechts auf die eigene Wohnung beraubten und dem Menschen, wenn sie nur könnten, die Bissen im Mund nachzählen würden. Dann sprach sie von ihren Befürchtungen mit Bezug auf die Rückkehr ihres Sohnes; die Behörden erführen so manches; hätten sie nicht auch in Erfahrung gebracht, daß Annas seliger Onkel nach der Kristallnacht seinerzeit die Thüringer Puppenfabrik, in welche Heinz Hofer eingeheiratet, einem Juden abgenommen hatte, was dann unter dem SED-Regime zur Verstaatlichung der Fabrik und allerhand Unannehmlichkeiten führte. Man sei damals verraten worden an die Behörde, erwiderte Sohn Hofer; was aber gäbe es diesmal zu verraten; die übertriebene Besorgnis seiner Mutter erkläre sich aus der Tatsache, daß sie viel zu lange schon unter östlichen Bedingungen lebe. Sie wiederum betonte, auch sie hätte sich längst nach dem Westen begeben, wenn sie nur sicher wäre, daß der Tod ihres Mannes, welcher als SS-Offizier während des Krieges in Amsterdam unter mysteriösen Umständen umgekommen, in der Bundesrepublik als ausreichend zur Zahlung einer angemessenen Rente sowie Entschädigung anerkannt werden würde. Heinz weigere sich ja leider, sie zu sich zu holen, immer nur vertröste er sie auf später.
Darauf der Sohn: Was würdest du sagen, wenn du in etwa einer Woche die ganze Wohnung für dich hättest?
Witwe: Und wohin mit Anna?
Sohn: Die junge Frau Hofer und ich, wir nehmen uns ein Haus. Eine Villa. Eine Bonzenvilla. Und für den Untermieter findet sich ein Laternenpfahl. Für alle dieser Couleur.
Witwe: Aber bis es soweit ist, trägst du den Hals in der Schlinge.
Sohn: Was willst du, so weiterleben wie jetzt? Glaubst du, mir macht mein Job Spaß? Immer auf dem Sprung, klein-klein, das, jenes. Aber das wird bald vorbei sein und erledigt. Außerdem habe ich Pläne. Was meinst du, wird man Geschäfte machen können, sobald sich das hier ändert!
Weniger der Gedanke an die geschäftlichen Möglichkeiten des Sohnes als an das Ende ihrer Widerwärtigkeiten, wozu der Untermieter gehörte, ferner Herr Thiel aus der Mansardenwohnung, der, obwohl blind, sich in alles einmischte, die Dame vom Wohnungsamt, der Kerl, der am 1. Mai bei ihr geklingelt und das Heraushängen einer Fahne gefordert hatte, usw., erzeugte im Herzen der Witwe eine Anwandlung mütterlicher Zärtlichkeit. Sie erhob sich, um ihrem Sohn das Haar zu streicheln.
Sohn: Nur wenige Tage, glaub mir, dann kracht es in Ost-Berlin und der Zone. Inzwischen werd ich dich öfters besuchen kommen, bleib vielleicht auch mal die Nacht.
Auf diese Ankündigung hin verflüchtigte sich der zärtliche Impuls; die Angst kehrte zurück.
Sohn: Ich habe mehrere Adressen. Aber die Wohnung liegt günstig und hat den Vorteil, daß ich bei der eigenen Frau ins Bett hüpfen kann.
Witwe: Hier werden sie dich doch zuerst suchen.
Sohn: Du möchtest wohl nicht, daß ich bleibe?
Witwe: Du kannst immer weglaufen. Aber ich bin eine alte Frau.
Sohn: Ich brauche diese Wohnung, und ich werde sie benutzen. Und hier im Haus wirst du allen gegenüber tun, als ob du dich freust, daß ich wieder da bin.
Witwe: Ich freu mich ja auch.
Sohn: Ich weiß, ich weiß.
Witwe: Aber der Untermieter? Und Anna? Sicher treibt sie’s mit ihm. Ich habe ihr nie getraut.
Sohn: Hast du dem Untermieter was über mich erzählt?
Witwe: Nie! Wie käme ich dazu.
Sohn: Von Anna kann er höchstens erfahren haben, daß ich lange drüben war, das ist nicht verboten. Überhaupt, Anna überlaß mir, die kippt flach auf den Rücken, sobald sie mich sieht, und hat nur einen Gedanken im Kopf. Lehr du mich die Weiber kennen …
4Sonntag, 14. Juni 1953
17.00 Uhr
schob sich der Dampfer Urania zwischen zwei Bojen hindurch in den Kanal. Zur Linken, zwischen dem satten Grün der Bäume, wurde ein Kirchturm sichtbar, ziegelrot, Sonne auf Dach und schmalen Fenstern. Dann lag alles wieder im Schatten zwischen dem Dorf auf dem einen Ufer und den Wochenendhäuschen, halb versteckt hinter Hecken und Gesträuch, auf dem anderen.
Auf der Titania, die ihrem Schwesterschiff folgte, juchzten sie über Mosigkeits Witze; Greta hörte es über das Wasser herüber, hörte Paula Priests spitze Schreie, als ob sie einer kitzelte. Drüben auf der Titania fuhr auch Witte. Es hatte sich so ergeben. Plötzlich war er nicht mehr an ihrer Seite; sie aber war schon an Bord und konnte nicht mehr zurück.
»Ach«, sagte Frau Kallmann und lächelte verständnisvoll, »Männer wollen auch mal allein sein.« Sie wies auf das niedrige Deck, wo achtern ihr Mann saß, sein Bier auf dem Schoße, ins Gespräch vertieft mit Gadebusch und Wiesener und Csisek und Pietrzuch. Kallmann, als fühle er sich beobachtet, blickte auf und tippte Gadebusch an, der sich unauffällig interessiert zeigte. Dann winkte Kallmann seiner Frau und warf Greta eine Kußhand zu. »Sonst ist er nicht so galant«, sagte Frau Kallmann. »Wahrscheinlich hat er schon einen in der Krone.«
Der Teil der Kapelle, welcher der Urania zubemessen war, begann wieder zu spielen, »jetzt wird geschunkelt!« rief der alte Schreyer und zog Greta und Frau Kallmann weg von der Reling, hinein in die schwitzende Gemütlichkeit. Greta fand sich neben Banggartz. Der hatte die Jacke ausgezogen; die Krawatte saß ihm volkstümlich schief; er faßte Greta um die Hüfte, »Na, kommst du auch mal zu mir?« und schunkelte mit ihr und sang lauthals:
»Das kommt nur einmal,
das kehrt nie wieder,
das ist zu schön …«
Greta hätte ihn gerne gefragt, was eigentlich vorgefallen war zwischen ihm und Witte, aber er hielt die Augen geschlossen und lächelte so glückselig, daß sie nicht das Herz hatte dazu.
Auf dem Heck, über der quirlenden Schraube, war das Getöse der Musik erträglich. Man mußte nicht einmal laut sprechen, um einander zu verstehen. Gadebusch saß bescheiden auf einer Ecke seiner Bank, klemmte seine Bierflasche zwischen die Füße, damit sie nicht umkippe, und fragte: »Also warum hat der Banggartz gesprochen und nicht, wie jedes andre Jahr, der Witte?«
»Darfst dreimal raten«, sagte Kallmann. Gadebusch hatte mindestens so gute Informationsquellen wie er, Gadebusch saß in der Werkzeugausgabe, zu Gadebusch kamen sie aus allen Abteilungen des Betriebs.
»Der Witte spielt nicht mit«, erklärte Wiesener, »bei der Normerhöhung.«
Gadebusch hob den Kopf.
»Woher weißt du«, fragte Csisek, »warst du dabei?«
Wiesener nahm seinen Papierhut ab und wischte sich den Schweiß von der buckligen Glatze. »Daß da Krach gewesen ist, leuchtet doch ein.«
Pietrzuchs eines Auge blickte listig in die Runde. Mit Genuß zitierte er, was der Dreher Bartel mittags gesagt hatte: »Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.«
»Banggartz ist ein Dummkopf«, meinte Csisek. »Witte ist doch ihr bester Mann. Auf Witte hören die Kollegen noch, auch die Parteilosen.«
»Aber wenn der Witte nicht mitspielt«, sagte Wiesener, »bei der Normerhöhung?«
»Das bedeutet noch lange nicht, daß er mit uns geht«, warnte Gadebusch. »Solche Genossen kennt man doch. Am Schluß heißt’s bei denen immer: die Partei.«
Kallmann rieb sich das Kinn. Natürlich hatte Gadebusch recht, wie meistens, wenn man sich mit ihm unterhielt. Trotzdem wäre es gut, man hätte so einen wie Witte auf seiner Seite, oder könnte wenigstens einmal mit ihm reden, von Mensch zu Mensch. Witte hatte ein Verhältnis zu den Leuten, und er nützte seine Macht nicht aus. Wären sie alle wie der, dachte Kallmann, ich pfiffe auf die ganze Korona hier, ich wär sogar selber in ihrer Partei, möglicherweise.
»Wir sitzen nicht hier, um über Witte zu reden«, sagte Csisek.
Kallmann trank und wischte sich den Mund. Er wußte, was von ihm erwartet wurde. Viele suchten seinen Rat, schon seit je. Vielleicht lag es an seinem Wesen, bestimmt an den Jahren im Betrieb, die er hinter sich hatte. Er hatte mit eigener Hand zugepackt, um aus den Trümmern des Krieges zu retten, was zu retten war, und hatte geholfen, aus dem verbogenen Schrott wieder etwas zusammenzubauen, was sich benutzen ließ, und hatte angefangen zu arbeiten, in noch nicht einmal notdürftig geflickten Werkhallen, während andere an ihrem Land und sich selbst verzweifelten und nur den Hunger und die Ruinen sahen. Warum er das getan hatte, wußte der Teufel – aus Pflichtbewußtsein, oder weil er sich ein Leben außerhalb seiner Sielen nicht vorstellen konnte, oder weil sein Gewissen ihn plagte.
So begann er denn, über die Lage zu sprechen, und darüber, was die Kollegen dachten, seines Wissens, und darüber, was sich vielleicht tun ließe, seiner Einschätzung nach. Er redete wie über ein Werkstück, das herzustellen war, ruhig, fachgerecht. Gadebusch merkte wohl, wie viele von Kallmanns Worten und Gedanken eigentlich von ihm stammten; aber bei Kallmann klang alles ursprünglicher, kräftiger, volkstümlicher. Gadebusch stellte das neidlos fest, voller Anerkennung; es lag ihm auch nicht, sich in den Vordergrund zu spielen, er gönnte Kallmann die Führerrolle.
»Nun, was haltet ihr davon?«
Kallmanns Ton deutete an, daß er weniger an Meinungen interessiert war als daran, daß man ihn begriffen hatte.
»Solidarität«, sagte Gadebusch, bückte sich nach seiner Flasche und trank einen Schluck. »Solidarität ist die Waffe des Arbeiters.«
Auf dem Oberdeck spielte die Kapelle Ach ich hab sie ja nur auf die Schulter geküßt.
»Aber was ich denke, ist nicht so wichtig«, fügte Gadebusch hinzu. »Ihr« – er blickte Csisek ins Gesicht, dann Wiesener, Pietrzuch, Kallmann – »ihr seid die Leute mit Einfluß. Ihr kennt die Kollegen in euren Abteilungen, ihr wißt, Punkt eins, wo sie der Schuh drückt, Punkt zwei, wie man sie in Bewegung bringt …«
Ein Segel glitt vorbei. Gadebusch winkte der Kleinen zu, die oben auf Deck ihren Bauch in die Sonne hielt. Das erste Mal, dachte Kallmann, daß der eine menschliche Regung zeigt: war wohl in Laune; sonst schloß er sich eher ab, einer der Stillen im Lande, schwärmte höchstens mal von seiner Laube, die er sich ausbaute, sonn- und feiertags, mit allen Schikanen.
Man sprach wieder von Alltäglichem. Kallmann schloß die Augen. Die Marmeladenpreise waren erhöht und vor wenigen Tagen wieder herabgesetzt worden; Pietrzuch hatte einen Vetter, bei dem hatten sie die Steuern aufs Häuschen zwangsweise eingetrieben; und der Frau, die den Blumenladen am Friedhof betrieb, waren die Lebensmittelkarten entzogen worden, jetzt mußte sie das Vielfache zahlen für alles; und was gab es schon in den Läden; und Wohnungen, nicht dran zu denken; aber Csiseks Nachbar war eingelocht worden, weil er ein paar Dutzend Eier nach West-Berlin brachte, so was nannte sich Arbeiterregierung, in großen Limousinen herumfahren, das konnten sie; das müßte sich alles ändern.
Ändern, dachte Kallmann: und dann? Wiesener, Csisek, Pietrzuch, überhaupt die meisten, sahen nur das eigne Portemonnaie, und das Geld darin stimmte eben nicht. Was aber sah so einer wie Gadebusch?
Auf einmal redete niemand mehr. Kallmann öffnete die Augen: Lehnert. Lehnert lächelte, ein Mann, der seine Pflichten zu aller Zufriedenheit hinter sich gebracht hat und der nun Entspannung sucht im Kreise der Kollegen.
»Gut, daß du kommst«, grüßte Kallmann. »Wir sprechen gerade von den Normen. Setz dich.«
»Normen?« Lehnert zerknüllte seine Papiermütze. »Laßt mich bloß damit in Ruhe!«
Und machte kehrt, die eiserne Treppe hinauf, zum Oberdeck, wo die Kapelle jetzt Am Rheinam Rhein am deutschen Rhein spielte und wo Greta Dahlewitz wieder an der Reling stand und hinüberblickte zu dem Schwesterschiff Titania.
»Also wir fordern, daß sie die Normerhöhung zurücknehmen«, sagte Csisek. »Und wenn sie uns nein sagen?«
»Und sie werden nein sagen«, prophezeite Pietrzuch.
»Vielleicht könnte man über die Gewerkschaft …« Wiesener zögerte. Es war nur ein Vorschlag. »In der Gewerkschaft sitzt der Witte …«
»Früher«, sagte Kallmann, »früher haben wir Gewerkschaften gehabt. Früher kämpften die Gewerkschaften für die Rechte der Kollegen, und für ihre Löhne, und die Unternehmer horchten auf, wenn die Gewerkschaft sprach …« Er schloß die Faust um seine Flasche. »Witte hin, Witte her – jetzt verlangt auch noch deine Gewerkschaft, daß du schneller arbeiten sollst. Und für was?«
»Jawohl!« sagte Csisek und griff sich ein Bier aus dem Kasten. Gadebusch schwieg.
»Für was!« wiederholte Kallmann. In Fragen der Ökonomie kannte er sich aus; man war nicht umsonst zwanzig Jahre und mehr in diesem Betrieb, und Bücher hatte er auch gelesen und Vorträge gehört. »Sie haben Leistung weit über Norm aus uns herausgekitzelt, indem sie uns das Zweifache und Dreifache dafür zahlten; und dann drehen sie sich herum und sagen: Ihr habt ja gezeigt, daß ihr’s könnt – und erhöhen die Norm.«
Das war die Rechnung, dachte Gadebusch, die jeder Arbeiter verstand.
»Wir Arbeiter sind immer die Ausgebeuteten.« Kallmann zuckte die Achseln. »Das ist seit je so gewesen, überall in der Welt, und das wird wohl auch so bleiben, Kapitalismus oder Kommunismus. Oder glaubt einer, daß er wirklich den Wert wieder rauskriegt, den er produziert?«
Der geborene Volksredner, dachte Gadebusch. Wenn der Mann in den nächsten Tagen auch so sprach, und bei der Stange blieb, und nicht weich wurde, dann ließ sich vielleicht etwas machen in dem Betrieb.
»Wenn aber die Ausbeutung auch noch von Leuten besorgt wird«, Empörung schwellte Kallmanns Stimme, so daß Wiesener die Hand mahnend hob, »von Leuten, die behaupten, sie wären nicht mehr wie wir, und eine Arbeiterregierung, und wenn sie die Schraube dabei so hart anziehen – dann sollten wir uns doch wenigstens erlauben dürfen, ihnen mitzuteilen, daß uns das nicht paßt, und was uns nicht paßt …«
Er brach ab. Das Gurgeln des Kielwassers, das Gelächter auf dem Oberdeck klangen überlaut. Vielleicht, dachte Gadebusch, war Kallmann erschrocken vor der Konsequenz seiner Gedanken.
Er klopfte Kallmann aufs Knie. »Recht hast du. Sie sind eine Arbeiterregierung. Wir sind Arbeiter. Es kann ihnen nur helfen, wenn wir ihnen zeigen, daß sie zu weit gegangen sind.«
Kallmann nickte.
»Wenn sie uns aber doch nein sagen?« beharrte Csisek.
»Dann« – Kallmann holte tief Atem – »Streik.«
Das Wort, bisher von keinem ausgesprochen, lief wie heißes Blei.
»Aber dazu wird es nicht kommen«, fügte Kallmann sofort hinzu. »Sowie sie sehen, daß wir’s ernst meinen …«
»Das ist klar«, tröstete Gadebusch und ließ sieh von Csisek ein Bier reichen. »Trotzdem sollte man sich baldmöglichst unterhalten, was da im einzelnen zu tun wäre.«
Kallmann schien nicht zu hören. Er rief hinauf zum Oberdeck: »Greta, Mädchen, willst du nicht ein paar einsamen Männern Gesellschaft leisten?«
Greta nickte noch einmal hinüber zur Titania, dann kam sie die Treppe herunter, zögernd noch, mißtrauisch ob der plötzlichen Freundschaft. Gadebusch schob Csisek zur Seite. Greta setzte sich, die Handtasche auf dem Schoß, und strich sich den Rock glatt.
Die Genossin Dahlewitz, dachte Gadebusch, Wittes Ehemalige, in diesem Kreis – das war etwas fürs Album, im übrigen war sie für ihr Alter nicht so übel, wenn man von den faltigen, verarbeiteten Händen absah.
5Sonntag, 14. Juni 1953
19.00 Uhr
stellte Gudrun Kasischke alias Goodie Cass, Berlins begnadetste Stripperin, die in einem Westberliner Nachtlokal arbeitete, jedoch in einem Ostberliner Vorort auf einem Wochenendgrundstück zusammen mit ihrem Geliebten Fred Gadebusch hauste, das Wasser ab, rollte den Gartenschlauch auf und begab sich unter die Dusche, um sich in Vorbereitung ihrer nächtlichen Tätigkeit zu säubern.
Dabei bedachte sie
in bezug auf Gadebusch:
daß du mir bei der Hitze nicht vergißt abends zu sprengen hat er gesagt ich will nicht daß mir der Rasen verbrennt bloß weil ich mit muß auf den verdammten Ausflug und du deine Flausen im Kopf hast er tut sich was zugute mein Fred auf seine Gründlichkeit immer systematisch sagt er Punkt eins zwei drei und immer schön abgehakt nur ich bin ihm zufällig hereingeschneit ganz schön durcheinandergebracht hab ich Punkt eins zwei drei Goodie hat er gesagt so eine wie dich gibt’s nur einmal bleib bei mir ich hab eine Laube die ist nicht erfaßt vom Wohnungsamt die hab ich mir ausgebaut Wohnzimmer Schlafstube Küche Duschraum Klo mit Sickergrube und ich habe noch allerhand vor damit mein Fred das muß ihm der Neid lassen der schafft sich was hat stets Leute an der Hand die ihm verpflichtet besorgt ihnen dies und das leiht auch Geld aus oder lotst sie hin wo sie hinmüssen mit ihren Anliegen Verbindungen sagt er immer Verbindungen muß der Mensch haben aber selbst nicht hervortreten meine Laube die ist unauffällig und die Hecke ist dicht und wächst jedes Jahr höher ich sagt er immer bin gelaufen von Stalingrad bis nach Berlin ich hab mein Stück Welt gesehen jetzt möcht ich seßhaft bleiben my home is my castle Eigenheim bringt Glück allein aber still und bescheiden wer sich hervortut hat Feinde die Menschen sind ein neidisch Volk
in bezug auf sich selbst:
die Haut muß ich noch cremen eine Haut hab ich wie Sahne sagt er immer er hat eine poetische Ader mein Fred und meine Füße sagt er sind ein Gedicht ist ein Fußfetischist oder so was und mit Recht was meine betrifft auch wenn ich vom Dorf komm bin ich kein Bauerntrampel Goodie früher Gudrun Tochter des Bauern Kasischke was hat mich mein Alter geprügelt erstens überhaupt und dann wegen der Sache damals wo ich doch gar nichts dafürkonnte sie ist doch noch ein Kind hat die Frau selber gesagt meinen Alten haben sie eingesperrt und dann ist er abgehaut nach dem Westen nie mehr gehört von ihm vielleicht ist er tot aber ich leb hab mich auch durchkämpfen müssen die Arbeit geht jetzt nur Samstag Sonntag immer drei Shows das ermüdet aber sonst ich fühl mich ganz wohl hier mein Fred sagt ich hab hier Wurzeln geschlagen er liebt so Vergleiche als wär ich ein Radieschen oder eine von seinen Zierstauden die er reinsteckt in die Erde und Torfmull drauf
Gudrun Kasischke alias Goodie Cass schlüpfte in ihr Négligé, kochte sich Kaffee, machte sich eine Schnitte mit Salami, fester, ungarischer, blickte auf die Uhr, erkannte, daß ihr Zeit blieb, um in Ruhe zu essen, und setzte sich hin, dieses zu tun.
Dabei bedachte sie
in bezug auf Verschiedenes:
komisch die sozialistischen Länder sagt mein Fred immer da exportieren sie die feinsten Sachen Salami zum Beispiel aber beileibe nicht zu ihren sozialistischen Brüdern nein in den Westen zum Klassenfeind von wo wir’s dann wieder herüberholen in den Sozialismus mit der S-Bahn sei so lieb hat er gesagt und nimm mir den Brief mit hinüber heut abend und gib ihn dem Herrn Quelle ich komm heut nicht dazu bei mir wird’s spät werden bei so einem Betriebsausflug da sitzt man hinterher noch mit den Kollegen Herr Quelle wird ins Lokal kommen und sich umschaun nach mir dann gibst du’s ihm aber vergiß nicht ich prügel dich windelweich wenn du’s vergißt so wahr ich hier stehe einmal hat er mich geschlagen das war wie der junge Maler mir nachgelaufen ist mit seinen traurigen Augen und ich mich hätt beinah erweichen lassen der Maler ist nicht wiedergekommen dafür hat Fred gesorgt mein ganzes Gesicht war kaputt eine Woche lang konnt ich mich nicht sehen lassen im Lokal nirgends
in bezug auf Geheimnisse: