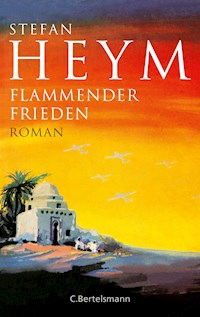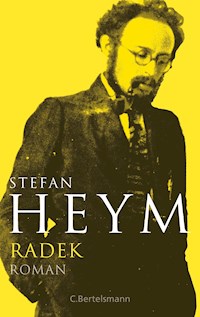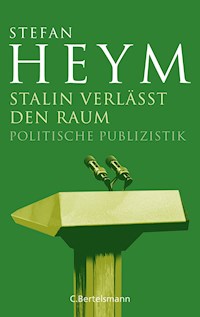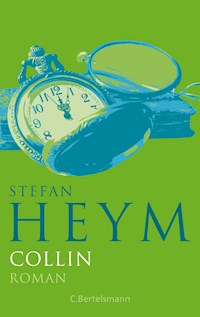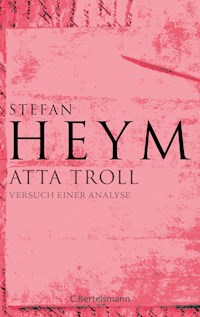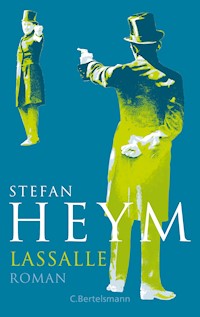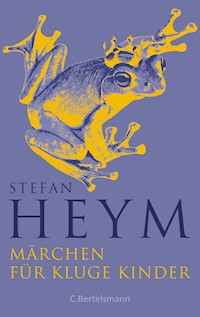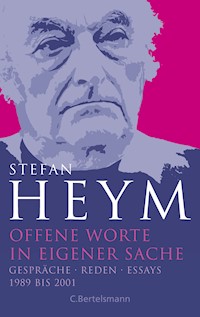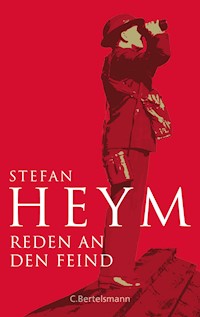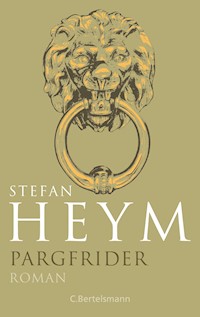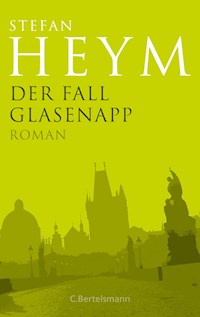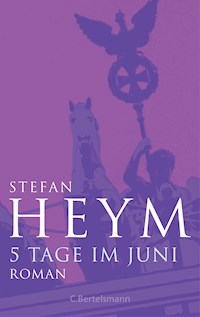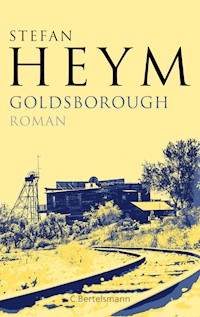
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane
- Sprache: Deutsch
Stefan Heyms großer Amerikaroman
Mickie Kennedy ist hungrig nach dem großen Leben. Sie wohnt in Goldsborough, einer typisch amerikanischen Stadt, in der die Menschen ihr Brot unter Tage verdienen müssen. Wäre sie in gesicherten Verhältnissen aufgewachsen, hätte sie vielleicht die Liebe kennengelernt, wie sie es sich ersehnte. Doch Arbeit und Sorge zu Hause sind kein Nährboden für romantische Träume eines jungen Mädchens. So nimmt sich Mickie vom Leben, was es ihr bietet, und kümmert sich nicht weiter um die Moral. Ein Gedanke beherrscht sie völlig: Sie will raus aus ihrem armseligen Dasein, koste es, was es wolle ...
Stefan Heyms sozialkritischer Roman über das Amerika der kleinen Leute im Bergarbeitermilieu wirft ein zeitloses Bild auf die Abgehängten des amerikanischen Traums. Auf Deutsch erstmals 1953 beim List Verlag Leipzig erschienen, endlich wieder lieferbar als Teil der digitalen Werkausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 899
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Mickie Kennedy ist hungrig nach dem großen Leben. Sie wohnt in Goldsborough, einer typisch amerikanischen Stadt, in der die Menschen ihr Brot unter Tage verdienen müssen. Wäre sie in gesicherten Verhältnissen aufgewachsen, hätte sie vielleicht die Liebe kennengelernt, wie sie es sich ersehnte. Doch Arbeit und Sorge zu Hause sind kein Nährboden für romantische Träume eines jungen Mädchens. So nimmt sich Mickie vom Leben, was es ihr bietet, und kümmert sich nicht weiter um die Moral. Ein Gedanke beherrscht sie völlig: Sie will raus aus ihrem armseligen Dasein, koste es, was es wolle ...
Stefan Heyms sozialkritischer Roman über das Amerika der kleinen Leute im Bergarbeitermilieu wirft ein zeitloses Bild auf die Abgehängten des amerikanischen Traums. Auf Deutsch erstmals 1953 beim List Verlag Leipzig erschienen, endlich wieder lieferbar als Teil der digitalen Werkausgabe.
»Ich gestehe, daß es Goldsborough in Wahrheit nicht gibt. Aber es gibt viele Goldsboroughs. In Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Illinois, Kenntucky, Arkansas.« Stefan Heym
»Es wird viele Leser überraschen, in ›Goldsborough‹ ein Bild von Amerika zu finden, wie es vorher nur Upton Sinclair oder John Steinbeck gezeigt haben.« Daily Worker, London
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1952 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Goldsborough
Roman
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel „Golsborough“ bei 1953 bei Blue Heron Press, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1953 beim Paul List Verlag, Leipzig.
Aus dem Amerikanischen vom Verfasser.
Die Zeichensetzung folgt, wo sie von den Regeln abweicht, den besonderen Wünschen des Verfassers.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © für Original und Übersetzung 1953 by Inge Heym
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München nach einem Entwurf von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagmotiv: © Atmosphere1 / Shutterstock.com
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Abiling
ISBN 978-3-641-27833-5V002
www.cbertelsmann.de
Angus Cameron,
dem Redakteur und Kämpfer
EDITORISCHNOTIZ
Stefan Heym hat den Roman Goldsborough in den frühen 1950er Jahren verfasst. In dieser Zeit war es gebräuchlich und keineswegs herabwürdigend, Menschen mit schwarzer Hautfarbe als »Neger« zu bezeichnen. So tat es auch Stefan Heym in diesem Buch. Aus dem Textzusammenhang ist unschwer zu erkennen, dass der Autor großes Mitgefühl mit den afroamerikanischen Bergarbeitern empfand, die noch schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen hatten als ihre weißen Kumpel. Er steht deshalb fern jeden Verdachts der Diskriminierung seiner Figuren.
C. Bertelsmann Verlag
Erstes Kapitel
Die Verandatreppen wurden morsch. Jedes Mal, wenn er seinen Fuß auf eine der Stufen setzte, spürte er, wie das Holz unter seinem Gewicht nachgab. Man müßte die Sache in Ordnung bringen. In der Grube lag schließlich genug Holz herum, und er konnte es relativ billig bekommen. Aber das ganze Haus war am Zusammenfallen, und wenn man da einmal mit Reparaturen anfing, würde man nie fertig werden.
Immerhin, das bißchen, was der Mensch hat, sollte er nicht so vor die Hunde gehen lassen. Und es war nun mal sein Haus; und auf den Blechbriefkasten, der schief und ungeschickt an eine Zaunlatte genagelt war, hatte Mickie seinen Namen gemalt: Carlisle Kennedy. Die Farbe hatte rote Tränen geweint, die unter dem »C« und dem »K« und dem »y« eingefroren zu sein schienen. Es war sein Haus; er zahlte ja immer noch dafür. Alle zwei Wochen, nach dem Blick in die Lohntüte, gab es ihm von neuem einen Stich. Und auch wenn er die letzte Rate abgestottert haben würde, dachte er sich, würde es ihm noch vorkommen, als gehöre diese alte Holzbaracke nicht ihm, sondern der lausigen Bergwerksgesellschaft. Was für ein Schwindel! Man mußte das Haus kaufen, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, und mit jeder Abzahlung, die sie einem gleich vom Lohn abzogen, fesselten sie einen noch mehr an die Grube.
Er klappte den Deckel des Briefkastens herunter. Eine bunte Reklamebroschüre von einer Kreditanstalt und die heutige Nummer des Goldsborough Daily Eagle lagen darin. Er schmiß die Broschüre ungelesen fort, klemmte die Zeitung unter den Arm und folgte der Spur nackter Erde, die sich durch schütteres Gras hinzog bis zu dem windschiefen Abtritt am Ende des Pfades. Ein paar große, blaue Herbstfliegen surrten hoch. Kennedy setzte sich hin, ließ aber die Tür offen, um Licht zum Lesen zu haben.
Der Präsident hatte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus eine Erklärung abgegeben, irgendetwas über Demokratie. Weinbergs Herrenartikelgeschäft in Goldsborough veranstaltete einen Ausverkauf vor der nächsten Preissteigerung. Der Prozeß gegen Hale war auf heute vor dem Kreisgericht Goldsborough angesetzt.
Kennedy zerriß die Zeitung in Vierecke. Vom Hause her hörte er Evalines keifende Stimme. Er stand auf. Beim Herausgehen versetzte er der Tür des Abtritts einen wütenden Stoß mit seinem Absatz, so daß sie krachend zuflog.
Das einzig Gute an diesem Tag war noch das Wetter, frisch und klar. Von seiner Veranda aus hatte er einen großartigen Blick über ganz Goldsborough, über den Pokie-Fluß hinweg und noch weiter über die dahinter liegenden Berge, die sich in einem bläulichen Schimmer verloren. Er liebte dieses Land und diese Berge. Wenn die Jagdzeit begann, drückte er sich immer für ein paar Tage vor der Arbeit in der Grube, nahm sein Gewehr und ging in die Wälder. In zwei Tagen konnte er dann mehr Fleisch heranschaffen, als er für zwei Wochen Lohn kaufen konnte – besonders jetzt, wo Kurzarbeit die Regel war.
Schon wieder kam das Keifen aus der Küche. Er ging ins Haus. Im ersten Augenblick konnte er im Halbdunkel nur den großen weißen Kühlschrank erkennen; dann unterschied er seine Kinder. Sie waren in ständiger Bewegung, fielen übereinander her, stürzten, sprangen auf, rannten weiter; Gott weiß, wo sie die Energie dazu hernahmen. Und dann sah er Angeline, unbeweglich in ihrem Schaukelstuhl in der Ecke, ihr schweres regelmäßiges Atmen klang wie das Rauschen auf einer abgenutzten Grammophonplatte.
Bedauernswertes Wesen, dachte er und fühlte sich gleichzeitig verärgert und schuldbewußt. Er konnte sie schon nicht mehr ansehen – das Baumwollkleid, straff gespannt durch die fetten, rosa Schenkel, die unter dem zu kurzen Rock sichtbar waren; ihre dicken, weichen Hände, die vergeblich versuchten, über dem Bauch zueinanderzukommen; ihre Augen, eingeengt von den verquollenen Backen. Dabei war sie eine gute Frau; tadellos; sie konnte ja nichts für ihr Unglück. Die Kinder hatten sie so gemacht, wie sie war; und er war es, der ihr die Kinder gemacht hatte.
»Wir werden noch zu spät kommen!« Das war Evaline, vom Küchenherd her. »Alle Jubeljahre einmal bitte ich den Mann, mir eine Gefälligkeit zu tun. Gehn wir jetzt also, oder was? Wenn du mich nämlich nicht mitnimmst, werd ich schon jemand anders finden. Nicht jeder ist so stinkfaul wie du –«
Ihre dünnen Lippen schnappten über ihrem zahnlosen Munde zusammen. Wie ein derart dürres Weibsstück ein Monstrum wie seine Frau in die Welt gesetzt haben konnte, blieb Kennedy ein Rätsel.
»Kaffee!« sagte er und setzte sich an den Tisch.
Evaline schob die Tasse vor ihn hin und einen Teller mit ein paar Stück Brot und mehreren Scheiben Speck.
»Du hast dich ja schön herausstaffiert!« bemerkte er.
»Und warum nicht?« gab sie ihm sofort zurück, wobei sie an ihrem schwarzen Kleid herumzupfte und ihren Kragen glattstrich. »Wie oft komm ich schon in die Stadt? Wie ich noch mein eignes Haus hatte, da bin ich jeden Tag in die Stadt gegangen, manchmal sogar zweimal. Aber jetzt? Wer füttert denn deine Brut und wischt ihnen die Rotznasen? Du vielleicht? Und wenn’s nicht das ist, dann ist’s was anderes. Schinderei den ganzen Tag –«
Er legte die letzte Scheibe Speck auf sein Brot und erklärte höflich: »Wenn’s Ihnen hier in Pritchett Heights nicht passt, Mrs. Polowski, dann wissen Sie ja, was Sie tun können.«
»O ja?« Sie lehnte sich über ihn. »Ich möcht mal sehen, was passieren würde, wenn ich hier fortginge.«
Er hustete und wischte sich den Mund. Der Streit endete immer an diesem Punkt. Sie wußte, daß sie unentbehrlich war, die alte Hexe. »Wo ist Mickie?« fragte er.
»Wo wird sie schon sein?« sagte Evaline. »Im Bett, schläft. Leute wie ich müssen sich die Haut von den Knochen arbeiten, aber die Prinzessin darf man ja nicht stören. Wenn du meine Meinung wissen willst –«
»Wer will deine Meinung schon wissen!« sagte er und lachte. Er hatte eigentlich keinen Grund zum Lachen, nur daß er wusste, daß sein Lachen Evaline furchtbar reizte. Er lachte tief aus der Brust heraus, die Fältchen neben seinen Augenwinkeln zuckten. Sein Lachen füllte die Küche von einem Ende zum andern. Die Kinder – Donnie und Robbie und Sally – und die drei kleineren, die er von Angeline hatte, stimmten in das Gelächter ein.
Evaline schlug die Hände an die Ohren. »Gackernde, schnatternde Teufel!« schrie sie.
Kennedy erhob sich. Mit seiner arbeitsschweren Hand haute er ihr eins auf den knochigen Hintern; dann, mit einem halben Blick auf Angeline, die während des ganzen Lärms ungerührt dagesessen hatte, verließ er das Haus.
Weit ausschreitend, ging er an der Reihe der grauen, aus Holzlatten zusammengenagelten Häuschen entlang, die sich nur durch die verschiedenen Stadien ihrer Reparaturbedürftigkeit voneinander unterschieden. Das war Pritchett Heights. Billiges Land auf einer Anhöhe, die kahl war bis auf ein paar magere Bäume und zerzauste Büsche; darum hatte die Bergwerksgesellschaft hier gebaut. Billige zweistöckige Buden, ohne Keller und Isolierung, ohne Kanalisation, Wasser nur aus ein paar Pumpen; so hatte die Bergwerksgesellschaft hier gebaut. Überall in diesem Teil von Pennsylvania konnte man Siedlungen dieser Art finden; sie waren weder Dorf noch Stadt; amtlich hatten sie überhaupt keinen Namen; Bergarbeitersiedlungen waren es; und wenn man sich in Goldsborough nach dem Weg nach Pritchett Heights erkundigte, schauten die Leute einen mißtrauisch an – was konnte einer schon dort wollen?
Kennedy erreichte das Ende der Reihe, dort, wo Elijah Jamiesons Haus, getragen von wackligen hölzernen Stützen, zu einem Viertel über den Abhang hinausragte. Vor diesem Haus begann die ungepflasterte Straße, die den Berg hinunter nach Goldsborough führte, und hier parkten die Autobesitzer unter den Arbeitern ihre Wagen.
Kennedy trat zu seinem Chevrolet. Das war ein Wagen, wie man ihn so leicht nicht wieder fand. Mit seinen verbogenen, geflickten rostzerfressenen Kotflügeln, mit Stoßstangen, die an Drähten hingen, mit dem altersgefleckten Glas seiner Windschutzscheibe war dieser Chevrolet ein Schandfleck auf den spiegelglatten Autobahnen des Landes. Nicht daß Kennedy es so empfand – die Karre lief; das war die Hauptsache. Sie brachte ihn und noch ein paar Kumpel von Pritchett Heights wohlbehalten zur Grube und zurück; und während der Jagdzeit fuhr er damit in die Wälder; und wenn er sie heute vor dem Gerichtsgebäude falsch parkte, würde der nächste beste Polizist ihm einen Strafzettel verabreichen, was bewies, daß die alte Ratterkiste genauso gut war wie jeder andere Wagen und daß vielleicht doch etwas Richtiges an Trumans Erklärung über Demokratie war, die im Goldsborough Daily Eagle gestanden hatte.
Evaline war ihm nachgerannt. Noch ganz außer Atem, setzte sie sich neben ihn. Sie versuchte, aufrecht zu sitzen, wie sich’s gehört, und gleichzeitig die Sprungfeder zu vermeiden, die durch das Sitzpolster gedrungen war. Der Starter winselte ein paarmal, der Motor sprang an, und Kennedy steuerte den Wagen vorsichtig auf die Straße.
Die Straße hatte tiefe Schlaglöcher, und das Gestrüpp in den Gräben wucherte bis auf die Fahrbahn. Sie führte steil bergab, mit drei scharfen Kurven, bei Wintereis kaum befahrbar. Im Frühling und Herbst mußten sich die Autos durch dicken Schlamm hindurcharbeiten, während sie im Sommer solche Staubwolken hochwarfen, daß die Blätter und Dornen des Gestrüpps gelblich-weiß statt grün waren. Blieb ein Wagen stecken und konnte er nicht abgeschleppt werden, so war die Straße tagelang nicht zu benutzen. Dann geschah es wohl, daß Kennedy eine Delegation von Bergarbeitern von Pritchett Heights zusammenbrachte und mit ihr in Bürgermeister Purdys Amt in Goldsborough vorsprach und verlangte, daß die Stadt die Straße endlich in Ordnung bringe. Purdy redete sich heraus, sagte, der Landkreis sei dafür zuständig; die Kreisbehörde dagegen erklärte, Pritchett Heights gehöre zur Stadt Goldsborough und gehe sie nichts an.
Kennedy fuhr fast automatisch. Der Chevrolet holperte über die Löcher; Evaline mußte ihren Hut und ihre schwarze kunstlederne Handtasche krampfhaft festhalten. Dabei redete sie unaufhörlich und hielt nur inne, wenn ein besonders harter Stoß ihr den Atem benahm. Kennedy hörte nicht zu; er war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.
Die Frage, warum »Doc« Silas Hale vor Gericht gezerrt wurde, interessierte ihn nicht so sehr; die Antwort darauf war klar genug. Selbst in einem Drecknest wie Goldsborough konnte der Mensch sich der politischen Maschine nicht widersetzen und gleichzeitig erwarten, auf die Dauer ungeschoren zu bleiben – und bei den Wahlen von 1946 hatte Doc Hale der Maschine beinahe eine tödliche Niederlage beigebracht. Ein Schwein wie Lou Geoghan vergibt und vergißt nicht; er kann es sich nicht leisten. Drei Jahre hatte Geoghan gewartet, jetzt schlug er zu, hart, mörderisch. Armer Kerl, Doc!
So arm eigentlich auch wieder nicht. Hale konnte eine Menge Mut entwickeln, sobald er einmal anfing, sich zu engagieren. Besaß auch Charakter. Schließlich hatte er es nicht nötig zu kämpfen; wenn er gewollt hätte, hätte er seinen Frieden durchaus machen können. Ein Bergarbeiter zum Beispiel hat keinen anderen Ausweg, er muß kämpfen; aber ein Zahnarzt, oder beinahe ein Zahnarzt, wie Doc es war, so einer hat Dutzende von Möglichkeiten.
Es waren diese Möglichkeiten, die Kennedy Sorge machten. Irgendwie lag ihm daran, daß Hale in diesem Gerichtssaal Widerstand leistete; dabei wußte er, daß er kein Recht hatte, es zu verlangen oder zu erwarten, und wußte außerdem, daß Hale, selbst wenn er bereit war zu kämpfen, kaum eine Chance haben würde, auch nur den Mund aufzutun. Alles würde sich zwischen den Herren Juristen abspielen, und es würde heißen: Bitte antworten Sie Ja oder Nein. So war es nun mal in diesen Gerichten, und die Stimme des einzelnen wurde einfach erstickt.
Mit einer Reihe von Stößen und einer letzten Erschütterung fuhr der Chevrolet über die Knüppelbrücke am Ende der Straße und bog in die Chaussee nach Goldsborough ein. Kennedy trat auf den Gashebel. Die Zementbahn floß mit großer Geschwindigkeit unter dem Wagen vorbei, und über dem Singen der Reifen hörte er Evalines Wortschwall.
»Es würde dir auch nicht weh tun, zu antworten! Es ist ja, als ob man mit einem Taubstummen zusammen wäre! Oder hast du vielleicht vergessen, dir die Kohle aus den Ohren zu waschen?«
»Jawoll!« sagte er.
»Leid wird’s dir noch mal tun, Carlisle Kennedy! Eines Tages wird’s dir ganz gehörig leid tun. Immer nur an sich selber denken und an seine eigenen gottlosen Vergnügungen – aber wenn du nur ein einziges Mal einem Menschen, der schließlich auch zu deiner Familie gehört, einen Gefallen tun sollst, wie beispielsweise mich nach Goldsborough mitnehmen, damit ich nicht den ganzen Weg zu Fuß machen muß und mir die Beine in den Löchern auf der Straße breche, dann tust du, als ob das das größte Unglück auf der Welt wäre.«
»Jawoll!« sagte er.
Sie rutschte auf ihrem Sitz herum. Wohin sie sich auch immer setzte, schien die lose Sprungfeder sie zu verfolgen; und sie hatte Angst um ihr gutes schwarzes Kleid. Ein Skandal wäre das, wenn ihr das Kleid jetzt kaputtginge und sie sich in aller Öffentlichkeit mit einem Riß im Rock zeigen müßte. Aber ihr passierten solche Sachen. Ihr ganzes Leben lang hatte sie Pech. Selbst jetzt, in einem Alter, wo andere Frauen es friedlich und gut hatten, mußte sie den Rotz an den Nasen der Gören dieses Kennedy abwischen und noch dazu seine und Mickies Beleidigungen einstecken. Pater Boleslav von der Kirche des Heiligen Ignaz sagte zwar, das wäre alles eine Prüfung, und er hatte ja wohl auch recht – aber war sie um Gottes willen noch nicht genug geprüft worden? Hatte sie nicht alles verloren, ihr Haus und ihre Zähne und das Versicherungsgeld, das ihr Mann ihr hinterlassen hatte; und die drei Töchter, die sie unter so vielen Opfern groß gezogen und verheiratet hatte, Angeline ganz besonders – was hatte sie jetzt schon davon? Und für die Nerven waren sie das Allerschlimmste, diese dauernden Prüfungen. Was würde geschehen, wenn sie heute versagte?
Sie bemerkte, daß Kennedy die Stirn runzelte. »Meinst du das im Ernst«, hörte sie ihn sagen, »daß du sogar zu Fuß gelaufen wärst, nur um zu diesem Prozeß zu kommen? Was liegt dir denn so viel daran?«
Für den Bruchteil einer Sekunde schlossen sich ihre großen, sehnigen Hände fest um ihre Handtasche, als wollten sie sich überzeugen, daß die Tasche noch da war. Heimlich machte sie die Tasche auf. Ihre Finger fischten nach der kleinen Pappschachtel. Jawohl, auch die war noch da mit ihren neuen Zähnen drin, Zähnen, die weiß glänzten wie Perlen und in einem rosigen Zahnfleisch aus einer Art Zelluloid saßen. Nach Jahren, in denen man nur breiiges Zeug in sich hineinlöffeln mußte, wieder ein Stück Fleisch beißen zu können! Vielleicht würde Mr. Adair sie zu einem Steak einladen; sie könnte es wenigstens durchblicken lassen – höflich wie sich’s gehört, natürlich.
»He – also was liegt dir denn daran?« fragte Kennedy wieder.
Sie schmatzte, schluckte und sagte dann: »Du glaubst wohl, ich hab überhaupt kein Recht, aus dem Haus herauszukommen? Wie oft seh ich denn schon mal was Interessantes, und noch dazu gratis und umsonst? Vielleicht wird mir’s Spaß machen zuzusehen, wie einer von deinen sauberen Freunden endlich mal abkriegt, was er verdient. Pater Boleslav sagt immer –«
Er preßte seinen Daumen auf die Hupe, obwohl die Chaussee völlig leer vor ihm lag, und nahm den Daumen erst herunter, als er sah, daß ihre Lippen wieder fest aufeinander lagen. Er hatte sie großartig zum Schweigen gebracht, und er konnte sich ausrechnen, wie sie innerlich kochte, und er wünschte, die Innentemperatur der Alten stiege weiter, bis sie zerplatzte.
Evaline unterdrückte ein Lächeln. Sie erriet, was er sich dachte. Da dachte er, wie gescheit er war, und daß er alles wußte. Aber nichts wußte er, gar nichts, und schon überhaupt nichts von den Zähnen. Eine schöne Überraschung würde er erleben. Was sie wußte, half ihr jedoch nicht, ihre Aufregung zu überwinden. Nur Reden half ihr; und er ließ sie nicht zum Reden kommen. Solange sie redete, war sie imstande gewesen, ihre Besorgnisse irgendwie im Zaum zu halten; jetzt fraßen sie in ihren Eingeweiden. Es war natürlich lächerlich, daß sie Angst hatte. Sie brauchen keine Angst zu haben, hatte Mr. Adair ihr erklärt, alle werden auf Ihrer Seite sein, wenn Sie Ihre Aussage nur gut vorbringen, so wie Sie sie mir jetzt schon dreimal vorgesprochen haben. Ich habe Ihnen alle Fragen mitgeteilt, die ich Sie fragen werde, und ich habe Ihnen auch über die Fragen Bescheid gesagt, die der Verteidiger wahrscheinlich stellen wird; und außerdem sitzt auch Seine Ehren da oben am Richtertisch, und Seine Ehren wird Sie bestimmt in Schutz nehmen.
Das hatte alles sehr gut geklungen, und sie war auch überzeugt, daß die Sache glattgehen würde, sobald nur einmal ein Anfang gemacht war. Wovor sie Angst hatte, waren die Minuten, die es dauern würde, bevor sie richtig in Fahrt kam. Aus dem Zeugenzimmer herauskommen und ganz alleine, vor aller Augen, zu dem Zeugenstuhl gehen und sich auf den Stuhl setzen und angeglotzt werden – und wenn die Leute plötzlich lachten? Sie war ja nur eine arme Frau, sie war immer arm gewesen, und eine Witwe sein und Zimmer an Bergarbeiter vermieten und für sie kochen und dann als Reinemachefrau im Goldsborough Palace Hotel arbeiten und später das Haus für Kennedy führen hatte sie auch nicht gerade schöner gemacht. Die Armen sehen vor der Welt eben nicht gut aus. Die Armen haben diesseits des Paradieses überhaupt keine Vorteile … Sie spürte die lose Sprungfeder im Sitz. Hastig griff sie nach ihrem Rock. Gott! Wenn ihr Kleid jetzt zerriß, würde sie einfach nicht fähig sein, die Sache zu machen.
Sie fuhren in Goldsborough ein und gerieten in den Automobilverkehr auf dem Pennsylvania Boulevard. Vor der Verkehrsampel an der Kreuzung des Boulevards mit der Vierten Avenue mußte Kennedy stoppen.
»Was hast du eigentlich gegen Doc Hale?« fragte er plötzlich.
»Ich?« Sie zuckte die Achseln. »Nichts.«
Er spuckte aus dem Fenster.
Sie starrte geradeaus. »Na schön, ich mag ihn eben nicht leiden! Ich kann ihn nicht ausstehen, so wenig wie dich! Dich und deine ganzen Freunde! Bande von gottlosen, schlimmen Leuten, mit denen es auch kein gutes Ende nehmen wird. Immer lachen und dreckige Witze erzählen und Bier trinken und über Politik reden!« Sie wandte sich Kennedy zu, ihre Pupillen waren klein geworden vor Haß. »Schau dir doch Angeline an! Was hast du ihr angetan? Wie du zu mir gekommen bist und gesagt hast, daß du sie zur Frau willst, da war sie jung und stark, mit Augen, die etwas erkannten, und einem Mund, der sprechen konnte –«
Die Verkehrsampel zeigte Grün. Mit abrupter Schärfe schwang er das Steuer herum. Der Wagen kreischte nach rechts in die Vierte Avenue hinein und bog wieder links ab. Der Platz vor dem Gerichtsgebäude war schon voll geparkter Automobile. Ganz Goldsborough war erschienen.
Kennedy öffnete seine Jacke.
Der Gerichtssaal war überheizt, und die Menschen, die sich auf den Zuschauerbänken drängten, erzeugten noch mehr Wärme. Die amerikanische Flagge, die einen Teil der Wand über dem großen Lehnstuhl des Richters verdeckte, schien sich in der aufsteigenden Luft leise zu bewegen. Das einzige Geräusch im Saal war ein unterdrücktes Stimmengemurmel. Es erinnerte Kennedy an eine Begräbniskapelle, bevor die trauernden Hinterbliebenen eintreten und Schweigen einsetzt.
Er reckte den Hals. Sein Platz in der hintersten Reihe war als Beobachtungsposten nicht sehr geeignet; aber er war froh, überhaupt einen Platz gefunden zu haben. Er und Evaline waren fast die letzten gewesen, die noch hereingelassen worden waren. Unmittelbar hinter ihnen hatten die uniformierten Gerichtsdiener die Türen vor den Nasen der nachdrängenden Menge zugeschlagen. Hale hatte viele Freunde und noch mehr Feinde.
Seine Feinde hatten sich die besten Plätze reservieren lassen. Die vorderen Reihen waren mit Prominenz gespickt. Die ganze politische Maschine war höchst persönlich erschienen – Bürgermeister Purdy, Polizeichef Bodenheimer, die Ratsherren und die anderen hohen Beamten. Kennedy kannte sie alle, entweder von Angesicht oder von ihren idealisierten Photographien auf den Wahlplakaten von 1946. Sie alle hatten etwas an sich, das sie einander ähnlich machte, eine Art anmaßender Zufriedenheit mit sich selbst und mit der Welt, die sie manipulierten. Sie waren Männer, die sich nicht leicht in Wallung bringen ließen; sie sprachen gewichtig, wenn sie überhaupt sprachen, und dann brachten sie es noch fertig, nichts zu sagen. Nur einmal hatte Kennedy sie unsicher und nervös gesehen; das war während der Wahlkampagne gewesen, als Hale ihnen die Hölle heiß machte.
Lou Geoghan saß bescheiden in der zweiten Reihe. Er trug einen unauffälligen grauen Anzug. Was ihn aber von den gewöhnlichen Sterblichen abhob, waren die zwei Männer zu seinen beiden Seiten. Sie hielten sich bewegungslos; sie waren wie ein zu schwerer Rahmen, der das Bild erdrückt. Kennedy konnte nur ihre Nacken sehen, enorm und muskulös, und ihr gelocktes, mit Pomade festgeklebtes Haar. Zu viel Artillerie, dachte er sich, für einen Abteilungsleiter in der Stadtverwaltung.
Hale saß jenseits der hölzernen Barriere, die das eigentliche Gericht von der Zuschauerreihe trennte. Er saß vornübergebeugt auf seinem Stuhl; mit der linken Hand strich er sich gelegentlich das schon grau werdende Haar von seiner hohen, unregelmäßig geformten Stirn zurück, die rechte trommelte auf dem Rand des vor ihm stehenden Tisches. Ein Aktenstoß lag auf dem Tisch; Hale blickte ihn nicht an, er blickte auch nicht auf Trelawney, der neben ihm saß. Trelawney stützte sein scharfkantiges Gesicht auf seine eine gesunde Hand, als ob er sich um gar nichts kümmerte und nur wartete. Na ja, dachte Kennedy, der Mann war ein guter Advokat und hatte alles, was er konnte, getan; die Geschworenen waren bestimmt und saßen bereits auf der Geschworenenbank, und nur Seine Ehren der Richter fehlte noch.
Kennedy sah sich die Gesichter der Geschworenen an. Neun Männer und drei Frauen, saßen die Schöffen in zwei Reihen, ruhig und unberührt, mit dem Ausdruck erzwungener Gleichgültigkeit. Kennedy fragte sich, ob sie wirklich glaubten, daß sie objektiv urteilen könnten. Den ganzen Tag gestern hatte Trelawney wegen der Auswahl der Geschworenen gestritten und gefeilscht, gegen einen Schöffen nach dem anderen hatte er Einspruch erhoben und versucht, diejenigen auszuschalten, die zu offenbar von Geoghans Gunst abhingen; aber wen gab es schon in Goldsborough, der zu einer Klasse gehörte, in der man als Geschworener aufgerufen wurde, und der doch unabhängig genug war, seine eigenen Interessen wenigstens momentan vergessen zu können? Geschäft ist Geschäft, und ein guter Job ist ein guter Job; der Mensch denkt gar nicht darüber nach, und doch beeinflußt so etwas jeden seiner Gedanken.
Adair, dieser Lausebengel, flegelte sich am Tisch der Staatsanwaltschaft und lehnte sich so weit zurück, daß sein Stuhl nur auf zwei Beinen stand. Er konnte es sich leisten, sorglos zu erscheinen. Für ihn war die Sache bereits entschieden; und nicht nur für ihn, für alle die großen Herren da vorn, für Geoghan und Purdy und Bodenheimer; sie waren hier, um zu genießen, wie ein Mensch erledigt wurde. Auch Lonsdale war zu diesem Zwecke erschienen. Kennedy sah ihn erst jetzt. Lonsdale saß weiter seitlich. Unser ehrlicher, braver Herb Lonsdale, in einem besonders weißen Hemd, in einem makellos sauberen, maßgeschneiderten Anzug, sein Gesicht ein Arbeitergesicht, aber den Mund noch mehr verzogen als früher, und die Nase noch geschwollener vom Saufen. Die Reden, die der Mann 1946 geschwungen hatte! Die Versprechungen, die er gemacht hatte! Wenn ich Bürgermeister bin, wenn ihr mich und meinen guten Freund Hale und meinen guten Freund Trelawney wählt, dann werden wir aus dieser Stadt eine anständige und saubere Stadt machen, eine Stadt, wo die Polizei auf Seiten des ehrlichen Arbeitsmannes stehen wird, eine Stadt, wo man mit hoch erhobenem Kopf auf der Straße gehen kann! Hurra für Lonsdale, das ist unser Mann! Nur daß unser Mann sich ausgerechnet direkt vor dem Wahltag dünne machte. Die Menschen haben eben kein Gedächtnis. Wenn sie ein Gedächtnis hätten, nur genug Gedächtnis, um drei kurze Jahre zurückdenken zu können, so würden sie Lonsdale aus diesem Gerichtssaal und aus dieser Stadt heraus jagen.
Und doch … Er sah sich in den hinteren Reihen um. Die waren vollgepfropft mit Menschen seiner Art, zum Teil Hales Patienten, Männer und Frauen, denen Hale auf diese oder jene Weise geholfen hatte, und vielleicht steckte in ihnen ein Teilchen seiner eigenen Verbitterung, obwohl sie gar nicht wußten, worum es eigentlich hier ging. Es lag so in der Haltung, in der sie dasaßen, ungelöst, steif, oder sich nach vorn beugten, den Blick auf den immer noch leeren Riesenlehnstuhl des Richters gerichtet. Es war eine Spannung da, und sie wuchs mit jeder Minute. Die Spannung sprang auch auf Kennedy über. Die Leute fühlten eben auch, daß es sich bei diesem Fall um mehr handelte als nur um eine juristische Anklage gegen Doc Hale. Die Spannung kam von außerhalb des Gerichts, von den Gruben, in denen man jetzt ohne Tarifvertrag arbeitete, von der Unsicherheit, die auf jedem Menschen lastete, von den Entbehrungen und Beschwernissen, und sie sammelten sich hier in diesem Gerichtssaal. Deshalb war er hier, und deshalb waren auch seine Kumpel hier, und deshalb hatte Lonsdale kommen müssen, und deshalb saß Geoghan da vorn, flankiert von seinen Leibwachen, und deshalb hatten sich auch Bodenheimer, Purdy und die ganze feine Gesellschaft eingestellt.
Plötzlich fuhr er herum. Einer der Gerichtsdiener war auf ihn zugekommen – nein, nicht auf ihn, auf Evaline! Der Gerichtsdiener beugte sich zu ihr hinab und flüsterte ihr etwas zu. Sie stand auf und folgte ihm, den Hauptgang entlang.
Verflucht noch mal, Evaline! wollte er ihr nachrufen. Er wollte ihr sogar nachlaufen, aber sie war schon durch die Klapptür in der Barriere gegangen. Er saß noch immer da und sah dumm aus. Sie marschierte am Tisch der Staatsanwaltschaft vorbei und dann aus dem Saal, durch eine Tür, die sich in der getäfelten Wand seitlich hinter dem Podium des Richters befand.
Dann erhob sich alles.
Richter Pritchett bestieg das Podium, stand einen Augenblick lang hinter seinem reichgeschnitzten, schweren Tisch, blickte kurz über die Menschen in seinem Gerichtssaal hin und ließ sich in seinen Lehnstuhl sinken.
Adair stellte sich an die Ecke der Geschworenenbank, seinen Ellbogen auf das davor gebaute Geländer gestützt. Er sprach im Konversationston. Die juristische Terminologie tat er mit einer Handbewegung ab – als wollte er sagen: Darum brauchen wir uns hier nicht zu kümmern, meine Damen und Herren, weder Sie noch ich … In seinen Worten schwang ein Unterton höflichen Bedauerns mit. Er schien zum Ausdruck bringen zu wollen, daß es einfach eine Schande war, zwölf gute Amerikaner – Männer und Frauen, die alle Wichtigeres zu tun hatten – mit einer Angelegenheit zu belästigen, die von vornherein so klar lag wie der Fall Fiskus gegen Silas Hale.
»Sie zum Beispiel, gnädige Frau —«, wandte er sich an Schöffen Nummer drei, eine Frau in mittleren Jahren, die ihn befangen anstarrte, »Sie sind eine Hausfrau und Mutter. Wenn nun, Gott behüte, eines Ihrer Kinder plötzlich ernstlich erkrankte, würden Sie zulassen, daß der Drogist aus dem Laden an der Ecke es behandelt? Selbstverständlich nicht, obwohl Sie den Drogisten vielleicht als einen sehr lieben und netten Menschen kennengelernt haben. Sie würden einen wirklichen Arzt heranziehen … Und Sie, mein Herr« – dies zu Schöffen Nummer acht, einem jüngeren, aber schon glatzköpfigen Mann – »nehmen wir an, Ihre Frau Gemahlin ginge einem gesegneten Ereignis entgegen, würden Sie nicht dafür Sorge tragen, daß sie sich während der ganzen Zeit ihrer anderen Umstände in der Fürsorge des besten Arztes, den Sie kennen, befindet, und daß das Krankenhausbett für sie reserviert ist und bereitsteht? Sie würden keineswegs zulassen, daß, sagen wir, Tante Emily etwas für Sie so Kostbares wie Ihre Frau Gemahlin und das neuentstehende Leben behandelt – obzwar Sie Tante Emilys Kürbistorten und andere Haushaltstugenden durchaus zu schätzen wissen.
Sehen Sie, meine Damen und Herren, hier handelt es sich um einen Fall, der diesen beiden Beispielen durchaus ähnelt. Unsere moderne ärztliche Wissenschaft hat bewiesen, daß die Zähne ein ebenso wichtiger Teil des Körpers sind wie jeder andere. Darum wird unsere diesbezügliche Gesetzgebung nicht nur auf Ärzte, sondern auch auf Dentisten angewendet. Darum gestattet das Gesetz niemandem, Medizin oder« – er machte eine Pause und fügte mit besonderer Betonung hinzu – »oder zahnärztliche Heilkunde zu betreiben, ohne die hierzu notwendige Lizenz zu besitzen …«
Hale hörte nicht mehr zu. Er hatte versucht zuzuhören, als sei nicht er es, um dessen Hals dieser billige Demagoge mit seinen quasi-volkstümlichen Vergleichen die Schlinge legte, sondern als sei er jemand anderes, jemand außerhalb seiner selbst, der es sich leisten konnte, an dieser traurigen Farce Spaß zu finden. Aber es handelte sich eben doch um seinen eigenen Hals.
Seine Finger trommelten schneller.
Trelawney blickte auf. »Ruhig bleiben«, sagte er. »Soll er reden.«
Hale zwinkerte nervös. Nie hatten sie ihn antasten können. Sie hatten ihm nichts anhaben können, als er Reformen verlangte und mit den Menschen darüber sprach und die Menschen dafür gewann, und als er den Sprung von der Rede zur Tat machte, indem er eine besondere Kandidatenliste für die Primärwahlen innerhalb der Demokratischen Partei durchsetzte. Gelacht hatten sie über ihn. Als er dann aber die Primärwahlen gewann und so die Organisation der Demokratischen Partei in der Stadt Goldsborough von innen her eroberte, hatten sie nicht mehr gelacht. Gewinselt hatten sie und gedroht. Aber was konnten sie ihm schon tun? Man lebte schließlich in Amerika, und er hatte nur seine Bürgerpflicht erfüllt, und seine Hände waren absolut sauber. Daß sie sich dann Lonsdales bemächtigten und sich so den Sieg in den Endwahlen verschafften, war wieder eine andere Sache. Auch das war Amerika. Aber jetzt hatten sie ihn, Silas Hale, bei den Eiern und drückten zu – und alles im Namen des Gesetzes!
Adair war immer noch bei seinem gemütlichen Gespräch mit den Geschworenen. »Nicht jedermann ist so mir nichts, dir nichts imstande, sich gegen Kurpfuscherei zu schützen. Nicht jedermann ist genügend geschult und charakterfest, nicht jedermann hat genügend Urteilskraft, um sich gegen Kurpfuscherei zur Wehr zu setzen – besonders wenn er sich einem skrupellosen Menschen gegenüber sieht, einem geschickten Burschen sozusagen, der aus finanziellen oder anderen Gründen Leute, die ihm ihr Vertrauen schenken, gewissenlos ausnützt. Das ist der Punkt, meine Damen und Herren, wo die Regierung und die Staatsanwaltschaft eingreifen müssen …«
Trelawney lächelte verächtlich. »Zu plump«, flüsterte er Hale zu, »viel zu plump. Pritchett mag so was nicht.«
Hale blickte nach oben, auf die schwarz-umrobten Schultern und das unpersönliche, rosige Gesicht des Richters. Trelawney setzte zu viel Vertrauen auf Pritchett; Trelawney hatte sogar gesagt: Wir können froh sein, daß Pritchett den Fall zugewiesen bekommen hat. Auf diese oder jene Weise waren sämtliche anderen Richter am Kreisgericht Goldsborough Geoghan verpflichtet; Pritchett aber war zu sehr geachtet, zu alt und selber zu wohlhabend, um Unterstützung seitens des politischen Apparats nötig zu haben. Und außerdem, so hatte Trelawney gesagt, hat Pritchett einen angeborenen Sinn für Fairness.
Warum duldet er dann einen Menschen wie Geoghan? hatte Hale gefragt.
Und Trelawney hatte brüsk geantwortet, daß Geoghan den Richter überhaupt nicht interessiere.
Hale hatte nichts weiter gesagt. Er hatte nicht gefragt, warum Pritchett dann das Verfahren nicht niedergeschlagen habe. Trelawney konnte so etwas nicht verstehen. Trelawney war auch vermögend und gehörte zur Oberschicht. Pritchetts Reichtum war allerdings anderer Art. Pritchetts Geld stak in den Bergwerken um Goldsborough, und obwohl die Pritchett-Kohlen-undKoks-Gesellschaft jetzt nur noch ein Bestandteil des Amalgamated-Steel-Trusts war, war sie ein Millionen-Unternehmen. Und ihr Hauptaktionär war Richter Pritchett.
Der Richter schien durch ihn hindurchzublicken. Was sah so ein Mann in ihm? Etwas Unbequemes, einen Störenfried, einen Rebellen, eine Bedrohung der bestehenden Ordnung, an welcher der Richter in so beträchtlicher Weise Anteil hatte. Auch das konnte Trelawney nicht erkennen, und deshalb konnte er den dummen Auslassungen Adairs so gleichgültig zuhören – Auslassungen, die gar nicht so dumm waren für einen Staatsanwalt, der sich keine Sorgen um die Einstellung des Richters zu machen brauchte.
»Die Staatsanwaltschaft wird beweisen, daß der Angeklagte die zahnärztliche Heilkunde ohne Lizenz betrieben hat, das heißt ohne das Recht dazu und ohne die dafür notwendigen Kenntnisse. Wir werden solche unwiderlegliche Beweise und Zeugenaussagen beibringen, daß Sie, meine Damen und Herren, gar nicht anders können werden, als den Angeklagten für schuldig zu befinden.«
Ohne sich nach dem Richter oder nach Geoghan umzusehen, schritt der Staatsanwalt zu seinem Tisch zurück, setzte sich hin und streckte die Beine aus. Pritchett nickte Trelawney zu. Trelawney lehnte sich nach vorn und richtete das Gelenk seiner Stützprothese gerade. Dann griff er nach dem langen, kräftigen Stock, der auf dem Tischende lag, setzte ihn hart auf den Boden, zog sich daran hoch und schleppte sich mit verkniffenem Gesicht zu der Geschworenenbank hinüber.
Winzige Schweißtröpfchen standen auf Lauffers Stirn. Adairs Gesicht schwebte so dicht vor seinem, daß er befürchtete, der Atem des Mannes könnte seine Brillengläser beschlagen. Lauffer versuchte abzurücken, aber der solid gezimmerte Zeugenstuhl war plötzlich zu eng geworden. Es war dieselbe Rückwärtsbewegung, die seine Patienten immer machten, wenn sie im Operationsstuhl saßen und er ihnen mit dem Bohrer zu Leibe rückte. Komisch, dachte er, wie die Gedanken der Menschen in kritischen Augenblicken wandern.
»Wie bitte?« fragte er.
»Ich habe Ihnen doch erklärt«, sagte der Staatsanwalt geduldig, »Sie brauchen nicht nervös zu sein. Ich möchte nur von Ihnen wissen, wie lange Sie schon für den Angeklagten arbeiten.«
Lauffer nahm seine Brille ab. Er bemerkte, daß seine feuchten Finger ihren Abdruck auf den Gläsern hinterließen. »Mit dem Angeklagten«, sagte er irritiert und bedauerte sofort, Adair widersprochen zu haben.
»Verzeihung«, lächelte Adair. »Mit dem Angeklagten. Wie lange?«
»Seit 1947.«
Durcheinanderzubringen versucht er mich, dachte Lauffer. Name? Robert Lauffer. Wie alt? Neununddreißig. Geburtsort? Philadelphia. Beruf? Zahnarzt. Akademischer Grad? Doktor der Zahnärztlichen Heilkunde – promoviert 1933 an der Zahnärztlichen Hochschule des Staates Pennsylvania. Verheiratet? Nicht mehr. Also geschieden? Jawohl … Er muß wohl so fragen, wegen des Protokolls. Aber die Art und Weise, wie er fragt! Ich habe doch schließlich nichts Schlimmes getan, ich bin doch kein Verbrecher, ich bin doch nur ein Zeuge!
»Und was haben Sie vor 1947 gemacht?«
Lauffer bewegte sich unbehaglich. Was hatte das mit diesem Fall zu tun? »Na ja«, sagte er, »ich war in der Armee, 57. Etappen-Hospital in Frankreich.«
»Das war bis zu Ihrer Entlassung aus der Armee im Jahre 1945.« Adair lächelte schon wieder. »Aber zwischen 1945 und 1947?«
»Ich hatte meine eigene Praxis in Philadelphia«, gab Lauffer mit leiser Stimme zu.
»Bitte sprechen Sie deutlich«, ermahnte Adair. »Der Gerichts-Stenograph möchte Sie auch hören.«
»Ich hatte meine eigene Praxis«, wiederholte Lauffer.
Das Gesicht des Staatsanwalts war zu einem unscharfen weißen Fleck geworden, der sich kreuz und quer über Lauffers Blickfeld schob. Er dachte an Ethel, seine Frau. Ethel hatte das Geld gehabt. Alles, was in seiner Praxis stand, hatte ihr gehört, er selber dazu. Und er dachte an den schrecklichen Tag, da sie ihm nach Camden, New Jersey, nachgefahren war und mit dem Detektiv vor der Tür stand, und er in Unterhosen, und die beiden Huren splitternackt auf der Couch, und an den fürchterlichen Zorn, der sich schrill und gnadenlos über ihn ergossen hatte – und dann hatte er auf einmal keine Frau und keine Praxis mehr gehabt.
»Na also«, sagte der Staatsanwalt. »Wenn Sie vorher eine eigene Praxis hatten und danach für den Angeklagten arbeiten mußten – das war ein ganz hübscher Abstieg, nicht?«
Trelawneys Stimme war scharf. »Ich erhebe Einspruch!«
»Dem Einspruch wird stattgegeben«, sagte der Richter. »Mr. Adair, es ist für das Gericht nebensächlich, ob der Zeuge glaubte, daß er auf der sozialen Leiter auf- oder abstieg.«
»Jawohl, Euer Ehren«, sagte Adair gehorsam. Er hatte ja bereits den Geschworenen zu Bewußtsein gebracht, was er wollte, und er wußte, daß Lauffer rapide genau in die Geistesverfassung hineinglitt, in der er ihn brauchte. Er trat zurück an seinen Tisch und blätterte ein paar Akten durch. Er suchte gar nichts; er ließ Lauffer nur ein bißchen schwitzen.
»Nun, Herr Dr. Lauffer«, fragte er plötzlich, aber immer noch von seinem Tisch aus, »erinnern Sie sich vielleicht an eine Gelegenheit während der mehr als zwei Jahre Ihrer Geschäftsverbindung mit dem Angeklagten, wo dieser selbst eine zahnärztliche Behandlung vornahm?«
»Nein.«
Hände in den Taschen, die Schultern etwas nach vorn gezogen, pirschte Adair sich an den Zeugenstuhl heran.
»Sie sind sich Ihrer Aussage absolut sicher, ja, Herr Dr. Lauffer?«
»Einspruch!« von Trelawney.
»Einspruch abgelehnt.«
Adair wandte sich Pritchett zu. »Euer Ehren, ich wollte nur die Aufmerksamkeit des Zeugen darauf lenken, daß Meineid strafbar ist.«
Trelawney langte nach seinem Stock. Aber er wußte, daß er zum Aufstehen zu viel Zeit brauchte, und entschied sich, sitzend zu sprechen. »Was ist die Absicht des Staatsanwalts? Den Zeugen einzuschüchtern?«
»Wenn die Verteidigung eine juristische Frage mit der Staatsanwaltschaft zu besprechen hat, so wäre es angebracht, diese Diskussion vor dem Richtertisch stattfinden zu lassen«, sagte Adair.
Trelawney verkniff den Mund. Man hörte das Knacken des Gelenks seiner Prothese.
Etwas rührte sich in dem großen Lehnstuhl. »Bitte, bitte, meine Herren!« kam Richter Pritchetts milde, ebenmäßige Stimme von oben. »Eine Besprechung dieser Art ist hier unnötig. Ich nehme an, daß der Zeuge, als ein gebildeter Mensch, über die Frage des Meineids Bescheid weiß. Wollen Sie fortfahren, Herr Staatsanwalt.«
Lauffer hatte den Streit verfolgt. Aber es war nur eine kurze Ruhepause für ihn gewesen; der Staatsanwalt machte sich schon wieder an ihn heran.
»Also – Sie hatten erklärt, Herr Dr. Lauffer, daß, soweit Sie sich erinnern können, der Angeklagte während der Zeit Ihrer Geschäftsverbindung mit ihm an niemandem eine zahnärztliche Behandlung vornahm?«
Lauffer griff nach dem Strohhalm, den der Staatsanwalt ihm hingehalten hatte. Dankbar wiederholte er die allentschuldigende Redensart: »Soweit ich mich erinnern kann –« und fügte hinzu: »Nein.«
Dabei sprach er die reine Wahrheit! Gewiß, Doc Hale sah sich den Mund des Patienten gerne selber an – aber als Behandlung konnte man so etwas doch keineswegs bezeichnen. Lauffer war auch fest entschlossen, strikt bei der Wahrheit zu bleiben. Warum aber machte der Staatsanwalt ihm dann das Leben so schwer?
»Würde es Ihr Gedächtnis auffrischen«, fragte Adair hilfsbereit, »wenn ich den Namen von Mrs. Evaline Polowski erwähnte?«
Lauffer saß stumm da. Er wußte, daß irgendeine Antwort von ihm erwartet wurde, aber welche Antwort der Staatsanwalt von ihm hören wollte, war ihm unklar.
»Nun, Mrs. Polowski war doch Ihre Patientin, nicht wahr?«
»Jawohl.«
»Und am Nachmittag des 17. Juli 1949 kam sie doch zu Ihnen zur Behandlung, nicht wahr?«
Die Schweißtröpfchen auf Lauffers Stirn waren schwer geworden und vereinten sich zu großen, fettigen Perlen. Er fühlte, wie sie herabzurinnen begannen.
»Ich weiß nicht«, sagte er elend.
»Haben Sie denn kein Visitenbuch?« stieß Adair zu.
»Ja – ja, aber natürlich! Nur hab ich’s eben in meinem Sprechzimmer liegen …«
»Sie geben also zu, daß Sie eine Patientin namens Evaline Polowski hatten und daß diese sich während der zweiten Hälfte des Monats Juli dieses Jahres bei Ihnen in Behandlung befand, ja?«
»Ja.«
»Nun, an diesem Nachmittag – wir werden später noch feststellen, daß es sich um den Nachmittag des 17. Juli handelt –, als Mrs. Polowski sich also in Ihrem Sprechzimmer aufhielt, hat der Angeklagte ihr da irgendeine zahnärztliche Behandlung angedeihen lassen?«
»Soweit ich mich erinnern kann –«
»Jawohl, Herr Dr. Lauffer, soweit Sie sich erinnern können?«
Lauffer blinzelte. Die Gesichter im Saal, lauter weiße Flecke, hörten auf, sich zu bewegen. Wahrscheinlich starrten alle auf ihn.
»Nein«, sagte er, »er hat Mrs. Polowski nicht behandelt. Ich habe sie behandelt.«
»Aha, jetzt erinnern Sie sich plötzlich?«
Irgend etwas war falsch gewesen, dachte Lauffer. Hatte er zu viel gesagt?
»Und erinnern Sie sich, Herr Dr. Lauffer, daß der Angeklagte Ihr Sprechzimmer betrat, während Mrs. Polowski vor Ihnen im Behandlungsstuhl saß? Das ist doch so gewesen, nicht wahr?«
»Vielleicht …«, sagte Lauffer. Nein, sehr wahrscheinlich sogar. Aber wie konnte man das so genau wissen? Docs Laboratorium lag direkt neben dem Sprechzimmer, und Doc ging ein und aus, wie es ihm einfiel; es war jedenfalls nie eine Angelegenheit gewesen, der Lauffer besondere Aufmerksamkeit schenkte.
»Vielleicht«, sagte Adair mit einem bedeutungsvollen Achselzucken in Richtung der Geschworenen, »ist das einzige Wort, das vor Gericht nicht gestattet wird. Es muß entweder Ja heißen, Herr Dr. Lauffer, oder Nein.«
»Na ja, ich denke schon, daß Doc manchmal hereinkam. Und für Mrs. Polowski mußte er ja ein Gebiß machen. Nicht, daß meine Gipsabdrücke nicht genügten; so was mach ich mit der linken Hand; und jeder Zahntechniker kann von guten Gipsabdrücken ein Gebiß herstellen; aber Doc sieht sich die Sache immer gern selber an. Wie ich schon sagte, nötig ist es nicht –«
»Entschuldigen Sie, Herr Dr. Lauffer. Sie haben also gesagt, daß der Angeklagte gewöhnlich in Ihr Sprechzimmer kommt, wenn jemand eine Zahnprothese braucht, und daß er sich den Patienten gerne selber ansieht?«
»Ja«, antwortete Lauffer und zögerte. »Das hab ich gesagt.«
»Und ist er ins Sprechzimmer gekommen, als Mrs. Polowski im Behandlungsstuhl saß?«
»Ja.«
»Und hat er ihren Mund irgendwie berührt?«
Ein scharfes »Einspruch!« von Trelawney.
»Stattgegeben!« sprach das Orakel vom Richtertisch.
Adair verbeugte sich andeutungsweise vor dem Richter.
»Das wäre alles«, sagte er, und zu Trelawney gewandt, »Sie können den Zeugen übernehmen!«
Kennedy hatte das Gefühl, als wäre es ihm in seiner Haut zu eng. Und unter seiner eigenen Nase war das alles abgekartet worden! Da hatten sie Doc Hale einen Strick gedreht, und sein Miststück von Schwiegermutter, die unter seinem eigenen Dach lebte und von seinem eigenen Tisch aß, hatte den Hanf dazu geliefert.
Er wünschte, sie hätte den öligen frommen Quatsch, den sie von sich geben würde, schon ausgesagt, damit er sie irgendwo allein erwischen könnte. Wer hatte sie nur dazu gekriegt? Und was hatte sie davon? Und wie konnte es überhaupt passieren, wo sie mit ihm im selben Haus lebte?
Aber vorläufig mußte er erst mal abwarten, bis dieser Wurm Lauffer sich durchgewunden hatte. Trelawney nahm ihn sich gerade vor. Ein schönes Geschäft, diese Justiz! Immer zwei Bedeutungen bei allem, was sie sagten, und vielleicht noch eine dritte, die hinter den andern zweien lag – und meistens war es diese dritte, um die es plötzlich ging.
Trelawney war geschickter als Adair. Erst brachte er Lauffer dazu, auszusagen, daß gar nichts Unrechtes dabei war, wenn ein Zahntechniker einem Patienten, der eine komplizierte Zahnprothese benötigte, in den Mund schauen wollte. Dann ließ er Lauffer erklären, daß auch vom zahnärztlichen Standpunkt nichts dagegen einzuwenden sei. Dann behandelte er genau das Gebiet, das Adair bereits durchgeackert hatte, aber merkwürdigerweise ergaben Lauffers Antworten plötzlich einen ganz anderen Sinn. Und schließlich veranlaßte er Lauffer, klar und deutlich zu berichten, daß – jawohl! – Doc Hale sich Evalines dreckiges Maul zwar betrachtet, es aber keineswegs berührt habe.
Kennedy erhob sich halb. Jetzt würde Evaline auftreten, und das wollte er in allen Einzelheiten sehen! Aber nein – Lauffer, der schon vom Zeugenstuhl aufgestanden war, mußte sich wieder hinsetzen. Adair kam auf ihn zu, frisch und fröhlich wie ein Ersatzmann beim Fußball. Er setzte seinen Fuß auf die unterste Stufe der Plattform, auf der der Zeugenstuhl festgeschraubt war, und sagte: »Nun, Herr Dr. Lauffer, es tut mir leid, aber es gibt doch noch einige Fragen, über die Sie uns etwas erzählen sollten.«
Hales Nerven hatten sich allmählich beruhigt. Er war sogar jetzt imstande, Lauffer zuzuhören und zu versuchen, einen Sinn in dem Frage- und Antwortspiel festzustellen. Er hatte Lauffer nie sehr gemocht; es gab zu viel Kleinliches an dem Mann. Man mußte ihn als ein notwendiges Übel akzeptieren. Was er übrigens auch war. Denn wenn 1929 die große Wirtschaftskrise nicht gekommen wäre, dann hätte er jetzt keinen Lauffer gebraucht. Er selbst wäre ein voll ausgebildeter Zahnarzt geworden.
»Jawohl«, sagte Lauffer aus, »die Apparatur gehörte Doc Hale.«
Adair sprach mehr zu den Geschworenen als zu Lauffer. »Die Sprechzimmereinrichtung gehört dem Angeklagten, die zahnärztliche Apparatur gehört dem Angeklagten, alle Rechnungen wurden von dem Angeklagten bezahlt, die von den Patienten einkommenden Honorare wurden von dem Angeklagten entgegengenommen – und Sie wollen noch behaupten, Herr Dr. Lauffer, daß Sie sein Partner sind?«
Hales Augen begannen zu zwinkern, wie es oft geschah, wenn Ärger sich seiner bemächtigte. Auch ein Partner! Er brauchte leider einen Zahnarzt, weil in einer Stadt, in der ein Geoghan die Macht hatte, nur sein eigener Zahnarzt ihm zahntechnische Arbeit geben konnte. Er hatte vor Lauffer schon andere Zahnärzte für sich arbeiten lassen, und keiner von ihnen hatte die Frage der Partnerschaft überhaupt erwähnt; Lauffer aber war ein eingebildeter Esel, der nicht vergessen konnte, daß er in Philadelphia eine eigene Praxis gehabt hatte, und der glaubte, daß sein zahnärztliches Diplom einen Menschen aus ihm machte. Warum benahm er sich denn nicht wie ein Mann, statt sich von dem Staatsanwalt herumstoßen zu lassen!
Nur – und das war wirklich ein Witz! – schien es, daß Lauffers Gerede über seine Partnerschaft ausgerechnet das war, was Adair nicht in den Kram passen wollte. Adair hämmerte immer noch auf ihm herum: »Aber Sie haben doch eben gesagt, Herr Dr. Lauffer, daß Sie eine Art Fifty-fifty-Abmachung mit dem Angeklagten haben. Hat er Ihnen tatsächlich die Hälfte von allem einkommenden Geld ausgezahlt?«
»Mrs. Hale führte die Geschäftsbücher«, sagte Lauffer unbehaglich. Im Publikum lachte jemand, und Richter Pritchett blickte auf.
Der Staatsanwalt ging auf und ab mit federnden Schritten, die zeigten, daß ihm das Verhör Spaß machte. »Ohne daß ich die Bücher von Gerichts wegen herbringen lasse und sie prüfe – würden Sie sagen, Herr Dr. Lauffer, daß Sie wirklich fünfzig Prozent erhalten haben?«
»Ich weiß nicht.«
Hales Gesicht rötete sich. Bis auf den Cent hatte der Bursche nach Abzug der Unkosten genau die Hälfte von allem Geld bekommen; aber er war nie zufriedenzustellen, und wenn Rosemary ihm die Bücher zeigte, glaubte er ihr nicht!
»Sie wissen also nicht! … Wurden Sie regelmäßig bezahlt, Herr Dr. Lauffer?«
»Ungefähr.«
»Jede Woche? Alle zwei Wochen?«
»Jede Woche, wenn Geld da war.«
»Gut. Wenn ein Mann regelmäßig jede Woche bezahlt bekommt, so nennt man das doch ein Gehalt, nicht wahr?«
Trelawney erhob die Hand. »Einspruch!«
»Dem Einspruch wird stattgegeben.«
Adair nickte ernsthaft. »Ich werde die Frage anders stellen, Euer Ehren … In Anbetracht der Tatsache, Herr Dr. Lauffer, daß Sie regelmäßig eine Summe erhielten, die fünfzig Prozent des Profits im Unternehmen des Angeklagten entsprochen haben mag oder auch nicht, würden Sie nicht lieber sagen, daß Sie auf der Grundlage eines Gehaltes für ihn arbeiteten?«
»Ich bin sein Partner«, sagte Lauffer verbockt. »Mein Name ist auf die Eingangstür zur Praxis aufgemalt!«
»Aber der Name des Angeklagten ist groß und breit vor der Hausfront in Neon-Licht zu lesen, das stimmt doch?«
»Nun – ja.«
Der Ton des Staatsanwaltes wurde einschmeichelnd. »Also, Herr Dr. Lauffer, ob Sie nun der Angestellte oder der Partner des Angeklagten sind, jedenfalls haben Sie ihm gegenüber Ihre Loyalität bewiesen –«
»Ich erhebe Einspruch!« rief Trelawney. »Das ist kein Kreuzverhör – das ist ein auf die Geschworenen zugeschnittenes Theater!«
Richter Pritchetts Kopf hob sich, sein rosiges Gesicht erschien so gleichmütig wie immer. »Wir werden es durchgehen lassen. Wenn die Staatsanwaltschaft einem Zeugen, der dem Angeklagten freundlich gesinnt ist, ein Kompliment zu machen wünscht – warum sollen wir darin ein Problem sehen? Haben Sie noch Fragen an den Zeugen, Mr. Adair?«
»Ich war eigentlich fertig, danke, Euer Ehren.«
Hale blickte kurz auf die tiefen Falten, die sich um Trelawneys Augen gebildet hatten. Trelawney fing offensichtlich an, einiges über Richter Pritchett zu lernen. Der Advokat tat ihm sogar ein wenig leid, obwohl er sich sein Mitleid lieber für sich selber aufsparen sollte. Denn das ganze Gebäude der Glaubwürdigkeit, das Trelawney um Lauffer errichtet hatte, war von Adair zerstört worden.
»Keine weiteren Fragen«, sagte Trelawney.
Zweites Kapitel
Evaline schob ihre Füße so weit wie möglich unter den Stuhl. Ihre Füße, ihre Hände, ihr Haar, überhaupt alles an ihr schien irgendwie nicht zu ihr zu gehören. Ihr einziger Rettungsanker war ihre Handtasche mit den Zähnen darin – ihre Handtasche und die ruhige, ermutigende Stimme des Staatsanwalts. Was für ein verständnisvoller Mann! Wenn er ein Pfarrer wäre, würde sie Pater Boleslavs Gemeinde im Handumdrehen verlassen und zu Mr. Adair in die Kirche gehen.
»Nun, wann wurden Sie sich also darüber klar«, fragte Adair, »daß Sie ein Gebiß brauchten?«
Evaline vermied es, in den Gerichtssaal zu blicken. Zwar war die Frage wortwörtlich die, die jetzt an die Reihe kommen mußte; aber als er diese Frage damals zwischen den vier Wänden seines Büros stellte, hatte sie doch anders geklungen. Es war natürlich keine Schande, wenn einer keine Zähne hatte; viele Leute hatten keine; dennoch war es nicht angenehm für einen, in aller Öffentlichkeit über seine körperlichen Mängel sprechen zu müssen …
»Hab schon seit langem keine Zähne mehr!« sagte sie herausfordernd. »Der Herrgott gibt sie, der Herrgott nimmt sie, so ist das im Leben!«
Adair verzog die Stirn. Die religiöse Note war nicht vorgesehen gewesen, und er war nicht sicher, was die Reaktion darauf sein würde. Schöffe Nummer elf grinste, aber der Rest der Geschworenen schien sich damit abzufinden.
»Immerhin ist es doch nicht gerade schön, wenn man keine Zähne mehr hat?« sagte Adair, um sie auf das Gleis zurückzulenken.
»Schön? Ach, Mr. Adair, es ist, als ob man auf Erden schon im Fegefeuer säße! Wie ich noch Zimmer vermietete, mit Pension, da mußte ich meinen Mietern doch richtiges Essen vorsetzen, das Beste vom Besten, sie arbeiteten ja schwer genug; aber für mich gab’s nur Brei und Weichgekochtes, die ganze Zeit immer nur Brei und Weichgekochtes. Wie möchte Ihnen das gefallen?«
Im Saal bildeten sich Inseln nur mit Mühe unterdrückten Gelächters. »Ich glaube nicht, daß es mir gefallen würde«, sagte Adair, und erkannte plötzlich, daß ihre Stegreifbemerkungen gerade das waren, was bei den Proben gefehlt hatte. Er hatte sich Sorgen gemacht, daß sie zu steif, zu mechanisch sprechen würde; wer aber konnte die Wahrhaftigkeit einer Person bezweifeln, die so frisch von der Leber weg redete. Er nickte ihr aufmunternd zu. Ihre Füße krochen unter dem Zeugenstuhl hervor, ihre Finger entspannten sich. »Wann entschieden Sie sich also, etwas wegen Ihrer Zähne zu unternehmen?«
»Letzten Sommer, im Juli war das. Pater Boleslav hatte über das Lamm Gottes gepredigt, und das gab mir zu denken –«
Evaline blickte über das gewellte Haar des Staatsanwalts hinweg auf Pater Boleslav, der in der sechsten Reihe neben Rosemary Hale saß. Sie war sehr stolz darauf, daß sie ihn so vor allen Leuten herausgestrichen hatte; sie verehrte ihn sehr, obwohl Mr. Adair ihm vorzuziehen war.
Adair begann den Zusammenhang zwischen dem Lamm und der Tatsache, daß sie keine Zähne hatte, zu verstehen. Bei jedem anderen Menschen wäre die Gedankenverbindung gotteslästerlich gewesen; bei ihr aber war es ganz harmlos herausgekommen. »An einem Sonntag im Juli?« fragte er.
»Jawohl, Sir. Und furchtbar heiß war es auch.«
»Und dann, am Nachmittag des 17. Juli, gingen Sie zum Zahnarzt?«
»Am Morgen komm ich ja nie dazu!« sagte sie. »Viel zuviel Arbeit. Wenn man sich um sechs Kinder kümmern muß und eine kranke Tochter hat, und die Mickie – das ist das Mädel, das schon erwachsen ist – nur im Haus herumfaulenzt …«
»Mr. Adair!« sagte Pritchett und wiegte sich sanft in seinem Lehnstuhl, »machen Sie der Zeugin doch bitte klar, daß sie sich darauf beschränken soll, Ihre Fragen zu beantworten.«
Adair hatte die richterliche Mahnung halb und halb erwartet. Die Frau war unkontrollierbar; solange sie ein Publikum hatte, spielte sie sich auf. Aber wenn er sie zu scharf anpackte, verlor sie möglicherweise den Faden ganz und gar.
»Na, sehen Sie, Mrs. Polowski«, sagte er schonend, »Sie haben wohl selber gehört, was Seine Ehren gesagt haben. Sie müssen genau auf das antworten, was ich Sie frage. Sie gingen also zum Zahnarzt. Zu welchem Zahnarzt?«
Sie dachte einen Moment nach. »Doc Hale«, sagte sie mit gepreßter Stimme.
»Meinen Sie nicht, zu Dr. Lauffer?«
»Ist das nicht dasselbe?« sagte sie prompt.
»Einspruch!« hakte Trelawney ein. »Ich beantrage, daß das aus dem Protokoll gestrichen wird.«
Gerade darauf hatte Adair hingearbeitet. Des Richters: »Man streiche!« störte ihn ganz und gar nicht. »Mrs. Polowski«, erklärte er ihr mit großer Liebenswürdigkeit, »vor Gericht darf man keine persönlichen Meinungen aussprechen, nur Tatsachen berichten. Erzählen Sie uns bitte, warum Sie just diesen Zahnarzt gewählt haben.«
»Einspruch!« Auf Trelawneys scharfgeschnittenem Gesicht zeigte sich intensive Wachsamkeit. »Der Staatsanwalt hat der Zeugin soeben auseinandergesetzt, daß persönliche Meinungen fehl am Platze sind, und in der nächsten Sekunde verlangt er selbst von ihr, ihre Meinung zum besten zu geben.«
»Einspruch wird abgelehnt!« sagte der Richter. »Ich betrachte die Motive, die eine Person zu einem gewissen Entschluß veranlassen, als Teil der Beweisführung. Fahren Sie fort, Mr. Adair.«
All das ging weit über Evalines Verständnis. Sie konnte ja auch nicht wissen, daß Pritchett Trelawney im Verdacht hatte, er baue schon jetzt seinen Fall für die Berufungsinstanz auf; sie befürchtete vielmehr, daß sie irgendwo einen Fehler gemacht hatte und daß der alte Herr da oben, der ihr so freundlich gesinnt sein sollte, sie dafür tadelte. Auch glaubte sie, vorwurfsvolle Blicke von der Geschworenenbank her zu bemerken; nur das Gesicht des Staatsanwalts blieb weiter freundlich.
»Sprechen Sie nur ruhig, Mrs. Polowski!« redete er ihr zu. »Erzählen Sie uns, warum Sie zu der Firma Lauffer & Hale gingen.«
»Oben in Pritchett Heights, wo ich wohne, da gehen alle Leute zu Doc Hale.«
»Weshalb?«
»Die glauben, sie kommen dabei billiger weg, deshalb! Und wenn einer nicht viel Geld hat, muß er sich die Preise genau ansehen.«
»Wußten Sie, welcher von den beiden Herren in den Räumen dieser Praxis der Zahnarzt war?«
»Nicht gleich. Oben in Pritchett Heights reden die Leute ja nur von Doc Hale, und unsereiner denkt gar nicht daran, daß da noch ein anderer Herr ist.«
»Ich erhebe Einspruch!« sagte Trelawney.
»Abgelehnt!« sagte Richter Pritchett, die einzelnen Silben dehnend.
»Nun berichten Sie uns mal, Mrs. Polowski, was geschah, nachdem Sie in das zahnärztliche Sprechzimmer kamen.«
Evaline lehnte sich bequem zurück. Von jetzt an lief die Geschichte glatt bis zum Ende durch, und sie kannte jeden Satz auswendig. Sie sah Doc Hale unten am Tisch der Verteidigung sitzen, die Höcker auf seiner Stirn rot angelaufen, die Augen tief eingesunken unter den Brauen. Geschieht dir recht, dachte sie, schwitz du nur tüchtig! Der Antichrist nahm viele Gestalten an, und der Mann da unten war eine davon.
»Ich komme herein«, sagte sie, »und ich habe Angst. Ich bin schon eine alte Frau, und ich habe mein ganzes Leben lang hart gearbeitet, aber vor dem Doktor und dem Zahnarzt hab ich immer Angst gehabt. Dr. Lauffer war allerdings sehr nett zu mir. Er hat mich in den Stuhl gesetzt, den er da hat, und hat gesagt: Seien Sie nur ruhig, es wird Ihnen schon nicht weh tun. Und dann hab ich eben meinen Mund auf gemacht, und er hat mit so einem kleinen Spiegel drin herumgeschaut – und dann –«
»Ja, Mrs. Polowski«, sagte Adair, »und dann?«
Ganz weit hinten, in der letzten Reihe, sah sie Kennedy. Sie hatte keine Furcht mehr, weder vor ihm noch vor irgend jemandem. Sie hatte ihr Gebiß, und es hatte sie keinen roten Penny gekostet. Und Adair hatte ihr versichert, wenn sie Schwierigkeiten haben sollte, würde er das schon erledigen.
»Und dann kommt Doc Hale herein und fragt Dr. Lauffer: Was will denn die? Und Dr. Lauffer sagt: Sie braucht ein Gebiß. Doc Hale schiebt Dr. Lauffer zur Seite und sagt: Lassen Sie mich mal sehen! Und zu mir sagt er: Machen Sie den Mund auf, aber weit! Dann stochert er mir im Munde herum und sagt zu Dr. Lauffer: Die Zähne da müssen raus. Und Dr. Lauffer sagt: Aber warum denn? Die Zähne sind doch ganz in Ordnung –«
»Zu der Zeit hatten Sie noch Zähne?«
»Gerade zwei Stück.«
»Sprechen Sie weiter, Mrs. Polowski.«
»Dann fingen die beiden Herren an, sich zu zanken.«
»Erzählen Sie uns davon.«
»Na ja, Dr. Lauffer sagte, daß die Zähne doch sehr gut wären, um das Gebiß schön zu verankern, und Doc Hale sagte zu ihm: Was verstehen Sie schon davon? Und daß er mehr in seinem kleinen Finger wüßte als Dr. Lauffer in seinem ganzen Kopf, und daß es überhaupt viel billiger wäre, ein einfaches Gebiß zu machen, und wenn Dr. Lauffer die Zähne nicht ziehen wollte, dann würde er sie eben selber ziehen, und basta. Dann sagte Dr. Lauffer, mit so einer Sache wollte er nichts zu tun haben, und Doc Hale wurde fürchterlich wütend und griff schnell nach einem von den Dingern, mit denen Zähne herausgezogen werden, und hat es mir in den Mund hineingezwungen; aber ich hab geschrien und gesagt: Bitte, bitte, Herr Dr. Lauffer, so helfen Sie mir doch, er wird mir weh tun, und Schmerzen kann ich nicht aushalten; und Doc Hale sagte, wenn ich nicht mit dem Gezeter aufhörte, würde er mich nach Hause schicken; da hat Dr. Lauffer dann gesagt, daß er es schon machen würde, und er hatte eine Nadel in der Hand, und mit der Nadel hat er mich gestochen, und Doc Hale ging noch ganz wütend raus, und Dr. Lauffer zog mir die Zähne, aber er hat mir nicht weh getan dabei …«
Sie hatte sich außer Atem geredet. Die Haut über ihren Backenknochen war rot geworden, und sie blickte mit feindselig flackernden Augen auf Hale.
»Haben Sie Ihr Gebiß bei sich?« fragte Adair.
»Aber klar!« sagte Evaline. Sie griff in ihre Handtasche, holte die saubere kleine Pappschachtel heraus und übergab sie dem Staatsanwalt.
Adair öffnete die Schachtel. Er nahm das Gebiß vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und trat auf den Richtertisch zu.
»Ich bitte Euer Ehren um Erlaubnis, den Geschworenen diesen Gegenstand zeigen zu dürfen, ohne ihn als Beweismaterial den Gerichtsakten beizufügen. Es ist ja wohl selbstverständlich, daß die Zeugin ihre Zähne benötigt.«
Diesmal war das Gelächter im Saal hemmungslos. Adair spielte den Leuten eine wunderbare Komödie vor, und Geoghan und seine Anhänger wußten so etwas zu schätzen. Sogar Richter Pritchett gestattete sich ein dünnes Lächeln, als er fragte: »Haben Sie etwas dagegen, Mr. Trelawney?«
Trelawney zuckte die Achseln. »Die Verteidigung stellt nicht in Abrede, daß ein Gebiß für die Zeugin angefertigt wurde.«
Adair ging von einem Ende der Geschworenenbank zum andern und hielt dabei das Gebiß in die Höhe. Das Gelächter, das etwas abgeflaut war, brach wieder los.
Evaline fühlte sich gekränkt. Sie fand weder ihre Zähne noch ihre Leidensgeschichte komisch. »Glauben Sie vielleicht, daß ich das Ding da so leicht gekriegt habe?« sagte sie mit plötzlicher Heftigkeit.