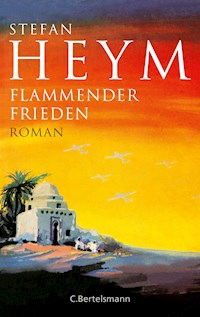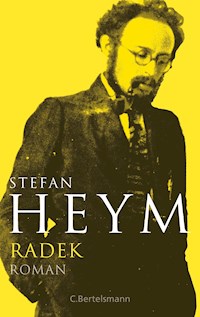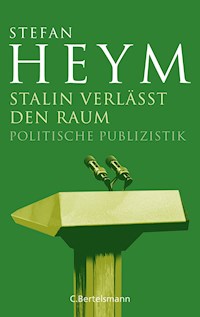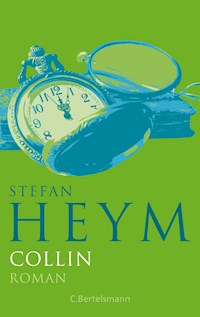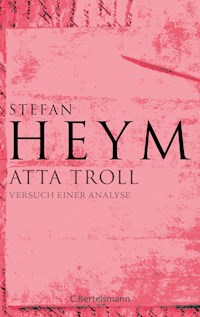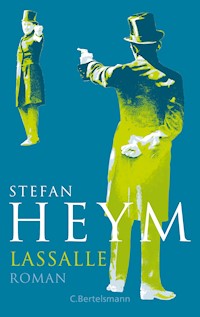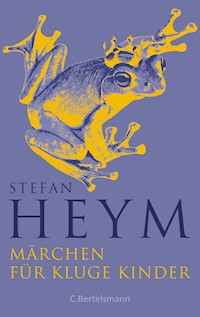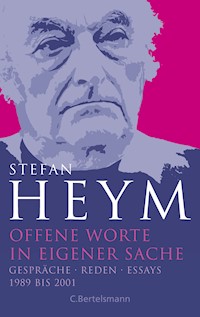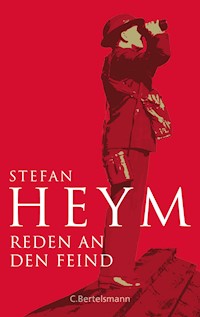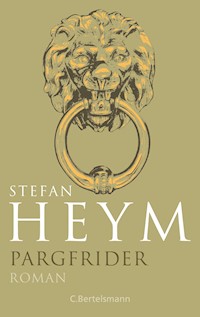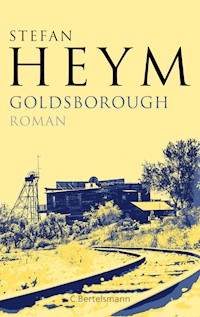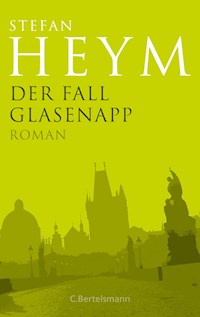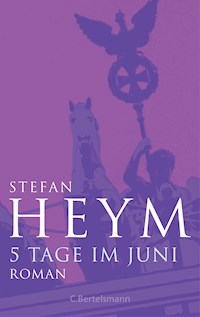16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane
- Sprache: Deutsch
Die abenteuerliche Geschichte des Aufrührers, Dichters und Frauenhelden Andreas Lenz
Das Großherzogtum Baden im Revolutionsjahr 1849: Andreas Lenz ist ein feuriger Schwärmer und Rebell. Seine Wege kreuzen Josepha, ein lebensfrohes Mädchen aus dem Volk, und die geheimnisvolle und charakterstarke Lenore, die aus Liebe zu Lenz mit ihrem großbürgerlichen Elternhaus bricht und das gefahrvolle Leben des Freundes teilt. In farbigen, unvergesslichen Bildern rollt Stefan Heym die bewegte Geschichte des Aufstands ab, in dem das Volk um die Lösung der nationalen Frage und um die Schaffung demokratischer Verhältnisse kämpfte. Er fängt die Hoffnung und den Schmerz jener Tage ein, zeigt die Triebkräfte der Ereignisse auf, macht ein bedeutungsvolles und folgenschweres Kapitel deutscher Vergangenheit einprägsam lebendig.
Stefan Heyms brillanter historischer Roman über die badische Revolution von 1848/49, auf Deutsch erstmals erschienen 1963 beim Paul List Verlag, Leipzig, endlich wieder lieferbar in der digitalen Werkausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1069
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Das Großherzogtum Baden im Revolutionsjahr 1849: Andreas Lenz ist ein feuriger Schwärmer und Rebell. Seine Wege kreuzen Josepha, ein lebensfrohes Mädchen aus dem Volk, und die geheimnisvolle und charakterstarke Lenore, die aus Liebe zu Lenz mit ihrem großbürgerlichen Elternhaus bricht und das gefahrvolle Leben des Freundes teilt. In farbigen, unvergesslichen Bildern rollt Stefan Heym die bewegte Geschichte des Aufstands ab, in dem das Volk um die Lösung der nationalen Frage und um die Schaffung demokratischer Verhältnisse kämpfte. Er fängt die Hoffnung und den Schmerz jener Tage ein, zeigt die Triebkräfte der Ereignisse auf, macht ein bedeutungsvolles und folgenschweres Kapitel deutscher Vergangenheit einprägsam lebendig.
Stefan Heyms brillanter historischer Roman über die badische Revolution von 1848/49, auf Deutsch erstmals erschienen 1963 beim Paul List Verlag, Leipzig, nun Teil der digitalen Werkausgabe.
»Ein Liebesbekenntnis zur Demokratie, gerade wegen seiner Wahrhaftigkeit und seines Feuers.« Mannheimer Allgemeine Zeitung
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1952 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Lenz oder die Freiheit
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die englische Originalausgabe erschien 1964 unter dem Titel The Lenz Papers bei Cassel, London.
Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Helga Zimnik, erstmals erschienen 1963 unter dem Titel Die Papiere des Andreas Lenz beim Paul List Verlag, Leipzig
Karten und Skizzen: Adolf Böhm, München
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © 1963 by Inge Heym
Copyright © 2005 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München nach einem Entwurf von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagmotiv: © Shutterstock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27838-0V001
www.cbertelsmann.de
Für Gertrude
Prolog
»Verrückte Idee!«
»Ja? – Was ist so verrückt …?«
»Dies alles!« Lenz wies auf die schwarzen Sträucher, dann glitt seine Hand über das Feld, das sich grau und trübe in der aufsteigenden Dämmerung des Februarnachmittags streckte, über die Reste von Schnee auf dem Hügelzug, hinter dem noch mehr Gräber lagen. »Friedhof! Meilenweit Friedhof!«
»Schließlich mußte man sie ja irgendwo begraben«, antwortete ich. »Warum nicht, wo sie starben?«
Lenz runzelte die Stirn. Er schlug den Kragen seines Wintermantels hoch. »… und geloben wir hier feierlich, daß diese Toten nicht umsonst gestorben sein sollen«, sagte er. Das Lachen, das die Düsterkeit des Zitats aufhellen sollte, glückte nicht ganz. Die Schatten über diesem Ort waren zu schwer.
Ich bekämpfte das leichte Frösteln, das mir den Rücken hinunterkroch und an dem das Wetter schuld war. Ich wollte etwas sagen über vergangene Zeiten und daß wir im Jahre 1944 lebten, daß wir unseren eigenen Krieg hätten und unsere eigenen Sorgen.
»Natürlich mußte man sie irgendwo begraben«, fuhr er fort und verzog spöttisch das schmale, empfindsame Gesicht. »Aber müssen wir ausgerechnet dort hausen, wo sie begraben sind?«
Damit hatte er recht. Wir redeten niemals darüber, doch in der einen oder anderen Form hatte der Gedanke daran die meisten Leute in der Kompanie mehr als einmal geplagt. Man gewöhnt sich an vieles in der Armee; die Offiziersgehirne haben besondere Windungen; doch was hier geschah, besaß einen ganz eigenen, faden Geschmack: Männer, die man in kommende Schlachten schicken wollte, unter den Toten einer vergangenen Schlacht unterzubringen!
Oh, Gettysburg! Schmetternde Trompeten! Das dumpfe Dröhnen von Pferdehufen auf den Schollen dieser Erde – Atta – a – acke!
Und das erbarmungslose Krachen der Geschosse und das Knirschen der Bajonette, die in Fleisch und Knochen stießen!
Wir schliefen in ein paar verfallenen Baracken, die seinerzeit die Jungens vom Civilian Conservation Corps gebaut hatten, als sie hierhergeschickt worden waren, um den Friedhof zu säubern und die Arbeitslosenlisten während der großen Depression niedrigzuhalten. Jetzt schluckte die Armee die Arbeitslosen, Gott sei Dank, und Sergeant Andrew Lenz und ich, die Gewehre über die gekrümmten Schultern gehängt, spielten Patrouille auf den Schlachtfeldern vergangener Jahre.
»O Gott!« seufzte er. »Ich setze mich hin.«
Vom Standpunkt der Bequemlichkeit aus hatte das Patrouillieren auf einer gut erhaltenen nationalen Gedenkstätte seine Vorteile. Hier gab es Bänke, die durch sorgsam angepflanzte Hecken vorm Wind geschützt waren; im Sommer war es sicher sehr nett hier, mit schattigen Winkeln rings um ein paar alte, gewissenhaft gepflegte Kanonen und einem guten Blick auf einen schönen großen Grabstein, von dem man Namen, Dienstgrad und Einheit ablesen konnte.
Lenz wischte Schmutz und Feuchtigkeit von einer Ecke der Bank, setzte sich und streckte die Beine aus. Er stellte das Gewehr zwischen die Knie, nahm den Helm ab und hängte ihn über die Mündung. Schweißfeuchtes dunkles Haar klebte ihm auf der Stirn. Er hatte eine hohe, wohlgeformte Stirn und schiefergraue, meistens nachdenkliche Augen. Ich hatte den Verdacht, daß er Gedichte schrieb oder wenigstens geschrieben hatte; aber derartiges war ihm nie in den Sinn gekommen, versicherte er mir, und die Vermutung schien ihn zu befremden. Er war Drucker von Beruf; wahrscheinlich haben Drucker etwas von einem Intellektuellen an sich.
Jetzt hefteten sich diese seine Augen auf den Grabstein. Ich sah, wie er erstarrte. »Schau dir das an!« sagte er. »Ich will verdammt sein!«
Seine Stimme hatte etwas Eindringliches, das im Widerspruch zu seiner lässigen Redeweise stand: etwas Eindringliches, das beinahe an Furcht denken ließ. Ich blickte auf den Stein, auf die Namen. Das Tageslicht wurde langsam schwächer, aber man konnte die Aufschrift auf der Gedenktafel noch erkennen. Gleich der erste Name hieß:
ANDREWLENZ
Capt, Co. B, 3rd Illinois Inf.
Sergeant Lenz lachte; es klang hohl. Er brauchte die Frage nicht zu stellen; das konnte ich selbst tun, da ich wußte – wie wir alle es wußten –, daß die Invasion kurz bevorstand und daß wir dabeisein würden. Wie würde es dir, so lautete die Frage, bei einer solchen Aussicht gefallen, plötzlich deinen Namen unter den Toten zu entdecken?
Man brauchte nicht abergläubisch zu sein; der winzige Überrest uralter Atavismen, den jeder von uns seit unvordenklichen Zeiten im Blute trägt, genügt, um Unheil vorauszuahnen. Natürlich sagte ich Lenz, daß das Unsinn sei. Lenz war kein seltener Name, besonders unter Menschen deutscher Abstammung; und Männer namens Andrew gab es auf der ganzen Welt, Andrew, Andreas, André, Andruschka – warum sich aufregen?
»Red nicht so dumm«, sagte er. »Das ist mein Großvater.«
Er lehnte Gewehr und Helm gegen die Bank und ging hinüber zu dem Grab. Während er es forschend betrachtete, fuhr er, mit dem Rücken zu mir, fort: »Meine Familie hat immer gewußt, daß er Captain im Bürgerkrieg war und hier gestorben ist. Bloß man stellt sich Großpapa nicht immer als Soldaten der Unionsarmee vor. Ich war einfach nicht darauf gefaßt, ihm hier und auf diese Weise zu begegnen …«
Er wandte sich um und sah mich an. Es war schon recht dunkel geworden.
»… so ohne Warnung«, schloß er, jetzt mit fester Stimme. Nur seine Augen zeigten eine Spur dessen, was er empfunden haben mußte. »Andrew Lenz«, sagte er und fügte hinzu: »Der andere – er war wohl noch nicht vierzig, als es ihn erwischte. Wir haben irgendwo zu Hause ein Bild von ihm – ein Mann mit Bart und breitkrempigem Offiziershut. Er sieht etwas verlegen aus – wahrscheinlich haßte er es, sich in Positur zu stellen. Aber das Bild ist schon reichlich verblaßt.«
Er griff nach seinem Gewehr.
»Gehen wir?«
Man mußte es Lenz – dem heutigen Lenz – hoch anrechnen. Er barg dieses Erlebnis tief in sich und ließ es nur einige wenige Male nach außen dringen. Die Ereignisse halfen. Krieg bedeutet Veränderung – Veränderung des Schauplatzes, Veränderung der Menschen, jeden Tag eine neue Art von Dreck, eine neue Art von Stumpfsinn, und dazwischen sehr vereinzelt ein bißchen menschliche Größe, um einem zu zeigen, daß doch nicht alles umsonst ist. Doch dieser Moment in Gettysburg ließ weder ihn noch mich ganz los – er blieb zwischen uns, ein Geheimnis, das wir beide teilten. Es schuf eine Bindung zwischen uns. Es veranlaßte mich, ihn den ganzen Krieg hindurch mit einer gewissen Besorgnis zu betrachten: einmal, an jenem trüben Nachmittag im Februar, hatte ich den Finger des Schicksals deutlich auf ihn weisen sehen. Ich wollte nicht, daß es sich bestätigte, ich wollte nicht daran glauben, und ich glaube noch immer nicht daran – aber jedesmal wenn ich ihn traf, nach unserer Landung in Europa, und irgendwo in Frankreich, und dann in Deutschland, fühlte ich mich erleichtert. Unsere Arbeit brachte uns häufig auseinander; immer wenn neue Gefangene von irgendeiner Einheit gemeldet wurden, mußte der eine oder andere von uns fort, um sie zu vernehmen. Es dauerte Tage und Wochen und manchmal Monate, ehe wir uns wiedersahen. Und wenn wir uns dann begegneten und ich auch nicht eine Schramme an ihm entdeckte, lachte ich gewöhnlich und sagte: »Na, wie steht’s damit?« Und er wußte, und ich wußte, daß die Frage sich auf Andrew Lenz bezog – den anderen Lenz – daheim in Gettysburg, der nichts weiter war als ein Name auf einem Stein. Wirklich und wahrhaftig nichts weiter.
Und dann sprachen wir über ihn. Es war wie ein innerer Zwang. Wir mußten es tun, um den Schatten des Todes, der seit jenem Nachmittag in Gettysburg über Lenz – dem heutigen Lenz – schwebte, auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Nach und nach erinnerte er sich an einiges von dem, was sein Vater ihm über seinen Vater erzählt hatte; von einer unserer Begegnungen zur anderen erfuhr ich immer mehr über den Mann, der auf jenem alten Schlachtfeld neben der alten Kanone die letzte Ruhe gefunden hatte; bis ich ihn schließlich ganz klar vor mit hatte, obwohl aller Wahrscheinlichkeit nach nicht er es war, den ich sah, sondern der Lenz, der mit mir zusammensaß – die Konturen unseres Denkens werden im allgemeinen von den Perspektiven unserer eigenen Zeit bestimmt.
Lenz – der andere – hatte den Taufnamen Andreas und war 1849 in die Vereinigten Staaten gekommen; er brachte eine Frau mit, jung wie er selbst, auch schön auf eine gewisse verfeinerte Art, und von ihnen beiden anscheinend das stetigere Element. Sie hatte die Hosen an; so stellte es Lenz – der heutige Lenz – dar. Das Ehepaar hatte mehrere Kinder, von denen das jüngste, der Vater meines Lenz, nach dem Tode von dessen Vater geboren war. Lenz – der Lenz, der tot in Gettysburg lag – versuchte sich in vielen Dingen und scheiterte in genauso vielen. Eine Zeitlang gab er eine deutschsprachige Zeitung in Chicago heraus. Er hatte auch für ein städtisches Amt kandidiert, 1856 glaube ich, und erlitt eine knappe Niederlage. »Ein Radikaler!« meinte Lenz und zuckte die Achseln, so wie man heutzutage mit den Achseln zuckt über Propheten und Hellseher und ähnliche Lieferanten von Allheilmitteln gegen die Übel dieser Welt. Als man begann, den Nachlaß von Captain Andrew Lenz durchzusehen, der, wie Lincoln es ausgedrückt hatte, dafür gestorben war, daß die Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk auf dieser Erde nicht untergehe, wurde festgestellt, daß er nur eine Menge kleiner Schulden und einen Stapel Papiere hinterlassen hatte – alle möglichen Papiere, von denen einige in die Zeit vor seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten zurückreichten – Tagebücher, Notizbücher, Karten, Flugblätter, Kopien militärischer Befehle, sogar einige Verse: nichts von Wert, nichts, was einer Witwe und ihren Kindern helfen konnte, sich über Wasser zu halten. Was die verwaiste Familie rettete, war eine Geldsumme, die gerade zu dieser Zeit von den Brüdern der Frau aus Deutschland eintraf. Die Witwe benutzte das Geld, um damit eins der ersten Modehäuser in Chicago zu eröffnen, »Lenores Salon für Damen« in der State Street, und sie führte das Geschäft sehr geschickt, bis das große Feuer von Chicago alles zerstörte.
Lenz lächelte ein wenig, als er mir von dem Modesalon erzählte; es erschien so widersinnig im Vergleich zu dem, was Andreas, später Andrew Lenz gewesen war und gewollt hatte. Doch es war sehr viel realer – wenn die Jungens aus ihren Hosen herauswuchsen und die Kaufleute ihre Rechnungen präsentierten. Lenz – mein Freund Lenz – hatte ein sympathisches Lächeln. Es lag darin etwas von dem – was es auch immer sein mag –, worauf die Frauen hereinfallen, von Gettysburg in Pennsylvania durch ganz Frankreich hindurch bis über den Rhein. Der Krieg war beinahe zu Ende, als er diese Seite der Geschichte erwähnte – es bestanden nur noch Widerstandsnester, und es war Frühling, der schönste Frühling unseres Lebens, wie ich dachte, mit Frieden in der Luft wie ein besonderer Hauch. Wir lachten sogar über die merkwürdige Furcht, die bei unseren seltenen Begegnungen als ein Dritter zwischen uns gestanden hatte.
Er starb an einer dummen kleinen Brücke über einen dummen kleinen Fluß, von der Hand einiger dummer kleiner Hitlerjungen, die eine Panzerfaust abfeuerten. Wir erwischten die Jungen. Sie waren so verängstigt, es war jammervoll.
Ungefähr sechs Monate später erhielt ich ein Päckchen von seiner Frau mit einem Begleitbrief, aus dem ich zitieren möchte:
»… Andrew bat mich, dies Ihnen zu schicken. Er meinte, Sie würden sich vielleicht dafür interessieren. Er erwähnte es bei seinem letzten Urlaub, als er aus dem Lager in der Nähe von Gettysburg nach Hause kam, die Papiere hervorsuchte und anfing, darin zu blättern. Er schrieb auch mehrmals aus Übersee darüber und fügte immer hinzu: für den Fall, daß mir etwas passiert …
Es tut mir leid, daß ich die Papiere nicht ordnen oder sortieren konnte, ich habe sie so eingepackt, wie sie waren. Im Hinblick auf ihr Alter dachte ich, jedes unnötige Anfassen könnte ihnen eher schaden als nützen. Nein, ich will ehrlich sein – ich wollte nichts damit zu tun haben, sie sind für mich mit Andrews Todesahnungen verbunden, von denen ich ihn vergeblich freizumachen versuchte, als wir zum letztenmal beisammen waren.
Ich danke Ihnen, daß Sie meinem Andrew ein guter Freund gewesen sind. Natürlich haben Sie recht: Ihr Erlebnis bei jenem Grab war reiner Zufall, ohne jede Bedeutung für spätere Ereignisse. Trotzdem möchte ich die Papiere nicht zurückhaben. Ich möchte mir die Erinnerung an den Andrew Lenz bewahren, der an meiner Seite lebte – die Erinnerung an den anderen gehört Ihnen, wenn Sie wollen.
Hochachtungsvoll
Elizabeth Lenz«
Erstes Buch
Erstes Kapitel
17. April 1849
An Mademoiselle Lenore Einstein, Rastatt
Liebe Lenore!
Es war reizend und aufmerksam von Dir, mich für heute abend zu Deiner officiellen Geburtstagsfeier einzuladen. Ich fürchte jedoch, daß der einzige Effekt meines Kommens sein würde, Deine anderen Gäste zu schockiren und Dich und mich zu einer Handlungsweise zu verpflichten, die wir beide bedauern könnten. Ich wünsche Dir Glück und alles Liebe …
(Fragment in der Handschrift von Andreas Lenz)
Sebastian Stäbchen trauerte über dem Rest seines Bieres. Er befingerte die Münzen in seiner Tasche; er zählte sie: er würde sparsam sein müssen. Es hatte eine Zeit gegeben, da spielten Ausgaben keine Rolle, da wußte die Regierung die Dienste eines Mannes richtig zu würdigen … Passé! Die Regierung Seiner Hoheit des Großherzogs sparte am falschen Ende! Es war immer verkehrt, die Polizei knapp zu halten, und ausgesprochen selbstmörderisch, wenn eine Revolution kaum vorbei war und die nächste möglicherweise kurz bevorstand.
Stäbchen winkte: »Noch ein Bier!«
Die Vogelaugen hinter der Theke blickten ausdruckslos auf. Diese Augen saßen in einem Kopf, der viel zu klein war für die lang aufgeschossene Gestalt des Mannes; Nase wie ein Kakadu, dürre Lippen; ein Gesicht, das man leicht im Gedächtnis behielt, ein Gesicht, das zu dem Dossier im Kommissariat paßte: Frei, Fidel; Eigenthümer des Wirthshauses »Zum Türkenlouis«, das von Soldaten, Schanzarbeitern, leichten Mädchen besucht wird; republikanischer Sympathien verdächtig; et cetera, et cetera …
Frei brachte das Bier, wischte den Tisch ab, stellte das Glas vor Stäbchen hin, streckte die Hand aus: »Geld!«
»Du traust mir nicht, wie?«
»Nein. Geld bitte.«
Stäbchen zahlte mürrisch.
Ein paar Soldaten lachten. Stäbchen sah finster zu ihnen hin. Er kannte sie, kannte das Gesicht und so ziemlich auch die Gedanken eines jeden Mannes, der mehr als zwei Wochen hier in Rastatt in der Garnison gewesen war. Nicht so sehr die Bauernjungen – die waren nicht von unmittelbarem Interesse; aber diejenigen, die lesen und schreiben konnten, die kannte er, die Ex-Studenten und ehemaligen Dorfschulmeister, und die Handwerksgesellen, die herumgekommen waren bis in die Schweiz und besonders über den Rhein nach Frankreich hinein, zu der großen Hure und Verbreiterin aller möglichen Krankheiten. Er kannte sie im Dritten Regiment und im Vierten, bei den Dragonern und vor allem bei der Artillerie. Wäre er, Sebastian Stäbchen, Kriegsminister, er würde die Artillerie abschaffen. Eine Kanone war wie eine Maschine, und Männern, die sich mit Maschinen befaßten, konnte man nicht trauen; sie wollten immer noch mehr und zweifelten an, was von jeher gut genug gewesen war für die Menschen, und einige von ihnen meinten sogar, das, was 1848 so verheißungsvoll begonnen hatte, sollte in diesem Jahr, 1849, durchgeführt, abgerundet und vollendet werden. Ein höchst unchristliches Jahr versprach das zu werden, wenn es von ihnen abhing!
»Der Großherzog ist ein guter Mann!« rief ein langer Artilleriesergeant. »Ein ehrlicher Mann! Ein lieber Mann! Eine Seele von einem Mann! Bitte, wessen Interessen liegen ihm am Herzen? Unsere natürlich. Er hat nur das Volk, es ist alles, was er besitzt. Er macht sich Gedanken um uns. Er sorgt sich um uns wie die Ameise um die Blattlaus, die sie auf den zartesten Blättern weiden läßt, um sie dann zu melken und auszusaugen, bis nur noch die zusammengeschrumpfte Haut übrigbleibt.«
»Ach du!« Eines der Mädchen, eine verblühte Blondine mit schlaffen Brüsten, setzte sich dem Sprecher auf den Schoß. »Du kannst reden! Wenn du dir bloß halb soviel Gedanken machen würdest, damit dir was Hübsches für mich einfällt! …«
Der Sergeant stieß sie weg und erhob sich von seinem Sitz. Den Tschako schief nach vorn geschoben, dozierte er: »Keine Zeit zum Süßholzraspeln, mein Schatz. Überleg dir mal, was der Soldat heute alles tun muß. Er muß sechsunddreißig verschiedene deutsche Vaterländer verteidigen, einige mit und einige ohne Verfassung, mit sechsunddreißig verschiedenen Königen, Großherzögen, Herzögen und Fürsten, seinen Souveränen, ganz zu schweigen von unserer Nationalversammlung in der großen Stadt Frankfurt, die sich mit aller Kraft bemüht, einen Kaiser für uns zu finden. Er muß Stiefel wichsen und dreiundneunzig verschiedene Knöpfe und Schnallen blank polieren, und er muß zwei Patronengurte, sechs Patronentaschen und zwei Gamaschen putzen und reinigen, nicht zu reden von der Pflege und Reinigung einer Muskete mit Schloß, Schaft und Lauf und in unserem Fall einer Kanone mit all ihren Teilen. Außerdem haben Seine Hoheit der Großherzog und seine Regierung von fünfzigtausend großen, mittleren und kleinen Bürokraten in ihrer unendlichen Weisheit und weil sie Angst hatten, wir könnten sie uns selber nehmen, dem Volk von Baden einschließlich der Truppen Versammlungsfreiheit gewährt. Also versammeln wir uns und reden und versuchen zu denken, aber so etwas fällt schwer in Deutschland, wo dreiunddreißig Jahre lang und länger Denken eines der schlimmsten Vergehen war!«
Er griff nach der Blonden und küßte sie unter allgemeinem Beifall auf den Mund, bis sie keine Luft mehr bekam. Dann hob er sein Glas, rief: »Freiheit!« und sank auf der Bank zusammen.
Die Soldaten und die Mädchen applaudierten. Nur die Festungsarbeiter in der Ecke, es mochten etwa ein Dutzend sein, blieben grau und schweigsam bis auf ein gelegentliches Wort zu dem Mann mit der geblümten Weste, der in ihrer Mitte saß.
Diesem Mann wandte Stäbchen jetzt seine Aufmerksamkeit zu. Beim Kommissariat gab es auch über ihn ein Dossier: Comlossy, Bruno; achtundvierzig Jahre; Hersteller von Regen- und Sonnenschirmen; und dann Einzelheiten, jede ein winziges Teilchen, das zu einem recht üblen Gesamtbild beitrug. Das großmächtige Gerede dieser Soldaten war noch nicht das Schlimmste! … Meistens war es ja nur das Echo von dem, was gerissenere Männer ihnen eingeblasen hatten; dieser Comlossy zum Beispiel, der aussah, als könnte er kein Wässerchen trüben, und der in seinem kleinen Laden in der Vorstadt seine Regenschirme machte und niemals in eine Lage geriet, wo man ihn festnageln konnte. Und solche Leute gab es überall in dieser Stadt, überall im Großherzogtum, überall in Deutschland – ein geheimes Netz von Agenten und Klubs und Vereinen, mit eigenen Verbindungen und Beziehungen, von denen ein paar bekannt waren, die meisten aber nicht.
Bei dem Gedanken daran rutschte Stäbchen ärgerlich auf seinem Stuhl hin und her und griff nach dem Bier. Das Netz schien sich überallhin zu erstrecken, sogar bis hinein in die Kasematte hinter den dicken Mauern der Bastion Dreißig dieser Festung, wo Struve gefangengehalten wurde, der führende Kopf der Revolution des Vorjahrs und tatsächliche Leiter des zweiten Aufstandes. Stäbchen nahm einen vorsichtigen Schluck und blickte, vorbei an dem Soldaten im blauen Rock, auf die zum Hinterzimmer führende Eichentür. In diesem Zimmer, hinter dieser Tür, saß in diesem Augenblick Madame Struve, die Frau des eingesperrten Rebellenhäuptlings, und ließ sich auf weißem Leinen ein feines Abendessen servieren. Was wollte sie in Rastatt? Nur versuchen, ihren Mann zu sehen – oder steckte mehr dahinter? Sie war selbst gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Forderte sie eine neue Verhaftung heraus? Wer in diesem Raum wartete darauf, mit ihr zu sprechen, Informationen an sie weiterzugeben oder Nachrichten und Instruktionen von ihr zu erhalten?
Stäbchen spitzte die Ohren. Der lange Artillerist führte wieder das Wort.
»Wie kommt es, daß ich heute genauso arm bin und beinahe so nackt wie an dem Tag, wo ich in die Armee eintrat?« Der Sergeant packte seinen Bierkrug, als ob er ihn zerquetschen wollte. »Ich gebe meine Haut und meine Knochen anstelle der reichen Jungen, damit die in ihren weichen Betten faulenzen und angenehm leben können, und für jeweils drei Jahre meines Lebens zahlt der Papa so eines zarten Jünglings sechshundert Gulden badisch. Aber nicht ich kriege das Geld, o nein, ich könnte ja das Geld einsacken und damit weglaufen, und wo bliebe dann die Armee? Also wird das Geld auf Konto gezahlt, ein Konto auf meinen Namen, zu treuen Händen meiner Regierung, und ich vertraue meiner Regierung mein Geld an, ich vertraue es ihr nicht bloß einmal an, nicht bloß zweimal, auch nicht dreimal – sondern viermal, Geld genug, um mir ein Stück Land zu kaufen und ein Häuschen und Vieh, und mir eine Frau zu nehmen … Und jetzt plötzlich ist kein Geld mehr da. Weg ist es, verschwunden, hat sich aufgelöst. Es gibt keine Einsteher mehr! sagt die Regierung. Jeder dient für sich selbst! Alle sind vor dem Gesetz gleich! Ich habe ja nichts gegen Gleichheit, ich will nicht besser oder schlechter sein als andere. Aber wo ist mein Geld geblieben? frage ich. Wer hat es? Oder, wenn es weg ist, wer hat es verschwendet, verhurt, in die Gosse gepißt? Ist das vielleicht Gleichheit? Steht das in der Verfassung, die der Großherzog zu verteidigen geschworen hat?«
Irgendwo in der Brust spürte Stäbchen ein Schwächegefühl. Dann wurde seine Aufmerksamkeit abgelenkt: für einen Augenblick öffnete sich die Eichentür zum Hinterzimmer; während der Wirt eine neue Flasche Wein hineintrug, erhaschte Stäbchen einen Blick auf die Frau, die dort saß. Und noch einer hatte beim Öffnen der Tür gespannt aufgeschaut – Stäbchen, geübt im Erfassen solcher Einzelheiten, bemerkte es sofort.
Dieser Mann saß allein, abseits, ein stämmiger Bursche mit Muskeln auf den Knochen, mit einem eckigen Kinn und einer entschlossenen Stirn – und doch kein auffallender Typ. Nur seine plötzliche Bewegung hatte Stäbchen auf ihn aufmerksam gemacht. Stäbchen durchforschte sein Gedächtnis, das seine beste Kartei war, fand aber nichts vorliegen. Die Lider halb geschlossen, betrachtete er prüfend den Fremden; der Bursche war in seine scheinbare Teilnahmslosigkeit zurückgesunken, die Hände lagen auf dem Tisch, die breiten Daumen waren leicht gegeneinandergepreßt. Ein Neuer? Ein Soldat, der von woanders hierher in diese Garnison versetzt worden war? Dann fielen Stäbchens Augen auf die Knöpfe, silberweiß auf dunkelblauer Uniform. Stäbchen wurde nachdenklich. Die Armee trug gelbe Knöpfe, billiges Messing; nur das Zweite Regiment oben in Freiburg hatte silberweiße, Gott mochte wissen warum. Was wollte dieser Soldat aus Freiburg hier in Rastatt, in der Festung, im Wirtshaus »Zum Türkenlouis« des Fidel Frei, der republikanischer Sympathien verdächtig war? Was wollte er unter dem gleichen Dach wie Madame Amalia Struve?
Der plötzliche Lärm hinter ihm ließ ihn auffahren.
Rufe: »Lenz!«
»Wieder bei Josepha gelandet, wie ich sehe?«
»Hast du ein neues Lied, Lenz?«
»Nein, sing uns das von dem Soldaten, der alle auf dem Nacken trägt, Fürst und Pfarrer und Wucherer …«
Stäbchen beobachtete, wie der Soldat mit den silberweißen Knöpfen einen Blick auf Lenz und die Frau warf, die mit ihm gekommen war, und dann schnell wegschaute. Verstellt sich schlecht, dachte Stäbchen; der Mann vom Zweiten Regiment in Freiburg war kein Schauspieler; Lenz und die Frau waren ein so auffallendes Paar, daß unverhohlene, natürliche Neugier weniger Verdacht erregt hätte.
Stäbchen griente.
Ein auffallendes Paar, dachte er. Zwei ansehnliche Dossiers hatten sich da gefunden: das eine von der politischen, das andere von der Sittenpolizei – obwohl Josepha außerdem noch als Näherin arbeitete, bei Mademoiselle Laroche, wo nur die Damen von Frau Oberstleutnant aufwärts ihre Kleider anfertigen ließen.
Lenz hatte seinen Tschako über einen Kleiderhaken geworfen. Seine schiefergrauen, nachdenklichen Augen blieben auf Stäbchen haften. Das Mädchen Josepha, geschmeidiges, üppiges Fleisch, schmiegte sich an ihn. Das Haar – warmes Braun mit einem ins Rötliche spielenden Schimmer – schlängelte sich auf der halbnackten Schulter.
Lenz streckte den freien Arm hin, die Hand fordernd offen. Man reichte ihm eine Gitarre, die Fidel Frei unter der Theke hervorgeholt hatte. Lenz schüttelte Josepha ab. Die Gitarre in der Hand, trat er vor, setzte die Stiefelspitze auf die Leiste von Stäbchens Stuhl, als wenn der kleine Mann gar nicht dort säße, und schlug ein paar Akkorde an.
»Nein«, sagte er dann mit leichtem Stirnrunzeln, »ich werde nicht singen. Aber ich will euch ein Gedicht aufsagen – es stammt von einem Mann namens Villon, der vor langer Zeit in Paris gelebt hat und der das Leben sehr liebte …«
Stäbchen machte eine Bewegung, als ob er aufstehen wollte. Doch Lenz war schneller. Die Hand, die über die Saiten gestrichen hatte, legte sich schwer auf Stäbchens Schulter, eine stumme Aufforderung zum Sitzenbleiben.
Lenz begann leise, mit halb trauriger, halb herausfordernder Stimme, die den Leuten unter die Haut ging. Er rezitierte Villon nicht, er war Villon, dessen Lachen durch seine Resignation hindurchklang, der mit seinem Zerfall kokettierte, der alle seine Mitmenschen um Vergebung bat – Mönche und Nonnen und tonsurierte Priester, alle die Händler mit himmlischer Gnade, die Jungfrauen in ihren engen Kleidchen und die geilen Greise, die nicht mehr springen konnten, die Stutzer und Gecken und die Huren mit nackten Brüsten, die Kuppler und Diebe, die Gauner, Landstreicher und Schwindler, sogar die Totschläger, die blutbefleckten Mörder; von ihnen allen erbat er Vergebung, demütigte sich vor ihnen und machte sich gleichzeitig über sie lustig …
Lenz hob die Stimme:
»Nicht so die Polizistenhunde!«
Und peitschenscharf:
»… die nahmen mir vom Munde
die letzte Rinde Brot, den letzten Tropfen Wein!
Ich möchte gerne sie verfluchen,
obgleich ich sterbenskrank.
Man schlage ihnen ihre Fressen
mit schweren Eisenhämmern ein! …«
»Nein!« Stäbchen riß sich in panischer Angst los. Sein Blick hastete über die grinsenden Gesichter. »Nein!« rief er noch einmal, die Stimme schrill angesichts der Drohung, die auf ihn zukam. Dann durchbrach er mit erhobenen Ellbogen blindlings den ihn umschließenden Kreis und rannte auf die Tür zu und stolperte hinaus.
Gelächter. Sie fielen auf die Bänke vor Lachen und schlugen sich auf die Schenkel und klatschten den Mädchen aufs Hinterteil und schüttelten sich, bis ihnen die Seiten weh taten. Das war ihr Lenz! Das war der Mann, der in Worte faßte, seine eigenen oder die eines anderen, was sie alle empfanden. Eine Verfassung war gut; Freiheit war besser; und eine Republik war vielleicht das Allerbeste – aber Man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhämmern ein! … Wie viele Hunderte von Jahren hatten sie in Deutschland gewartet, immer Befehlen gehorchend, ständig der Autorität die Stiefel leckend, daß dieser große Tag herandämmerte? War nicht die Zeit gekommen? Im fernen Preußen, in Berlin, war im letzten Jahr ein König gezwungen worden, seinen Hut vor den Toten der Revolution abzunehmen, und Prinz Wilhelm hatte nach England fliehen müssen. Gewiß, das Leben lief sich wieder ein; doch es war ein unsteter Friede, und in der Kirche dort in Frankfurt, wo das neue Parlament des Reiches tagte, redeten sie und redeten und redeten die Freiheit zu Tode. Aber hier im Großherzogtum Baden und anderwärts ließ sich schon ein neues Grollen vernehmen. Es mochte von der anderen Seite des Rheins kommen, aus Frankreich, oder aus Schlesien, wo die Weber die Maschinen in Brand gesteckt hatten, oder aus Ungarn, wo das Volk sich in Waffen erhoben hatte und die Truppen des österreichischen Kaisers vor sich hertrieb. Schlagt ihnen ihre Fressen ein, ein für allemal! Gott, wäre es möglich? Haben wir die Kraft?
Der Soldat mit den silberweißen Knöpfen erhob sich langsam. Verkniffenen Auges betrachtete er aufmerksam Josepha, ihre vollen Lippen, die sanften Mulden an ihrem Hals. Hungrig geworden, folgte sein Blick dem Schatten zwischen ihren Brüsten und hielt erst an, wo der eckige Ausschnitt des Kleides die Sicht verwehrte. Dann schloß er einen Moment lang die Augen, öffnete sie wieder, ging entschlossen auf Lenz zu, streckte die Hand aus und sagte: »Ich bin Christoffel aus Freiburg.«
Falls Lenz das kurze Zwischenspiel überhaupt bemerkt hatte, schien es ihn nicht weiter zu stören. Seine Bewegungen, langsam und doch gelöst und leicht, waren von einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Mädchen an seinem Arm, die zeigte, wie sicher er sich ihrer fühlte. Lenz, dachte Christoffel, war nicht das, was man als einen schönen Mann bezeichnete: dazu lagen die Augen zu tief im Schatten der Brauen, waren die glattrasierten Wangen zu hohl, der Mund zu hart. Aber kenne sich einer aus im Geschmack der Weiber!
Lenz winkte Fidel Frei, und kurz darauf brachte der Gastwirt Wein. Lenz hob sein Glas und sagte: »Willkommen, Bruder Christoffel!« Dann lachte er und erkundigte sich: »Was macht die gute Sache? Predigt ihr fleißig das Evangelium von Aufruhr und Rebellion?«
Christoffels Verstand arbeitete nicht so rasch. Er brauchte ein Weilchen, um den Sinn und den Überschwang zu begreifen, und selbst dann blieb er noch ein wenig mißtrauisch. Wußte Lenz denn nicht, wie ernst die Sache war, in der sie steckten?
Der unauffällige Mann, der bei den Festungsarbeitern gesessen hatte, gesellte sich zu ihnen. »Bürger Comlossy würde die Neuigkeiten auch gern erfahren«, stellte Lenz ihn vor.
Comlossy hakte die Daumen in die Armlöcher seiner geblümten Weste und musterte Christoffel von oben bis unten. Endlich schien er befriedigt zu sein. Er nickte in der Richtung zur Eichentür und schlug vor: »Wie wär’s, wenn wir uns dorthin zurückzögen?«
»Geh spielen!« sagte Lenz zu Josepha.
»Aber ich will nicht!« Sie schmollte. »Drei Tage warst du nicht bei mir, und jetzt gehst du schon wieder weg!«
Die hat Temperament, dachte Christoffel, und Krallen hat sie auch.
»Geh zu deinen Freundinnen schwatzen!« befahl Lenz.
»Nein, nein, nein!« rief Josepha schrill. »Wenn du mich jetzt allein läßt …« Sie blickte sich um und entdeckte einen jungen Soldaten mit dicken Lippen und rundem Gesicht, der sie mit blödem Grinsen angaffte. »… fang ich mir mit dem da was an! Dann siehst du mich heut abend nicht wieder … oder überhaupt nicht …!«
»Genug jetzt!« Lenz warf dem Wirt eine Münze zu. »Fidel! – Gib ihr, was sie will, aber keinen Branntwein! Der macht sie zänkisch und häßlich und dumm.«
»Ich bin nicht zänkisch und nicht häßlich und nicht dumm!« Sie sah ihn böse an. »Und ich brauch deinen Schnaps nicht oder deinen Wein oder dein Bier oder sonst etwas von dir! Warum kommst du bloß immer wieder zu mir zurückgelaufen, möcht ich wissen! Warum suchst du dir nicht eine andere, an die du dich hängen kannst? Warum gehst du nicht deiner Lenore ein Ständchen bringen, der hochnäsigen Pute, die so klug ist und gescheit?«
»Wie ich das hasse – diese Szenen!« Lenz hob die Arme. »Kann mir denn niemand das Frauenzimmer vom Leibe halten! … Bruder Christoffel, du zum Beispiel …?«
Christoffel wurde rot. Comlossy lachte. Lenz ging auf die Eichentür zu. Christoffel folgte ihm, ohne sich noch einmal umzublicken.
Lenz war innerlich belustigt. Amalia Struve ließ einen niemals ihre Weiblichkeit vergessen, ja sie betonte sie sogar; und doch gab es Momente, wie etwa jetzt, da konnten Männer mit ihr reden wie mit einem Mann. Sie hielt einen im Banne – ihre seltsamen strahlenden Augen blickten einen an und sahen gleichzeitig durch einen hindurch; und Christoffel schien sich klein und unbehaglich zu fühlen unter dem Schnellfeuer ihrer Fragen.
»Ich werde versuchen, zu Struve zu gelangen«, sagte sie gerade. Sie nannte ihren Mann »Struve« – niemals »Gustav« oder »mein Mann« – so als wäre sie ein Minister, der sich bei seinem Kabinettschef für einen Bittsteller einzusetzen versprach. »Ich werde versuchen, zu Struve zu gelangen, und werde ihm Ihr Problem unterbreiten. Ich bin sicher, es wird ihn freuen zu erfahren, daß Sie in Ihrem Regiment Gruppen bilden, eine Gruppe in jeder Kompanie, eine sehr gute Form der Organisation. Die schwache Seite bei der Aktion der Aufständischen im letzten Herbst war gerade das Fehlen solcher Organisation. Das hat Struve längst gesagt. Es genügt nicht zu hoffen, daß die Soldaten nicht auf das Volk schießen werden, sagte Struve – man muß sich darauf verlassen können! …«
»Aber …«, begann Christoffel.
»Ich weiß!« fiel sie ihm ins Wort. »Sie wollen Instruktionen, was Sie Ihren Leuten sagen sollen und auf welches Ziel Sie sie ausrichten sollen und wie Sie ihnen erklären sollen, welch große …«
»Er möchte nur wissen, mit wem er Verbindung halten soll«, warf Lenz ein.
»Das auch«, meinte Madame Struve ungeduldig.
»Sehen Sie«, erläuterte Comlossy, »vielleicht hat unser Freund das Gefühl, daß seine Bindungen zu unserer Bewegung bisher zu locker waren.«
Christoffel blickte dankbar in das ruhige Gesicht des Schirmmachers.
»Und wie und durch wen soll er Verbindung halten?« fuhr Comlossy fort.
Eine kurze Geste von Amalias kleiner Hand und ein sonniges Lächeln überbrückten die Tatsache, daß sie von solchen Einzelheiten keine Ahnung hatte und von ihnen gelangweilt war. »Bürger Brentano in Mannheim wird sich damit zu befassen haben«, sagte sie nachsichtig. »Er leitet das politische Komitee in Struves Abwesenheit.«
»Aber Bürger Brentano handelt so langsam in allem!« rief Comlossy.
Wieder lächelte Madame Amalia, aber anders diesmal, wissend. »Bürger Brentano ist der fähigste Advokat in unserem Staat«, fügte sie in einem Tonfall hinzu, der ebenso deutlich wie anzüglich war. Lenz verstand, was sie damit sagen wollte – Bürger Brentano, obwohl der beste Advokat, war nicht der beste Führer. Das war Struve; und eigentlich nicht einmal Struve, sondern Madame Amalia.
»Wir könnten ihn ja befreien!« schlug Lenz vor.
»Struve?« Lenz sah Comlossys hochgezogene Augenbrauen. Comlossy liebte überraschende Ideen nicht. Er wägte wahrscheinlich im stillen den Vorteil, einen Märtyrer hinter Schloß und Riegel der Bastion Dreißig zu haben, gegen die Wirkung ab, die eine Befreiung Struves vorzeitig entfachen könnte. Comlossy würde die Sache von allen Seiten betrachten und mit anderen zuverlässigen Männern besprechen wollen. Wahrscheinlich verflucht er mich, dachte Lenz, weil ich Madames bewegtem Gemüt eine neue Möglichkeit gegeben habe, sich auszuleben.
Lenz lächelte in sich hinein. »Machen ließe es sich nämlich! Eine dunkle Nacht – ein paar entschlossene Männer – Pferde draußen vor der Mauer …«
»Struve hat noch nie auf einem Pferd gesessen«, erklärte Amalia kühl.
Das stimmte, wenn man es recht bedachte. In all dem Wirrwarr komischer und weniger komischer Ereignisse, die sich während des Aufstandes im letzten Frühjahr Lenz’ Gedächtnis eingeprägt hatten, war keins gewesen, bei dem Struve zu Pferd gesessen hätte – Struve war entweder mit Madame und anderen Führern in einer Kutsche gefahren oder zu Fuß gegangen. »Sie sind Romantiker, nicht?« fragte ihn Madame Struve.
In einem gewissen Sinne war Lenz das wirklich, oder war es wenigstens im vorigen Jahr gewesen, als er sich, ein armer, stets hungriger Student, dem Zug der Aufständischen anschloß, aus vollem Herzen von der Freiheit singend, die Seele erfüllt von dem großen, schwarzrotgoldenen Traum von den Menschenrechten und einem geeinten, vernünftigen Deutschland – bis die ersten Schüsse krachten und alles auseinanderlief, die jungen Büroschreiber mit den uralten Musketen und die Handwerksgesellen mit ihren Sensen und die Kleinstadtadvokaten und die Zeitungsredakteure mit ihren bunten Schärpen … Es war dann nicht so romantisch gewesen, als man ihn vor die Wahl stellte zwischen Kerker und Eintritt in die Armee; und der letzte Rest Romantik war ihm auf dem Exerzierplatz von halbbetrunkenen, machtgeschwellten Sergeanten ausgetrieben worden, und keinen Kreuzer hatte man in der Tasche, um sie zu schmieren und die Prügel zu mildern …
»Struve«, sagte Madame stolz, »wird frei sein, wenn das Volk sich befreit.«
Lenz zuckte die Achseln. Anscheinend träumte Amalia Struve von einem langen angenehmen Aufenthalt hier in der Stadt, sah sich als Bindeglied zwischen ihrem Mann und den Volksvereinen, wobei die Behörden gutmütig zuschauten. War sie wirklich so naiv?
Madame Struve fuhr fort und erklärte, daß – obwohl sie keine gültige Aufenthaltserlaubnis für die Festung Rastatt besitze – ihre Beharrlichkeit die Polizei schon weichgemacht habe; sie beabsichtige im »Türkenlouis« zu bleiben, bis ihr Gesuch an den Kommandanten der Festung, General Strathmann, bearbeitet war; mehr noch, sie war überzeugt, daß sie eine Unterredung mit dem General haben würde. Inzwischen …
»Inzwischen«, sagte sie mit einem Lächeln ganz neuer Art, das alle drei Männer umschloß, »kann die Revolution jedoch nicht warten, nicht wahr? Wir möchten alles hören, was Sie uns zu berichten haben, Bürger Christoffel!«
Der Krach begann, wie immer, um nichts.
Josepha fühlte sich wunderbar – der ganze Raum mit den Gesichtern der Männer kreiste um sie. Natürlich hatte sie ihren Branntwein bekommen, mehr als genug. Fidel Frei hielt sich streng an seine Anweisung: keinen Schnaps für sie auf Lenz’ Kosten; andere zahlten. Josepha trank, weil es ihr guttat und weil Lenz es haßte, wenn sie betrunken war; du besabberst dich von oben bis unten, hatte er ihr gesagt, aber das stimmte nicht, sie hielt sich sauber, auch wenn sie betrunken war, sie fühlte sich nur äußerst wohl und entspannt und voller Liebe für die ganze Menschheit einschließlich Andreas Lenz. Die Tränen kamen ihr dann immer so leicht.
Doch bevor sie heute dieses Stadium erreichen konnte, war die Blonde über ihr, daß das strähnige, ausgebleichte Haar flog und die Hängebrüste schwappten. Josepha spürte, wie Fingernägel ihr das Gesicht zerkratzten, hörte das zusammenhanglose Geschrei, begriff schließlich, daß sie beschuldigt wurde, jener das Geschäft verdorben zu haben; aber da hatte sie die Blonde schon beim Wickel und gab es ihr, so gut sie konnte. Und die Männer johlten Beifall.
Josepha hielt sich an einem umgekippten Tisch fest; alles schwankte; ihr Kleid war oben zerrissen, der Busen halb entblößt; wenn schon, da war nichts, dessen sie sich zu schämen brauchte. Die Soldaten beteiligten sich an dem Spaß und warfen mit Bierkrügen. Und dann kam Lenz durch die Eichentür, gefolgt von Fidel Frei und Comlossy und dem anderen Soldaten. Lenz sprang auf einen Stuhl, hob die Hände und rief wütend: »Aufhören!«
Ah, er war großartig. Alles in Josepha drängte zu ihm hin, das Herz sprengte ihr förmlich die Rippen, ihr Gesicht war in Tränen gebadet, und ihre Lippen formten immer und immer wieder seinen Namen: »Andreas … Andreas … Andreas …«
Er warf einen Blick auf sie, sah die verschmierte Schminke auf ihren Wangen, sah, wie Josepha zitterte und sich in sich zurückzog. Lenz stieg von seinem Stuhl herunter und wandte sich ärgerlich ab. Was war es, das ihm die Macht, die er über dieses Mädchen besaß, so wünschenswert erscheinen ließ und das ihn doch davon abhielt, diese Macht bis zum letzten zu genießen? Sein Gewissen? Frauen waren nichts, worüber man sich ein Gewissen machen mußte. Lenore? Lenore stand auf einer anderen Ebene, fern, unerreichbar, sie beeinflußte seine Gefühle in keiner Weise. Hemmungen? Furcht? Weshalb? – Das Leben war eine süße Frucht, die aufgeschnitten, in Scheiben geteilt, genossen werden wollte; die Kerne spuckte man aus.
Da fiel sein Blick auf die Außentür, die einen Spalt breit offen war, und auf das Gesicht, das hindurchspähte – Stäbchen war zurück! Stäbchen zwängte sich in den Raum, immer noch vorsichtig, aber auch mit einer gewissen Entschlossenheit, die auf nahende Verstärkung hindeutete. Jetzt hatten auch die anderen seinen Eintritt bemerkt, und eine gespannte Stille trat ein.
Dann hörte man Hufe galoppieren, Räder auf dem Kopfsteinpflaster rasseln. Die Tür wurde aufgestoßen. Ein halbes Dutzend Offiziere, die Gesichter vom Trinken gerötet, behängt mit Orden und Ordensbändern, mit Schulterstücken und Tressen, betrat sporenklirrend und säbelrasselnd den Raum. Nach ein paar Schritten blieben sie stehen, als wären sie gegen eine Wand von Eis gelaufen. Dann schienen sie zu einem Entschluß zu kommen. In zwei leicht schwankenden Reihen stellten sie sich zu beiden Seiten der Tür auf, als Ehrengarde für welche Hoheit auch immer, die im Begriff war, die Gaststube von Fidel Freis »Türkenlouis« zu beehren.
»Achtung!«
Lenz erstarrte – aber nicht auf Grund des Befehls.
Eingerahmt von der schon etwas hinfälligen, beinahe unmilitärischen Gestalt des Generals Strathmann und dem plumpen, rosigen Dragonerleutnant Gramm, stand da Lenore Einstein. Blaß, die Lider mit den langen Wimpern halb gesenkt, das dunkle Haar streng geteilt und zu einem üppigen Chignon nach hinten gekämmt, trat sie zwischen das von der Offizierseskorte gebildete Spalier.
Lenz spürte, wie ihm das Blut zu Kopf stieg. Er hörte nicht das: »Weitermachen!« des Generals. Er sah nur die aufreizende Ruhe auf Lenores Gesicht, die leicht verzogenen Mundwinkel, die kaum erhobenen Brauen, die die hohe, glatte Stirn betonten. Er packte Josepha, zog sie zu sich heran und drückte ihre Schulter so fest, daß sie aufstöhnte.
Fidel Frei, die Kappe in der Hand, dienerte: »Herr General – Mademoiselle – meine Herren – zu Ihren Diensten …«
»Zum Teufel mit der ganzen Sippschaft!« sagte jemand laut aus dem Hintergrund.
»Sie haben eine Madame Struve hier?« fragte der General.
Mal in den Schmutz tauchen, dachte Lenz, das war Lenores Absicht. Mal sehen, wie sich die andere Hälfte der Bevölkerung amüsiert. Mischt sich unters Proletariat in ihrem neuen Geburtstagsstaat, den sie ihm beschrieben hatte. Dabei hatte sie einen Sinn fürs Dramatische; das mußte man zugeben. Es erforderte wenig Phantasie, sie sich als jüdische Prinzessin vorzustellen, ein goldenes Tablett balancierend, auf dem ein abgeschlagener Kopf lag – sein eigener höchstwahrscheinlich, bei der Stimmung, in der sie sich befand.
»Melden Sie mich Madame Struve!« sagte der General.
Ein Possenspiel, dachte Lenz. Das Ganze ist ein einziges ungeheuerliches Possenspiel – arrangiert zu Lenores Geburtstag, ein neuer Kitzel für ihre Überspanntheit.
Lenore saß wie betäubt und starrte auf ein paar Krumen, die von Madame Struves Abendessen auf dem Tischtuch liegengeblieben waren. Worte, Worte, Worte: der General triefte vor Wohlwollen, während er ein lüsternes Auge auf Madame warf; die berühmte Frau gab sich zurückhaltend; Gramm knurrte ein gelegentliches »Mit Verlaub!« oder »Sie verstehen!« Alles glitt an Lenore vorüber; sie wünschte, sie könnte sich auf die Unterhaltung konzentrieren; irgendwie mußte sie sich von dem dumpfen Druck ablenken, der ihr das Herz beschwerte.
Diese Demütigung! Diese Kränkung! Sie hatte ihn zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen entgegen den Warnungen, die ihr in allen Tonarten im Ohr geklungen hatten: »Das schickt sich einfach nicht!« Sie war bereit gewesen, etwas von dem Ansehen und der gesellschaftlichen Stellung aufs Spiel zu setzen, die ihr Vater sich in Jahren erworben hatte, in denen er stillschweigend alle einem Juden zugedachten Tritte und Beleidigungen einsteckte. Und dann war Andreas Lenz doch nicht gekommen, hatte nicht einmal geschrieben, kein Wort der Annahme oder Ablehnung; hatte sie einfach stehen und ihre Gäste empfangen lassen, die führenden Bürger der Stadt und deren Söhne und Töchter, dazu ein paar von den Ingenieuren, die den Bau der Festung leiteten, und Offiziere, eine ganze Korona von Offizieren. Lenore machte sich keine Illusionen über die Gründe, weshalb sie gekommen waren – Geld, die geruchloseste und gleichzeitig mächtigste aller Lockungen, ihres Vaters Geld hatte all diese Menschen ins Haus geführt. Nicht so Lenz – ihn hatte nichts zu ihr gelockt, weder Geld noch Charme, noch Verständnis, noch ihre Sehnsucht nach ihm … Sie hatte so lange wie möglich an der Salontür ausgeharrt, die Gäste begrüßend, hübscher anzusehen als je in ihrem Leben, dessen war sie sicher. Sie war einundzwanzig Jahre alt, gescheit, begehrenswert, und hatte einen Vater, dessen Unterschrift auf einem Stück Papier von Frankfurt bis hinauf nach Basel galt und respektiert wurde. Da stand sie nun in ihrem schönen Haus, mechanisch den Fächer bewegend, und brachte es sogar fertig, höflich Konversation zu machen. Endlich war der letzte Gast begrüßt, und der Vater zwang sie sanft zu Tisch.
»Ein Dichter ist er, was?« Ihr Vater zuckte die Achseln. »Brotlose Sache. Kein Kredit!«
Und jetzt – ihn in dieser Kaschemme zu treffen, zusehen zu müssen, wie er dieses Mädchen betastete! … Nie wieder, versprach sich Lenore. Nie, solange sie lebte. Reiß ihn dir aus dem Herzen; seine Augen, seinen Mund, den ganzen verkommenen Kerl! Er hatte mit ihren Gefühlen gespielt, nur um sie zu zerbrechen. Nein, das stimmte nicht ganz. Nie hatte er ihr sein Wort gegeben, nie ihr Treue geschworen; er war frei, darauf hatte er stets geachtet, keine Verpflichtungen, keine Bindungen … Und sie? Vergaß Zurückhaltung und alle Regeln, warf sich ihm an den Hals, hoffte ihm zu gefallen, wollte ihn verlocken, ihr hinterherzulaufen, sich zu binden … Wenn sich doch die Erde unter den Planken dieses Fußbodens öffnen würde und sie in die Tiefe versinken ließe …
Doch die Erde tat ihr den Gefallen nicht, und sie mußte das Gesicht wahren. Lenore warf einen verstohlenen Blick auf Gramm, auf den General – die anderen Offiziere waren draußen vor der Tür geblieben, eine glanzvolle Prätorianergarde. Gramm schwamm in Wonne, sein Bullenschädel neigte sich ihr zu; Strathmann war bezaubert von der göttlichen Amalia. Der General befand sich auf dem besten Wege, seine Wette zu verlieren.
»Ihre Bemerkungen über die Tugend, mein Herr«, Madame Struves Stimme rührte ans Herz, »erfüllen mich von neuem mit Glauben. Sie haben ja so recht! In einer Zeit, da Freisinn und Zügellosigkeit die Fundamente jeglicher sittlicher Einrichtung angreifen, verdient weibliche Tugend die Unterstützung einer jeden Amtsperson.«
General Strathmann lächelte, hoffend, die Dame werde ihre Tugendhaftigkeit nicht zu weit treiben, solange ihr Gatte saß, wo er saß. Seine Hand väterlich auf die ihre legend, bemerkte er deshalb einschränkend: »Natürlich müssen wir, wenn auch nicht Ihre, so doch zumindest Herrn Struves Vergangenheit im Auge behalten …« Und dachte, sich an die Witzeleien bei Bankier Einsteins ausgezeichnetem Kognak und den guten Zigarren erinnernd: Vorsicht, mein Lieber, die Welt ist voller Fallgruben!
Armer Strathmann – er war so leicht zu durchschauen! Lenore fühlte sich immer unbehaglicher. Warum, um Gottes willen, hatte sie diesem Besuch im »Türkenlouis« zugestimmt, hatte den Plan sogar unterstützt, als er bei der Tischunterhaltung auftauchte? War es denn so interessant, zuzusehen, wie ein alter Mann sich zum Narren machte? Und hatte sie nicht gewußt, daß Andreas Lenz in den gemeinsten Kneipen und mit den übelsten Menschen verkehrte? Oder hatte sie gerade die Begegnung erhofft, die sich hier ergeben hatte? …
»Aber ich versichere Sie, Herr General«, Madame Struve erschien völlig hilflos, »nur die Treue einer Ehefrau veranlaßte mich hierherzukommen …« Ihre Augen schimmerten. »Nur die Treue einer Ehefrau konnte mich dazu bringen, dieses Gesuch an Sie zu schreiben, mein ganzes Herz Ihnen zu eröffnen …«
»Nun, nun!« Der General tätschelte Madames Hand. Leutnant Gramm spürte trotz seines dicken Fells etwas von der Stimmung. Er rückte näher zu Lenore hin und hüstelte, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Lenore lächelte teilnahmslos.
Nein, so hatte sie das nicht beabsichtigt. Die Unterhaltung bei ihrem Geburtstagssouper war albern gewesen. Sie hatte nur halb hingehört, die Kehle war ihr wie zugeschnürt gewesen vor Enttäuschung. Jemand, der Staatsprokurator war es wohl gewesen, hatte den Gefangenen in Bastion Dreißig erwähnt, und man hatte sich entrüstet über die skandalöse Art und Weise, wie es seinem Anwalt Brentano gelungen war, den Prozeß in ein Forum für die aufrührerischste staatsfeindliche Agitation zu verwandeln. Schrecklich, wie sehr die Regierung in Bedrängnis war – man vergegenwärtigte sich, daß sie die wenigen Jahre Strafe akzeptieren mußte, die Struve erhielt, und es nicht einmal wagen durfte, Madame Amalia vor Gericht zu stellen! Und jetzt, aus der Untersuchungshaft entlassen, reiste die Dame ungeniert kreuz und quer durch das ganze Großherzogtum und warb um Sympathie und Unterstützung. Wußten Sie, mein Wertester, daß sie zur Zeit sich hier in Rastatt aufhielt? Ja, direkt in der Festung, in dem übelbeleumdeten Wirtshaus »Zum Türkenlouis«? …
Die Meinungen gingen dann auseinander. Die meisten der Herren taten die Bedrohung von seiten dieser modernen Jungfrau von Orleans geringschätzig ab. Am lautesten gebärdete sich der General; er prahlte, im Besitz von Madame Amalias Gesuch zu sein, sie dadurch völlig in der Hand zu haben und sie ganz und gar vernichten zu können, falls er das wollte. Man bezweifelte das: der Herr General sei denn doch zu sehr Kavalier, als daß er mit einer Dame so streng verfahren könnte. Jemand stellte die Frage: Würde der Herr General wohl das Kommando bei einem besonderen Aufklärungsauftrag zu La belle Amalia übernehmen und den Geburtstagsgästen unverzüglich berichten, ob sie wirklich so schön und reizvoll war, wie das Gerücht besagte?
Das Gerücht, dachte Lenore, traf zu, und doch auch nicht. Amalia Struve wirkte auf die Männer, aber die Wirkung war zu beabsichtigt. Sie besaß Charme, aber selbst dieser Charme hatte eine Schärfe, die sie bewußt zu mildern suchte. Intelligent war sie, bewundernswert intelligent, dachte Lenore, aber irgend etwas, vielleicht ihre zuweilen leicht kreischende Stimme, ließ auf zuviel Ambition schließen.
»Sie erwähnten meine Vergangenheit, mein Herr …«, die kleine Hand entzog sich dem sanften Druck des Generals, »meine und die Struves. Ich stehe zu dem, was ich getan habe, und bereue nichts. Aber als Mann von Ehre werden Sie verstehen, daß wir – welcher Vergehen Sie auch Struve oder mich für schuldig halten – keine gemeinen Verbrechen begangen haben; wir verdienen nicht, zusätzlich bestraft zu werden durch … durch …«
»Aber, aber! Wir sind doch keine Barbaren!« Ein gerührtes Blaßrosa färbte die pergamentartige Wange Strathmanns. »Wir haben sogar angeordnet, daß Ihr Mann vegetarisches Essen bekommt und daß er die Bücher über Phrenologie erhält, die er zur Fortführung seiner wissenschaftlichen Studien wünschte …«
»Sie sind so liebenswürdig!« brach es aus Amalia heraus. »Und Struve wird so beglückt darüber sein! Aber …«
Sie unterbrach sich. Lenore staunte, wie gut sie den rechten Moment wahrzunehmen wußte. Sogar ein Strathmann konnte den Gedanken zu Ende führen, den sie angedeutet hatte: Salate, ja; Phrenologie, ja; nicht aber den Trost der nur allzu seltenen, unschätzbaren Besuche seiner Frau …?
Gramm lachte in sich hinein. Er hatte durchaus begriffen. »Es ist nicht das Hauptanliegen der Armee Seiner Hoheit des Großherzogs, Madame, ihre Gefangenen zu beglücken!«
Er beugte sich vor, in Erwartung der Zustimmung seines Vorgesetzten und wenigstens eines anerkennenden Nickens seitens der jungen Dame, deren jüdische Abstammung er um ihrer anderen Vorzüge willen bereit war in Kauf zu nehmen. Aber keine Zustimmung kam. Tölpel! … dachte Lenore. Sie hätte ihn sogar zurechtgewiesen, hätte sie nicht gewußt, wie gut die andere imstande war, sich selbst zu verteidigen.
»Ich freue mich, daß Sie das so klar festgestellt haben, Herr Leutnant.« Eine feine Trauer im Ton verbarg, was Madame Struve wahrhaft empfinden mochte. »Aber ich wende mich ja nicht an die Armee, auch nicht an den General – ich wende mich an den Mann und an das Herz in seinem Busen.«
Der Adamsapfel zwischen den steifen Ecken des goldbeborteten Generalskragens bewegte sich. Amalia, fand Lenore, hatte ein bißchen zu dick aufgetragen bei dem Bild, das sie von sich selbst entwarf. Trotzdem begann sie diese Frau sympathisch zu finden – wenn die sich erst in Rastatt etabliert hatte, würde sie die Dinge schon ins Wirbeln bringen und Glanz und Leben schaffen … Vielleicht eine ältere Freundin für sie selbst? Lenore verzog die Stirn. Sie brauchte eine Freundin, besonders jetzt. Und hatte sie sich nicht immer einsam gefühlt unter diesen Provinzlern, da ihr Vater doch einer anderen Generation angehörte und Lenz – Lenz ein verderbter, wüster, bösartiger Schuft war?
General Strathmann schien, wenn er auch eine andere Perspektive im Sinn hatte, einen längeren Aufenthalt Amalia Struves gleichfalls in Betracht zu ziehen. Er erhob sich, sehr hager, sehr gebrechlich, sehr aristokratisch. »Sie verstehen, Madame« – seine Zunge befeuchtete die bläulichen Lippen –, »daß die Bewilligung Ihres Gesuches die strengste Kontrolle Ihres Tuns erfordern würde. Rastatt ist nicht irgendeine Stadt. Rastatt ist die neueste Festung des Reiches, und man muß Vorsicht walten lassen …«
Lenore hob die Hand. »Ich übernehme die Verantwortung für Madame Struve!« rief sie impulsiv.
Plötzlich glaubte sie einen Sinn in dem Abenteuer dieses Abends zu erkennen, das als ein geschmackloser Scherz begonnen hatte, als Amüsement einiger Herren Garnisonsoffiziere, während ihr Wunsch, sie zu begleiten, als Geburtstagslaune eines eigenwilligen Mädchens hingenommen worden war. Aber jetzt bot sich eine Chance, ihre Sympathien für die Ideen dieser Frau zum Ausdruck zu bringen, was ihre Ideen im einzelnen auch sein mochten. Sympathien? – Lenore spürte, daß sie beide gegen die Langeweile waren, gegen den kleinen, täglichen Druck und gegen die großen Ungerechtigkeiten, gegen generationenalte Vorurteile und die allgemeine Feigheit. Darin fühlte sie sich eins mit Amalia Struve und mit tausend anderen und mit – ja, auch mit Andreas Lenz. »Ich werde Madame Struve regelmäßig besuchen, Herr General«, versicherte sie, »ich werde ihr Gesellschaft leisten. Ich werde …«
»Oh, nein …!« sagte der General. Lenores Enthusiasmus beunruhigte ihn. Er wünschte keine Eindringlinge in das Gehege, das er zu seinem eigenen zu machen hoffte. »Ich fürchte, meine liebe junge Dame, diese Art von Überwachung wird ausschließlich eine militärische Angelegenheit bleiben müssen … Madame! – Ich hoffe, Sie vergeben die Plötzlichkeit unseres Besuches. Sie werden sehr bald von mir hören.«
Er nahm die ausdrucksvolle kleine Hand, führte sie an die Lippen und preßte einen leichten Kuß darauf. Dann bot er Lenore galant den Arm, winkte Leutnant Gramm, die Tür zu öffnen, und zog ab.
»Achtung!«
Das Herz krampfte sich Lenore wieder zusammen. Wie durch einen Nebel bemerkte sie die Handbewegung des Generals, sein herablassendes »Weitermachen!« Hinter seinem verschwommenen Profil gafften die Gesichter. Sie hörte Bemerkungen, meist feindlicher Natur. Zum Teil galten sie ihr. Die Offiziere schlossen sich um sie zusammen, schützten sie jetzt vor den gehässigsten Blicken, vor plumpen Fingern, die den Stoff ihres Kleides, die Echtheit ihrer Brosche prüfen wollten. Lenore schluckte. Alles war verfehlt: Sie ging am Arm des falschen Mannes, und die falschen Leute schützten sie vor der Bedrohung von der falschen Seite. Sie zwang sich, den Kopf hoch zu tragen. Sie zwang ihre Augen, alles klar zu erkennen, ihren Verstand, alles zuverlässig in sich aufzunehmen. Ja, er war noch da: Andreas Lenz, eine Strähne fiel ihm über die Stirn; zunächst mied er ihren Blick, dann wich er nicht länger aus, sondern hielt mit gespielter Gleichgültigkeit stand; das Weibsstück hing ihm noch immer am Arm, wenn auch seine Hand sie nicht mehr so fest hielt. Die Tatsache, daß sein Griff erschlafft war, schien seine Freundin jedoch nicht weiter zu stören, seine Nähe war alles, was sie zu ihrem Glück brauchte; ihr Gesicht, das die Spuren ihres Lebenswandels zeigte, war wie in ein eigenes Licht getaucht. Lenore wandte sich ab. Armes Ding! … Auch sie würde er fallenlassen. Oder vielleicht nicht. Vielleicht war so eine genau sein Niveau, genau der Morast, in dem er sich zu wälzen liebte … Als wenn sie nicht ihre Brosche und ihr hübsches Kleid und ihre Geburtstagsgesellschaft und Gott weiß was dafür gegeben hätte, anstelle der anderen Frau zu sein, die sich an Lenz klammern durfte – statt von dem ängstlichen General in seiner Paradeuniform und einem halben Dutzend Offizieren eilig hinausgeführt zu werden, verfolgt von obszönen Rufen und anzüglichem Gelächter und von ihrem eignen Gefühl, schändlich versagt zu haben …
Und dann war nur noch dieser schmierige Mann da mit seinem schmierigen Lächeln und der schmierigen Stimme: »Der Name ist Stäbchen«, sagte er, »Sebastian Stäbchen – falls Mademoiselle an irgend jemand besonders interessiert sind – jede Information, die Sie wünschen – über jede Tätigkeit wird Bericht erstattet, ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig – alles streng vertraulich – der Name ist Stäbchen, Sebastian Stäbchen …«
Zweites Kapitel
Preßfreiheit … und den Galgen daneben!
(Zeitungsausschnitt, datiert in Andreas Lenz’ Handschrift: »Neue Rheinische Zeitung, 22. März 1849«)
Von weither erklang das Pfeifen eines Zuges. Christoffel ging schneller und zwang dadurch Comlossy, mit ihm Schritt zu halten. Es war ein klarer Morgen, ziemlich warm für April. Comlossy, in Rock und Weste, begann zu schwitzen.
»Wir brauchen uns nicht zu beeilen!« ächzte er protestierend und tupfte sich das Gesicht mit seinem blaukarierten Taschentuch ab. »Der Zug fährt frühestens in zehn Minuten am Bahnhof ein, und dann muß die Lokomotive erst Wasser und Kohlen aufnehmen.«
Christoffel verminderte das Tempo, verfiel aber bald wieder in seinen Trab. Er war nervös, und das nicht nur wegen der ungewohnten Zivilkleidung, der weiten Hose, der dunkelbraunen, an den Ellbogen glänzenden Jacke, der schwarzen Mütze mit dem zerknitterten Schirm, dem respektablen, aber ausgefransten Halstuch. Da war die Erwartung der langen Reise – mit dem Zug, mit der Kutsche und wieder mit dem Zug, den ganzen Weg nach Norden bis Köln –, er hatte Grenzen zu überschreiten und Kontrollen zu passieren, und nicht eine freundliche Seele würde ihm helfen und raten, außer dem Korrespondenten der »Neuen Rheinischen Zeitung«, der ihn in Frankfurt abholen sollte. Und da war sein Paß, ausgestellt für einen gewissen Felix Weinmeister, Handlungsgehilfe, jetzt auf Stellungssuche – Comlossy hatte ihm versichert, daß der Ausweis so echt sei, wie man sich nur wünschen könnte – aber wenn er nun doch nicht echt genug war? …
Diese und viele andere Fragen nagten an ihm seit der Zusammenkunft im Stübchen hinter Comlossys Laden, wo sie bis in den Morgen hinein geredet hatten – er und Comlossy, und ein paar Arbeiter, und der lange Artilleriesergeant, dessen Name Heilig war, und dieser Dichter Lenz, der abwechselnd ernsthafte Gedanken äußerte oder einschlief, den Kopf auf dem Tisch …
»Wir setzen sehr viel Vertrauen in Sie, Bruder Christoffel«, sagte Comlossy und legte seinen Arm um Christoffels Schulter. »Wir sind nicht viele, und unter den Soldaten besonders wenige. Deswegen wollen wir, daß gerade Sie mit unseren Leuten in Köln reden. Aus diesem Grunde haben wir das Geld für Ihre Reise aufgebracht, obwohl keiner von uns reich oder auch nur einigermaßen wohlhabend ist. Und falls Sie geschnappt werden sollten, hier im Großherzogtum, oder jenseits der Grenze, in Hessen, oder später in Preußen …«
Christoffel packte sein Bündel fester – es war leicht genug, ein zweites Hemd, ein Handtuch, ein Regenumhang. »Machen Sie sich keine Sorgen! Ich halte mich an die verabredete Geschichte. Ich werde keine Namen verraten.« Sein Kinn schien sich zu verhärten. »Lieber will ich im Gefängnis vermodern!«
»Beschreien Sie das nicht! Waren Sie je in einem preußischen Gefängnis?«
Christoffel verzog das Gesicht. »Ich kenne die Gefängnisse in einem halben Dutzend deutscher Länder, eins übler als das andere. Ich war Schustergeselle, bevor ich zur Armee eingezogen wurde.« Er runzelte die Stirn in der Erinnerung daran. »Daher kenne ich auch einige Ihrer Leute. Der Bund der Kommunisten …«
»Der Bund?« unterbrach ihn Comlossy scharf. »Den gibt es nicht mehr. Wenigstens nicht in der bisherigen Form.« Er hielt inne. Bis an den Rand der Straße stand der sprießende Weizen, üppig und grün. »Wenn man ernten will«, fügte er leiser hinzu, »darf man die Saat nicht im Sack behalten.«
Sie betraten den Bahnhof und drängten sich zum Bahnsteig durch, gerade als der Zug – Lokomotive, Tender und vier Wagen – einfuhr. Mit ohrenzerreißendem Pfeifen und einem letzten furchtbaren Bullern, bei dem Christoffel und alle anderen Wartenden mit Funken überschüttet wurden, hielt die Lokomotive.
»Bruder Comlossy!« Christoffel wollte sich verabschieden.
Doch Comlossy hatte bereits einen Abstand zwischen ihnen geschaffen. Er sah teilnahmslos aus, fremd, als ob sie nicht mehr zusammengehörten. »Ich gehe jetzt«, sagte er mit abgewandtem Gesicht, kaum die Lippen bewegend.
»Schon?«
»Bleiben Sie auf Distanz!« mit halber Stimme. »Nicht die Hand geben! Steigen Sie in den Zug!«
Christoffel folgte Comlossys Blick. Im Schatten des Vordachs an eine Säule gelehnt, gemütlich einen Bambusstock schwingend, stand der Polizeispitzel, den Lenz aus dem »Türkenlouis« hinausgeworfen hatte. Christoffel überlief es kalt. Erwischt zu werden, bevor er die Reise überhaupt angetreten hatte! Kriegsgericht! Jahre hinter Gittern …!
Comlossy war in der Menge untergetaucht. Christoffel, die Schirmmütze tief über den Augen, stolperte in den nächsten besten Wagen, hinter ihm kamen schubsend und drängend die anderen Reisenden. Vor den Fenstern, die grau waren von Staub und Fingerabdrücken, zogen verschwommene Gesichter vorbei. Christoffel zog den Kopf ein. Wenn er nicht hinausschaute, würde er vielleicht nicht gesehen werden. Durchsuchten sie den Zug? Warum fuhr er nicht ab?