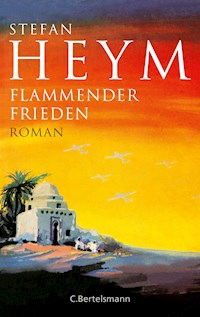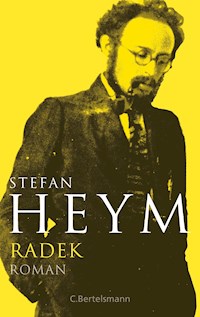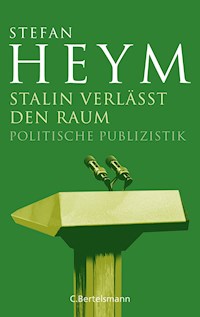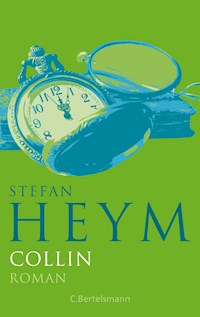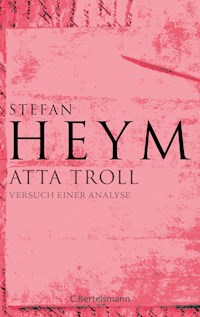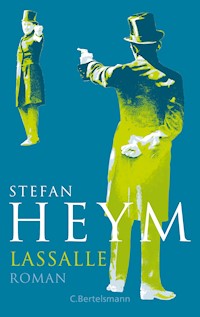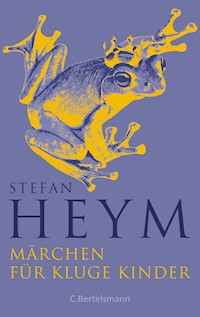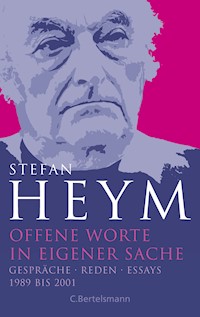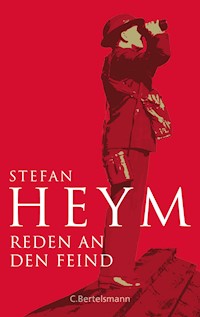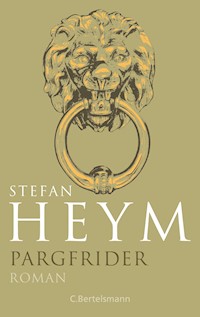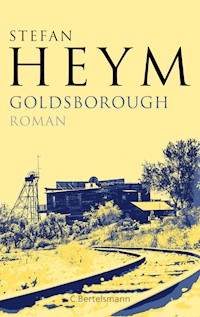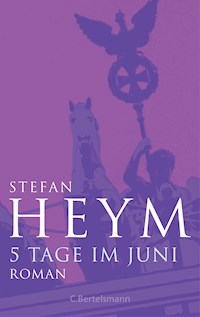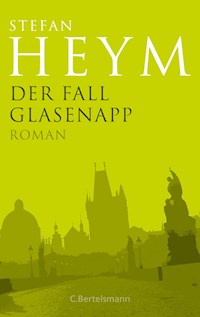
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane
- Sprache: Deutsch
Heyms erster Roman: ein Welterfolg und von Hollywood verfilmt
Prag 1939. Ein deutscher Offizier wird tot aus der Moldau geborgen. Gestapo-Chef Reinhardt nimmt willkürlich tschechische Bürger als Geiseln und droht sie zu erschießen, wenn der Täter sich nicht findet. In seinem ersten, 1942 geschriebenen Roman verdichtet Stefan Heym ein Stück düsterer Zeitgeschichte zu zeitloser Aktualität.
Stefan Heyms erster Roman, beim Paul List Verlag Leipzig 1958 erstmals auf Deutsch erschienen, endlich wieder lieferbar als Teil der digitalen Werkausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Prag 1939. Ein deutscher Offizier wird tot aus der Moldau geborgen. Gestapo-Chef Reinhardt nimmt willkürlich tschechische Bürger als Geiseln und droht sie zu erschießen, wenn der Täter sich nicht finde, um dem Widerstand gegen das Besatzungsregime entgegenzutreten. So grausam, heimtückisch und gnadenlos Reinhardts Methoden auch sind, sie können die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit nicht ersticken. In seinem ersten, 1942 geschriebenen Roman verdichtet Stefan Heym ein Stück düstere Zeitgeschichte zu zeitloser Aktualität.
Stefan Heyms erster Roman, der in den USA auf Anhieb ein großer Bestseller und von Hollywood verfilmt wurde, ist nun Teil der digitalen Werkausgabe.
»Eine spannende Geschichte, die man am liebsten in einem Zug auslesen möchte: eine seltene Mischung aus Detektivroman, Liebesstory, Zeitgeschichte, antifaschistischem Bekenntnis.« Hannoversche Allgemeine Zeitung
»Ein Welterfolg, ein Reißer, zeitgeschichtlich interessant.« Die Zeit
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1952 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Der Fall Glasenapp
Roman
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel „Hostages“ bei 1942 bei G.P. Putnam’s Sons, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1958 beim Paul List Verlag, Leipzig.
Vom Autor besorgte Übersetzung aus dem Amerikanischen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © 1976 by Inge Heym
Copyright © 1976 by C. Bertelsmann Verlag in der Penguin Randomhouse Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München nach einem Entwurf von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagmotiv: © Renata Sedmakova / Shutterstock.com
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27829-8V003
www.cbertelsmann.de
Dem Andenken meines Vaters,
der als Geisel verhaftet war
Erstes Kapitel
»Janoschik! Janoschi-i-i-i-k!«
Die schrille Altmännerstimme des Barkeepers hallte durch den engen Gang, der von der Bar ein Dutzend Stufen hinab zur Toilette führte.
Janoschik öffnete langsam die Tür und brummte zurück: »Was ist denn schon wieder los?«
Der Barkeeper holte Atem. Jetzt würde er diesem Janoschik endlich mal die Meinung sagen. »Immer treibst du dich oben herum, wenn ich dich nicht brauche. Aber wenn ich dich brauche, kann ich mir den Hals heiser schreien. Los, mach mal ’n bißchen rasch! Und bring Eimer und Besen mit!«
Janoschik knurrte etwas und warf die Tür zu.
Ihm gefiel die Ruhe hier unten. Jedesmal, wenn ein Gast die Tür aufmachte und an ihm vorbei in die Toilette ging, fühlte Janoschik sich gestört durch den Schwall von Lärm, den der Gast von oben mitbrachte – Stimmen und Melodienfetzen aus dem Grammophon.
Ihm gefiel die Ruhe hier. Er brauchte Ruhe und Zeit, denn er war ein ordentlicher und etwas langsam denkender Mann, der seine oder eines anderen Eindrücke und Ideen vornahm und sie umwandte und drehte und von allen Seiten betrachtete, bevor er sie in genau bestimmten Fächern seines Gehirns verstaute. Hatte er aber einmal etwas dort verstaut, so war er in der Lage, es zu jeder Zeit herauszuholen und es geschickt und systematisch in der Praxis anzuwenden.
Janoschik beeilte sich nicht. Er beeilte sich nie. Von all den Menschen, die ihn kannten, konnte keiner sich erinnern, ihn je in Eile gesehen zu haben. Sogar unten in der Grube in Kladno, als der Schacht einsackte und die Kumpel verzweifelt aufschrien oder wie Mäuse in der Falle herumliefen, beeilte er sich nicht. Er suchte sein Werkzeug zusammen, weil er glaubte, es vielleicht noch brauchen zu können. Er stellte das Licht in der Lampe so ein, daß die Batterie möglichst geschont wurde. Dann wartete er, bis die Männer um ihn die Lage begriffen hatten und aufhörten mit dem Lärm. Und in dem schrecklichen Schweigen, das auf die Katastrophe folgte, trat er vor, bereit, die Führung zu übernehmen.
Janoschik beeilte sich nicht. Er hörte, wie der Barkeeper schon wieder nach ihm rief.
Er holte Besen, Eimer und Scheuerhader aus dem Abstellraum, dann füllte er den Eimer mit Wasser aus der Leitung über dem Ausguß und begab sich nach oben, langsam, mit schwerem, gemessenem Schritt.
Es war gut, daß seine Füße gewohnt waren, fest auf dem Boden zu stehen, denn die Treppe heruntergetorkelt kam ein Mann in deutscher Offiziersuniform. Der Offizier, verglasten Auges und käsig blaß, angelte nach Halt. Seine Hand fand Janoschiks breite Schulter.
»Immer schön langsam, mein Bester!« sagte Janoschik. »Halten Sie sich nur geradeaus – Sie können gar nicht dran vorbeigehen.«
Aber der Betrunkene rutschte an Janoschiks Leib entlang nach unten, bis er auf der Treppe saß. Dann begrub er sein Gesicht in den Händen und fing an zu schluchzen – ein lautes, wimmerndes, lächerlich weibisches Schluchzen.
Ein heulendes Stückchen Elend – aber Janoschik empfand keinerlei Mitleid. Er zuckte die Achseln und ging weiter.
»Ich dachte schon, du würdest überhaupt nicht mehr kommen!« begrüßte ihn der Barkeeper. »Ich bitte um Verzeihung, die Herren!«, und er bewegte entschuldigend die Hände.
Die Gäste an der Bar machten Platz für Janoschik, der sich die Bescherung besah. Der Betrunkene, dem er auf der Treppe begegnet war, hatte sich offenbar hier oben erbrochen.
Janoschik drückte seine Mißbilligung durch ein halbes Kopfschütteln aus.
»Also los, aufwischen!« Die Stimme war scharf, und sie sprach deutsch.
Janoschik blickte auf, blickte direkt in das Gesicht eines Nazi-Offiziers.
»Aufwischen!« wiederholte der Barkeeper auf tschechisch und sprach weiter – laut, offensichtlich, damit die anderen Gäste es hören sollten: »Warum hast du so lange getrödelt? Von Rechts wegen müßtest du all die Herren hier um Verzeihung bitten, weil sie so lange auf dich warten mußten! Schließlich sind Bar und Grill im Café Parnaß doch kein Schweinestall!« Er lachte nervös.
Janoschik begann aufzuwischen. Der Offizier wandte sich an einen zweiten und sagte: »Faule Bande, diese Tschechen – verdreckt, liederlich, undiszipliniert. Brauchst dir nur den Kerl anzusehen.«
Der zweite Offizier zeigte kein Interesse für die Weisheiten des ersten. »Wir hätten den Glasenapp nicht mitnehmen sollen«, murmelte er. »Mit dem ist nichts los. Ein paar Schnäpse – und er wird sentimental und kotzt die ganze Bude voll.«
Der erste ließ sich nicht von seinem Thema abbringen. »Soll er kotzen, soviel er will. Die Tschechen wissen ganz genau, was ihnen passieren würde, wenn sie hier eine Lippe riskierten. Schau dir an, wie respektvoll und manierlich sie sind – sagen kein Tönchen, wagen nicht mal zu verduften. Mein lieber Marschmann, die haben wir großartig abgerichtet. Angst haben die, alter Junge, Angst, daß wir beleidigt sein könnten, wenn sie wagten, sich zu verdrücken!«
Er schrie: »Bäh!« und fing an hysterisch zu lachen, daß es ihn schüttelte.
Die Tschechen, alle Zivilisten, sowohl die an den Tischen wie auch die an der Bar, hatten aufgehört zu sprechen. Wie unter den besseren Bürgern Prags üblich – und die Stammkundschaft des Parnaß gehörte zu dieser Klasse –, verstand fast jeder Deutsch.
Ein gutgebauter junger Mann, der an einem Ecktisch gesessen hatte, erhob sich. »Kellner, die Rechnung!« Und zu seinem Begleiter gewandt, sagte er: »Ich denke, wir gehen, Prokosch. Stickige Luft hier.«
Der Offizier mit der ausgeprägten politischen Haltung ging unsicheren Schritts auf den jungen Mann zu. Am Tisch angekommen, richtete er sich auf: »Gestatten, Hauptmann Patzer. Und Sie sind?«
Der junge Mann verharrte in Schweigen.
»Wer Sie sind, habe ich gefragt!« wiederholte Patzer lauter.
»Mein Name ist Peter Lobkowitz.«
»Also, Herr Lobkowitz, Sie wollen uns doch nicht etwa verlassen, weil ich oder Leutnant Marschmann oder der arme Leutnant Glasenapp, der den lausigen Schnaps hier nicht vertragen konnte, Ihnen unsympathisch sind?«
Lobkowitz wußte nicht recht, wie er die provokatorische Frage beantworten sollte. Dieser Hauptmann Patzer war offensichtlich angetrunken. Was man auch immer sagte, es würde zu Unannehmlichkeiten führen, und Unannehmlichkeiten dieser Art führten zu raschem Eingreifen der Polizei – und die Polizei griff immer zugunsten der Deutschen ein.
»Ich habe eine Verabredung«, sagte er.
Patzer grinste. »Aber vorhin haben Sie doch gesagt, daß Ihnen die Luft zu stickig wäre.« Er hörte auf zu grinsen und trat dicht an Lobkowitz heran. »Wenn die Luft gut genug ist für mich und Leutnant Marschmann, dann ist sie auch gut genug für euch Tschechen. Klar?«
»Bitte schön«, sagte Lobkowitz.
»Na, sehen Sie, das ist schon besser.« Patzer wurde freundlich. »Ich würde mich freuen, wenn Sie darauf mit mir und Leutnant Marschmann einen trinken würden. Sehen Sie« – und er machte eine große Geste, durch die er sich an alle Anwesenden wandte –, »wenn ihr Tschechen euch vernünftig verhaltet, dann kommen wir schon miteinander aus – sehr gut sogar.« Der Hauptmann nahm Lobkowitz beim Arm und stolperte zurück zur Bar.
Janoschik, der den Fußboden immer noch säuberte, beobachtete das Ganze mit wachsendem Unbehagen. Niemand konnte voraussagen, was geschehen würde, wenn deutsche Offiziere es sich in den Kopf setzten, die tschechische Bevölkerung zu erziehen.
Außerdem befand sich unter den Gästen heute abend auch Breda, mit dem er zu sprechen hatte und der wohlbehalten wieder verschwinden mußte. Wie, wenn sich dieser Hauptmann Patzer jedesmal, wenn ein Gast gehen wollte, persönlich beleidigt fühlte?
Breda stand am Ende der Bar, so weit wie möglich von den deutschen Offizieren entfernt. Er nippte ruhig an seinem Bier.
Janoschik bückte sich nach dem Eimer. Als er sich wieder aufrichtete, begegneten seine und Bredas Blicke einander. Janoschik bewegte den Kopf leicht in Richtung der Tür zur Toilette, ein Zeichen, das nur für Breda wahrnehmbar war.
Auf dem Weg nach unten erinnerte sich Janoschik plötzlich, daß der betrunkene Offizier wahrscheinlich immer noch auf der Toilette war. Janoschik fluchte leise. Breda würde nach unten kommen, und sie würden nicht einmal miteinander reden können.
Aber zu seiner Überraschung fand Janoschik die Toilette leer. Er sah überall nach, aber der Betrunkene war tatsächlich nicht mehr da. Obwohl Janoschik das Schicksal des Kerls höchst gleichgültig war und sein ganzes Denken sich auf die Meldung richtete, die er von Breda erwartete, konnte er doch nicht völlig von dem Bild dieses Offiziers loskommen. Schließlich mußte dieser Glasenapp ja irgendwo sein!
Vielleicht war er durch die kleine Seitentür hinaus auf die Mole gegangen.
Sollte man nachsehen? Die Mole war nicht sehr breit, und es gab auch kein Geländer, das einen vor einem Sturz in die Moldau schützte.
Dieser kleine Seitenausgang zur Mole war einer der Gründe gewesen, die Janoschik veranlaßt hatten, die Stellung als Toilettenwärter und Faktotum im Café Parnaß anzunehmen. Ein weiser Mann, dachte Janoschik, sichert sich stets eine Rückzugslinie.
Überhaupt paßte so ziemlich alles am Café Parnaß zu Janoschiks Plänen. Er mußte eine Operationsbasis haben, wo man ihn besuchen und unauffällig mit ihm sprechen konnte. Und es ließ sich schon einiges besprechen und arrangieren, während man dem Besucher die Schuhe putzte! Sogar der kurze Moment, während dessen man jemandem den Kragen abbürstete, gab Gelegenheit, ein paar Worte zu flüstern – eine Adresse, die weitergegeben werden mußte, eine Warnung, die verbreitet werden sollte.
Auch wenn er freihatte, konnten Nachrichten für ihn in dem Arzneischränkchen hinterlassen werden, das das Notwendigste zur Ersten Hilfe enthielt – eine Flasche Jod, Gaze, Watte, Alkohol. Kleinere Pakete konnten unbeobachtet mit der Wäsche hereingebracht werden. Der Lieferjunge von der Wäscherei war in Ordnung; er war es sogar gewesen, der Janoschik auf die Möglichkeiten im Café Parnaß aufmerksam gemacht hatte.
Und schließlich war da noch der Zugang vom Wasser. Das Café Parnaß stand teilweise auf einer Mole, die in die Moldau hinausreichte. Im Hauptgeschoß befand sich das Café; das Obergeschoß war für Kunstausstellungen vermietet worden. Nachdem die Nazis in Prag einmarschiert waren, hörte das Parnaß jedoch auf, Zentrum der modernen tschechischen Kunst zu sein.
Ein Durchgang führte vom Café nach links zu Bar und Grillraum. Rechter Hand befand sich die Treppe, über die man zur Toilette und zu ein paar Abstellräumen gelangte. Und gleich am Fuß der Treppe befand sich das Türchen zum Wasser.
Janoschik, der schwimmen konnte wie ein Fisch, hatte die Stellung für ein sehr bescheidenes Gehalt angenommen. Hier und da gab es auch Trinkgelder. Er war ohnehin gewöhnt, von nahezu nichts zu leben, und hätte, wenn nötig, zugezahlt, um diese Stellung zu bekommen.
Jetzt arbeitete er schon mehr als vier Monate im Parnaß, und es war die ruhigste Zeit seines Lebens geworden. In früheren Jahren, als er noch unter den Bergarbeitern Organisationsarbeit machte oder sich bei den mährischen Landarbeitern herumtrieb, hatte er erheblich mehr Abwechslung gehabt – mal mußte der Name, mal das Quartier geändert werden, und gelegentlich geriet man auch ins Gefängnis. Aber jetzt? – er lächelte vor sich hin – jetzt hatte er ein warmes kleines Versteck, noch dazu mit einem Hinterausgang, und es schien, als hätten ihn die Behörden, die tschechischen wie auch die deutschen, entweder vergessen oder noch nicht entdeckt.
Natürlich machte sich Janoschik keine Illusionen. Er wußte, so konnte es nicht dauernd weitergehen. Über kurz oder lang würden sie ihn schnappen; dann war man eben an der Reihe. Angst davor glaubte er nicht zu haben. Als er damals im Krieg war – und er war vier lange Jahre dabeigewesen –, hatte er auch gewußt, daß es ihn treffen konnte. Ein Soldat mußte mit so etwas rechnen. Und Soldat war er wieder – aber diesmal aus freiem Willen.
Die Tür öffnete sich. Breda trat ein.
»Gib mir ein Stückchen Seife«, sagte er.
Janoschik gab ihm Seife und Handtuch. Der Mann wusch sich die Hände. Janoschik beobachtete ihn und seine Hände – große wohlgeformte Hände, Hände, die einem Vertrauen einflößten.
»Wir können sprechen«, begann Janoschik, »aber mach’s kurz. Du mußt so rasch wie möglich weg von hier. Diese Offiziere da oben …«
»Laut sind sie«, berichtete Breda, »große Schnauze und nichts dahinter. Jetzt haben sie sich jemanden vorgenommen, den du kennen solltest – deinen früheren Chef, glaube ich.«
»Meinen Chef?« fragte Janoschik.
»Ja – Lev Preissinger vom Kohlensyndikat. Jetzt gehören ihm die ganzen Gruben in der Gegend von Kladno. Er ist hier mit einem Arzt, komischer Kauz, Wallerstein heißt er. Wallerstein hält den Nazis einen Vortrag über Psychoanalyse; er redet sich den Mund fusselig, um sie beschäftigt zu halten und zu beruhigen. Eigentlich eine ganz komische Situation.«
Breda trocknete sich gründlich die Hände und gab Janoschik das Handtuch zurück.
»Also gut«, sagte er, »alles ist vorbereitet und fertig. Heute ist Donnerstag. Nächsten Dienstag, spätestens Mittwoch soll die Lieferung hier durchkommen. Einen, höchstens zwei Tage werden die Waggons hier stehen. Wir wissen nicht genau, auf welchem Gleis – die Eisenbahner werden das selbst feststellen müssen. Was meine Gruppe betrifft, haben wir unsere Arbeit getan, die Pakete sind bereit. Die Eisenbahner wissen, daß sie ihren Auftrag erledigt haben müssen, bevor die Waggons umrangiert sind. Jetzt merk dir diese Adresse: Watzlik, Smichovská-Straße 64. Wiederhol mal!«
»Watzlik, Smichovská-Straße 64«, sagte Janoschik langsam. »Ich vergesse es schon nicht.«
Sie sahen einander an. Sie spürten, daß vielleicht noch etwas mehr zu sagen wäre, etwas von Bedeutung. Aber sie schüttelten sich nur die Hände.
»Wenn etwas Besonderes sein sollte, komme ich vorbei«, sagte Breda.
Janoschik wandte sich um und begann das Waschbecken zu säubern.
Der andere schloß leise die Tür.
Sieh einer an, dachte Janoschik, der Lev Preissinger ist hier. Und ich habe ihn nicht einmal erkannt. Sonderbar – dabei habe ich so viele Reden gegen ihn gehalten. Wie er uns nicht genug Grubenholz geben wollte, um die Decke abzustützen. Holz kostet Geld, ein Menschenleben kostet nichts. Die paar Kronen – was bedeuteten sie einem Mann wie Lev Preissinger! Na ja, ein paar Kronen hier, ein paar Kronen da, wenn man’s addiert, kommen ein paar Millionen heraus. Aber Petkas Gesicht, nachdem das Gestein ihn zerdrückt hatte – und Petka war fast noch ein Kind!
Nachher würde er mal hinaufschauen und sich den Preissinger genau ansehen. So genau, wie er sich damals Petkas Gesicht angesehen hatte. In diesem Leben, dachte er, wird nichts vergeben und nichts vergessen. Einmal wird Bilanz gezogen.
Jemand kam eilig die Treppe herunter. Der Barkeeper ließ sein Gesicht in der Tür sehen. »Sag mal – wo ist der Offizier? Richte ihm aus, er soll sich beeilen, und er soll auch nicht vergessen, sich die Hosen zuzuknöpfen.«
»Ich kann einem deutschen Offizier nicht vorschreiben, daß er sich die Hosen zuknöpfen soll«, bemerkte Janoschik trocken. »Das ist gegen seine Würde.«
»Richte ihm aus, daß Hauptmann Patzer das befohlen hat«, antwortete der Barkeeper. »Der Hauptmann möchte gehen. Bin ich froh, daß die den Aufenthalt bei uns endlich satt bekommen haben!«
Janoschik brauchte Zeit. Er mußte Zeit gewinnen für sich selbst, zum Nachdenken, und für Breda, der entkommen mußte.
»Hast du den Otto Krupatschka gekannt«, fragte er den Barkeeper, »dem der Goldene Engel in Žižkov gehört hat?«
»Was geht mich dein Otto Krupatschka an«, antwortete der Barkeeper. »Ich muß machen, daß ich zurückkomme, und willst du die Güte haben, dem Offizier auszurichten, was ich dir gesagt habe!«
Janoschik trat zur Tür und packte den Barkeeper am Ärmel. »Wenn ich dir aber von dem Krupatschka erzähle, so ist es nicht ohne Interesse für dich – verstehst du?«
Der Barkeeper machte ein saures Gesicht. »Laß mich gefälligst los!«
Janoschik fuhr ungerührt fort: »Dieser Krupatschka hatte eine junge Frau, die sehr gute Fleischklößeln machte, Fleischklößeln mit einer besonderen Soße mit einer Menge Pfeffer drin. Es muß was in der Soße gewesen sein – auf jeden Fall konnte der Krupatschka nicht so ganz mit ihr mitkommen – du verstehst?«
Des Barkeepers Neugier geriet in Konflikt mit seinem Pflichtgefühl. »Ich hab’ keine Zeit«, sagte er, »so erzähl schon, mach schnell, um Gottes willen!«
»Und dann«, spann Janoschik seine Geschichte weiter, »eines schönen Tages schickt der Krupatschka seinen Piccolo, er soll der Frau sagen, daß er zeitig nach Hause kommt, und sie soll das Essen, bitte schön, fertig haben, weil er nämlich Hunger hat. Und der Piccolo geht, und nach einer langen Zeit kommt er zurück zum Goldenen Engel.«
»Erzähl mir den Rest morgen!« Der Barkeeper verlegte sich aufs Bitten. »Die Leute wollen was zu trinken. Und der Hauptmann Patzer wartet immer noch!«
»Wie soll ich dir eine Geschichte erzählen«, erkundigte sich Janoschik, »wenn du mich die ganze Zeit unterbrichst? Ich wär’ schon längst fertig gewesen damit, wenn du zugehört hättest, statt dauernd zu reden.
Jedenfalls, wie ich dir zu erklären versucht hab’, kommt der Piccolo zurück zum Krupatschka. Also, sagt der Krupatschka, was hat sie gesagt? Sagt der Piccolo, nichts hat sie gesagt. Und wenn ich Sie wäre, Pan Krupatschka, würde ich heute abend außerhalb essen. Denn Ihre Frau ist durchgebrannt – mit einem gewissen Ludwig Pollatschek, ein sehr netter junger Mann, habe ich erfahren, und Student der Medizin …«
Dem Barkeeper war es gelungen, seinen Ärmel von Janoschiks Griff zu befreien.
»Und warum«, fragte er streng, »hältst du mich von meiner Arbeit ab, mit dieser dummen Geschichte, die keine Pointe hat?«
»Weil es da eine gewisse Parallele gibt, sozusagen«, erklärte Janoschik geduldig. »Wie die Frau von dem armen Otto Krupatschka, die durchgebrannt ist mit dem Pollatschek, so muß nämlich dein Offizier auch davongelaufen sein. Hier ist er nicht mehr. Verschwunden ist er.«
»Unmöglich!« Angst klang in der Stimme des Barkeepers mit.
»Sieh dich doch selber um!«
Der Barkeeper sah sich um. Er machte jede einzelne Klosett-Tür auf, er blickte hinaus ins Dunkel durch den Seitenausgang zur Mole – nirgendwo eine Spur von Leutnant Glasenapp.
»Heilige Mutter Gottes!« stöhnte er. »Das ist ja schrecklich! Das ist ja katastrophal!« Und schrie Janoschik an: »Weißt du, was das heißt?«
»Nein«, antwortete Janoschik freimütig, »das weiß ich nicht.«
Der Barkeeper war totenbleich geworden. Er hatte seine Stimme verloren und konnte nur noch flüstern: »Du bist so blöd, daß ich dich umbringen könnte!«
Janoschik, der ein Riese war verglichen mit dem ausgetrockneten Männchen, erkundigte sich voller Mitgefühl: »Wieso?«
Aber der Barkeeper rannte schon die Treppe hinauf.
Die Tür war offengeblieben, und Janoschik konnte das Theater, das nun anfing, mit anhören.
Die ganze Zeit, während er die Krupatschka-Geschichte erfunden hatte, waren Janoschiks Gedanken in eine ganz anderen Richtung gelaufen. Es war ihm einfach unklar, was aus dem Offizier geworden sein konnte. Es hatte auch nicht viel Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen – jetzt kam es darauf an, die eigene Taktik, das eigene Verhalten zu planen. Vielleicht war es am besten, man blieb bei der Wahrheit und sagte einfach: Ich weiß nicht. Als er den Offizier das letztemal sah, saß er auf der Treppe – das war alles. Mehr wußte er nicht. Mehr würde er nicht sagen. Und da konnte ihm auch keiner viel antun, und aller Wahrscheinlichkeit nach war dieser Offizier längst zu Hause in seinem Quartier.
Wenn es Breda nur gelungen war, sich rechtzeitig zu verdrücken!
Schwere Stiefel hallten auf der Treppe wider. Janoschik sah den Nazi kommen – erst die Stiefel, dann die Reithosen, dann den ganzen Mann.
Auf dem Gesicht des Mannes spiegelten sich seine Gefühle: Angst, Herrschsucht und Wut. Und in der rechten Hand hielt er drohend die Pistole.
»Wo ist Leutnant Glasenapp?« forderte Patzer.
»Woher soll so einer wie ich das wissen?« fragte Janoschik. »Ich möchte respektvoll zu bedenken geben, daß ich nicht die Ehre gehabt habe, jemals die Bekanntschaft des Herrn Leutnant zu machen.«
»Behalten Sie Ihre Weisheiten gefälligst für sich«, erwiderte Patzer in unheilverheißendem Ton. »Sie wissen sehr wohl, daß ich von dem Offizier spreche, der hier hinunterkam, um sich zu erleichtern. Wo ist er?«
Janoschik hob die Hände, ein Bild absoluter Hilflosigkeit. »Mein Ehrenwort, bester Herr, ich weiß nicht. Wie soll ich alle Leute im Gedächtnis behalten, die auf die Toilette gehen? Und manchmal bin ich drin, und manchmal bin ich draußen …« Er drehte sich um und fing an, ein frisches Handtuch aus dem Schrank zu nehmen. Was ihn, Janoschik, betraf, war das Gespräch vorbei, und er beabsichtigte, dem Offizier diese Tatsache sehr deutlich zu machen.
Aber Hauptmann Patzer wurde nur noch wütender auf diesen verstockten Tschechen.
»Mitkommen!« befahl er.
»Warum?« fragte Janoschik. »Wohin?«
Patzer stieß seine Pistole Janoschik zwischen die Rippen.
»Ich habe das Zucken im Finger«, drohte der Hauptmann. »Ich gebe Ihnen den guten Rat zu gehorchen, ohne dumme Fragen zu stellen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Sie Idiot?« Und er drückte die Mündung der Pistole fester gegen Janoschik.
Janoschik lächelte, die verletzte Unschuld in Person. »Herr Offizier – ich habe mir nur gestattet zu fragen, weil mein Chef es nicht gern sieht, wenn ich mich von meiner Arbeitsstätte entferne. Ihre Gesellschaft ist mir ein Vergnügen, Ihre Einladung eine Ehre. Möchten Sie vielleicht, daß ich Ihnen helfen soll, ihn zu suchen, diesen – diesen Herrn Leutnant Glasenapp?«
Sie befanden sich schon auf der Treppe, auf dem Weg nach oben.
Janoschik redete unentwegt weiter.
»Es kommt ja vor, daß Leute auf die sonderbarste Art und Weise verschwinden. Ich weiß da Bescheid, Herr Offizier, weil ich nämlich häufig Pinocle gespielt habe mit dem Herrn Inspektor Jan Poczporek vom zwanzigsten Polizeirevier. Jetzt ist er schon über zehn Jahre tot, Gott hab’ ihn selig, aber er war eine Quelle für Informationen. Nicht, daß er gut gespielt hätte, das konnte man nicht von ihm sagen …«
»Halten Sie das Maul!« brüllte Patzer.
Oben im Grillraum herrschte große Aufregung. Die meisten Gäste waren aufgestanden, hielten sich aber bei ihren Tischen auf. Einige der mutigeren versuchten, Leutnant Marschmann Fragen zu stellen:
»Wird man uns gestatten, bald nach Hause zu gehen?«
»Ich muß meine Frau anrufen – sie wartet auf mich – dürfte ich vielleicht das Telefon benutzen?«
»Warum halten Sie uns hier fest? Ich habe nichts mit diesem Offizier zu tun. Ich habe hier die ganze Zeit gesessen. Bitte schön, Herr Doktor Wallerstein, stimmt das oder nicht?«
Auf all das gab Leutnant Marschmann keinerlei Antwort. Endlich konnte er einmal zeigen, daß er jemand war – wie Hauptmann Patzer hatte er seine Pistole aus der Tasche genommen. Die Gäste versuchten, den Anblick der bösartig aussehenden kleinen Mündung zu vermeiden.
Sofort nach seiner Rückkehr nahm Patzer die Situation wieder in die Hand. Er stellte sich auf einen Stuhl, stemmte die geballte Faust in die Hüfte und wartete. Nach einem Weilchen merkte er, daß diese Maßnahme keinerlei sichtbare Wirkung auf das Verhalten der Gäste hatte. Sie waren viel zu erregt, um ihr Gerede einzustellen. Darum schnarrte er, so schneidend er konnte: »Ruhe!«
Sofort trat Ruhe ein. Hauptmann Patzer blickte um sich. Er sah Gesichter – viele Gesichter, ihm schien, viel zu viele. Gesichter, die er doppelt sah und die noch dazu anfingen, um ihn zu kreisen. Patzer hatte seine Erfahrungen mit solchen optischen Erscheinungen. Er wußte, im nächsten Augenblick würde ihm schwindlig werden.
Darum stieg er von seinem Stuhl herunter und hielt sich an der Stuhllehne fest.
»Etwas hat sich ereignet«, begann er langsam, um nicht die Gewalt über seine schwere Zunge zu verlieren. »Etwas hat sich ereignet, das mich veranlaßt, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Wir waren drei, und Leutnant Glasenapp, der Dritte, ist verschwunden. Unter geheimnisvollen Umständen verschwunden, ohne ein Wort, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Die Zeiten sind nicht einfach. Wir Deutsche versuchen, Ordnung in dieses Land zu bringen. Aber unsere Bemühungen werden nicht immer genügend geschätzt. Mitunter geschieht es, daß einer von uns zum Verschwinden gebracht wird.
Das soll nicht heißen, daß ich einen von Ihnen, meine Damen und Herren, anklage. Jetzt noch nicht, jedenfalls.«
»Könnte er nicht einfach nach Hause gegangen sein«, warf jemand ein, »zurück in die Kaserne?«
»Wer hat hier dazwischengeredet?« fragte Patzer scharf.
»Ich«, antwortete Lev Preissinger. »Gestatten Sie, Lev Preissinger, Generaldirektor des Böhmisch-Mährischen Kohlensyndikats.«
Janoschik, der unauffällig in einer Ecke stand, warf Preissinger einen raschen Blick zu. Er sah einen untersetzten Mann, ein wenig gebückt, mit borstigem grauem Haar, kleinen zwinkernden Augen und rot angelaufenem Gesicht.
»Sehr interessant«, sagte Patzer herausfordernd, »vielleicht können Sie uns dann sagen, ob Sie Herrn Leutnant Glasenapp das Lokal durch diese Tür verlassen sahen« – er deutete auf die zur Straße führende Tür – »und wann Sie bemerkt haben, daß er ging?«
»Tut mir sehr leid«, erwiderte Preissinger, »aber ich war in mein Gespräch mit meinem Freund, Herrn Doktor Wallerstein, vertieft.« Und an den Arzt gewandt: »Das können Sie doch bestätigen?«
»Anscheinend waren alle hier in irgend etwas vertieft«, fuhr Patzer fort. Die Sache machte ihm Spaß, den Preissinger hatte er großartig abgefertigt. »Und wir werden auch noch herausfinden, in was für Angelegenheiten Sie vertieft waren. So – wir werden Sie also hier festhalten müssen, bis die Polizei kommt. Das ist ein dienstlicher Befehl, und Befehle werden hier befolgt.«
Patzer ließ das Licht auf seine Pistole fallen, so daß keiner der Anwesenden das Funkeln des Stahls übersehen konnte.
Eine gedrückte Stille folgte. Nur das leise Klirren der Gläser, die der Barkeeper völlig unnötig und sinnlos immer wieder abwusch und abtrocknete, klang in sie hinein.
Janoschik lehnte seinen Kopf gegen die Wand und schloß die Augen.
Die Spannung, die in ihm gewesen war, hatte nachgelassen, und das Atmen machte ihm nicht mehr die Schwierigkeiten, die es ihm bereitet hatte, als Patzer ihn die Treppen hinauf- und in den Grillraum hineinschob. Denn Breda war nicht mehr da.
Janoschik war mit sich zufrieden. Die Eheprobleme des unglücklichen Otto Krupatschka hatten den Barkeeper unten in der Toilette festgehalten und Breda die Flucht ermöglicht.
Um sich selbst machte sich Janoschik nicht allzu viele Sorgen. Er hatte keine verdächtigen Papiere bei sich, unten in der Toilette befand sich gleichfalls nichts, was ihn verraten könnte, und sollten sie sich die Mühe machen, das kahle Stübchen in der Královská-Straße, wo er schlief, zu durchsuchen, so würden sie auch dort nichts finden.
Die ganze Sache war sowieso lächerlich. Glasenapp mochte sehr wohl auf die Mole geraten sein und von dort aus die Straße erreicht haben, indem er einfach die Böschung hinaufgekrochen war. Irgendwann würde er in seiner Kaserne auftauchen, oder man würde ihn im Rinnstein finden.
Die Polizei, die die beiden Besoffenen heranzitiert hatten, würde sich wahrscheinlich die Adressen aller Anwesenden aufschreiben, und damit würde der Fall erledigt sein. Und mit ziemlicher Sicherheit würde die Aufmerksamkeit der Polizei sich auch nicht auf Janoschik richten, der schließlich nur der Toilettenwärter war und nicht gerade intelligent aussah und ein Mundwerk hatte, das jeden Polizeibeamten zur Verzweiflung trieb.
Janoschik lächelte. Er erinnerte sich an den Sergeanten in Mährisch-Ostrau – das war nicht einmal ein so unebener Mensch gewesen; aber am Ende ihrer gemeinsamen Unterhaltung war der Sergeant über seinem Schreibpult zusammengebrochen und hatte geschrien: »Schafft ihn hinaus! Führt ihn ab! Ich kann ihn nicht mehr hören!«
Das war in der guten alten Zeit gewesen.
Die Gestapo war anders. Diese Menschen waren härter, und sie hatten keinen Sinn für Humor – doch gerade das müßte es erleichtern, sie aus der Fassung zu bringen.
Ganz früher hatte Janoschik einmal ein Buch gelesen über das Leben der Tiere. Es gab welche, die waren so schwach, daß sie sich überhaupt nicht verteidigen konnten. Aber ihre Farbe verändern konnten sie und aussehen wie ein totes Blatt, so daß niemand sich bemühen und sich bücken würde, um sie aufzuheben. So ähnlich war auch er. Das einzige, was einem solchen Tierchen passieren konnte, war, daß jemand zufällig darauf trat. Aber das war unwahrscheinlich, ein Fall in einer Million.
Die immer die großen Reden gehalten hatten, taugten nichts in diesem Kampf. Ihr Name, ihr Ruf – wie ein Meteor war das aufgestiegen, nur um rasch wieder zu platzen und ins Dunkel zurückzusinken. Was war überhaupt Ruhm? Heutzutage bedeutete es nur, daß man sich zusätzlichen Gefahren aussetzte. Die große Kunst war, die Arbeit zu machen und trotzdem am Leben zu bleiben.
Das war Janoschiks Erfahrung, sie hatte sein Leben geformt, und er verhielt sich entsprechend. Daher sah er dem, was kommen sollte, mit Zuversicht entgegen.
Die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei erschien unerträglich lang. Die Gäste wurden immer nervöser, und Leutnant Marschmann und Hauptmann Patzer kam es allmählich albern vor, mit ihren Pistolen herumzufuchteln.
Marschmann tuschelte mit seinem Vorgesetzten: »Und wenn Glasenapp nun doch irgendwie einfach weggegangen ist und längst in seinem Bett schnarcht – was dann?«
Patzer antwortete nicht sofort. Er dachte nach. »Auf alle Fälle«, sagte er schließlich, »hat es erzieherischen Wert für diese Herrschaften. Wir lassen uns eben nichts gefallen – das werden sie daraus lernen. Stimmt’s?«
Marschmann schüttelte bedenklich den Kopf. Er befürchtete, Patzers Übereifer könnte ihnen endlose Scherereien bringen, und er wünschte, sie hätten den Trauerkloß Glasenapp zu Hause gelassen, statt zu versuchen, ihm alkoholischen Trost zu spenden. Es war immer am besten, dachte er, wenn man sich nicht in anderer Leute persönlichen Kummer mischte.
Er wurde in seinem Philosophieren durch das schrille Tuten des herannahenden Polizei-Einsatzkommandos unterbrochen.
Plötzlich war Stille. Hauptmann Patzer zog sich den Waffenrock straff und hob die Pistole wieder höher.
Genagelte Stiefelabsätze krachten auf dem Fußweg. Die Tür zur Bar wurde mit viel Getöse aufgerissen.
Die Patrouille schwarzuniformierter SS-Leute trampelte herein, geführt von einem Jüngling mit rosa Bäckchen, der aussah wie eine Jugendausgabe von Max Schmeling. Der Jüngling sah sich mit raschen Blicken um und bemerkte, daß die beiden Wehrmachtsoffiziere die Lage beherrschten. Mit einer Handbewegung wies er einen seiner Leute an, sich am Eingang zu postieren, und begab sich dann zu Hauptmann Patzer.
»Sturmführer Gruber, Herr Hauptmann! Persönlicher Adjutant des Sicherheitsbeauftragten Reinhardt von der Kriminalpolizei, der heute abend leider nicht im Amt sein konnte. Ich habe Befehl, mich um Sachen zu kümmern, die während seiner Abwesenheit anfallen. Also, was ist hier los?«
Patzer spürte, daß er von diesem eifrigen Jüngling jede Unterstützung haben konnte. Seine Selbstsicherheit kehrte zurück, seine Stimme wurde metallisch.
»Hauptmann Patzer, 431. Infanteriedivision«, stellte er sich kurz und präzise vor. »Es handelt sich um eine recht unerfreuliche Angelegenheit, fürchte ich. Entführung. Einer unserer Kameraden, Leutnant Glasenapp. Möglicherweise Mord.«
»Und dieses Volk hier?« Gruber wies auf die Gäste, die verschüchtert herumstanden.
»Leutnant Marschmann und ich waren der Meinung, daß es besser wäre, sie hier bis zur Ankunft der Polizei festzuhalten. Einer von ihnen oder mehrere sind wahrscheinlich an dem Verbrechen beteiligt.«
Gruber nickte verständnisvoll. »Ausgezeichnet, Herr Hauptmann, ausgezeichnet. Ich wünschte, wir fänden immer so gute Zusammenarbeit. Und jetzt berichten Sie mir bitte, was sich hier abgespielt hat.«
Bevor Patzer jedoch beginnen konnte, drängte sich jemand nach vorn: Lev Preissinger.
»Sie sind der kommandierende Polizeioffizier?« sprach er Gruber an. »Ja? Warum lassen Sie uns dann nicht gehen – ich meine meinen Freund, Herrn Doktor Wallerstein, und mich. Ich heiße Lev Preissinger, bin Generaldirektor des Böhmisch-Mährischen Kohlensyndikats, und ich kann wohl darauf rechnen …«
Gruber nickte einem seiner Leute zu. Der Mann trat vor und stieß Preissinger so grob vor die Brust, daß der zurücktaumelte und gefallen wäre, wenn Dr. Wallerstein ihn nicht gestützt hätte.
Preissingers Gesicht färbte sich purpurrot. Er stammelte nur noch.
Ohne sich die Mühe zu machen, die Menschen anzublicken, an die er sich wandte, bemerkte Gruber: »Der nächste, der seine große Fresse aufmacht, ohne gefragt worden zu sein, wird noch ganz anders behandelt werden.« Und zu Patzer sagte er: »Tut mir leid, wir waren unterbrochen worden. Wann und unter welchen Umständen ist Leutnant Glasenapp verschwunden?«
»Ungefähr um 23.00 Uhr«, berichtete Patzer. »Er fühlte sich nicht ganz wohl und ging zur Toilette hinunter – und ist nicht wieder zurückgekommen.«
»Wann schöpften Sie Verdacht?«
»Nach fünfzehn, vielleicht auch zwanzig Minuten. Ich habe dann diesen Kerl runtergeschickt …«
Der Barkeeper erbleichte unter Grubers Blick.
Patzer fuhr fort: »Ich habe diesen Kerl runtergeschickt, er solle Glasenapp holen. Er kam zurück und stotterte ganz aufgelöst, er könne den Herrn Leutnant nicht finden. Ich bin dann selber runtergegangen. Nicht eine Spur. Er war einfach weg, völlig mysteriös.«
»Ich verstehe«, sagte Gruber mit so viel Gewicht, wie er den Worten geben konnte, und befahl: »Enzinger! Walters!«
»Jawohl!« Die beiden traten vor.
»Gehen Sie nach unten und prüfen Sie nach. Sehen Sie, was Sie finden können.«
Enzinger und Walters traten ab.
»Also jetzt …« Gruber begann seine Untersuchung. »Erinnern Sie sich, Herr Hauptmann, ob irgendwelche Gäste das Lokal verlassen haben, nachdem Leutnant Glasenapp gegangen war, um sein Bedürfnis zu verrichten?«
Patzer dachte einen Augenblick nach. »Offen gestanden ist mir das unmöglich«, sagte er. »Schließlich haben weder Leutnant Marschmann noch ich vermutet, daß ein so heimtückisches Verbrechen geplant war. Aber ich entsinne mich, daß zwei der Gäste – der junge Mann da drüben und sein Begleiter – ganz offensichtlich die Absicht hatten, sich zu entfernen. Ich hab’ sie aber schön hierbehalten.«
»Interessant, außerordentlich interessant!« bemerkte Gruber. »Treten Sie mal vor, Sie!«
Peter Lobkowitz folgte dem Befehl.
»Sie wollten sich also verdrücken?« erkundigte sich Gruber mit einem Grinsen. »Warum?«
»Weil ich eine Verabredung hatte«, erklärte Lobkowitz ruhig.
»Mit Ihren Mitverschworenen, was?« gab Gruber sofort zurück.
»Keineswegs. Ich möchte hier ein für allemal zu Protokoll geben, daß ich in keiner Weise mit dem Verschwinden irgendeines deutschen Offiziers irgend etwas zu tun habe.«
Enzinger und Walters kehrten von ihrer Expedition zu der Toilette zurück und bauten sich vor Gruber auf, bereit zum Bericht.
»Sie werden wir uns später noch vornehmen«, sagte Gruber zu Lobkowitz und wandte sich seinen Leuten zu.
»Na – was habt ihr gefunden?«
»Es ist tatsächlich nicht die geringste Spur von Leutnant Glasenapp zu entdecken«, stellte Enzinger, der Älteste von beiden, fest. »Aber wir haben etwas anderes gefunden, das von Wichtigkeit zu sein scheint: Es gibt da unten einen zweiten Ausgang, der auf die Mole hinausführt – und in den Fluß.«
Gruber war nun wirklich interessiert. »Aha!« sagte er. »Gar nicht so schwer zu rekonstruieren! Sehr einfach sogar! Sehen Sie« – er wandte sich an Hauptmann Patzer –, »Ihr Herr Kamerad, der zur Zeit leider nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, entfernte sich von Ihnen, mehrere Leute lauerten ihm unten auf, oder sie schlichen ihm nach. Feige und hinterlistig, wie sie nun einmal sind, überwältigten sie ihn, brachten ihn entweder gleich um oder schlugen ihn nur bewußtlos und warfen den Körper in den Fluß.«
Patzer lief es kalt den Rücken hinunter. Genau dasselbe hätte auch ihm passieren können.
»Ein hundsgemeiner Anschlag!« fuhr Gruber fort. »Wirklich! Teuflisch!« Er schrie die Gäste an: »Aber die Verbrecher werden gefunden werden! Und büßen werden sie dafür!«
Plötzlich hatte er eine neue Idee. »Hat’s denn da keinen Toilettenwärter gegeben?« erkundigte er sich.
Janoschik hatte in seiner Ecke gestanden und die Vorgänge beobachtet. Von dem Moment an, da die beiden Gestapo-Leute nach unten gegangen und dann zurückgekehrt waren und Gruber ihren Bericht gegeben hatten, hatte er dieses Stichwort erwartet. Nun trat er vor.
»Zu Diensten, Herr Offizier«, sagte er. »Toilettenwärter, das bin ich. Ich habe aber schon bessere Tage gesehen, das kann ich Ihnen versichern. Jawohl, es hat sogar Zeiten gegeben, da würde ich so einen wie mich keines Blicks gewürdigt haben. Und doch ist es ehrliche Arbeit, und schließlich muß man in Betracht ziehen, daß es gar nicht so leicht ist, heutzutage sein Brot zu verdienen …«
»Fresse!« sagte Gruber, nachdem er seinen ersten Schrecken über den Wortschwall überwunden hatte.
Janoschiks Gesicht brachte klar zum Ausdruck, daß er eine empfindsame Seele war, die nur versuchte, hilfreich zu sein.
Gruber sah ihn sich an. Da stand dieser Tscheche doch vor ihm fast wie ein Hund, der darum bettelte, nicht geprügelt zu werden. Besiegt und geschlagen sind sie, jawohl, Gruber empfand seine Macht.
»Sie haben gesehen, wie Leutnant Glasenapp zur Toilette ging? Antworten Sie einfach ja oder nein!« fügte Gruber hastig hinzu, denn er hatte Janoschik tief Atem holen sehen.
»Das kommt darauf an«, sagte Janoschik. »Ich hab’ ihn gesehen, aber man kann auch sagen, ich hab’ ihn nicht gesehen.«
»Ist der verrückt?« fragte Gruber verärgert. Er erhielt keine Antwort, denn offensichtlich war die Frage nicht an jemanden Bestimmten gerichtet. Schließlich meldete sich des Barkeepers gepreßte Stimme: »Er ist ein bißchen schwer von Begriff, wenn Sie gestatten, Herr.«
»Was heißt das?« fuhr Gruber mit Janoschiks Verhör fort. »Entweder Sie sehen einen Menschen, oder Sie sehen ihn nicht – und Sie müssen Glasenapp gesehen haben!«
Janoschik lächelte beglückt. »Sehr richtig! Natürlich! Wenn Sie so fragen, ist es ganz einfach. Ich habe ihn gesehen – aber ich habe nicht gesehen, daß er in die Toilette hineingegangen ist, Herr Polizist.«
Grubers Augen verkniffen sich. Tief in seiner Magengrube stellte sich ein unsicheres Gefühl ein: Wurde er hier auf die Schippe genommen? »Wo soll er denn hingegangen sein?«
»Zur Toilette«, versicherte Janoschik dem Gestapo-Mann. »Er war nämlich sehr krank. Traurig hat er ausgesehen. Ich hab’ schon allerhand Besoffene gesehen in meinem Leben, aber der war einer von den schlimmsten, wenn Sie gestatten. Er ist mir beinahe in die Arme gefallen, der arme Kerl. Und geweint hat er. Die Tränen kullerten ihm nur so die Backen herunter.«
Diesmal explodierte Hauptmann Patzer. »Herr Sturmführer! Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß dieser elende Tscheche von einem deutschen Offizier spricht! Ich fordere …«
»Mir macht das auch keinen Spaß«, erwiderte Gruber, ganz heiser vor unterdrücktem Arger. »Aber ich muß Sinn und Ordnung in diesen Bericht kriegen. Der Mann hat gesagt, er hat gesehen, wie Leutnant Glasenapp auf die Toilette ging.«
Janoschik schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Offizier, das habe ich nicht gesagt!«
Gruber brüllte. »Verflucht noch mal! Sie haben gesagt, Sie haben ihn gesehen!«
Janoschik hob beide Hände, als sei er vollkommen verzweifelt. Einige der Gäste konnten ein Kichern nicht mehr unterdrücken.
Grubers Gesicht lief rot an. Er schluckte.
Janoschik wußte, was nun kommen würde; es war leicht, sich in die Denkweise des Gestapo-Jünglings zu versetzen. Gruber würde ihm eins über den Schädel ziehen. Aber Janoschik wollte nicht gern geschlagen werden. Er wollte nur seinen Ruf als ein harmloser Trottel begründen, und diesen Zweck hatte er wohl erreicht. Und er wollte sich ein Alibi schaffen.
»Mit Ihrer freundlichen Genehmigung, Herr Offizier – ich kann ja alles erklären. Ich war auf der Treppe auf dem Weg nach oben. Mein unmittelbarer Vorgesetzter war hinter der Bar hervorgekommen und hatte mich gerufen. Ich sollte den Fußboden aufwischen. Eine schöne Schweinerei, das kann ich Ihnen sagen, hatte der unglückselige Leutnant, Gott segne ihn, dort hinterlassen. Und dieser Herr Offizier« – er zeigte auf Hauptmann Patzer –, »der hat sogar zu mir gesprochen. Er hat mir noch einmal ganz klar gesagt, ich soll’s aufwischen.«
Patzer nickte.
»Das letzte, was ich von dem Herrn Leutnant gesehen habe, war, daß er sich auf die Treppe gesetzt hat und angefangen hat, sich das Herz aus dem Leibe zu weinen, aber ob er nun wirklich in die Toilette hineingegangen ist, das kann ich doch nicht wissen. Ich war eine ganze Zeitlang hier oben, eben weil es eine so große Schweinerei war …«
»Schon gut! Schon gut!« sagte Gruber. »Die Einzelheiten brauchen wir nicht!«
Der junge Gruber hatte keine Gelegenheit gehabt, das Polizeiwesen längere Zeit zu studieren. Frisch von der Schule war er in die schwarzuniformierte Mustergarde gekommen, aus der sich die Gestapo rekrutierte. Eines jedoch hatte man ihm ins Gehirn gehämmert – daß er und seine Kameraden unter Feinden lebten, daß sie gefürchtet und verhaßt waren und daß in jedem Fall die rücksichtslosesten Methoden die besten waren.
Gerechtigkeit war etwas, das nur in einem höheren Sinne existierte – soweit sie der Sache Deutschlands und Adolf Hitlers diente. Der einzelne zählte überhaupt nur, soweit er dieser Sache von Nutzen war. Außerhalb dessen besaß er keinerlei Rechte und war hart und energisch anzufassen.
Gruber erkannte, dieser Fall war hier und jetzt nicht lösbar. Natürlich konnte er die Leute verhören, aber er mochte die Verantwortung nicht übernehmen, die einen zu entlassen und die anderen einzubehalten.
»Sachen mitnehmen!« schnauzte er. »Sie kommen alle mit!«
Gestoßen und getrieben von den Gestapo-Beamten, sammelten die Gäste ihre Siebensachen zusammen. Vor der Tür mußten sie sich anstellen, und dann ging es im Gänsemarsch hinaus. Gruber stand neben der Tür und zählte – achtzehn waren es im ganzen, achtzehn Männer. Lobkowitz und Prokosch, gefolgt von dem Barkeeper und Janoschik, kamen zuletzt. – Zwei Herren jedoch blieben an ihrem Tisch sitzen – Lev Preissinger und Dr. Wallerstein. Preissinger paffte ruhig an einer Zigarre, und Wallerstein schien in den Anblick seines Tischnachbarn vertieft zu sein.
Gruber, die Hände in die Hüften gestemmt, marschierte zu ihnen hinüber.
Preissinger behielt seine Zigarre zwischen den Lippen, während er sprach. »Ich möchte doch nicht annehmen, daß Sie mich in Ihre Komödie da hineinziehen werden?«
Unter seinen Kameraden und Freunden hatte Gruber den Spitznamen »das Baby«. Sein rundes Gesicht leuchtete jetzt in einem wirklich kindhaften Lächeln auf. Dann hob er seine rechte Hand und schlug Preissinger so hart ins Gesicht, daß die Zigarre durch den Raum flog.
Wallersteins Blick blieb auf Preissinger geheftet. Er interessierte sich außerordentlich für die Reaktion des Mannes auf diese rüde Behandlung. Die Ader auf Preissingers Stirn verdickte sich zu einem blauen Strang.
»Das wird Ihnen noch leid tun!« sagte er, und seine Stimme klang brüchig. »Zufällig bin ich sehr gut mit Herrn Göring bekannt …«
»Enzinger!« rief Gruber.
Enzinger, der gerade den Raum verlassen wollte, kehrte eilig zurück. Gruber wandte sich seinem Untergebenen zu und erläuterte ihm: »Dieser Herr behauptet, er sei ein Freund von Reichsmarschall Göring. Ich glaube daher, daß er nicht mit den gewöhnlichen Sterblichen mitlaufen kann. Also nehmen Sie ihn, binden Sie ihn schön fest und lassen Sie ihn im Wagen mitfahren. Und wenn er auch nur ein einziges Mal muckst, wissen Sie, was Sie zu tun haben!«
Enzinger hatte, was Menschenbehandlung betrifft, sehr große Erfahrungen. Lev Preissinger, der Generaldirektor des Böhmisch-Mährischen Kohlensyndikats, wurde von seinem Stuhl gezerrt. Er spürte einen plötzlichen stechenden Schmerz in den Schultergelenken – dann wurde er ohnmächtig.
Wallerstein sah, wie sie den willenlosen Körper hinausschafften. Zu Gruber gewandt, sagte er: »Saubere Arbeit. Könnte dem alten Herrn sogar ganz nützlich sein.«
»Wer sind Sie?« fragte Gruber. »Ein Witzbold?«
»Das gerade nicht«, antwortete Wallerstein sachlich. »Ich bin Arzt. Psychoanalytiker, wenn Sie wissen, was das ist.«
»Weiß ich nicht«, gab Gruber zu, »und es wird Ihnen auch nichts helfen. Los, mitkommen!«
Wallerstein senkte seinen unverhältnismäßig großen Kopf. Er ging unbeholfen, mit kleinen, schlurfenden Schritten.
»He, Sie!« sagte Gruber.
Wallerstein blieb stehen.
»Wissen Sie vielleicht, wie sich das hier tatsächlich abgespielt hat?« fragte Gruber, gar nicht mehr selbstsicher.
Wallerstein sah das Baby an, und seine Lippen verzogen sich zu einem dünnen Lächeln. »Weiß ich nicht«, sagte er. »Aber ich kann Ihnen mitteilen, daß das Problem in seinem abstrakten Sinn mich außerordentlich zu interessieren beginnt.«
Zweites Kapitel
»Weitere Befehle?« fragte das Baby.
Reinhardt blätterte flüchtig in dem Aktenstück, das lakonisch mit »Erich Glasenapp, Leutnant« beschriftet war. Dann blickte er auf und sah, wie das Baby ihn mit sichtlicher Bewunderung anstarrte. Grubers Uniform saß wie immer schlecht. Der schlaksige, rosige, noch immer wachsende Körper schien die eng anliegende Uniform sprengen zu wollen. Die Kinderbäckchen sahen komisch aus über dem silbernen Totenschädel und den gekreuzten Knochen auf dem Abzeichen.
»Mißfällt Ihnen etwas an mir?«
»Keineswegs, entschuldigen, Standartenführer!« antwortete das Baby, durcheinandergebracht.
»Was starren Sie mich dann an? Und wie oft muß ich Ihnen noch sagen, daß Ihre Uniformtaschen jederzeit zugeknöpft sein müssen? Sie scheinen zu vergessen, daß Sie hierzulande das Deutsche Reich zu repräsentieren haben.«
Das Baby errötete, wodurch seine Backen noch rosiger und das blasse Blau seiner Augen noch blasser wurde.
»Abtreten! Heil Hitler!« Helmut Reinhardt konnte seine Worte knallen lassen wie eine Peitsche, besonders wenn er Befehle gab. Er beobachtete ihre Wirkung auf das Baby. Der ganze große Bursche schien sich zu straffen, krachte die Hacken zusammen und zog ab.
Leise schloß sich die Tür. Reinhardt war allein hinter seinem breiten Schreibtisch, von dem er selbst das kleinste Staubkörnchen fernzuhalten liebte. Jeder hat sein Schlachtfeld, pflegte er zu sagen, und dieser Schreibtisch ist meines. Mein Frontabschnitt – und muß daher in beispielhafter Ordnung sein.
Er lehnte sich in seinen Armstuhl zurück und streckte sich wohlig im Vorgenuß des ruhigen konzentrierten Denkens, dem er sich hingeben wollte. Vor ihm lag die dünne Akte mit der Aufschrift »Glasenapp«. Wie hatte das Baby in seiner kindischen Überheblichkeit gesagt? »Ein Schwächling!«
Das Baby und seine Heldenverehrung fingen an, ihm auf die Nerven zu gehen. Daß er der Held dieses Knaben war, machte die Sache noch peinlicher, manchmal sogar beunruhigend.
Sehe ich denn aus wie ein Held? fragte sich Reinhardt. Das fliehende, schwach geprägte Kinn, die dunklen stechenden Augen, die viel zu nahe beieinander standen, die dünne, gebrechliche, viel zu sensitiv geformte Nase, die Stirn … Gut, die Stirn konnte sich einigermaßen sehen lassen, sie war hoch genug und hatte eine erfreuliche Wölbung. Ein unausgeglichenes Gesicht – das war das Beste, was man davon sagen konnte.
Aber vielleicht, so wanderten Reinhardts Gedanken weiter, war sein Gesicht ganz eindrucksvoll in den Augen eines dummen Jungen, wie das Baby einer war. Schließlich galten ja die Arbeit, die einer tat, die Autorität, die einer hatte, die Befehlsgewalt, die er ausübte. Wenn man sich zum Beispiel Hitler ansah, glaubte man auch nicht, daß der Mann mehr als eine mittelgroße Schuhfabrik leiten konnte – von halb Europa gar nicht zu reden. Und doch war halb Europa Hitler untertan. Natürlich gab es Schwierigkeiten. Aber, dachte Reinhardt weiter, gerade um solche Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, gab es Männer wie ihn selbst, die ständig hingebungsvoll arbeiteten. Eine ungeheure Maschine, und sie funktionierte. Wo auf Erden existierte Vergleichbares? Schließlich leben wir im Maschinenzeitalter. Individueller Heroismus ist Quatsch. Der Mann, der die Maschine zum Laufen bringt – der ist der wahre Held.
Zunächst hatte Reinhardt auf den alten Gruber geflucht, der seinen kostbaren Sprößling vor der Gefährdung durch irgendwelche sowjetische Panzer zu behüten suchte, indem er ihn durch verschiedene Um- und Schleichwege in den Apparat der Gestapo verpflanzen ließ. Reinhardt hatte überhaupt nicht gewußt, was er mit dem unnötigen Zuwachs zu seinem Stab anfangen sollte, und hatte schließlich aus ihm einen Laufburschen mit mehr oder weniger hochklingendem Titel gemacht. Man konnte nie im voraus wissen, wann und wo ein Gefallen, den man dem alten Gruber tat, Zinsen bringen würde.
So unangenehm war es auch nicht, das Baby um sich zu haben. Mitunter, wenn man sich wirklich ärgerte, brauchte man einen Blitzableiter. Und schließlich – Reinhardt begann es mit einer gewissen Überraschung zur Kenntnis zu nehmen – brauchte man auch ein bißchen Bewunderung. Es war eben nicht genug zu wissen, daß man im Rahmen des großen Vorhabens der ganzen Volksgemeinschaft seine Pflicht tat. Auch die Männer, die im Apparat der Geheimen Staatspolizei arbeiteten, verlangten nach Anerkennung. Das Baby gab ihm ein wohltuendes Gefühl des Anerkanntwerdens. Doch mußte man ihn mit Strenge behandeln. Sonst erlaubte er sich Vertraulichkeiten, die man nicht dulden durfte.
Kriminaldirektor Reinhardt brach den Gedanken ab, ärgerlich auf sich selbst.
Er stand auf und trat zum Fenster seines Arbeitszimmers. Unten, vor dem Eingang zum Gebäude, ging der stahlbehelmte Wachposten auf und ab, auf und ab. Menschen eilten vorüber, niemand wagte stehenzubleiben, sich umzublicken, zu sprechen. Mit Genugtuung stellte Reinhardt fest: Wir sind gefürchtet.
Er kehrte an seinen Schreibtisch zurück und begann die Akte Glasenapp zu bearbeiten.
Die persönlichen Daten waren knapp und ergaben nicht viel. Geboren 1909 in Mainz, Volksschule und Gymnasium in Mainz. Universität in Köln und Heidelberg – studierte Philologie. Dann Lehrer an der Höheren Mädchenschule in Mainz. Mitglied der Nationalsozialistischen Partei seit 1934. Lehrgang für Reserveoffiziere. 1938 zum Leutnant d. R. befördert. 1939 mobilisiert und seither im aktiven Dienst. Besatzungsdienst – Tschechoslowakei, Polen, Norwegen, Frankreich. Vom Frontdienst zurückgestellt: schwache Augen, Plattfüße.
Bekam wahrscheinlich nicht genug Kalk zu fressen im ersten Weltkrieg, dachte Reinhardt.
War er verheiratet? – Nein. Auch keine unehelichen Kinder. Na ja, die Männer gestehen das auch nicht gern ein, obwohl wir versuchen, ihnen ein bißchen Stolz einzuflößen, wenn sie den Anstoß zur Schaffung eines zukünftigen Soldaten gegeben haben.
Mal sehen, was sonst noch da ist. Soldbuch. Geld: zwei Mark, fünfundvierzig Pfennige, ein paar Tschechenkronen – die Sache passierte, bevor es Löhnung gab. Ein Ausschnitt aus einer Zeitung: Abiturientenfeier an der Mainzer Höheren Mädchenschule. Auch ein Andenken! Wie wenig der Mensch doch auf dieser Erde hinterläßt …
Wahrscheinlich haben sie ihn an seiner Höheren Mädchenschule schon längst vergessen.
Und hier ist der Brief, den das Baby erwähnt hat. Ein Brief, der nie fertiggeschrieben und nie abgeschickt wurde – und der vielleicht die einzig brauchbare Spur ist, auf der wir uns in den Fall hineintasten können.
Reinhardt las langsam und gründlich.
Liebste Milada! Ich bin in ziemlicher Verzweiflung, was Du schon aus der Tatsache ersiehst, daß ich Dir überhaupt schreibe, nach dem, was zwischen uns geschehen ist. Ich weiß, was Du empfinden mußt, und ich versichere Dich, daß ich in der besten Absicht gehandelt habe. Was hätte ich sonst tun können? Konnte ich ihn zurückbringen?
Ich war jedoch unermüdlich deprimiert bei dem Gedanken, daß Du so ganz ohne Hoffnung sein solltest. Wie dumm von mir, nicht vorauszusehen, daß Du eines Tages doch die Tatsachen erfahren würdest. Ja, und wenn Du mich auf Herz und Nieren prüfst – ich müßte Dir gestehen, ich habe es schon damals vorausgesehen.
Aber Dir die Hoffnung zu erhalten war meine einzige Rechtfertigung, um überhaupt mit Dir zusammenzukommen. Und Du warst mir nach und nach für mein Leben so wichtig geworden, daß es sich nur schwerlich beschreiben läßt. Mein Leben war nicht mehr so leer.
Und jetzt ist all dies vorbei. Ich habe nicht einmal das Recht, Dich zu bitten –
Reinhardt trommelte ungeduldig auf den Schreibtisch, einen Marsch. Der Brief gefiel ihm ganz und gar nicht. Die Sache roch nach Selbstmord. Andererseits waren die paar Worte doch ein zu schmaler Ausschnitt aus dem Leben und den Erfahrungen eines Mannes, um so viel auszusagen. Um die ganze Geschichte zu rekonstruieren, dachte Reinhardt, müßte man wissen, worauf sich der Tote bezog.
Der Brief hatte über zwölf Stunden mit Glasenapp im Wasser gelegen. Gut hatten sie gearbeitet im Laboratorium bei der Wiederherstellung und Entzifferung des Textes. Mit einem durchweichten Stück Papier als einzigem Anhaltspunkt – es konnte eine ganz reizvolle Aufgabe sein, vielleicht. Reinhardts Polizistengehirn begann zu arbeiten, es schaltete fast automatisch. Er mußte nur ganz entspannt sein und seinen Gedanken ihren Lauf lassen. Lange Jahre Praxis auf diesem Gebiet trugen ihre Früchte.
Er nahm sich das Foto des Leutnants Glasenapp vor, das das Baby von den Wehrmachtsonkels besorgt hatte. Er schloß die Augen halb und ließ die Gesichtszüge des Toten auf sich wirken, wobei er langsam in jeden Winkel, jede Rundung dieses Gesichts eindrang. Wenn es einem gelang, sich den Mann lebendig vorzustellen, würde man beurteilen können, wie er agiert und reagiert haben mußte – wie er sich räusperte und wie er spuckte. Und damit war man schon ein Stückchen weiter.
Aber es war eine schlechte Aufnahme. Glasenapps Brillengläser hatten das Blitzlicht des Fotografen zurückgeworfen; es waren keine Augen zu sehen auf dem Bild, nur zwei leere, weißlich schimmernde Kreise. Vielleicht war aber gerade dieser ironische Zufall typisch. Denn das ganze Gesicht war eines von jenen, die man Mühe haben würde wiederzuerkennen, auch wenn man dem Mann ein dutzendmal begegnet war. Das Durchschnittsgesicht eines Durchschnittsmenschen. Der Mützenschirm verdeckte die Stirn fast gänzlich. Die Backenpartie, schien es, sagte noch am meisten über ihn aus – die hagere Haut zwischen Augenknochen und Kinnbacken war von den Schatten einer Menge Pusteln gemustert. Blasse Lippen, ohne Charakter, aber ein gut geformtes Kinn.
Was konnte einem solchen Menschen schon passieren? Wer sollte ein Interesse daran haben, ihn loszuwerden? Aus welchen Gründen?
Er beschloß, bei den Wehrmachtsonkels anzurufen. Die Verbindung zu Major Grauthoff beim Divisionsstab wurde hergestellt, und nach dem üblichen Palaver über das gegenseitige Wohlergehen fragte er:
»Sagen Sie mal, Herr Major – ich habe da eine Sache. Es handelt sich um diesen unangenehmen Fall Glasenapp. Was hat der Bursche eigentlich gemacht? Dienstlich, meine ich. Hat er viel Gelegenheit gehabt, mit der hiesigen Bevölkerung in Konflikt zu kommen?«
Die Stimme am anderen Ende des Drahtes, die ganz froh und zuversichtlich geklungen hatte, veränderte sich und wurde bitter.
»Tja, mein lieber Herr Kriminaldirektor – Sie wissen doch, daß wir alle hier nicht gerade beliebt und geschätzt sind.«
»Weiß ich!« Daß die Leute bei der Wehrmacht immer so schwerfällig waren! »Wir sind auch nicht zum Zwecke der Verbrüderung in Prag. Aber der Glasenapp – hat man ihn vielleicht für besonders unangenehme Sachen eingesetzt?«
»Nicht daß ich wüßte. Der übliche Betrieb. Hier und da mal eine Schlange vor irgendwelchen Läden auseinanderjagen, Wachdienst, bei Tag oder bei Nacht – langweiliges Zeug.«
»War er bekannt als – nun, sagen wir – rigoros?«
Major Grauthoff murmelte etwas. Dann wurde seine Stimme wieder klarer. »Rigoros? – Sie meinen brutal? Nein, würde ich nicht sagen. Eher das Gegenteil. Seine Kameraden meinten, daß er doch mehr ein weicher Mensch gewesen ist.«
Reinhardt zögerte einen Augenblick. Was gab es sonst, weswegen er bei dem Major nachfragen könnte? Nichts weiter. Da drüben wußten sie ebensowenig wie er über Glasenapp.
»Also – schönen Dank, Herr Major. Wenn ich mal etwas für Sie tun kann, Sie brauchen nur anzuklingeln. Heil Hitler.«
Er hörte das leise Klicken, das kam, wenn der Hörer am anderen Ende aufgelegt wurde. Der Major, schien es, fand kein besonderes Vergnügen daran, mit der Gestapo zu verhandeln. Drüben beim Wehrmachtsstab waren sie wohl der Meinung, man tue am besten, die Affäre Glasenapp so rasch wie möglich zu vergessen. Staub darüber aufzuwirbeln könnte höchstens noch ein paar Tschechen auf dumme Gedanken bringen, wie leicht es nämlich wäre, deutsche Offiziere einzeln oder gruppenweise zu liquidieren.
Reinhardt zog eine Grimasse. Niemand liebt es, sein Leben zu riskieren, wenn er in angenehm ruhiger Stellung sitzt. Draußen im Felde würden sie wahrscheinlich ihren Mann stehen und kämpfen, aber hier haben sie alle eine höllische Angst vor dem Feind, der im Dunkeln lauert. Sehen konnten sie ihn nicht, fassen konnten sie ihn nicht – und doch war er da; nur spürte man ihn meistens erst, nachdem er zugeschlagen hatte.
Drüben beim Divisionsstab neigten sie zu einer Taktik der Besänftigung, elende Idioten! Sahen sie denn nicht, daß jedes Zeichen von Schwäche die Tschechen nur noch verbockter machte? Schlagt sie, schlagt sie zu Boden, damit sie den Kopf auch nicht um einen Zentimeter erheben – dies, und nur dies, war die einzig angebrachte Politik.
Reinhardt schlug die Beine übereinander. Seine Gedanken lösten sich von den äußeren Umständen und konzentrierten sich auf die eigentlichen Elemente des Falles. Zwar drängten sich noch ein paar Nebensächlichkeiten ein. Da war, zum Beispiel, sein Knie und wie das schwarze Tuch seiner Reithose dieses Knie so schön stramm und fest umschloß. Dann verschwamm all das immer mehr, und statt seines Arbeitszimmers tauchte ein anderes Bild auf: Glasenapp.
Glasenapp schien sich zu bewegen, langsamen Schritts, fast ohne die Füße vom Boden zu lösen. »Ich war jedoch unendlich deprimiert …«, sagte er in seiner weichen, waschlappigen Art, »… daß Du so ganz ohne Hoffnung sein solltest.«
Reinhardt spürte kein Mitleid, er verachtete ihn.
»Und Du warst mir nach und nach für mein Leben so wichtig geworden, daß es sich nur schwerlich beschreiben läßt.«
Krank bist du, mein bester Glasenapp, krank im Kopf, im Herzen, im Gemüt, und es ist eine Schande, daß ich mir deinetwegen überhaupt Gedanken machen muß.
»Mein Leben war nicht mehr so leer … Und jetzt ist all dies vorbei. Ich habe nicht einmal das Recht, Dich zu bitten …«
Um was zu bitten? Und wen zu bitten? Ich muß das wissen! Wir werden deinen blutlosen grinsenden Mund schon aufkriegen!
Also schön, du willst nicht sprechen. Du bist für immer verstummt. Macht auch nichts. Wir werden auch ohne deine lächerlichen Gedanken und dein verzweifeltes Gerede auskommen.
Wir werden die Fäden einfach aufgreifen, wo du sie fallen gelassen hast.
Reinhardt griff nach einem Bogen Papier und begann zu schreiben:
1. Wer ist Milada? – Erkundigungen einziehen bei anderen Offizieren.
2. Was hat sich wirklich zwischen Milada und Glasenapp ereignet? – Milada offensichtlich tschechischer Name. Beziehung, welcher Art auch immer, gegen Dienstvorschrift. Drohte Erpressung? Unwahrscheinlich, da Mädchen sich auch selbst belasten würde. Außerdem erwähnt er seine »besten Absichten«. Was tat er mit besten Absichten?
3. Unternahm er Versuch, »ihn« zurückzubringen? Wer ist dieser »er«? Wie ist dieser »er« ursprünglich verschwunden und wohin? War Glasenapp in irgendeiner Weise verantwortlich für das Verschwinden dieses »er«? Glasenapp – oder andere Deutsche?
4. Eines Tages würde sie die Tatsachen sowieso erfahren – Tatsachen in Verbindung mit dem Verschwinden von »er«? Wahrscheinlich – doch nicht klar genug für endgültige Schlußfolgerungen.
5. Rest der Geschichte ziemlich offensichtlich. G. benutzt seine besten Absichten als Mittel, um mit M. zusammenzukommen. Leben gewinnt neue Bedeutung …
Reinhardt schob das Blatt, das jetzt von oben bis unten mit seinen präzisen, scharfen Schriftzügen bedeckt war, von sich.
So etwas Blödes! Hätte Glasenapp sich wie ein Mann benommen und nicht wie ein winselnder Köter, so brauchte man sich jetzt nicht zu bemühen. Aber würde man wirklich so viel Mühe anwenden müssen? Schließlich mußte man ja nur diese Milada finden und sie gründlich verhören, und man hatte die Lösung.
Die Lösung, soweit Milada betroffen war.
Was er jetzt zu entscheiden hatte, war, ob Glasenapps Tod überhaupt mit der Angelegenheit Milada zusammenhing.
Zunächst war er nicht abgeneigt, die Annahme gelten zu lassen. Natürlich bestand immer die Möglichkeit, daß andere, außerhalb dieses Verhältnisses stehende Kräfte im Spiel waren – aber die Wehrmachtsonkels hatten extra betont, daß Glasenapp weder wichtig noch irgendwie an exponierter Stelle gewesen war. Die Auskunft von Major Grauthoff deckte sich mit dem Eindruck, den Reinhardt durch den Brief und das Foto des Leutnants gewonnen hatte.
Es war höchst unwahrscheinlich, daß der Feind im Dunkeln ausgerechnet diesen belanglosen Hohlkopf für einen so dramatischen Tod ausersehen hatte.
Ein gründliches Vergleichen von Für und Wider, ein sorgfältiges Abwägen beider Seiten der Frage mußte für Reinhardt ergeben, daß Glasenapp auf eigenen Wunsch und eigene Initiative aus dieser Welt geschieden war.
Glasenapp hatte Selbstmord begangen.
Oder vielleicht war er besoffen gewesen und einfach in den Fluß gefallen und hatte es aufgegeben, um sein Leben zu kämpfen, weil er dieses Leben satt hatte.
Widerlich. Widerlich einfach.
Reinhardt war enttäuscht. Das war nichts, worin man sich verbeißen konnte. Ein Vorgang, der bald in staubigen Archiven vergessen sein würde. Ein paar kurze Notizen in der Zeitung. Sogar weniger noch als das – eine Schande für Deutschland! Deutsche Offiziere, die sich selber umbrachten!
Die Verwandten des Mannes in Deutschland mußte man überwachen lassen. Fälle solcher Art wirbeln immer unangenehmen Staub auf im Lande. Totschweigen lassen, das war am praktischsten.
Warum nur konnte Glasenapp nicht ein Held gewesen sein! Warum konnte er nicht den Heldentod gestorben sein vorm Feinde!
Reinhardt richtete sich auf.
Ja – warum eigentlich nicht? sagte er nachdenklich vor sich hin.
Es gab nicht einen vernünftigen Grund dagegen.
Man mußte ihn nur zum Helden machen.
Schließlich war der Feind Wirklichkeit. Und der Feind war immer nahe, lauernd im Dunkeln.
Und wer wollte das Gegenteil behaupten? Höchstens das Baby – und das Weibsstück, die Milada. Das Baby würde sich hüten, Fragen zu stellen. Und Milada – Milada würde froh sein, wenn niemand sie behelligte, und würde den Mund halten, wenn man ihr klarmachte, was ihr sonst geschehen würde.
Also endlich eine Theorie, mit der man weiterkam! Er hatte dem Baby Krach geschlagen, weil der einfach blindlings mitgeschleppt hatte, was an dem Donnerstagabend in der Parnaß-Bar gewesen war. Viel zu plump, aber jetzt konnte es nützlich werden. Nicht nur standen all diese Leute unter Verdacht – man konnte sie auch ganz großartig als Geiseln verwenden.