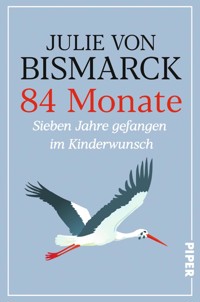
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unglückliche Umstände »Sie können jederzeit wieder schwanger werden.« Immer wieder hört Julie von Bismarck diesen Satz, nachdem sie eine Fehlgeburt hatte. Also hoffen sie und ihr Mann John weiter auf ein eigenes Kind. Aber was folgt, ist eine siebenjährige Leidensgeschichte: Operationen, Hormone, künstliche Befruchtung. Julie ordnet ihr ganzes Leben dem Kinderwunsch unter, verzichtet auf Sport, duscht nicht mehr heiß. Mit jedem negativen Schwangerschaftstest wächst ihre Verzweiflung, ebenso wie die Entfremdung zum sozialen Umfeld. Doch die Beziehung hält der großen Belastung stand. Eindrucksvoll und berührend schildert Julie von Bismarck, was es bedeutet, wenn das gewünschteste Wunschkind einfach nicht kommt. Aufrüttelnd und tröstend zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Epilog
2. Kapitel
Wie anders doch alles vor etwas über sieben Jahren war! Unser Leben war angefüllt mit Freude, Glück, Liebe, Zuversicht, Fröhlichkeit, Freunden, Familie und Lachen. Wir waren die glücklichsten Menschen auf dem Planeten – verliebt und voller Kraft, Glauben und Tatendrang. In unserem Leben war so viel Glück und Zuneigung vorhanden, dass wir die Menschen in unserer Umgebung mit vollen Händen daraus beschenken konnten. Alles war licht und hell und sonnendurchflutet.
John und ich, das war die buchstäbliche Liebe auf den ersten Blick gewesen. Ich hatte ihn gesehen und in dem Moment gewusst, dass dies der Mann ist, mit dem ich um jeden Preis mein Leben verbringen wollte. Und ihm war es mit mir genauso ergangen. »Ich glaube«, hatte er nach unserer ersten Begegnung zu seinem ehemals besten Freund gesagt, »ich glaube, ich bin in Schwierigkeiten.«
Um jeden Preis. Wie hoch der Preis sein würde, wussten wir damals nicht. Aber hätte ich es gewusst, ich hätte ihn trotzdem geheiratet.
Wir waren vielleicht das glücklichste Paar, das es je gegeben hat. Wir gingen stundenlang mit unseren Hunden spazieren, saßen nächtelang am Lagerfeuer, führten endlose Gespräche, während es dunkel wurde und nach frisch gemähtem Gras und Freiheit roch … Es war die schönste Zeit meines erwachsenen Lebens. Nach eineinhalb Jahren heirateten wir. Gegen erhebliche Einwände und Befürchtungen: »Der passt doch überhaupt nicht zu dir …«, »Das geht viel zu schnell, du kennst den doch gar nicht …«, solche Dinge.
Stimmte von außen betrachtet vielleicht sogar. Er, der strukturierte und durchtrainierte Ex-Polizist, der direkt nach dem Abschluss seiner Berufsausbildung zum Polizisten zur Ausbildung in der Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei abgeordnet wurde und sich bereits im darauffolgenden Jahr selbstständig machte, der international als Krisenmanager die schwierigsten Konflikte löste. Und ich, die ebenfalls weltweit tätige Pferdeosteopathin und Akupunkteurin, die sich außerdem als Autorin und Dozentin für das Wohl der Tiere einsetzte und dabei immer ein bisschen zu sehr an das Gute in allem glaubte und deswegen immer ein bisschen zu idealistisch an die Dinge heranging. Teil meines Jobs eben.
Mir war das gleichgültig. Es ging nicht um unsere Berufe, es ging um uns. Ich hatte den Mann, diesen einen besonderen Mann meines Lebens gefunden, von dem so wenige das Glück haben, ihn zu finden. Und ich heiratete ihn. Und wie!
Unsere Hochzeit ist heute, zehn Jahre später, zuweilen immer noch Thema unter den damaligen Hochzeitsgästen. Es war ein ausgelassenes Fest geworden, wider Erwarten. Es schien, als würde sich die Liebe, die John und ich füreinander empfanden, auf die Anwesenden und ihre Skepsis übertragen und so, für diesen einen Tag und diese eine Nacht, alle Querelen, Streitigkeiten und Dramen überstrahlen.
Johns kurze Rede zum Beginn des Abends hatte sicher einen großen Anteil daran. Er hatte nichts in der Hand gehabt, keinen Zettel, kein Glas, nichts. Hatte einfach dagestanden in seinem Smoking, wie ein Leuchtturm oder etwas sehr Besonderes, das man noch nie gesehen hat und von dem man sich sicher ist, dass es einmalig ist. Es wirkte, als würde er alle Gäste gleichzeitig ansehen, so fest und ruhig ließ er seinen Blick über die vielen Tische schweifen. Er stand einfach da.
Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Alle waren mucksmäuschenstill, wie in der Erwartung von etwas Außergewöhnlichem. Nicht wissend, ob es etwas Gutes oder Schlechtes sein würde. Und dann, in diese völlige Stille, diese angespannte Erwartung, sagte er mit seiner klaren, ruhigen, lauten Stimme:
»Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Julie«, (Pause) »ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. (Stille) Einmal abgesehen davon, dass ich wahnsinnig nervös bin (Lacher unter den Gästen), was man nicht merkt (brüllendes Gelächter an allen Tischen, Applaus), seht ihr hier heute einen sehr, sehr glücklichen Mann (Pause). Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so frei, so geborgen, so sicher und – so glücklich wie jetzt. Und das habe ich einer Frau zu verdanken. (Applaus) Meiner Frau. (Tosender Applaus, zustimmende Pfiffe) Die jetzt endlich mal weint.« (Lautes Gelächter, Applaus)
Und an mich gerichtet: »Julie, ich liebe dich so sehr, dass ich es mit Worten nicht fassen kann, und ich freue mich wahnsinnig darauf, mit dir den Rest unseres Lebens zu teilen. (Tosender Applaus, zustimmende Rufe) Und jetzt ist das Buffet eröffnet.« (Gelächter, Pfeifen, Bravo-Rufe, Klatschen)
Meine Arme um seinen Hals, die glücklichste Frau der Welt. Es war das rauschendste Fest, das je gefeiert wurde.
Einige Tage nach der Hochzeit lagen wir glückstrunken an unserem See. Eine meiner Freundinnen hatte uns gerade eröffnet, dass sie ein Baby erwarte, und halb im Spaß gesagt, ich solle doch dann jetzt auch schwanger werden, damit die Kinder später zusammen spielen könnten.
»Und? Wollen wir jetzt schwanger werden?«, fragte ich John halb im Spaß, der schläfrig in die Sonne blinzelte.
»Aber ganz bestimmt«, sagte er und grinste. »Was bemerkenswert ist, weil Kinder zuvor nie weit oben auf meiner Wunschliste standen, aber das hat sich geändert.« In seinen Augen blitzte es. »Denn«, fuhr er fort, »hast du dir schon mal überlegt, wie süß unsere Kinder werden?«
Ich war glücklich.
»Wir müssen eine richtige Familie sein«, sagte John und schloss mich in seine Arme »Das meine ich ernst.«
»Abgemacht«, erwiderte ich lachend.
Ich weiß noch, wie aufgeregt ich bei diesem Gedanken war. Es war dasselbe Gefühl, wie ich es damals als Kind beim Bauen der Baumhäuser gehabt hatte: eine Idee, für die ich mich so begeisterte, dass ich sie am liebsten auf der Stelle in die Tat umgesetzt hätte.
Wir lagen den ganzen Abend am See und redeten darüber, was wir alles mit unseren Kindern erleben würden, malten uns aus, nach wem sie wohl kämen, ob sie so aussehen würden wie einer von uns oder eine Mischung aus uns beiden und welche Charakterzüge von uns sich in ihnen widerspiegeln würden.
Weder John noch ich hatten uns bislang damit auseinandergesetzt, was »Schwangerwerden« eigentlich bedeutete – man wurde eben schwanger und bekam ein Kind. Ganz einfach. Als ich am Ende desselben Zyklus die Pille absetzte, waren wir beide so aufgeregt wie kleine Kinder vor ihrem Geburtstag.
»Na, dann wollen wir mal ein Baby bekommen«, sagte ich zu John.
Er grinste sein unverwechselbares Spitzbubengrinsen. »Jawoll. Ab heute wird scharf geschossen.«
Ich war so voller glücklicher Vorfreude, dass ich mich nicht einmal über den blöden Spruch beschwerte. Wir würden ein Kind bekommen, die Krönung unserer Liebe! Wie aufregend das war! Nach ein paar Tagen setzte der Arbeitsalltag wieder ein, und wir beide dachten nicht mehr allzu oft daran, dass wir nun nicht mehr verhüteten.
Einige Wochen später saßen wir abends mit einer riesigen Pizza auf dem Sofa, als ich wie selbstverständlich in die Küche ging, mir Ketchup und Mayonnaise holte und diese, als sei das ein normaler Vorgang, großzügig auf dem Pizzastück auf meinem Teller verteilte.
John sah mich irritiert an. »Sag mal, was isst du denn da? Kann es sein, dass du schwanger bist?«
Ich starrte ihn mit dem Mund voller Ketchup-Mayonnaise-Pizza an. Ich hatte gar nicht darüber nachgedacht. Irgendwie hatte ich einfach plötzlich Appetit auf Pizza mit Ketchup und Mayonnaise. Als ich jetzt darüber nachdachte, war es in der Tat etwas befremdlich. Konnte es sein, dass es wirklich so schnell ging? So einfach?
Ich hatte mich immer gewundert, dass in meiner Familie alle Frauen immer genau auf den Punkt an dem Tag ihre Kinder bekamen, an dem sie sie haben wollten. Achtzehn Monate auseinander. Maximum. Sonst können die Kinder nicht miteinander spielen, hieß es immer. Wenn es tatsächlich so einfach war, schwanger zu werden, war es ja überhaupt kein Wunder, dass ihnen das mit dieser Präzision gelang. Aber konnte das wirklich sein? Ich wusste ja nicht einmal, wann mein Eisprung gewesen war, und hatte gerade erst die Pille abgesetzt. Es hieß doch immer, nach Absetzen der Pille dauere es mindestens ein halbes Jahr, ehe man schwanger werden könne? Das hatte meine Mutter immer gesagt, daran sollte ich immer denken, wenn ich »meine Kinder planen« würde …
Am nächsten Morgen machte ich einen Test. Den Moment, als ich die Treppe herunterstürmte, John um den Hals flog und ihm meine Schwangerschaft verkündete, werde ich niemals vergessen. Ich war überwältigt vor Freude und verspürte so etwas wie Stolz auf dieses Baby, auf uns, es war unbeschreiblich. Wir würden eine richtige Familie werden!
Es war ein absolut einzigartiges Gefühl, es war mit nichts zu vergleichen, was ich jemals zuvor gefühlt hatte. Ein Gefühl, als sei ich schlagartig zu einem anderen Menschen geworden. Ich war eine schwangere Frau, und das machte mich augenblicklich zu etwas Besonderem: In mir wuchs ein Mensch heran!
In dem Augenblick, in dem ich den positiven Test in den Händen hielt, wurde mir klar, warum schwangere Frauen dieses besondere Leuchten haben, das ihnen immer nachgesagt wird: Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie wieder so außergewöhnlich, so wichtig, so stolz, so selbstbewusst, so unangreifbar, so zufrieden und so in mir ruhend gefühlt wie damals.
»Ich bin schwanger!«, jubelte ich ein ums andere Mal. »Ich bin schwanger! Wir bekommen ein Kind!«
Ich lachte und lachte, und auf Johns Gesicht lag eine solch pure und reine Freude, ein solch glückseliges Strahlen, als habe jemand in seinem Inneren ein ewiges und unlöschbares Feuer entzündet, dessen Widerschein nun auf seinem Gesicht lag. (Wie sich später herausstellte, war es das nicht, unlöschbar. Ich habe diesen Ausdruck nie wieder auf Johns Gesicht gesehen.)
»Hab ich es doch gewusst!«, strahlte er. »Das ist die beste Botschaft meines Lebens! Außer, dass du mich geheiratet hast, natürlich!«
Wir lagen uns in den Armen und lachten und waren glücklich wie nie zuvor.
Alle Tage und Wochen, die auf diesen Tag folgten, waren erfüllt von einer neuen, ungekannten Freude. Wir waren glückstrunken in der Gewissheit, dass wir nun eine Familie werden würden. Alles drehte sich um die Schwangerschaft und das Baby. Wann immer John mich sah, begrüßte er mich mit: »Na, wie geht es euch beiden?« Jeden Morgen und jeden Abend sprachen wir mit unserem Baby.
Henry, mein Hund und bester Freund, wurde noch wachsamer, als er es ohnehin schon war, wich mir keinen Zentimeter mehr von der Seite und sah irgendwie immer aus, als lächelte er. Seine großen, schwarzen, ordentlichen Mundwinkel waren nun immer ein bisschen angehoben, und in seinen braunen Knopfaugen lag ein fröhliches Zwinkern.
Gemeinsam lagen wir stundenlang im Gras, Henry passte auf und die Labradorin, unser zweiter Hund, stöberte in Kreisen um uns herum und suchte vergnügt nach Essbarem. John hatte seine Hand schützend auf meinen Bauch gelegt. Wir sprachen über Namen und ob wir unser Kind in meiner zweiten Heimat Afrika aufwachsen lassen könnten und ob es wohl ein Junge oder ein Mädchen werden würde.
Johns Vatergefühle beeindruckten mich. Ich hätte nie erwartet, ihn so verändert zu sehen. Er hatte so oft gesagt, er wolle nicht unbedingt Kinder haben, und wenn, dann nur mit der richtigen Frau … Die hatte er jetzt, und nun konnte er gar nicht genug bekommen von den Plänen und Tagträumen für unser Leben mit unserem Kind. Bereits in diesen ersten Tagen ließ er dem Baby seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit und Treue zuteilwerden. Es schien für ihn überhaupt keine Rolle zu spielen, dass es sich bisher nur um einen winzigen Zellhaufen handelte. Mir ging es genauso. Wir beide dachten von dem Moment des positiven Tests an nur an ein Baby. An unser Kind.
Die Gewissheit, dass er Vater werden würde, schien die stabilen Mauern, die John vor die Erinnerungen an seine eigene Kindheit und Jugend gebaut hatte, zum Bröckeln zu bringen. Er sprach plötzlich über seine Vergangenheit, etwas, das er zuvor nicht gerne getan hatte. Er hatte keine besonders schönen Erinnerungen an seine Kindheit. Ich vermute, dies war einer der Gründe, warum er nie hatte Kinder bekommen wollen. Aber nun, wo er Vater wurde, war er wie ausgewechselt. Er malte sich aus, wie er seine eigene Kindheit gewissermaßen an seinem Kind heilen könnte.
Eines Tages zeigte er mir seine alte Schule, genauer gesagt, den Sportplatz seiner alten Schule. John hatte es als Junge und Jugendlicher zu einiger Berühmtheit gebracht, da er dort so manchen Rekord auf den Kurzstrecken gebrochen hatte. Laufen war seine Leidenschaft, und offenbar besaß er eine besondere Begabung für diesen Sport. Seine Eltern hatten ihn fast nie begleiten können und so war er zu den meisten seiner Wettkämpfe allein gefahren, hatte vor jedem Lauf mutterseelenallein auf dem Platz gestanden. Er hatte einen Rekord nach dem anderen gebrochen, in der Hoffnung, es würde sich irgendwann jemand dafür interessieren – und war trotzdem beim nächsten Wettkampf wieder alleine gewesen. Ich glaube, seine Rekorde waren nicht viel wert für ihn – weil niemand da war, der sie mit ihm auskostete. Niemand, der ihn anfeuerte, niemand, der seine Leistungen mit Stolz verfolgte, niemand, der ihn lobte und mit ihm mitfieberte.
Es war Samstag, und auf dem Sportplatz tummelten sich etliche kleine Jungen und Mädchen. Auf den Rasenflächen um den Platz herum standen die Eltern und feuerten ihre Zöglinge an. Gerade liefen einige Jungen einen Staffellauf, eine andere Gruppe maß sich im Weitsprung. John blickte strahlend, zufrieden und mit so etwas wie Stolz auf die rennenden und springenden Kinder.
»Ha, da werden Erinnerungen wach!« Er deutete mit der Hand auf die rote Tartanbahn. »Der Kleine da unten, der gerade den Stab übernommen hat, der ist gar nicht schlecht. Aus dem könnte was werden. Lauf, Junge! Jetzt noch mal Gas geben! Sehr gut gemacht! Hast du gesehen, wie geschickt er den Stab übergeben hat? Der Junge ist richtig schnell. Und das Mädchen da, die jetzt läuft, die kann auch richtig gut werden.« Er schien die Eltern nicht weiter zu beachten und hatte nur Augen für die Kinder.
Ein älterer Herr kam über den Rasen zielstrebig auf uns zu.
»Kennst du den Mann?«, fragte ich. »Der sieht so aus, als wolle er zu dir?«
John folgte meinem Blick, und auf seinem Gesicht breitete sich absolute Verblüffung aus. »Das gibt es ja gar nicht, das ist mein alter Leichtathletiktrainer!«
Und mit einem Satz war John über den Zaun gesprungen, hinter dem wir standen, und lief dem Mann entgegen.
»Herr Jansen, das ist ja eine Überraschung! Immer noch hier im Dienst?«
Der alte Mann lachte. »Natürlich, Junge, wo soll ich denn sonst sein?«
Er schien ehrlich erfreut, John zu sehen, und gab ihm die Hand. »Na, wenn das man nicht mein schnellster Schüler ist! Das ist aber man schön, dich zu sehen! Wie geht’s denn immer?«
John strahlte. »Sehr gut, danke! Und Ihnen? Sie unterrichten immer noch hier?«
Herr Jansen lachte. »Na ja, in meinen Alter – nur noch die richtig Guten. Aber da gibt es kaum noch welche von.« Er zuckte mit den Achseln. »Zumindest keinen, der so rennen kann wie du damals.«
John schaute ihn an, als habe er sich verhört. »Wirklich?«, fragte er, und ich konnte sehen, wie er noch ein paar Zentimeter größer wurde.
Herr Jansen nickte. »Immer noch der Schnellste von meinen Schützlingen.«
John starrte seinen alten Trainer ungläubig an, und dann sah er aus, als habe man ihm gerade den Ritterschlag verliehen oder einen Orden – und etwas Ähnliches war es ja auch.
»Das ist ja verrückt«, sagte er strahlend.
»Ist das die werte Frau Gemahlin?« Herr Jansen streckte mir die Hand hin.
»Oh, ja, Entschuldigung. Das ist meine Frau Julie, Julie, Herr Jansen, mein alter Leichtalethiktrainer!« John freute sich, als sei er wieder ein kleiner Junge. Ich konnte nicht aufhören zu lächeln.
»Sehr erfreut«, sagte Herr Jansen und deutete eine Verbeugung an. »Ist wirklich so – der Bursche hier war der beste Hundertmeterläufer, den ich je trainiert habe. Der Junge konnte rennen – man konnte meinen, er liefe vor etwas davon. Hat alle besiegt, auch die aus den höheren Klassen. Das hat manch einer von denen nicht gut verwunden.« Herr Jansen schmunzelte. »Und überheblich war der Bursche! Hat sich immer erst im letzten Moment die Schuhe zugebunden und ist immer als Letzter an den Startblock. Als könnte er die anderen auch dann noch überholen, wenn er am Start zu spät wäre. Konnte er allerdings auch.«
Herr Jansen lachte, und ich beobachtete gerührt, mit welcher Begeisterung John an Herrn Jansens Lippen hing und wie es ihm gleichzeitig unangenehm und die größte Ehre war, so gelobt zu werden.
»Wirklich?«, fragte ich skeptisch. »Er hat die anderen überholt, auch wenn sie vor ihm losgelaufen sind? Auf hundert Metern?«
Herr Jansen nickte, und auf seinem freundlichen, faltigen Gesicht lag jetzt unverhohlener Stolz. »Einmal hat er am Start Faxen gemacht, das hat er immer gemacht, aber da hat er den Start verpasst. Die anderen hatten schon zwei, drei Schritte hinter sich, als er schließlich loslief. Wie Sie schon sagen – das ist ’ne Menge auf hundert Meter. Ich hatte mich schon gefreut, dachte, na endlich, heute bekommt er mal die Quittung für seine Faxen. Der Junge war nämlich kein guter Verlierer, müssen Sie wissen, der konnte tagelang schmollen, wenn er mal nicht gewonnen hat, wahrscheinlich gewann er deshalb immer. Na, jedenfalls hatte ich mich schon gefreut, da gibt der Bursche auf einmal Gas, mit einer Entschlossenheit und einem derart eisernen Willen, so was habe ich davor und danach nie wieder gesehen. Die ersten vier Konkurrenten hatte er mit wenigen Schritten überholt, die letzten drei schaffte er so fünf Meter vor dem Ziel. Und dann gewinnt der Kerl mit einem Schritt Vorsprung! Das war das Verrückteste, was ich je gesehen habe. Ja, der konnte rennen, und wenn der sich was in den Kopf gesetzt hatte, hat er es auch erreicht.«
Die ehrliche Bewunderung in Herrn Jansens Stimme war nicht zu überhören. Etwas verlegen klopfte er John kurz auf die Schulter, und in dieser kleinen Geste zeigten sich der ganze Stolz und die Zuneigung, die dieser Mann für ihn empfand.
Ich spürte wie sich mein Herz zusammenzog vor Dankbarkeit und Rührung. Also war John doch nicht ganz allein gewesen, es hatte jemanden gegeben, der unübersehbar stolz auf ihn war und der ihn offenbar ehrlich mochte.
»Kann mich nicht dran erinnern, deinen Vater bei den Wettkämpfen gesehen zu haben«, sagte Herr Jansen und gab sich keine große Mühe, sein Unverständnis zu verbergen. »Hat wirklich was verpasst, der Mann. Hab ich nie verstanden. Ich hab mir immer so ’nen Jungen gewünscht wie dich. Wenn ich das Glück gehabt hätte, so einen Sohn zu haben, hätte ich keinen einzigen Wettkampf verpasst.«
Ich konnte sehen, wie sehr John diese Worte berührten. »Haben Sie doch auch nicht!«, sagte er und lachte. »Sie waren jedes Mal da und haben mir die Hölle heißgemacht!«
Herr Jansen lachte jetzt auch. »Allerdings! Und es hat sich ja wohl gelohnt. Scheinst ja immer noch ’n büschen Sport zu machen, so wie du aussiehst. Na, hat nicht sollen sein mit einem eigenen, meine Gerda ist ja leider so früh verstorben. Und mit ’ner anderen Frau wollte ich nix zu schaffen haben.« Herr Jansen lachte und zog ein Stofftaschentuch aus der Tasche seiner beigen Altmännerhose, mit dem er sich über den Nacken fuhr. »Die wahre Liebe gibt’s nur einmal im Leben, sach ich immer. Zumindest war das bei mir so.« Er zwinkerte mir zu und steckte das Taschentuch behutsam wieder ein wie eine Kostbarkeit.
Auf dem Weg zum Auto schwiegen wir, jeder in seine Gedanken versunken. Aber kaum waren wir losgefahren, sprudelte es aus John heraus: »Wenn unser Sohn nach mir kommt, möchte er bestimmt auch in die Leichtathletik, meinst du nicht? Glaubst du, er kann die hundert Meter auch so schnell rennen, wie ich es konnte? Ab wann dürfen Babys Sport machen? Wann kann ich anfangen, mit ihm laufen zu gehen? Ich bin dann jedes Wochenende mit ihm unterwegs, darauf kannst du dich schon mal einstellen. Ich werde keinen einzigen seiner Wettkämpfe verpassen! Mein Sohn wird nie allein auf der Bahn stehen!«
Ich runzelte die Stirn und unterdrückte ein Lächeln. »Was macht dich eigentlich so sicher, dass es ein Junge wird?«
John schaute ertappt. »Na ja, oder meine Tochter halt. Die kann ja auch Leichtathletik machen.«
Ich lachte. Er sah so fröhlich aus, wie er dasaß, mit vor Aufregung roten Wangen, in die Vorstellungen seiner Zukunft als Vater versunken.
»Du wirst die schlimmste Hockey-Mum aller Zeiten«, sagte ich trocken.
»Kann schon sein«, schmunzelte er.
*
Ich schleppe mich in die Küche, drehe den Wasserhahn auf und trinke ein Glas Wasser. Kaltes, klares Wasser.
Henry verfolgt mich mit seinem bekümmerten Blick. Selbst die Labradorin öffnet nun ein Auge und wirft mir einen prüfenden Blick zu, offenbar scheint auch sie zu merken, dass heute etwas nicht in Ordnung ist. Wenn es sogar der stets unbesorgten Mabel auffällt, muss es schlecht um mich stehen.
Kühles, klares Wasser hat immer etwas Tröstendes für mich. Wenn ich es trinke, aber auch, wenn ich darin schwimme. Es weckt in mir die Hoffnung, es würde alles Schlechte von mir abwaschen oder aus mir herausspülen und ich könnte mich erneuern. Ohne jedes Übel neu beginnen. Es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern … Wer hat das neulich gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Was Herr Jansen wohl damit meinte, als er sagte, John sei vor etwas davongelaufen? Ich habe John nie gefragt.
Gekrümmt taumele ich wieder zum Hundeplatz und lege mich zu Henry. Ich denke an den Tag zurück, an dem wir zum ersten Mal das Herz unseres Babys hatten schlagen sehen.
*
Wir fuhren durch einen strahlenden Sommertag, die Sonne schien aus einem stahlblauen Himmel, an dem einzelne blitzweiße Wolken den Horizont zu vergrößern schienen. Die wellige, weite Landschaft Schleswig-Holsteins zog an uns vorbei, und wir redeten und redeten.
Wir waren auf dem Weg zum ersten Ultraschall, der Bestätigung der Schwangerschaft durch den Arzt. John löcherte mich mit Fragen. Das tat er immer, wenn er aufgeregt war oder sich sehr auf etwas freute. Er stellte dann unzählige Fragen, auf die er die meisten Antworten ziemlich sicher selber wusste. So auch an diesem Tag.
»Meinst du, man kann schon etwas sehen?«
»Weiß nicht, mit Glück vielleicht den Herzschlag.«
»So früh schon? Ab wann schlägt denn das Herz?«
»Ab der sechsten Woche.«
»Aber du hast gesagt, es ist bisher nur ein Haufen Zellen, wie kann dann ein schlagendes Herz da sein?«
»Weiß ich auch nicht, aber das habe ich gelesen.«
Nach kurzem Nachdenken: »Kann man dann auch schon sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?«
»Natürlich nicht, sei nicht albern!«
»Wieso, ein Herz ist doch komplizierter als ein Geschlechtsorgan, oder etwa nicht?«
Da hatte er recht. »Das Herz selbst kann man ja auch noch nicht richtig erkennen, nur einen schwarzen Punkt, der schlägt, schätze ich.«
»Das wäre trotzdem das Aufregendste, was ich je gesehen hätte. Hast du das schon mal gesehen?«
»Nein.«
»Findest du die Vorstellung nicht komisch, dass in deinem Bauch ein zweiter Mensch lebt? Mit Herzschlag und allem?«
Darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Wo er es jetzt sagte, doch, das war ein seltsames Gefühl. »Wir müssen erst einmal abwarten, ob man den Herzschlag heute überhaupt schon sieht, wir wissen ja nicht mal genau, in welcher Woche ich bin.«
»Okay, aber gleich, gleich wissen wir es.«
Auf dem Weg zum Wartezimmer in dem Krankenhaus, in dem mein Arzt arbeitete, kam uns eine Frau entgegen, die aussah, als würde sie jeden Moment gebären. Und zwar definitiv mehr als ein Kind. Sie stöhnte und watschelte breitbeinig den Flur hinunter, eine Hand in den Rücken gestemmt, die andere auf einen winzigen Mann gestützt, der jeden Moment zusammenzubrechen drohte. Die Frau war … gewaltig.
Entgeistert starrten John und ich dem ungleichen Paar hinterher. »Das ist bestimmt eine Ausnahme …«, sagte ich, »hoffentlich.«
Als wir das Wartezimmer betraten, mussten wir jedoch feststellen, dass es das offenbar nicht gewesen war, eine Ausnahme. Der Raum war voll mit hochschwangeren Frauen, die ihre riesigen Bäuche mühsam auf ihren Oberschenkeln balancierten. Es war ein einigermaßen verstörender Anblick für uns. Natürlich kannten wir Bilder von schwangeren Frauen, aber in dieser Masse, alle so weit fortgeschritten, so viele auf einen Streich, das war etwas anderes. Keine der Frauen strahlte von innen, der berühmte Schwangerschafts-Glow schien völliger Erschöpfung und absoluter Genervtheit gewichen zu sein. Alle sahen aus, als würden sie jeden Augenblick anfangen zu schreien oder zu weinen.
Die Blicke, mit denen ich beim Betreten des Raumes von oben bis unten gemustert wurde, in meinem dünnen Sommerkleid, ohne Anzeichen einer Wölbung, mit schlanken Fesseln und ohne geschwollene Füße, waren derart böse, dass ich befürchtete, gleich in Flammen aufzugehen. Ich schämte mich und fürchtete mich ehrlich gesagt auch ein bisschen vor diesen Blicken. Am liebsten wäre ich direkt wieder hinausgegangen, aber es gab leider nur dieses eine Wartezimmer.
»Wenn man sich hier so umsieht«, flüsterte ich John zu, »machen wir ein ganz schönes Bohei um meine Schwangerschaft, bei mir sieht man ja noch nicht mal was!«
John starrte entgeistert und einigermaßen indiskret auf die riesigen Körper und geschwollenen Beine um uns herum. »Sehen alle schwangeren Frauen so aus in dem Stadium?«, raunte er zurück und sah sehr besorgt aus.
»Ich glaube schon«, flüsterte ich. »Vielleicht werden manche Frauen nicht ganz so riesig …«
»O Mann, das hoffe ich wirklich.« John schien ehrlich schockiert zu sein.
»Warum? In ein paar Monaten sehe ich auch aus wie ein Wal mit Elefantenbeinen! Gewöhn dich lieber schon mal an den Anblick! Das Wunder des Lebens geht eben mit ein paar Opfern einher …«
John verzog das Gesicht.
»Du brauchst gar nicht so zu gucken, ihr Männer könnt froh sein, dass das alles nicht mit euren Körpern passiert! Das Mindeste, was wir Frauen ja wohl erwarten können, ist Respekt, Dankbarkeit und Liebe für die Opfer, die wir bringen, um eine Familie zu gründen!«
»Natürlich«, raunte John beschwichtigend. »Ich habe das bloß noch nie gesehen, das ist alles. Die Frauen sehen trotzdem toll aus. Nur eben … anders«, versuchte er sein Glück.
Ich lachte. »Lass es gut sein, du verschlimmbesserst es.«
Der Arzt erschien.
»Kommen Sie«, er winkte uns zu, »dann wollen wir mal gucken!«
Und einige Minuten später erschien auf dem Monitor des Ultraschalls, in all dem schwarz-weiß-grauen Gewusel tatsächlich deutlich und stark: das schlagende Herz unseres Babys! Alle Elefantenbeine und Walkörper waren schlagartig vergessen. Wir waren vollkommen überwältigt. Wir hatten einen Menschen erschaffen!
Mit einem Blick auf John sah ich, dass ihm die Tränen über die Wangen liefen. Er war genauso ergriffen wie ich. Ich war so gebannt von diesem winzigen schlagenden Herzen, dass ich meinen Blick keine Sekunde abwenden konnte.
Das Herz unseres Kindes schlug, dasselbe Herz, das es sein ganzes Leben haben würde, mit dem es uns lieben und vermutlich hin und wieder hassen würde; das Herz, das es in die Lage versetzen würde, zu rennen, auf Bäume zu klettern und mit vor Aufregung roten Wangen zu uns gelaufen zu kommen, weil es etwas Besonderes im Wald entdeckt hatte …
Hier schlug das Herz unseres Babys, in meinem Bauch war tatsächlich ein zweiter Mensch, der dort heranwuchs, der unsere Familie vervollständigen würde, mit dem wir von nun an den Rest unseres Lebens teilen würden. Es war das größte Wunder und das größte Geschenk unseres Lebens. Sowohl für John als auch für mich.
Später erzählte er mir, dass dieser Moment, in dem er zum ersten Mal das Herz unseres Kindes hatte schlagen sehen, der überwältigendste seines Lebens gewesen sei. Ich glaube, für mich war er das auch. Keiner von uns hatte sich zuvor darüber Gedanken gemacht, was es eigentlich bedeutete, ein Baby zu bekommen. Frauen wurden eben schwanger und bekamen Kinder, so einfach war das.
Aber jetzt, wo sich dieses kleine Wesen in meinem eigenen Bauch heranbildete, war es ein vollkommen anderes, vollkommen neues Gefühl. Als würden wir zum ersten Mal zu realisieren beginnen, welch komplizierte Abläufe und Entwicklungen dafür nötig waren.
*
»Keine Ahnung hatten wir«, sage ich traurig zu den Hunden und kraule Henry das linke Ohr.
Er grumpft leise.
Vielleicht hätten wir es verhindern können, denke ich, wie schon so oft in den letzten sieben Jahren, wenn wir nur mehr gewusst hätten. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Dennoch durchströmen mich augenblicklich Selbstvorwürfe, Schuld, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Ich ziehe meine Beine näher an mich heran. Die Schmerzen. Diese unvorstellbaren Schmerzen.
*
Mit welcher Freude ich damals die körperlichen Beeinträchtigungen auf mich genommen hatte, die die Schwangerschaft mit sich brachte! Die permanente Übelkeit, die Schmerzen, wenn sich die Mutterbänder dehnten, die bleierne Müdigkeit, jede Nacht stündlich auf die Toilette zu müssen. Der Verzicht auf meinen geliebten Sport, auf Laufen, Reiten, auf Kaffee, Sushi, Wurst, schwarzen Tee, Rohmilchkäse, etliche Lebensmittel, die sonst auf meinem täglichen Speiseplan standen.
Nichts davon hatte mir auch nur das Geringste ausgemacht. Im Gegenteil: Ich liebte es. Ich liebte die bleierne Müdigkeit, das mehrmals nächtlich auf die Toilette Gehen, die schmerzenden Brüste – alles davon erschien mir herrlich. Waren es doch sichere Zeichen dafür, dass in mir ein neues Leben heranwuchs. Und nicht irgendein neues Leben: unser Kind! Ich war so verliebt in mein Baby, ich hätte alles in Kauf genommen, um seine Unversehrtheit und sein gesundes Wachstum sicherzustellen.
Darunter fiel auch die für mich wirklich traurige Entscheidung, schweren Herzens mein Pferd zu verkaufen. Trotz Schwangerschaft weiterzureiten, wäre einfach zu gefährlich gewesen. Ich war schon so oft wirklich schlimm vom Pferd gefallen, das Risiko konnte und wollte ich nicht eingehen. Es wäre schon ziemlich seltsam gewesen, auf Camembert und Kaffee zu verzichten, aber einen Sturz vom Pferd in Kauf zu nehmen … Pferde und Reiten gehörten seit meiner frühesten Kindheit zu meinem Leben, waren Quell für Kraft und Freude und vor allem ein absolut selbstverständlicher Bestandteil meines Daseins. Ohne Pferd zu sein würde eine vollkommen neue Situation für mich darstellen, und unter anderen Umständen hätte ich mein Pferd niemals verkauft.
Aber dieses spezielle Pferd war ein Trakehner, ein etwas schwieriger Charakter, der unbedingt eine Bezugsperson brauchte, die sich tagtäglich um ihn kümmerte. Ihn irgendwo auf die Weide zu stellen oder eine »Reitbeteiligung« zu suchen, die dann im Zweifel nach dem dritten Mal schon keine Lust mehr gehabt hätte und regelmäßig ausgetauscht hätte werden müssen, wäre daher keine Lösung gewesen. Vorausgesetzt, ich hätte überhaupt eine gefunden, denn das gute Tier setzte fremde Leute reihenweise in den Sand.
Nein, ich musste einen neuen Besitzer und ein neues Zuhause für ihn finden.
»Trakehner – unner duisend löppt eener!«, wie man bei uns in Norddeutschland zu sagen pflegt. Ich war immer bestens mit dem Pferd zurechtgekommen, anderen Menschen aber hatte er erhebliche Schwierigkeiten bereitet.
Am Morgen des Termins mit einer Kaufinteressentin war ich daher angespannt. Hoffentlich war sie nett, hoffentlich kam sie mit dem Pferd zurecht!
»Guten Morgen, ihr zwei!« John stand vor dem Bett, zwei dampfende Kaffeetassen in der Hand.
»Ich habe geträumt, wir hätten einen Sohn bekommen, und er war das hübscheste Kind, das du dir vorstellen kannst!«
Ich nahm ihm den Becher ab, den er mir reichte.
»Einmal koffeinfrei.«
Gentleman wie immer.
»Heute ist wieder ein großer Tag, oder?«





























