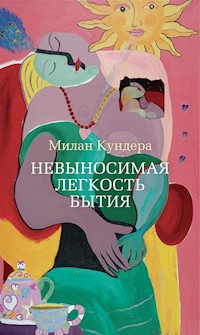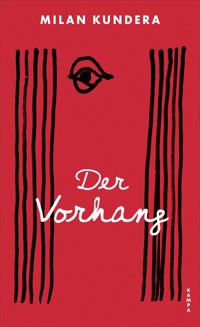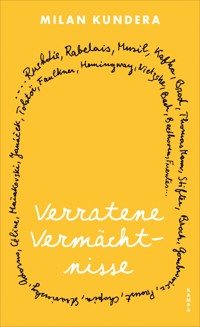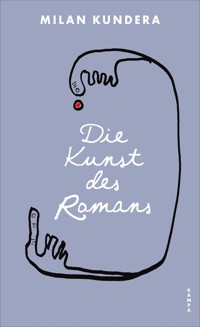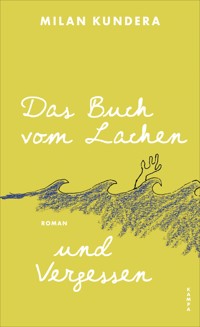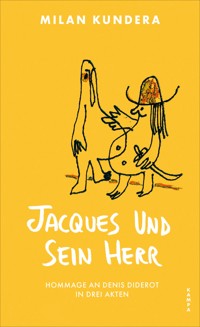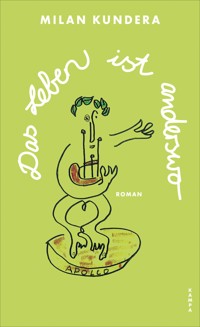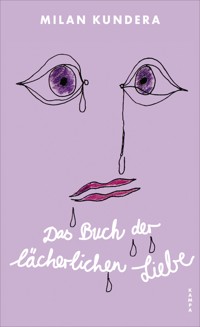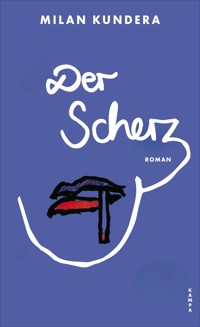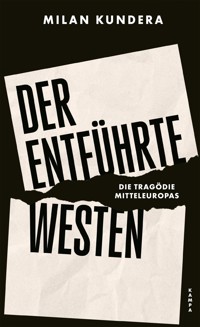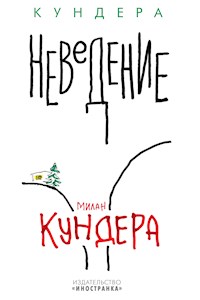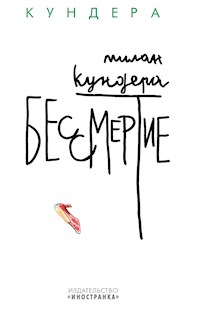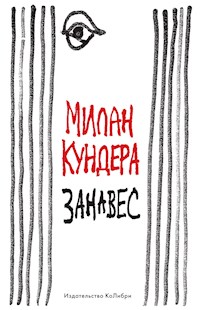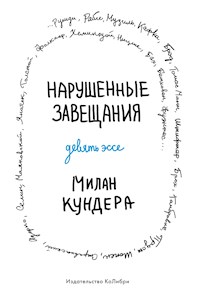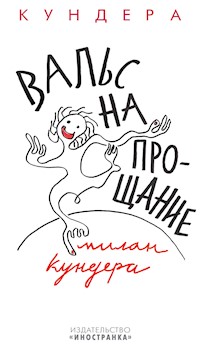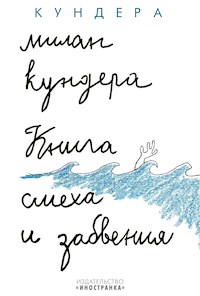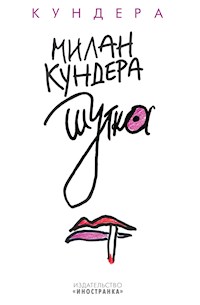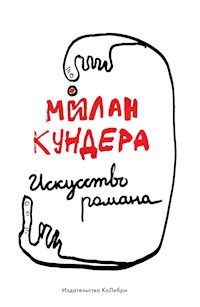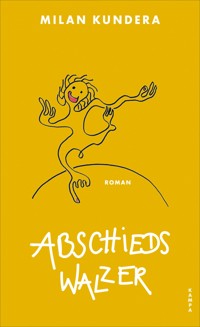
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den Quellen eines böhmischen Badestädtchens werden Wunderwirkungen nachgesagt, wie etwa Frauen Fruchtbarkeit zu schenken. Acht Personen begegnen sich hier: die Krankenschwester Rosa, der berühmte Trompeter Klima, der sie geschwängert hat, seine eifersüchtige Frau Kamila, Franta, Rosas verzweifelter Geliebter, der Gynäkologe Dr. Skreta und sein Patient Bertlef, der Dissident Jakub, der das Land verlassen will, und seine Ziehtochter Olga. Im Takt eines immer schneller werdenden Walzers erzählt Milan Kundera leichtfüßig und witzig von den Wundernissen und Komplikationen der Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Milan Kundera
François Ricard
Abschiedswalzer
Roman
Aus dem Tschechischen von Susanna Roth
Mit einem Nachwort von François Ricard
Kampa
Erster Tag
1
Es wird Herbst, und die Bäume färben sich gelb, rot, braun; das in einem schönen Tal gelegene Badestädtchen ist gleichsam von einer Feuersbrunst umgeben. Unter den Kolonnaden gehen Frauen und neigen sich über die Quellen. Es sind Frauen, die keine Kinder bekommen können und hoffen, in diesem Bad fruchtbar zu werden.
Männer gibt es unter den Patienten weit weniger, aber es gibt sie, denn neben gynäkologischen Wunderwirkungen stärken die Bäder angeblich auch das Herz. Man zählt neun Patientinnen auf einen Patienten, was für eine ledige junge Frau, die hier als Krankenschwester arbeitet und unfruchtbare Damen am Schwimmbecken betreut, zum Verrücktwerden ist!
Rosa ist hier zur Welt gekommen, und hier leben ihre Eltern; wird sie diesem Ort mit seinem so fürchterlichen Frauenüberschuss je entrinnen?
Es ist Montag, und die Arbeitszeit nähert sich allmählich ihrem Ende. Noch die letzten dicken Tanten in Tücher wickeln, auf die Liegen legen, ihre Gesichter abwischen, sie anlächeln.
»Also, rufst du an?«, wird Rosa von ihren Kolleginnen gefragt; die eine ist eine füllige Mittdreißigerin, die andere jünger und mager.
»Warum denn nicht?«, sagt Rosa.
»Hab bloß keine Angst«, muntert die Mittdreißigerin sie auf und führt sie hinter die Umkleidekabine, wo die Krankenschwestern einen Schrank, ein Tischchen und ein Telefon haben.
»Du solltest ihn zu Hause anrufen«, sagt die Magere hämisch, und alle drei fangen an zu lachen.
Als das Lachen verstummt ist, sagt Rosa: »Ich habe die Telefonnummer des Theaters.«
2
Es war ein grässliches Gespräch. Kaum hörte er ihre Stimme am Telefon, erschrak er.
Er hatte immer Angst vor Frauen, obwohl keine ihm das glaubte und alle diese Behauptung für einen koketten Scherz hielten.
»Wie geht es dir?«, fragte er.
»Nicht sehr gut«, antwortete sie.
»Warum?«
»Ich muss mit dir reden«, sagte sie pathetisch.
Genau auf diesen pathetischen Ton hatte er seit Jahren mit Schrecken gewartet.
»Ja«, sagte er mit bedrückter Stimme.
Sie wiederholte: »Ich muss dringend mit dir reden.«
»Was ist passiert?«
»Ich bin jetzt anders als damals, als wir uns kennenlernten.«
Er brachte kein Wort hervor.
Erst nach einer Weile wiederholte er: »Warum?«
»Es ist schon sechs Wochen überfällig.«
Er sagte mit Überwindung: »Vielleicht ist es nichts. Das kommt manchmal vor und hat nichts zu bedeuten.«
»Nein, diesmal ist es so.«
»Das ist unmöglich. Ganz einfach unmöglich. Meine Schuld kann es jedenfalls nicht sein.«
Sie war gekränkt: »Ich bitte dich, für wen hältst du mich?«
Er fürchtete, sie zu verletzen, weil er sich überhaupt vor ihr fürchtete. »Nein, ich will dich nicht beleidigen, Unsinn, weshalb sollte ich dich beleidigen, ich sage ja bloß, dass es mit mir nicht passieren konnte, du brauchst keine Angst zu haben, es ist einfach unmöglich, physiologisch unmöglich.«
»Dann nichts für ungut«, sagte sie sehr beleidigt. »Entschuldige die Störung.«
»Nein, nein, nein.« Er fürchtete, sie könnte einhängen.
»Es ist richtig, dass du mich anrufst! Ich helfe dir selbstverständlich gern. Das lässt sich alles arrangieren, selbstverständlich.«
»Wie meinst du das, arrangieren?«
Er wurde verlegen. Er wagte nicht, die Dinge beim Namen zu nennen: »Na … arrangieren.«
»Das, woran du denkst, damit rechne nicht. Das schlag dir aus dem Kopf. Selbst wenn ich mir das Leben verpfuschen sollte, ich mache es nicht.«
Wieder überfiel ihn Entsetzen, aber er ging nun zaghaft zum Angriff über: »Warum rufst du mich dann an, wenn du nicht mit mir reden willst? Willst du dich mit mir beraten, oder hast du schon alles entschieden?«
»Ich will mich mit dir beraten.«
»Ich komme zu dir.«
»Wann?«
»Ich geb dir Bescheid.«
»Ja.«
»Mach’s gut.«
»Mach’s auch gut.«
Er hängte den Hörer ein und kehrte in den kleinen Saal zurück, in dem seine Kapelle wartete.
»Meine Herren, die Probe ist beendet«, sagte er. »Ich kann heute nicht mehr.«
3
Als sie den Hörer einhängte, war sie rot vor Aufregung. Sie war beleidigt über die Art, wie Klima auf ihre Nachricht reagiert hatte. Im Übrigen war sie seit Längerem beleidigt.
Sie hatten sich vor zwei Monaten kennengelernt, als der berühmte Trompeter mit seiner Kapelle im Badestädtchen aufgetreten war. Nach dem Konzert fand eine Party statt, zu der sie eingeladen war. Der Trompeter hatte ihr vor allen anderen den Vorzug gegeben und verbrachte die Nacht mit ihr.
Seitdem hatte er sich mit keiner Silbe mehr gemeldet. Sie schickte ihm zweimal einen Kartengruß, er aber antwortete nicht. Einmal war sie in der Hauptstadt und rief ihn im Theater an, wo er ihren Informationen zufolge mit seiner Kapelle probte. Der Mann, der sich am Telefon meldete, verlangte, dass sie sich vorstellte, und sagte dann, er würde sich nach Klima umsehen. Nach einer Weile kam er mit der Nachricht zurück, dass die Probe bereits beendet und der Herr Trompeter weggegangen sei. Ihr kam der Gedanke, er habe sich verleugnen lassen, und sie verspürte einen umso größeren Hass, als sie schon damals fürchtete, schwanger zu sein.
»Angeblich ist es physiologisch unmöglich! Das sagt sich so leicht, physiologisch unmöglich! Ich bin gespannt, was er sagt, wenn es da ist!«
Die beiden Kolleginnen pflichteten ihr aufgeregt bei. Seit jenem Tag, da sie ihnen in der dampfgeschwängerten Badehalle mitgeteilt hatte, dass sie in der vergangenen Nacht mit dem berühmten Mann unbeschreibliche Momente erlebt hatte, war der Trompeter zum Besitz all ihrer Kolleginnen geworden. Sein Phantom geisterte durch die Halle, in der sie sich gegenseitig ablösten, und jedes Mal, wenn sein Name fiel, kicherten sie innerlich, als wäre die Rede von jemandem, den sie intim kannten. Als sie erfuhren, dass Rosa schwanger war, wurden sie alle von einer seltsamen Freude erfüllt, weil er von diesem Zeitpunkt an tief in Rosas Körper auch für die Kolleginnen physisch anwesend war.
»Na, na, Mädchen, beruhige dich.« Die Mittdreißigerin klopfte ihr auf den Rücken: »Ich habe etwas gefunden für dich.« Sie entfaltete eine ziemlich schmuddelige, abgegriffene Illustrierte: »Schau mal!«
Alle drei blickten auf das Bild einer hübschen jungen Frau mit schwarzem Haar, die mit dem Mikrophon vor dem Mund auf einem Podium stand.
Rosa versuchte, aus diesen wenigen Quadratzentimetern ihr Schicksal herauszulesen. »Ich wusste nicht, dass sie so jung ist«, sagte sie besorgt.
»Ach geh!«, lachte die Mittdreißigerin: »Das Bild wurde vor zehn Jahren gemacht. Sie sind doch beide gleich alt. Wie will die es mit dir aufnehmen!«
4
Während des Telefongesprächs wurde Klima bewusst, dass er diese Schreckensnachricht seit Langem erwartet hatte. Nicht so sehr, weil er einen vernünftigen Grund gehabt hätte zu glauben, er habe Rosa nach jener fatalen Party geschwängert (er war sich vielmehr sicher, dass sie ihn zu Unrecht beschuldigte), er erwartete eine solche Mitteilung ganz einfach schon seit vielen Jahren, lange bevor er Rosa kennenlernte.
Er war einundzwanzig, als eine verliebte Blondine beschloss, ihm eine Schwangerschaft vorzutäuschen, um ihn zum Altar zu treiben. Es waren scheußliche Wochen, zum Schluss bekam er Magenkrämpfe und brach zusammen. Seither wusste er, dass eine Schwangerschaft ein Schlag war, der einen jederzeit und von überall her treffen konnte, ein Schlag, gegen den es keine Blitzableiter gab und der sich mit einer pathetischen Stimme am Telefon ankündigte (ja, auch damals hatte die Blondine ihm die unselige Nachricht zunächst telefonisch mitgeteilt). Dieser Vorfall seines einundzwanzigsten Lebensjahres hatte zur Folge, dass er danach nur noch unter Angstgefühlen (aber trotzdem recht eifrig) mit Frauen verkehrte und nach jedem verliebten Stelldichein dessen traurige Folgen fürchtete. Er tröstete sich zwar damit, dass die Wahrscheinlichkeit eines derartigen Unfalls bei seiner krankhaften Vorsicht kaum ein Tausendstelprozent groß war, er verstand es jedoch, sich auch vor diesem Tausendstel zu fürchten.
Einmal rief er, verführt von einem freien Abend, eine junge Frau an, die er vor zwei Monaten zum letzten Mal gesehen hatte. Als sie seine Stimme erkannte, rief sie: »Mein Gott, du bist es! Ich habe so darauf gewartet, dass du mich anrufst! Ich habe deinen Anruf so gebraucht!«, und sie sagte es so eindringlich, so pathetisch, dass sein Herz sich in altbekannter Angst zusammenschnürte und er mit seiner ganzen Seele fühlte, dass der Moment gekommen war, den er so sehr gefürchtet hatte. Weil er der Wahrheit möglichst schnell ins Auge sehen wollte, griff er an: »Und warum sagst du mir das mit so tragischer Stimme?« »Meine Mutter ist gestern gestorben«, antwortete sie, und er atmete auf, wusste aber, dass er vor dem, was er fürchtete, gleichwohl nicht verschont bleiben würde.
5
Jetzt reicht es aber. Was hat denn das zu bedeuten?«, fragte der Schlagzeuger, und Klima kam endlich zu sich. Er sah die besorgten Gesichter seiner Musiker um sich herum und sagte ihnen, was vorgefallen war. Die jungen Männer legten ihre Instrumente zur Seite und versuchten, ihm Ratschläge zu geben.
Der erste Rat war radikal: Der achtzehnjährige Gitarrist verkündete, dass man Frauen von der Sorte wie die, die eben den Kapellmeister und Trompeter angerufen hatte, hart zurückweisen müsse. »Sag ihr, sie soll machen, was sie will. Dein Kind ist es nicht, also interessiert dich das alles nicht. Und wenn sie will, wird die Blutprobe zeigen, mit wem sie es gemacht hat.«
Klima wandte ein, dass Blutproben meist nichts bewiesen und einem nur übrig blieb, für die Beschuldigung der Frau zu bezahlen.
Der Gitarrist antwortete, es werde überhaupt nicht zu einer Blutprobe kommen. Eine so zurückgewiesene Frau werde sich hüten, sich unnötige Sorgen aufzuhalsen, und habe sie einmal erkannt, dass der beschuldigte Mann kein ängstlicher Waschlappen sei, werde sie das Kind von sich aus und auf eigene Kosten wegmachen lassen. »Und sollte sie es am Ende doch zur Welt bringen, wird die ganze Kapelle dir vor Gericht bezeugen, dass wir zur fraglichen Zeit alle mit ihr geschlafen haben. Lass sie dann mal den Vater finden!«
Klima aber sagte: »Ich glaube euch, dass ihr es tun würdet. Nur wäre ich bis dahin längst wahnsinnig geworden vor Unsicherheit und Angst. In dieser Hinsicht bin ich der größte Feigling unter der Sonne, ich muss so rasch wie möglich Gewissheit haben.«
Das sahen alle ein. Die Methode des Gitarristen war grundsätzlich gut, aber nicht für jeden. Insbesondere taugte sie nichts für einen Menschen mit schlechten Nerven. Zweitens war sie nicht gut für einen berühmten und reichen Mann, für den Frauen auch das verrückteste Risiko eingingen. Sie neigten somit zu der Ansicht, dass es notwendig sei, die Frau statt durch brutales Zurückweisen durch eine Methode der Überzeugung zur Abtreibung zu bewegen. Aber welche Argumentation wählen? Es zeichneten sich drei grundlegende Möglichkeiten ab:
Die erste appelliert an das mitfühlende Herz des Mädchens: Klima wird mit der Krankenschwester wie mit seiner besten Freundin sprechen; er wird sich ihr aufrichtig anvertrauen; er wird ihr sagen, dass seine Frau schwer krank sei und zusammenbrechen würde, wenn sie erfahren sollte, dass ihr Mann mit einer anderen Frau ein Kind hatte; dass Klima eine solche Situation weder moralisch noch nervlich durchstehen würde; dass er die Krankenschwester deshalb bitte, sich seiner zu erbarmen.
Gegen diese Methode gibt es einen prinzipiellen Einwand. Man darf die ganze Strategie nicht auf etwas so Unsicherem und Ungewissem wie der Herzensgüte einer Krankenschwester aufbauen. Hat eine Frau nicht ein außergewöhnlich gutes Herz, so wird sich ein derartiges Vorgehen gegen Klima wenden. Die Frau wird sich durch die übertriebene Rücksicht, die der auserkorene Vater ihres Kindes auf eine andere Frau nimmt, beleidigt fühlen und umso härter handeln.
Die zweite Methode appelliert an das Urteilsvermögen der Frau: Klima wird versuchen, ihr klarzumachen, dass er nie und nimmer die Gewissheit haben könnte, dass es tatsächlich sein Kind sei. Er kenne die Krankenschwester von einer einzigen Begegnung und wisse gar nichts über sie. Er habe keine Ahnung, mit wem sie sonst noch verkehre. Nein, nein, er verdächtige sie nicht, dass sie ihn absichtlich hintergehen wolle, aber sie könne ihm doch nicht weismachen, dass sie sich nicht auch mit anderen Männern treffe! Und selbst wenn sie das wollte, wo nähme Klima die Gewissheit her, dass sie die Wahrheit sage? Und wäre es klug, ein Kind in die Welt zu setzen, dessen Vater sich seiner Vaterschaft nie sicher sein würde? Könnte Klima seine Frau wegen eines Kindes verlassen, von dem er nicht sicher ist, dass es seines ist? Und will Rosa vielleicht, dass ihr Kind seinen Vater nie kennenlernt?
Auch gegen diese Methode gibt es prinzipielle Einwände. Der Bassist (der älteste Mann in der Kapelle) wandte ein, dass es noch törichter sei, sich auf den Verstand des Mädchens zu verlassen statt auf ihr Mitgefühl. Die Logik der Argumentation ziele ins Leere, und ein Mädchenherz sei erschüttert, wenn der geliebte Mann nicht glaube, dass sie stets nur die Wahrheit sage. Das werde sie ermutigen, mit rührseliger Starrköpfigkeit noch hartnäckiger auf ihren Behauptungen und Absichten zu beharren.
Schließlich gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Klima wird der geschwängerten Frau schwören, dass er sie geliebt habe und immer noch liebe. Darüber, dass sie das Kind von einem anderen haben könnte, darf kein Sterbenswörtchen fallen. Klima wird sie vielmehr in ein Bad aus Vertrauen, Liebe und Zärtlichkeit tauchen. Ihr alles versprechen, einschließlich der Scheidung. Ihr eine herrliche gemeinsame Zukunft ausmalen. Im Namen dieser Zukunft wird er sie dann bitten, die Schwangerschaft liebenswürdigerweise abzubrechen. Er wird ihr erklären, dass die Geburt eines Kindes zu früh käme und sie um die ersten, allerschönsten Jahre ihrer Liebe brächte.
Dieser Argumentation fehlt das, wovon die vorangehende zu viel hat: die Logik. Wie kann Klima so verliebt in die Krankenschwester sein, wenn er ihr seit zwei Monaten aus dem Weg geht? Der Bassist behauptete aber, Verliebte verhielten sich immer unlogisch und nichts sei einfacher, als dem Mädchen das zu erklären. Alle waren sich schließlich einig, dass diese dritte Methode vermutlich die geeignetste war, denn sie appellierte an die Verliebtheit der Frau, und diese schien in der gegebenen Situation die einzige relative Sicherheit.
6
Sie verließen das Theater und verabschiedeten sich an der Ecke voneinander, der Gitarrist jedoch begleitete Klima nach Hause. Als Einziger war er mit dem vorgeschlagenen Plan nicht einverstanden. Er schien ihm des Kapellmeisters, den er vergötterte, unwürdig. »Wenn du zu Frauen gehst, vergiss die Peitsche nicht«, zitierte er Nietzsche, von dessen Werk er nur gerade diesen Satz kannte.
»Mein lieber Junge«, seufzte Klima, »die Peitsche würde sie für mich bereithalten.«
Der Gitarrist schlug Klima vor, mit ihm in seinem Wagen in das Badestädtchen zu fahren, das Mädchen auf die Straße zu locken und zu überfahren. »Niemand wird mir beweisen können, dass sie mir nicht von selbst unter die Räder gerannt ist.« Der Gitarrist war das jüngste Mitglied der Kapelle, er mochte Klima, und dieser war gerührt über seine Worte.
»Du bist wahnsinnig nett«, sagte er zu ihm.
Der Gitarrist entwickelte den Plan bis in alle Einzelheiten weiter, und seine Wangen glühten.
»Du bist wahnsinnig nett, aber es geht nicht«, sagte Klima.
»Was zögerst du? Sie ist doch ein Miststück!«
»Du bist wirklich sehr nett, aber es geht nicht«, sagte Klima und verabschiedete sich.
7
Als er wieder allein war, dachte er über den Vorschlag des Jungen nach und auch darüber, weshalb er ihn abgelehnt hatte. Es war nicht, weil er edelmütiger wäre als der Gitarrist, er war nur furchtsamer. Die Angst, dass man ihn der Mittäterschaft an einem Mord bezichtigte, war um nichts geringer als die Angst, als Vater identifiziert zu werden. Er stellte sich vor, wie der Wagen in Rosa hineinfuhr, er stellte sich vor, wie sie in einer Blutlache auf der Straße lag, und er wurde von einem kurzen Gefühl glücklicher Erleichterung erfüllt. Er wüsste aber, dass es keinen Sinn hatte, sich Spielereien der Illusion hinzugeben. Er hatte jetzt ernsthafte Sorgen. Er dachte an seine Frau. O Gott, morgen hatte sie Geburtstag.
Es war einige Minuten vor sechs, kurz vor Ladenschluss. Er ging rasch in ein Blumengeschäft und kaufte einen riesigen Rosenstrauß. Er dachte daran, wie schrecklich dieser Geburtstag sein würde. Er würde vortäuschen müssen, mit seinen Gedanken und Gefühlen bei ihr zu sein, er würde sich ihr widmen, nett und amüsant sein und mit ihr lachen und dabei unablässig an einen fremden, fernen Bauch denken müssen. Er würde ihr gezwungen liebenswürdige Worte sagen, sein Geist aber wäre weit weg, wie in Einzelhaft gefangen in einer Zelle fremder Eingeweide.
Er machte sich klar, dass es seine Kräfte übersteigen würde, diesen Geburtstag zu Hause zu feiern, und beschloss, die Reise zu Rosa nicht hinauszuschieben.
Diese Vorstellung war allerdings auch nicht gerade verlockend. Aus dem Badestädtchen im Gebirge wehte die Ödnis einer Wüste zu ihm herüber. Er kannte dort niemanden. Außer vielleicht jenen amerikanischen Kurgast, der sich benahm wie früher die reichen Bürger der Kleinstädte und der die ganze Kapelle nach dem Konzert in seiner Suite empfangen hatte. Er bewirtete sie mit vorzüglichen alkoholischen Getränken und verwöhnte sie mit dem weiblichen Personal des Badeorts, wodurch er indirekt verursachte, dass Klima mit Rosa anbändelte. Ach, wenn wenigstens dieser Mensch, der damals so vorbehaltlos freundlich zu ihm gewesen war, noch im Bad wäre! Klima klammerte sich an dessen Bild wie an einen Strohhalm, denn in Momenten, wie er sie gerade durchmachte, braucht ein Mann nichts dringlicher als das kameradschaftliche Verständnis eines anderen Mannes.
Er kehrte ins Theater zurück und ging zum Portier. Er verlangte ein Ferngespräch. Bald schon hörte er ihre Stimme im Hörer. Er sagte ihr, er würde gleich morgen zu ihr kommen. Die Nachricht, die sie ihm vor einigen Stunden mitgeteilt hatte, erwähnte er mit keinem Wort. Er sprach mit ihr, als wären sie beide ein unbeschwertes Liebespaar.
Zwischendurch fragte er: »Ist dieser Amerikaner noch im Bad?«
»Ja«, sagte Rosa.
Er atmete auf und wiederholte, schon leichteren Herzens, dass er sich auf sie freue. »Was hast du an?«, fragte er dann.
»Warum?«
Schon viele Jahre benutzte er diesen Trick bei Telefonflirts mit Erfolg: »Ich will wissen, wie du jetzt gerade angezogen bist. Ich will mir vorstellen, wie du aussiehst.«
»Ich trage ein rotes Kleid.«
»Rot muss dir gut stehen.«
»Vielleicht«, sagte sie.
»Und darunter?«
Sie lachte.
Ja, alle lachten, wenn er diese Frage stellte.
»Was für einen Slip hast du an?«
»Auch einen roten.«
»Ich freue mich schon, dich darin zu sehen«, sagte er und verabschiedete sich. Er hatte den Eindruck, den rechten Ton gefunden zu haben. Für einen Augenblick fühlte er sich erleichtert. Aber nur für einen Augenblick. Er wurde sich nämlich bewusst, dass er an nichts anderes als an Rosa denken konnte und die heutige Plauderei mit seiner Frau auf ein Minimum beschränken musste. Er ging an der Kasse eines Kinos vorbei, in dem ein amerikanischer Western gespielt wurde, und kaufte zwei Karten.
8
Obwohl Kamila Klima viel schöner war als krank, war sie dennoch krank. Ihrer schlechten Gesundheit wegen musste sie vor Jahren ihre Karriere als Sängerin aufgeben, die sie in die Arme ihres jetzigen Mannes geführt hatte.
Der Kopf der schönen jungen Frau, die an Bewunderung gewöhnt war, war plötzlich gefüllt mit dem Karbolgeruch von Krankenhäusern. Es schien ihr, als lägen zwischen ihrer Welt und der Welt ihres Mannes nun sieben Berge.
Als Klima an diesem Tag ihr trauriges Gesicht sah, wollte ihm das Herz brechen, und er streckte ihr (über die fiktiven Berge hinweg) liebevoll seine Hände entgegen. Kamila hatte begriffen, dass in ihrer Trauer eine Kraft lag, von der sie früher nichts geahnt hatte, eine Trauer, die Klima anzog und zu Zärtlichkeit und Tränen rührte. Kein Wunder, dass sie dieses unverhofft gefundene Instrument (vielleicht unwillkürlich, aber umso öfter) einzusetzen begann. Denn nur in den Momenten, da er sich in ihrem schmerzensvollen Gesicht spiegelte, konnte sie sich einigermaßen sicher sein, dass in seinem Kopf keine andere Frau mit ihr rivalisierte.
Denn diese wunderschöne Frau fürchtete die Frauen und witterte sie überall. Niemals und nirgends entgingen sie ihr. Sie konnte sie im Tonfall seiner Begrüßung finden, wenn er nach Hause kam. Sie konnte sie im Geruch seiner Kleider riechen. Kürzlich hatte sie auf seinem Schreibtisch einen Papierschnipsel gefunden, den er von einem Zeitungsrand abgerissen hatte; darauf war von seiner Hand ein Termin notiert. Natürlich konnte dieser die verschiedensten Anlässe betreffen, eine Konzertprobe, eine Verabredung mit dem Agenten, sie aber musste den ganzen Monat daran denken, mit welcher Frau sich Klima an diesem Tag wohl treffen würde, und sie schlief den ganzen Monat schlecht.
Wenn die heimtückische Welt der Frauen sie so sehr entsetzte, konnte sie zum Trost nicht in die Welt der Männer flüchten?
Schwerlich. Die Eifersucht hat die wundersame Macht, den Einzigen mit grellem Licht anzustrahlen und die Massen der übrigen Männer in völliger Finsternis versinken zu lassen. Frau Klimas Gedanken konnten sich nur in Richtung dieser quälenden Strahlen bewegen, und ihr Mann wurde zum einzigen Mann auf der Welt.
Jetzt hörte sie den Schlüssel im Schloss, und sie sah ihren Trompeter mit einem Rosenstrauß.
Im ersten Augenblick empfand sie Freude, unmittelbar danach aber meldeten sich Zweifel: Warum brachte er die Blumen schon heute, wenn sie erst morgen Geburtstag hatte? Was hatte das schon wieder zu bedeuten?
»Bist du morgen nicht da?«, hieß sie ihn willkommen.
9
Dass er die Rosen bereits heute gebracht hatte, bedeutete noch keineswegs, dass er morgen nicht zu Hause sein würde. Ihre argwöhnischen, ewig wachsamen und ewig eifersüchtigen Fühler verstanden es aber, jede heimliche Absicht ihres Mannes lange im Voraus zu erraten. Wann immer sich Klima der Existenz dieser fürchterlichen Fühler bewusst wurde, die ihn beobachteten, entblößten und entlarvten, wurde er von einem Gefühl hoffnungsloser Müdigkeit übermannt. Er hasste diese Fühler und war überzeugt, dass seine Ehe, wenn überhaupt, nur durch sie gefährdet war. Er war sich sicher (und hatte diesbezüglich immer ein kämpferisch reines Gewissen), dass er seine Frau nur deshalb manchmal belog, um sie zu schonen, vor jeglicher Beunruhigung zu bewahren, und dass sie sich ihre Qualen durch ihren Argwohn selbst bereitete.
Er sah ihr ins Gesicht und las Verdächtigung, Traurigkeit und Missmut heraus. Er hatte Lust, den Strauß auf den Boden zu schmeißen, beherrschte sich aber. Er wusste, dass er in den nächsten Tagen viel schwierigere Situationen würde meistern müssen.
»Hast du etwas dagegen, dass ich dir die Blumen schon heute bringe?«, sagte er, und seine Frau hörte die Gereiztheit in seiner Stimme. Also bedankte sie sich und füllte eine Vase mit Wasser.
»Verfluchter Sozialismus«, sagte Klima.
»Wieso?«
»Ich bitte dich. Ständig zwingt man uns, gratis aufzutreten. Einmal für den Kampf gegen den Imperialismus, ein andermal zum Jahrestag der Revolution, dann wieder zum Geburtstag irgendeines Potentaten, und wenn ich nicht will, dass wir liquidiert werden, muss ich zu allem Ja und Amen sagen. Du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich heute wieder geärgert habe.«
»Warum denn?«, sagte sie teilnahmslos.
»Während der Probe hat uns eine Referentin vom Nationalausschuss besucht, um uns zu belehren, was wir spielen dürfen und was nicht, und zum Schluss hat sie uns gezwungen, ein Gratiskonzert für den Jugendverband zu geben. Das Schlimmste aber ist, dass ich morgen den ganzen Tag auf einer blöden Konferenz verbringen muss, wo man uns abermals belehren wird, wie die Musik mithelfen kann, den Sozialismus aufzubauen. Ein verpfuschter Tag, ein völlig verpfuschter Tag! Und das ausgerechnet an deinem Geburtstag!«
»Man wird dich doch nicht bis in die Nacht hinein dort festhalten?«
»Das nicht. Aber du kannst dir vorstellen, in was für einer Stimmung ich heimkommen werde. Deshalb wollte ich wenigstens heute einen ruhigen Abend mit dir verbringen«, sagte er und nahm ihre Hände.
»Du bist lieb«, sagte Frau Klima, und er erkannte am Ton ihrer Stimme, dass sie ihm kein Wort von dem glaubte, was er über die morgige Konferenz gesagt hatte. Frau Klima wagte es allerdings nicht, ihm zu verstehen zu geben, dass sie ihm nicht glaubte. Sie wusste, dass ihr Argwohn ihn wütend machte. Aber Klima hatte längst schon den Glauben in ihr Vertrauen verloren. Ob er die Wahrheit sagte oder log, immer verdächtigte er sie, dass sie ihn verdächtigte. Es half jedoch nichts, er musste weiterreden, als glaubte er, dass sie ihm glaubte, und sie stellte ihm (mit traurigem, fremdem Gesicht) Fragen über die Konferenz, um ihm zu beweisen, dass sie nicht an deren Existenz zweifelte.
Dann ging sie in die Küche und machte das Abendessen. Sie versalzte es. Sie kochte immer gern und gut (das Leben hatte sie nicht verwöhnt und es ihr nie abgewöhnt, den Haushalt selbst zu besorgen), und Klima wusste, wenn das Essen ihr diesmal missraten war, so nur deshalb, weil sie sich quälte. Er sah im Geist die schmerzliche, abrupte Bewegung, mit der sie zu viel Salz ins Essen schüttete, und sein Herz krampfte sich zusammen. Es kam ihm vor, als kostete er in den salzigen Bissen den Geschmack ihrer Tränen, als schluckte er seine eigenen Verfehlungen herunter. Er wusste, dass Kamila sich vor Eifersucht quälte, er wusste, dass sie wieder nicht würde schlafen können, er wollte sie liebkosen, küssen, beschwichtigen, aber er machte sich sogleich klar, dass es zwecklos war, denn ihre Fühler hätten in seiner Zärtlichkeit nur das schlechte Gewissen entdeckt.
Schließlich gingen sie ins Kino. Klima fand eine Art Ermutigung in dem Helden, der auf der Leinwand mit einer hinreißenden Sicherheit verräterischen Gefahren entrann. Er sah sich selbst an dessen Stelle und glaubte zeitweise, Rosa zur Abtreibung zu überreden sei eine Kleinigkeit, die er dank seines Charmes und seiner guten Sterne mit der linken Hand meistern könne.
Dann legten sie sich nebeneinander ins breite Bett. Er schaute sie an. Sie lag auf dem Rücken, den Kopf ins Kissen gepresst, das Kinn leicht angehoben und den Blick an die Decke geheftet, und er sah in der straffen Gespanntheit ihres Körpers (die ihn immer an Saiten erinnerte, er sagte ihr, sie habe ›Seelensaiten‹) in einem einzigen Augenblick ihr ganzes Wesen. Ja, manchmal glaubte er (es waren wundervolle Momente), in einer einzigen Geste oder Bewegung gleichsam die ganze Geschichte ihres Körpers und ihrer Seele zu sehen. Es waren Augenblicke absoluter Hellsichtigkeit, aber auch absoluter Gerührtheit; diese Frau hatte ihn nämlich schon geliebt, als er noch unbedeutend gewesen war, sie war immer bereit gewesen, alles für ihn zu opfern, sie verstand seine Gedanken blind, er konnte mit ihr über Armstrong und über Strawinsky, über Belangloses und über Sorgen sprechen, sie stand ihm von allen am nächsten … Er stellte sich vor, dass dieser süße Körper, dieses süße Gesicht tot wären, und es schien ihm, als könnte er sie keinen einzigen Tag überleben. Er wusste, dass er fähig war, sie bis zu seinem letzten Atemzug zu beschützen, fähig, sein Leben für sie hinzugeben.
Aber dieses Gefühl atemberaubender Liebe war nur ein sekundenlanges, kraftloses Aufflackern, denn sein Denken blieb von Angst und Furcht erfüllt. Er lag neben Kamila, wusste, dass er sie grenzenlos liebte, und war doch abwesend. Er streichelte ihr Gesicht, als streichelte er es aus einer unermesslichen Entfernung von Hunderten von Kilometern.
Zweiter Tag
1
Es war gegen neun Uhr morgens, auf dem Parkplatz am Rand des Badestädtchens (weiter durften Autos nicht fahren) hielt ein eleganter weißer Wagen, und Klima stieg aus.
In der Mitte des Städtchens erstreckte sich ein langer Park mit schütter gepflanzten Bäumen, Rasen, sandbestreuten Wegen, bunten Bänken. Zu beiden Seiten standen die Badehäuser, darunter auch das Marxhaus, in dem Schwester Rosa ein Zimmer bewohnte und der Trompeter die zwei schicksalhaften Nachtstunden verbracht hatte. Gegenüber dem Marxhaus, auf der anderen Seite des Parks, lag, im Jugendstil der Jahrhundertwende, mit vielen Stuckaturverzierungen und einem Mosaik über dem Eingang, das schönste Gebäude des Bades. Dieses Haus besaß als einziges das Privileg, seinen ursprünglichen Namen Richmond unverändert weiterführen zu dürfen.
»Wohnt Herr Bertlef noch hier?« fragte Klima den Portier, und als er eine bejahende Antwort erhielt, lief er über den roten Teppich in den ersten Stock und klopfte an die Tür.
Als er eintrat, sah er, dass Bertlef ihm im Pyjama entgegenkam. Er entschuldigte sich verlegen für sein unangemeldetes Kommen, doch Bertlef unterbrach ihn:
»Mein Freund! Entschuldigen Sie sich nicht! Das ist die größte Freude, die mir hier je jemand in diesen frühen Morgenstunden gemacht hat.«
Er schüttelte Klimas Hand und fuhr fort: »In diesem Land schätzt man den Morgen nicht. Die Leute erwachen gewaltsam mithilfe eines Weckers, der ihren Schlaf wie mit einem Axthieb abhackt, und dann geben sie sich sofort einer trübsinnigen Eile hin. Sagen Sie mir, was ist das für ein Tag, der mit einem solchen Gewaltakt beginnt! Was muss in Menschen vorgehen, denen tagtäglich mithilfe eines Weckers ein kleiner Elektroschock verpasst wird! Sie werden täglich an Gewalt gewöhnt und täglich der Lust entwöhnt. Glauben Sie mir, es sind die Morgenstunden, die über den Charakter eines Menschen entscheiden.«
Bertlef fasste Klima sanft an der Schulter, setzte ihn in einen Sessel und fuhr fort: »Ich aber liebe diese Morgenstunden der Muße sehr, in denen ich wie über eine von Statuen gesäumte Brücke allmählich von der Nacht in den Tag, vom Schlafen ins Wachen schreite. Es ist die Zeit des Tages, da ich dankbar wäre für ein kleines Wunder, für eine unverhoffte Begegnung, die mich davon überzeugte, dass die Träume meiner Nacht sich fortsetzen und zwischen dem Abenteuer des Schlafes und dem Abenteuer des Tages nicht ein Abgrund klafft.«
Der Trompeter beobachtete Bertlef, wie er im Pyjama durch das Zimmer spazierte und sich mit der Hand die ergrauten Haare glattstrich; ihm wurde bewusst, dass seine klangvolle Stimme einen unverlierbaren amerikanischen Akzent hatte und seine Wortwahl liebenswert altmodisch war, was man leicht erklären konnte, hatte er doch nie in seiner ursprünglichen Heimat gelebt und die Muttersprache nur im Kreise der Familie erlernt.
»Und niemand, mein Freund«, sagte er und neigte sich vertrauensvoll über Klima, »niemand in diesem Badestädtchen ist imstande, mir entgegenzukommen. Sogar die sonst so nachgiebigen Krankenschwestern zeigen sich entrüstet, wenn ich sie dazu verführen will, in der Frühstückszeit fröhliche Augenblicke mit mir zu verbringen, sodass ich alle Begegnungen auf den Abend verschieben muss, wenn ich doch schon etwas müde bin.«
Dann trat er zum Tischchen mit dem Telefon und fragte: »Wann sind Sie angekommen?«
»Heute Morgen«, sagte Klima. »Mit dem Wagen.«
»Sie sind gewiss hungrig«, sagte Bertlef und hob den Hörer. Er bestellte das Frühstück: »Zweimal Ei im Glas, Käse, Butter, Hörnchen, Milch, Schinken und Tee.«
Klima sah sich inzwischen im Zimmer um. Ein großer, runder Tisch, Stühle, Sessel, ein Spiegel, zwei Sofas, Türen zum Bad und zu einem weiteren angrenzenden Raum, in dem, wie er sich erinnerte, ein kleines Schlafzimmer war. Hier, in diesem prächtigen Appartement, hatte alles angefangen. Hier hatten die betrunkenen Jungs seiner Kapelle gesessen, zu deren Vergnügen der reiche Amerikaner einige Krankenschwestern eingeladen hatte.
»Ja«, sagte Bertlef, »das Bild, das Sie betrachten, war letztes Mal noch nicht hier.«
Erst jetzt bemerkte der Trompeter das Bild, auf dem ein bärtiger Mann mit einer sonderbaren, blassblauen Scheibe um den Kopf und Pinsel und Palette in der Hand zu sehen war. Das Bild sah nicht aus wie ein Kunstwerk, der Trompeter wusste jedoch, dass viele Bilder, die so aussahen, berühmt waren.
»Wer hat es gemalt?«
»Ich selbst«, antwortete Bertlef.
»Ich wusste nicht, dass Sie malen.«
»Ich male sehr gern.«
»Und was ist es?«, wagte der Trompeter zu fragen.
»Der heilige Lazarus.«
»War Lazarus Maler?«
»Es ist nicht der biblische Lazarus, sondern der heilige Lazarus, ein Mönch, der im neunten Jahrhundert in Konstantinopel gelebt hat. Er ist mein Schutzpatron.«
»Ja«, sagte der Trompeter.
»Er war ein sehr sonderbarer Heiliger. Er wurde nicht von Heiden gequält, weil er an Jesus glaubte, sondern von schlechten Christen, weil er zu gern malte. Wie Sie vielleicht wissen, herrschte im achten und neunten Jahrhundert im griechischen Teil der Kirche ein strenges Asketentum, das keinerlei weltliche Freuden duldete. Sogar Bilder und Skulpturen wurden als etwas sündhaft Genusssüchtiges angesehen. Kaiser Theophil ließ Tausende von herrlichen Bildern vernichten und verbot meinem geliebten Lazarus das Malen. Lazarus wusste aber, dass er mit seinen Bildern Gott pries, und er hörte nicht auf. Theophil kerkerte ihn ein und folterte ihn, er wollte, dass Lazarus sich von seinem Pinsel lossagte, doch Gott war ihm gnädig und verlieh ihm die Kraft, die grausamen Qualen zu ertragen.«
»Eine schöne Geschichte«, sagte der Trompeter höflich.
»Eine wunderbare Geschichte. Sie sind aber bestimmt nicht zu mir gekommen, um meine Bilder zu betrachten.«
In diesem Moment klopfte es, und in der Tür erschien ein Kellner mit einem großen Tablett. Er stellte es auf den Tisch und richtete für die beiden Männer das Frühstück her.
Bertlef bat den Trompeter zu Tisch und sagte: »Das Frühstück ist nicht so exquisit, dass wir unser Gespräch dabei nicht fortsetzen könnten. Erzählen Sie, was Sie auf dem Herzen haben!«
Und so schilderte der Trompeter kauend seine Geschichte, die Bertlef an einigen Stellen zu prüfenden Fragen provozierte.
2
Vor allem nahm er Anstoß daran, dass Klima Schwester Rosa keinen ihrer Briefe beantwortet, sich vor ihr verleugnet und selber keine freundschaftliche Geste gezeigt hatte, um die Liebesnacht in einem stillen, versöhnlichen Echo zu verlängern.
Klima gab zu, weder anständig noch weise gehandelt zu haben. Er könne sich aber nicht helfen. Jede weitere Beziehung zu diesem Mädchen sei ihm zuwider.
»Eine Frau verführen«, sagte Bertlef unzufrieden, »das kann jeder Dummkopf. An der Art aber, wie man sie verlässt, erkennt man die Reife eines Mannes.«
»Ich weiß«, gestand der Trompeter traurig, »aber dieser Widerwille, dieser unüberwindliche Ekel in mir ist stärker als jeder gute Vorsatz.«
»Ich bitte Sie«, wunderte sich Bertlef, »sind Sie ein Misogyn?«
»Das sagt man.«
»Aber woher kommt das bei Ihnen? Sie sehen schließlich weder impotent noch homosexuell aus!«
»Ich bin in der Tat weder impotent noch homosexuell. Es ist etwas viel Schlimmeres«, gestand der Trompeter melancholisch. »Ich liebe meine eigene Frau. Das ist mein erotisches Geheimnis, das den meisten Leuten völlig unverständlich ist.«
Dieses Geständnis war so rührend, dass die beiden Männer für eine Weile verstummten. Dann erst fuhr der Trompeter fort: »Niemand versteht das, am wenigsten meine eigene Frau. Sie denkt, eine große Liebe manifestiere sich darin, dass man nichts mit anderen Frauen hat. Das ist aber Unsinn. Immer wieder treibt es mich zu irgendeiner fremden Frau, in dem Moment aber, da ich sie nehme, schleudert mich eine starke Sprungfeder wieder zu Kamila zurück. Manchmal sage ich mir, dass ich diese anderen Frauen nur dieser Sprungfeder wegen suche, dieses Schleuderns wegen, dieses herrlichen Fluges (voller Zärtlichkeit, Sehnsucht und Demut) hin zur eigenen Frau, die ich mit jedem neuen Seitensprung nur noch mehr liebe.«
»Dann war Schwester Rosa für Sie also nur eine Bekräftigung Ihrer monogamen Liebe.«
»Ja«, sagte der Trompeter, »aber eine sehr angenehme Bekräftigung. Schwester Rosa hat nämlich auf den ersten Blick ziemlich viel Charme und außerdem den Vorteil, dass dieser Charme sich innerhalb von zwei Stunden völlig verflüchtigt, sodass einen nichts zu längerem Verweilen verlockt und man von der Sprungfeder gewaltsam zum herrlichen Rückflug hochgeschleudert wird.«
»Lieber Freund, es gibt kaum jemanden, an dem ich besser beweisen könnte als an Ihnen, dass übermäßige Liebe sündhaft ist.«
»Ich dachte, die Liebe zu meiner Frau sei das einzig Gute an mir.«
»Und Sie irren sich. Die übermäßige Liebe zu Ihrer Frau ist nicht der ausgleichende Gegenpol zu Ihrer Gefühllosigkeit, sonderen deren Quell. Da Ihre Frau alles für Sie ist, sind alle anderen Frauen für Sie nichts, oder anders gesagt, sie sind Huren. Und das ist eine große Versündigung und eine Verachtung für die Kreaturen, die Gott geschaffen hat. Lieber Freund, diese Art von Liebe ist Ketzerei.«
3
Bertlef schob die leere Tasse von sich, stand vom Tisch auf und ging ins Badezimmer, aus dem Klima zuerst das Geräusch von fließendem Wasser und dann Bertlefs Stimme hörte: »Glauben Sie, dass der Mensch das Recht hat, ein ungeborenes Kind umzubringen?«
Schon als er das Bild des Bärtigen mit dem Heiligenschein gesehen hatte, war er stutzig geworden. Er hatte Bertlef als leutseligen Bonvivant in Erinnerung und wäre niemals auf den Gedanken gekommen, er könnte ein gläubiger Mensch sein. Nun krampfte sich sein Herz zusammen, denn er befürchtete, dass er eine Moralpredigt zu hören bekäme und sich seine einzige Oase in der Wüste dieses Badestädtchens in Sand verwandelte. Er sagte mit beklommener Stimme: »Gehören Sie zu denen, die das Mord nennen?«
Bertlef antwortete lange nicht. Dann trat er aus dem Bad, angekleidet und sorgfältig gekämmt.
»Mord ist ein Wort, das zu sehr nach elektrischem Stuhl riecht«, sagte er. »Es geht mir um etwas anderes. Wissen Sie, ich denke, dass man das Leben mit allem Für und Wider annehmen muss. Das ist das erste Gebot, noch vor den zehn anderen. Alle Ereignisse liegen in Gottes Hand, und wir wissen nichts über ihr morgiges Schicksal, womit ich sagen will, das Leben mit allem Für und Wider anzunehmen bedeutet, auch Unvorhergesehenes anzunehmen. Und ein Kind ist eine Konzentration von Unvorhergesehenem. Ein Kind ist das Unvorhergesehene selbst. Sie wissen nicht, was aus ihm wird, was es Ihnen bringen kann, und gerade deshalb müssen Sie es annehmen. Sonst leben Sie nur halb, Sie leben wie ein Nichtschwimmer, der am Ufer herumplanscht, obwohl das wirkliche Meer erst dort ist, wo es Tiefe hat.«
Der Trompeter wandte ein, das Kind sei nicht von ihm.
»Nehmen wir das einmal an«, sagte Bertlef. »Geben Sie aber aufrichtig zu, dass Sie Rosa auch dann hartnäckig zu einer Abtreibung überreden würden, wenn das Kind von Ihnen wäre. Sie würden es wegen Ihrer Frau tun und wegen der sündigen Liebe, die Sie für sie hegen.«
»Ja, ich gebe es zu«, sagte der Trompeter, »ich würde sie unter allen Umständen zu einer Abtreibung zwingen.«
Bertlef stand an die Badezimmertür gelehnt und lächelte: »Ich verstehe Sie und werde Sie gar nicht zu überreden versuchen. Ich bin zu alt, um die Welt verbessern zu wollen. Ich habe Ihnen gesagt, was ich denke, das ist alles. Ich bleibe Ihr Freund, auch wenn Sie gegen meine Überzeugung handeln, und werde Ihnen behilflich sein, auch wenn ich nicht mit Ihnen übereinstimme.«
Der Trompeter sah Bertlef an, der die letzten Sätze mit der Samtstimme eines weisen Predigers vorgetragen hatte. Er kam ihm großartig vor. Ihm schien, als könnte alles, was Bertlef sagte, eine Legende sein, ein Gleichnis, ein Kapitel aus einem modernen Evangelium. Er hatte Lust (verstehen wir ihn, er war aufgeregt und neigte zu übertriebenen Gesten), sich tief vor ihm zu verneigen.
»Ich werde Ihnen helfen, so gut ich kann«, fuhr Bertlef fort. »Wir gehen zu meinem Freund, dem Chefarzt Skreta, der die medizinische Seite der ganzen Angelegenheit für Sie erledigen wird. Sagen Sie mir nur noch, wie Sie Rosa zu einer Entscheidung bewegen wollen, gegen die sie sich sträubt!«
4
Das war das dritte Thema, über das sie sich unterhielten. Als der Trompeter seinen Plan dargelegt hatte, sagte Bertlef: