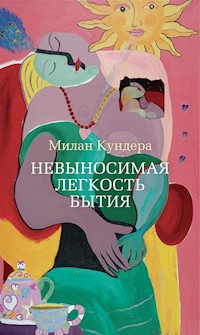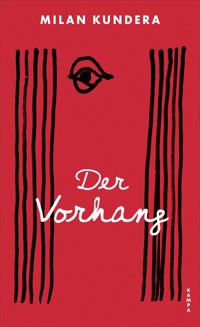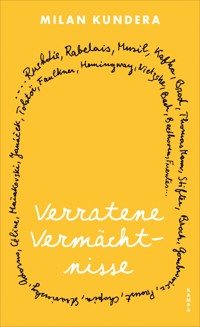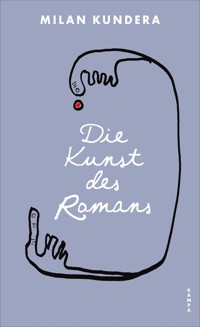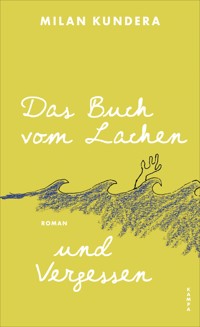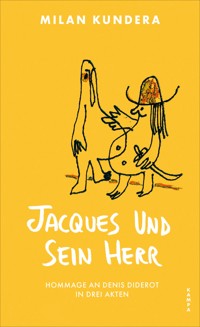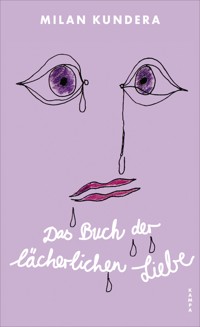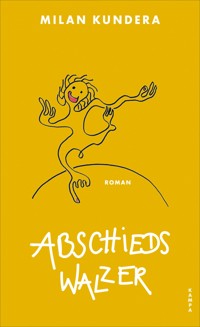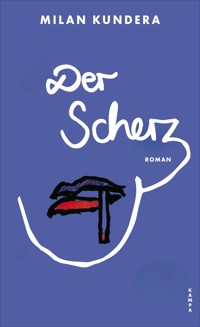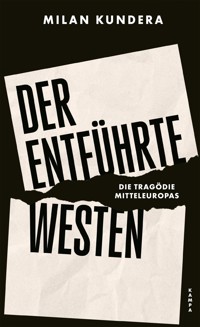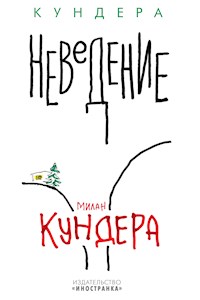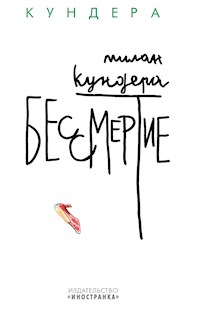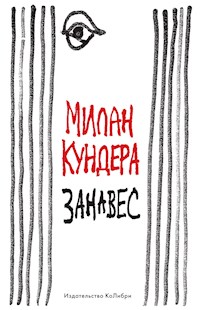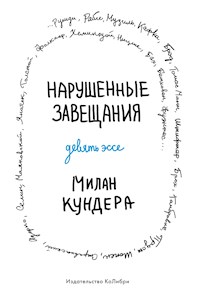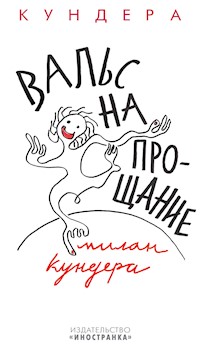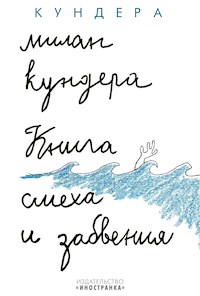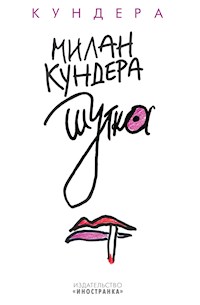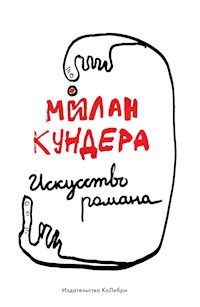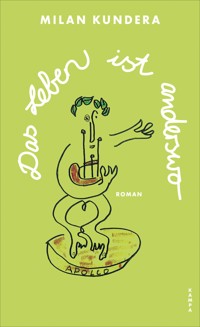
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von ihrer Ehe ist Jaromils Mutter enttäuscht. Ihr Mann hat für eine Abtreibung plädiert. Als er seine jüdische Geliebte im Ghetto von Theresienstadt besucht, wird er schließlich hingerichtet. Fortan widmet die Mutter sich ganz ihrem Sohn, in dessen kindlichen Kritzeleien und Brabbeleien sie ein außergewöhnliches Genie zu erkennen glaubt. Sie fördert ihn als Lyriker, kontrolliert alle seine Schritte und bindet ihn so eng an sich, dass er sich auch als Erwachsener nicht von ihr lösen kann. An der Eifersucht der Mutter scheitert jede von Jaromils Beziehungen: mit der Studentin, dem Rotschopf, der Filmerin …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Milan Kundera
François Ricard
Das Leben ist anderswo
Roman
Aus dem Tschechischen von Susanna Roth
Mit einem Nachwort von François Ricard
Kampa
Erster Teil oder Der Dichter wird geboren
1
Wenn die Mutter des Dichters darüber nachdachte, wo dieser empfangen worden war, kamen nur drei Möglichkeiten in Betracht: auf einer Bank in einem abendlichen Park, an einem Nachmittag in der Wohnung, die einem Kollegen des Vaters gehörte, oder vormittags in einer romantischen Gegend unweit von Prag.
Wenn sich der Vater des Dichters dieselbe Frage stellte, kam er zum Schluss, dass der Dichter in der Wohnung des Kollegen empfangen worden war, denn an jenem Tag hatte er nichts als Pech gehabt. Die Mutter des Dichters hatte nicht in die Wohnung des Kollegen mitgehen wollen, zweimal hatten sie sich gestritten und zweimal wieder versöhnt, und während sie sich liebten, drehte jemand in der Nachbarwohnung den Schlüssel herum, die Mutter des Dichters erschrak, sie hielten inne und liebten sich dann zu Ende, und zwar in beiderseitiger Nervosität, und ebendieser schrieb der Vater die Schuld an der Empfängnis zu.
Die Mutter des Dichters ließ die Möglichkeit, dass der Dichter in einer geliehenen Wohnung empfangen worden sein könnte, jedoch keineswegs gelten (die Wohnung war junggesellenhaft unordentlich gewesen, und die Mutter hatte sich vor dem ungemachten Bett geekelt, wo auf dem Leintuch ein zerknitterter, fremder Pyjama lag), desgleichen verwarf sie die Möglichkeit, er könnte auf einer Parkbank empfangen worden sein, wo sie sich nur ungern und gegen ihren Geschmack hatte zur Liebe bewegen lassen, da es sie anwiderte, dass gerade diese Parkbänke von den Prostituierten benutzt wurden. Es war ihr also klar, dass der Dichter einzig an jenem sonnigen Sommervormittag empfangen worden sein konnte, und zwar hinter der Wand eines hohen Felsblocks, der in einem Tal, wo die Prager ihre Sonntagsspaziergänge machen, inmitten anderer Felsen pathetisch aufragte.
Diese Kulisse eignet sich aus mehreren Gründen als Ort für die Empfängnis eines Dichters: Von der Mittagssonne beschienen, ist es eine Kulisse der Helle und nicht des Dunkels, des Tages und nicht der Nacht; es ist ein Ort inmitten einer offenen Landschaft, ein Ort also, der beschwingt und beflügelt; und schließlich ist es, obwohl von den letzten Mietskasernen der Stadt nicht allzu weit entfernt, eine romantische Gegend voller Felsklippen, die aus einem wild modellierten Boden ragen. Das alles schien ihr ein vielsagendes Bild dessen zu sein, was sie damals erlebt hatte. War ihre große Liebe zum Vater des Dichters nicht eine romantische Revolte gegen das Prosaische und Ordentliche ihrer Eltern gewesen? War der Mut, mit dem sie als Tochter eines reichen Kaufmanns einen mittellosen, gerade diplomierten Ingenieur erwählt hatte, dieser ungebändigten Gegend nicht wesensverwandt?
Die Mutter des Dichters hatte damals die große Liebe erlebt, und die Enttäuschung, die bald schon auf den schönen Vormittag folgte, änderte nichts daran. Als sie nämlich ihrem Geliebten freudig erregt mitteilte, dass die intime Indisposition, die ihr jeden Monat das Leben verleide, bereits mehrere Tage ausgeblieben sei, verkündete der Ingenieur mit aufreizender Teilnahmslosigkeit (mag sie uns auch gespielt und unsicher vorkommen), es handele sich um eine belanglose Störung des körperlichen Zyklus, der seinen wohltuenden Rhythmus gewiss wiederfinden werde. Die Mutter spürte, dass ihr Geliebter ihre Hoffnungen und Freuden nicht teilen wollte, war beleidigt und sprach bis zu dem Moment nicht mehr mit ihm, da der Arzt ihr mitteilte, dass sie schwanger sei. Der Vater des Dichters sagte, er sei mit einem Gynäkologen befreundet, der sie diskret von den Sorgen befreien werde, und die Mutter brach in Tränen aus.
Rührendes Ende einer Revolte! Zuerst lehnte sie sich im Namen des jungen Ingenieurs gegen ihre Eltern auf, und dann lief sie zu den Eltern zurück, um Hilfe gegen ihn anzufordern. Und die Eltern enttäuschten nicht; sie trafen sich mit ihm, nahmen ihn ins Gebet, und der Ingenieur, der offenbar begriffen hatte, dass es kein Entrinnen gab, willigte in eine prunkvolle Hochzeit ein und nahm widerspruchslos die ansehnliche Mitgift an, die es ihm erlaubte, ein eigenes Bauunternehmen zu gründen; seine spärliche Habe, die in zwei Koffern Platz fand, brachte er mit in die Villa, in der seine frischgebackene Ehefrau von Geburt an mit ihren Eltern lebte.
Die bereitwillige Kapitulation des Ingenieurs konnte die Mutter des Dichters aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, worein sie sich in einer Kopflosigkeit gestürzt hatte, die ihr wunderbar vorkam, nicht die gegenseitige große Liebe war, auf die sie ihrer Überzeugung nach ein volles Anrecht hatte. Ihr Vater war Besitzer zweier florierender Prager Drogerien, und die Tochter bekannte sich zur Moral der beglichenen Rechnungen; hatte sie selbst alles in die Liebe investiert (schließlich war sie bereit gewesen, die eigenen Eltern und deren trautes Heim zu verraten!), so verlangte sie, dass der Partner den gleichen Betrag an Gefühlen in die gemeinsame Kasse einzahlte. Sie versuchte, die Ungerechtigkeit auszugleichen, und wollte der Gefühlskasse nun entnehmen, was sie investiert hatte, und begegnete ihrem Gatten nach der Hochzeit mit stolzem, strengem Gesicht.
Vor Kurzem war die Schwester der Mutter aus der Familienvilla ausgezogen (sie hatte geheiratet und eine Wohnung in der Stadtmitte gemietet); der alte Kaufmann und seine Frau bewohnten weiterhin die Zimmer des Erdgeschosses, der Ingenieur und die Tochter konnten die drei darüberliegenden Räume beziehen, zwei größere und ein kleines Zimmer, die noch genauso aussahen, wie es der Vater der Frischvermählten vor zwanzig Jahren angeordnet hatte, als er die Villa bauen ließ. Dem Ingenieur kam es bis zu einem gewissen Grad gelegen, dass er als Heim eine fertig eingerichtete Wohnung erhielt, da er außer dem Inhalt der beiden erwähnten Koffer nichts besaß; dennoch schlug er vor, das Aussehen der Zimmer durch kleine Umstellungen zu verändern. Die Mutter des Dichters war jedoch nicht gewillt zuzulassen, dass der Mann, der sie unter das Messer des Gynäkologen hatte schicken wollen, die alte Ordnung des Interieurs störte, in dem der Geist ihrer Eltern und viele Jahre süßer Gewohnheit, Vertrautheit und Geborgenheit walteten.
Der junge Ingenieur kapitulierte auch diesmal kampflos und erlaubte sich nur einen einzigen kleinen Protest, den wir uns merken wollen: In dem Zimmer, in dem sich das Ehepaar zur Ruhe legte, stand ein kleines Tischchen, auf dessen breitem Bein eine schwere, runde Platte aus grauem Marmor ruhte, darauf stand die Statuette eines nackten Mannes; der Mann hielt in der linken Hand eine Lyra, die er auf die leicht vorgestreckte Hüfte stützte. Mit der rechten Hand holte er pathetisch aus, als hätten die Finger eben erst die Saiten angeschlagen, das rechte Bein hielt er vorgestellt, den Kopf leicht nach hinten geneigt, sodass seine Augen nach oben blickten. Wir wollen weiter hinzufügen, dass das Antlitz des Mannes über alle Maßen schön und sein Haar lockig war, dass das Weiß des Alabasters, aus dem die Statuette gemeißelt war, der Gestalt etwas zärtlich Mädchenhaftes oder göttlich Jungfräuliches verlieh; übrigens haben wir das Wort göttlich nicht grundlos gebraucht: Der in den Sockel gravierten Aufschrift zufolge handelte es sich bei dem Mann mit der Lyra um den griechischen Gott Apollo.
Die Mutter des Dichters konnte den Mann mit der Lyra allerdings selten ansehen, ohne sich zu ärgern. Meistens stand er so da, dass er dem Zimmer sein Hinterteil zukehrte, einmal war er in einen Ständer für den Hut des Ingenieurs verwandelt, ein andermal trug er einen Schuh über sein zartes Haupt gestülpt, dann wieder war er in eine Socke des Ingenieurs gehüllt, was eine ganz besondere Entweihung des Herrschers der Musen darstellte, denn die Socke stank.
Wenn die Mutter des Dichters das alles gereizt zur Kenntnis nahm, so war daran schwerlich nur ihr fehlender Sinn für Humor schuld, sie fühlte vielmehr richtig, dass ihr Mann ihr mit seiner über Apollos Leib gezogenen Socke unter dem Deckmantel eines Spaßes mitteilte, was er sonst höflich verschwieg: dass er ihre Welt ablehnte und nur vorläufig kapituliert hatte.
Auf diese Weise wurde der Alabastergegenstand zu einem wirklichen antiken Gott, also zu einem Wesen der außermenschlichen Welt, das in die Welt der Menschen eingreift, deren Geschichten verknotet, Intrigen spinnt und manches Geheimnisvolle verrät. Die Jungvermählte sah es als Verbündeten an, und ihre träumerische Weiblichkeit machte aus ihm ein lebendiges Wesen, dessen Augen sich bisweilen in den Farben einer trügerischen Iris verschleierten und dessen Mund zu atmen schien. Sie schloss diesen nackten Jüngling, der für sie und ihretwegen geschmäht wurde, ins Herz. Sie sah in sein liebliches Antlitz und wünschte sich, das Kind, das in ihrem Bauch heranwuchs, möge diesem schönen Feind ihres Mannes gleichen. Sie wollte, dass es ihm so sehr gleiche, dass sie sich glauben machen konnte, nicht ihr Mann, sondern dieser Jüngling sei der Erzeuger; sie flehte ihn an, durch einen Zauber die unglückselige Empfängnis zu korrigieren, sie umzuprägen, zu übermalen, wie einst der große Tizian, der eines seiner Bilder auf die verpfuschte Leinwand eines Dilettanten gemalt hatte.
Sie fand unwillkürlich ein Vorbild in der Jungfrau Maria, die ohne menschlichen Erzeuger Mutter geworden war und so ein Ideal der Mutterliebe geschaffen hatte, in die kein Vater sich einmischte oder störte, und sie verspürte ein provokatives Verlangen, ihr Kind Apollo zu nennen, was für sie dasselbe bedeutete, wie wenn es Wer keinen menschlichen Vater hat hieße. Freilich wusste sie, dass ihr Sohn mit einem so gewählten Namen ein schweres Leben haben und alle über sie und über ihn lachen würden. Sie suchte also nach einem tschechischen Namen, der des jugendlichen griechischen Gottes würdig wäre, und es fiel ihr der Name Jaromil ein (was Wer den Frühling liebt oder Wer vom Frühling geliebt wird bedeutet); damit waren alle einverstanden.
Übrigens war es gerade Frühling, und der Flieder blühte, als man sie eines Tages in die Klinik fuhr; dort entschlüpfte ihr nach einigen Schmerzensstunden der junge Dichter auf das befleckte Leintuch der Welt.
2
Dann legte man den Dichter in eine Wiege und stellte sie neben ihr Bett, und sie lauschte seinem süßen Plärren; ihr schmerzender Körper war von Stolz erfüllt. Beneiden wir diesen Körper nicht um seinen Stolz; bisher hatte er ihn nicht oft genossen, obwohl er recht hübsch war: Zwar hatte er einen etwas ausdruckslosen Hintern und eher kurze Beine, dafür aber außergewöhnlich frische Brüste und unter den feinen Haaren (die so leicht waren, dass sie sich nur schwer frisieren ließen) ein keinesfalls blendendes, aber unauffällig liebliches Gesicht.
Die Mutter war sich immer eher ihrer Unauffälligkeit als ihres Liebreizes bewusst gewesen, zumal sie von klein auf in Gegenwart ihrer älteren Schwester gelebt hatte, die hervorragend tanzte, sich in der besten Prager Schneiderei einkleiden ließ und mit einem zierenden Tennisschläger mühelos in die Welt der eleganten Männer eindrang und dem Elternhaus den Rücken kehrte. Durch das effektvolle Ungestüm ihrer Schwester wurde die Mutter in ihrer trotzigen Bescheidenheit noch bestätigt, sodass sie aus Protest lernte, den sentimentalen Ernst von Musik und Büchern zu lieben.
Vor dem Ingenieur war zwar schon irgendein junger Mann mit ihr gegangen, ein Medizinstudent, Sohn einer befreundeten Familie, doch war es dieser Bekanntschaft nicht vergönnt gewesen, ihren Körper mit einem substanzielleren Selbstvertrauen zu erfüllen. Einen Tag nachdem er sie in einem Wochenendhaus zum ersten Mal geliebt hatte, trennte sie sich in der melancholischen Gewissheit von ihm, dass weder ihren Gefühlen noch ihren Sinnen eine große Liebe bestimmt war. Und weil sie gerade damals das Abitur machte, hatte sie Gelegenheit zu verkünden, das Ziel ihres Lebens in der Arbeit sehen zu wollen, und sie beschloss (gegen den Willen ihres praktisch veranlagten Vaters), sich an der philosophischen Fakultät einzuschreiben.
Als ihr enttäuschter Körper in der Universität schon ungefähr den fünften Monat die breite Bank des Auditoriums drückte, begegnete er einmal auf der Straße einem frechen jungen Ingenieur, der ihn ansprach und sich seiner nach drei Rendezvous bemächtigte. Und da der Körper damals (überraschenderweise) sehr zufrieden war, vergaß die Seele den Ehrgeiz einer fachlichen Karriere rasch und eilte dem Körper (wie es sich für eine rechte Seele gehört) zu Hilfe: Sie akzeptierte die Ansichten des Ingenieurs, seine sorglose Nachlässigkeit, seine liebenswürdige Verantwortungslosigkeit, bereitwillig. Und obwohl sie wusste, dass ihr diese Eigenschaften von Haus aus fremd waren, wollte sie sich damit identifizieren, denn der zuvor traurig bescheidene Körper hörte in deren Gegenwart auf, an sich zu zweifeln, und begann verwundert, sich zu genießen.
War die Mutter also endlich glücklich? Nicht ganz: Sie schwankte zwischen Zweifel und Glaube: Wenn sie sich vor dem Spiegel entblößte, schaute sie sich mit seinen Augen an und kam sich bald erregend, bald fade vor. In ihrer Hörigkeit hatte sie ihren Körper fremden Augen ausgeliefert – und darin lag eine große Unsicherheit.
Doch wie sehr sie auch zwischen Hoffnung und Ungläubigkeit schwanken mochte, aus ihrer vormaligen Resignation war sie vollkommen herausgerissen; der Tennisschläger der Schwester deprimierte sie nicht mehr; ihr Körper lebte endlich als Körper, und die Mutter begriff, dass es schön war, so zu leben. Sie wünschte sich sehnlichst, dass dieses neue Leben nicht nur arglistiges Versprechen, sondern ewige Wahrheit wäre; sie wünschte sich sehnlichst, der Ingenieur möge sie aus der Fakultätsbank und dem Elternhaus führen und ihre Liebesgeschichte in eine Lebensgeschichte verwandeln. Deshalb hatte sie die Schwangerschaft mit Begeisterung begrüßt: Sie sah sich, den Ingenieur und ihr Kind, und es schien ihr, als ob diese Triade zu den Sternen emporragte und das All erfüllte.
Wir haben im vorangehenden Kapitel bereits darüber gesprochen: Die Mutter hatte rasch begriffen, dass derjenige, dem an der Liebesgeschichte lag, sich vor der Lebensgeschichte fürchtete und kein Verlangen verspürte, sich zusammen mit ihr in eine Statue zu verwandeln, die zu den Sternen emporragte. Und wir wissen auch schon, dass ihr Selbstvertrauen damals unter der Kälte des Geliebten nicht zusammenbrach. Etwas sehr Wichtiges hatte sich nämlich verändert. Der Körper der Mutter, bis vor Kurzem noch auf Gedeih und Verderb den Augen des Geliebten ausgeliefert, war in eine weitere Phase seiner Geschichte getreten: Er hatte aufgehört, ein Körper für fremde Augen zu sein, er war zu einem Körper für jemanden geworden, der bislang noch keine Augen hatte. Die Oberfläche verlor an Wichtigkeit; der Körper berührte einen anderen Körper mit seiner inneren, noch nie von jemandem gesehenen Wand. Die Augen der Außenwelt konnten an ihm also nur das Unwesentlich-Äußerliche wahrnehmen, und selbst die Meinung des Ingenieurs bedeutete nichts mehr für ihn, denn sie konnte sein großes Schicksal in keiner Weise mehr beeinflussen; erst jetzt war er vollkommen selbstständig und selbstgenügsam geworden; der Bauch, der immer mächtiger und hässlicher wurde, war für den Körper ein wachsendes Reservoir des Stolzes.
Nach der Niederkunft trat der Körper der Mutter in eine neue Phase ein. Als sie zum ersten Mal den suchenden Mund ihres Sohnes an ihrer Brust saugen spürte, schwoll ihr Busen an in süßem Beben, das seine zitternden Strahlen in den ganzen Körper aussandte; es glich der Liebkosung des Geliebten, hatte aber noch etwas anderes: ein großes, ruhiges Glück, eine große, glückliche Ruhe. Das war nie zuvor so gewesen; küsste der Geliebte ihre Brust, war das nur eine Sekunde, die Stunden des Zweifels und Misstrauens wiedergutmachen sollte; jetzt aber wusste sie, dass der Mund sich an ihre Brust presste zum Beweis unaufhörlicher Ergebenheit, deren sie sich sicher sein durfte.
Und noch etwas war anders: Immer wenn der Geliebte ihren entblößten Körper berührte, schämte sie sich; die gegenseitige Annäherung bedeutete stets Überwindung des Fremden, und der Augenblick der Annäherung war gerade deshalb berauschend, weil er bloßer Augenblick war. Die Scham schlief nie, sie ließ die Liebe erregend werden, wachte aber zugleich über den Körper, damit dieser sich nicht ganz und gar hingab. Diesmal jedoch war die Scham verschwunden; sie war nicht mehr da. Die beiden Körper hatten sich füreinander ganz und gar geöffnet, und es gab nichts mehr, was sie voreinander versteckt hätten.
Nie hatte sie sich einem anderen Körper so hingegeben, nie hatte ein anderer Körper sich ihr so hingegeben. Der Geliebte konnte ihren Schoß benutzen, doch darin gewohnt hatte er nie, er konnte ihre Brüste berühren, doch daraus getrunken hatte er nie. Ach, das Stillen! Liebevoll beobachtete sie die Fischbewegungen des zahnlosen Mundes und malte sich aus, wie mit der Milch auch ihre Gedanken, Vorstellungen und Träume in ihr Söhnchen einflossen.
Es war ein paradiesischer Zustand: Der Körper durfte ganz Körper sein und brauchte sich nicht mit einem Feigenblatt zu bedecken; sie waren beide ins Grenzenlose einer ruhigen Zeit getaucht; sie lebten miteinander, wie Adam und Eva gelebt hatten, bevor sie den Apfel vom Baum der Erkenntnis kosteten; sie lebten in ihren Körpern jenseits von Gut und Böse; und nicht nur das: Im Paradies werden Schönheit und Hässlichkeit nicht unterschieden, sodass alles, woraus der Körper ihres Sohnes bestand, für sie weder schön noch hässlich, sondern wonnevoll war; wonnevoll war das zahnlose Mündchen, wonnevoll die Brust, wonnevoll der Bauchnabel, wonnevoll der winzige Hintern, wonnevoll die Därme, deren Tätigkeit aufmerksam verfolgt wurde, wonnevoll der Flaum, der auf dem lächerlichen Schädel spross. Sie kümmerte sich besorgt um Bäuerchen, Pipi und Kackerchen ihres Sohnes, und es war dies nicht nur die Sorge einer Krankenschwester um die Gesundheit des Kindes; nein, sie kümmerte sich um sämtliche Vorgänge in seinem Körperchen mit Leiden-schaft.
Das war etwas ganz Neues, denn die Mutter empfand seit ihrer Kindheit eine ausgeprägte Abscheu nicht nur vor fremder, sondern auch vor der eigenen Körperlichkeit; sie war sich selbst zuwider, wenn sie sich auf die Toilette setzen musste (sie bemühte sich immer, dass wenigstens niemand sie sah, wenn sie hineinging), und es hatte sogar eine Zeit gegeben, da sie sich geschämt hatte, vor Leuten zu essen, denn Kauen und Schlucken waren ihr ekelhaft vorgekommen. Die über alles Hässliche erhabene Körperlichkeit ihres Söhnchens reinigte und rechtfertigte jetzt auf wunderbare Weise auch ihren eigenen Körper. Die Milch, von der manchmal ein Tröpfchen auf der runzeligen Brustwarze hängen blieb, schien ihr schön wie Tau; oft fasste sie ihre Brüste an und presste sie leicht, um dieses Zaubertröpfchen zu sehen; sie nahm es auf den Zeigefinger und kostete es; sie sagte sich, sie wolle den Geschmack des Getränks kosten, mit dem sie ihren Sohn ernährte, viel eher aber wollte sie erfahren, wie ihr eigener Körper schmeckte; und da diese Milch süß schmeckte, versöhnte dieser Geschmack sie mit all ihren anderen Säften und Ausscheidungen, sie begann sich selbst als appetitlich zu empfinden, ihr Körper war ihr angenehm, positiv und selbstverständlich wie jedes andere Ding der Natur, wie ein Baum, ein Strauch, wie Wasser.
Leider vernachlässigte die Mutter vor lauter Glück über den Körper ebendiesen Körper selbst; eines Tages wurde ihr klar, dass es zu spät war und die Haut auf dem Bauch faltig bleiben würde, mit weißen Streifen im Bindegewebe, eine vom Fleisch gelöste Haut, die nicht mehr fester Bestandteil des Körpers, sondern eher eine locker aufgenähte Hülle zu sein schien. Erstaunlicherweise war sie aber nicht verzweifelt, als sie das feststellte. Trotz der Falten auf dem Bauch war der Körper der Mutter glücklich, weil er ein Körper für Augen war, die die Welt bislang erst in nebelhaften Konturen wahrnahmen und nicht wussten (es waren ja paradiesische Augen!), dass es eine grausame Welt gab, in der die Körper in schöne und hässliche unterteilt wurden.
Wenn die Augen des Kindes es nicht sahen, so sahen es die Augen des Ehemanns, der nach Jaromils Geburt versuchte, sich mit der Mutter zu versöhnen. Nach sehr langer Zeit schliefen sie wieder einmal miteinander; aber es war anders als früher; sie räumten der körperlichen Liebe nur unauffällige Augenblicke ein, liebten einander verhalten und im Halbdunkel. Das kam der Mutter gerade recht: Sie war sich des verunstalteten Körpers bewusst und fürchtete, sie könnte in allzu leidenschaftlicher und offener Liebe den wonnevollen inneren Frieden, den ihr Sohn ihr geschenkt hatte, bald wieder verlieren.
Nein, nein, sie wird nie mehr vergessen, dass ihr Mann ihr Erregung voller Unsicherheit, ihr Sohn hingegen Ruhe voller Glück geschenkt hatte; darum flüchtete sie sich wie zum Trost auch weiter zu ihm (er krabbelte schon, ging schon, redete schon). Einmal erkrankte er schwer, und die Mutter schloss vierzehn Tage lang kein Auge, sie war ununterbrochen neben seinem heißen Körperchen, das sich vor Schmerzen wand; doch selbst diese Zeit durchlebte sie in Verzückung; als die Krankheit abgeklungen war, schien ihr, als hätte sie mit dem Körper ihres Sohnes auf den Armen das Reich der Toten durchschritten und sei von dort wieder zurückgekehrt; es schien ihr, dass sie beide nach diesem gemeinsamen Erlebnis nie mehr etwas voneinander trennen könnte.
Der durch Anzug oder Pyjama verhüllte Körper ihres Mannes, ein diskreter, verschlossener Körper, wurde ihr fremder und verlor von Tag zu Tag an Vertrautheit, wogegen der Körper des Sohnes ständig auf sie angewiesen war; sie stillte ihn zwar nicht mehr, brachte ihm aber bei, die Toilette zu benutzen, sie zog ihn an und zog ihn aus, sie bestimmte seinen Haarschnitt und seine Kleidung, täglich berührte sie ihn von innen mittels der Speisen, die sie mit Liebe für ihn zubereitete. Als er mit vier Jahren an Appetitlosigkeit zu leiden begann, wurde sie streng; sie zwang ihn zu essen und spürte zum ersten Mal, dass sie nicht nur die Freundin, sondern auch die Beherrscherin dieses Körpers war; dieser Körper wehrte sich, wollte nicht schlucken, musste es aber tun; mit merkwürdigem Gefallen blickte sie auf diesen vergeblichen Widerstand und diese Unterwerfung, auf dieses zarte Hälschen, auf dem sich der Weg des verabscheuten Bissens abzeichnete.
Ach, der Körper des Sohnes, ihr Zuhause und ihr Paradies, ihr Königreich …
3
Und die Seele des Sohnes? War sie nicht auch ihr Königreich? O doch, gewiss! Als Jaromil zum ersten Mal ein Wort aussprach und dieses Wort Mami lautete, war die Mutter wahnsinnig glücklich; sie sagte sich, dass sie, sie allein, das Denken ihres Sohnes, das bislang aus einem einzigen Begriff bestand, ganz und gar ausfüllte, wodurch sie selbst auch in späteren Zeiten, wenn sein Denken wachsen, sich verzweigen und Frucht ansetzen würde, für immer und ewig dessen Wurzel bliebe. Angenehm aufgemuntert verfolgte sie aufmerksam alle weiteren Wortversuche ihres Sohnes, und da sie ahnte, dass das Gedächtnis unzureichend und das Leben lang war, kaufte sie sich ein dunkelrot eingebundenes Tagebuch und notierte darin alles, was aus dem Mund des Sohnes kam.
Nehmen wir das Tagebuch der Mutter zu Hilfe, stellen wir fest, dass dem Wort Mami bald weitere Wörter folgten, wobei das Wort Papi erst an siebter Stelle verzeichnet ist, nach Omi, Opi, Hamham, Tutu, Wauwau und Pipi. Nach diesen einfachen Wörtern (im Tagebuch der Mutter stehen daneben jeweils ein kurzer Kommentar und das Datum) finden wir die ersten Satzversuche; wir erfahren, dass Jaromil schon lange vor seinem zweiten Geburtstag verkündete: Mami ist brav. Einige Wochen später sagte er: Mami ist bös. Für diesen Ausspruch, den er tat, als die Mutter sich weigerte, ihm vor dem Mittagessen Himbeersaft zu geben, bekam er einen Klaps auf den Hintern und schrie dann unter Tränen: Ich will eine andere Mami! Dafür bereitete er der Mutter eine Woche später große Freude, als er sagte: Meine Mami ist die Schönste. Ein andermal sagte er: Mami, ich geb dir einen Lutscherkuss, worunter er verstand, dass er die Zunge herausstreckte und der Mutter das Gesicht ableckte.
Überspringen wir einige Seiten, finden wir einen Ausspruch, der uns durch seine rhythmische Form fesselt. Die Großmutter hatte Jaromil einmal einen Apfel versprochen, dann aber ihr Versprechen vergessen und ihn aufgegessen; Jaromil fühlte sich damals hintergangen, wurde sehr wütend und wiederholte mehrere Male: Mein böses Omilein hat geklaut das Äpfelein. In gewissem Sinne konnte man diesen Ausspruch dem bereits zitierten Gedanken Mami ist bös zuordnen, bloß bekam er diesmal keinen Klaps auf den Hintern: Alle, selbst die Großmutter, lachten und wiederholten diesen Ausspruch später dann oft und amüsiert untereinander (was dem wachsamen Jaromil nicht entging). Jaromil konnte damals den Grund seines Erfolgs kaum begreifen, wir aber wissen, dass es der Reim war, der ihm die Prügel ersparte, und dass ihm die Poesie auf diese Weise erstmals ihre magische Macht offenbarte.
Gereimte Aussprüche finden wir auf den folgenden Seiten des Tagebuchs mehrere, und aus den Kommentaren der Mutter geht hervor, dass Jaromil damit dem ganzen Haus Freude und Vergnügen bereitete. So schuf er zum Beispiel ein folgendermaßen verkürztes Porträt des Dienstmädchens Grete: Das Dienstmädchen Grete ist wie ein Reh. Oder etwas weiter lesen wir: Gehn wir in den Wald, freut das Herz sich bald. Die Mutter selbst vermutete, dass es neben dem ganz natürlichen Talent, das Jaromil besaß, die Wirkung von Kinderreimen war, die diese Verse hervorbrachte; sie las sie ihm in solchen Mengen vor, dass er leicht dem Eindruck erliegen konnte, das Tschechische bestehe aus lauter Trochäen, doch müssen wir die Mutter an dieser Stelle berichtigen; eine weit größere Rolle als Talent und literarische Vorbilder spielte hier der Großvater, nüchterner Praktiker und flammender Feind von Gedichten, der sich absichtlich die albernsten Zweizeiler ersann und diese seinem Enkel heimlich beibrachte.
Jaromil merkte bald, dass seine Wörter mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurden, und er begann sich dementsprechend zu verhalten; hatte er die Sprache ursprünglich zur Verständigung benutzt, redete er nun, um Zustimmung, Bewunderung oder Lachen zu hören. Er freute sich schon im Voraus, wie die andern auf seine Wörter reagieren würden, und da es oft geschah, dass das erhoffte Echo ausblieb, versuchte er es mit Ungeheuerlichkeiten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das machte sich einmal nicht bezahlt; als er zu Vater und Mutter Ihr seid alle Pimmel sagte (das Wort Pimmel hatte er von einem kleinen Jungen im Nachbargarten gehört, und er erinnerte sich, dass die anderen Jungen brüllend gelacht hatten), verpasste ihm der Vater eine Ohrfeige.
Seit dieser Zeit verfolgte er aufmerksam, was die Erwachsenen an seinen Wörtern schätzten, welche sie billigten, welche nicht, und was sie konsternierte; das ermöglichte ihm einmal, als er mit der Mutter im Garten stand, folgenden von der Melancholie großmütterlicher Lamentationen getränkten Satz auszusprechen: Mama, das Leben ist eigentlich wie Unkraut.
Schwer zu sagen, was er sich unter diesem Ausspruch vorstellte; sicher ist, dass er nicht jene üppige Nutzlosigkeit und nutzlose Üppigkeit im Sinn hatte, durch die Unkraut sich auszeichnet, sondern vermutlich bloß die relativ vage Vorstellung umschreiben wollte, dass das Leben traurig und eitel sei. Obwohl er also etwas anderes sagte, als er zu sagen beabsichtigt hatte, war die Wirkung seiner Worte großartig; die Mutter verstummte, strich ihm übers Haar und sah ihm mit feuchtem Blick in die Augen. Von diesem mit gerührtem Lob erfüllten Blick war Jaromil dermaßen berauscht, dass er ihn noch einmal sehen wollte. Er trat auf einem Spaziergang gegen einen Stein und sagte dann zur Mutter: Mama, ich habe einen Stein getreten, jetzt tut er mir so leid, dass ich ihn streicheln möchte – und bückte sich tatsächlich zum Stein hinunter und streichelte ihn.
Die Mutter war davon überzeugt, dass ihr Sohn nicht nur begabt war (lesen konnte er bereits mit fünf), sondern auch außergewöhnlich sensibel und anders als die übrigen Kinder. Sie äußerte diese Meinung des Öfteren dem Großvater und der Großmutter gegenüber, was den still mit Zinnsoldaten oder einem Pferdchen spielenden Jaromil ungemein interessierte. Er sah dann allen ankommenden Gästen in die Augen und stellte sich verzückt vor, dass diese Augen ihn als außergewöhnliches und besonderes Kind sahen, das möglicherweise gar kein Kind war.
Als sein sechster Geburtstag nahte und er in wenigen Monaten zur Schule gehen musste, bestand die Familie darauf, dass er ein eigenes Zimmer bekam und allein schlief. Der Mutter tat es leid um die Zeit, die viel zu schnell verrann, doch sie erklärte sich einverstanden. Sie kam mit ihrem Mann überein, dem Sohn zum Geburtstag das dritte, kleinste Zimmer des oberen Stockwerks zu geben, ihm eine Couch sowie weitere für ein Kinderzimmer geeignete Möbel zu kaufen: ein kleines Büchergestell, einen Spiegel, der ihn zu Reinlichkeit und adrettem Aussehen anhalten sollte, und einen kleinen Arbeitstisch.
Der Vater erbot sich, das Zimmer mit Jaromils Zeichnungen auszuschmücken, und begann sofort, dessen kindliche Schmierereien von Äpfeln und Gärtchen in Passepartouts zu kleben. Da trat die Mutter zu ihm hin und sagte: »Ich möchte etwas von dir.« Er sah sie an, und ihre Stimme, schüchtern und doch entschlossen, fuhr fort: »Ich möchte einige Bogen Papier und bunte Tusche.« Dann setzte sie sich in ihrem Zimmer an den Tisch, legte das erste Blatt vor sich hin und zeichnete lange die Buchstaben vor; schließlich tunkte sie den Pinsel in rote Tusche und begann den ersten Buchstaben auszumalen, ein großes D. Darauf folgte ein a, und daraus entstand der Spruch: Das Leben ist wie Unkraut. Sie betrachtete ihr Werk und war zufrieden: Die Buchstaben standen gerade und waren ungefähr gleich groß; trotzdem nahm sie ein neues Papier und malte den Spruch anders, füllte die Buchstaben diesmal mit dunkelblauer Tusche, denn dies schien ihr farblich viel besser zu der unübersehbaren Traurigkeit in dem Gedanken des Sohnes zu passen.
Dann erinnerte sie sich daran, wie Jaromil gesagt hatte: Mein böses Omilein hat geklaut das Äpfelein, und mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen begann sie zu schreiben (diesmal mit leuchtend roter Tusche): Unser liebes Omilein isst so gerne Äpfelein. Dann erinnerte sie sich noch mit einem inneren Lächeln an Ihr seid alle Pimmel, doch diesen Ausspruch zeichnete sie nicht, dafür (grün) Gehn wir in den Wald, freut das Herz sich bald, dann (lila) Unsere Grete ist wie ein Reh (Jaromil hatte zwar Dienstmädchen Grete gesagt, doch der Mutter kam das Wort Dienstmädchen grob vor), und dann erinnerte sie sich daran, wie Jaromil sich zu einem Stein niedergebeugt und ihn gestreichelt hatte, und nach kurzem Nachdenken begann sie (hellblau) Ich könnte keinem Stein etwas zuleide tun zu schreiben, und erst zum Schluss und ein bisschen beschämt, aber umso lieber zeichnete sie (orange) Mami, ich geb dir einen Lutscherkuss und dann auch noch (golden) Meine Mami ist die Schönste von allen.
Am Vorabend des Geburtstags schickten die Eltern den aufgeregten Jaromil zur Großmutter schlafen und machten sich daran, die Möbel aufzustellen und die Wände zu behängen. Als sie dem Kind am Morgen erlaubten, das Zimmer zu betreten, war die Mutter ganz aufgeregt. Jaromil zerstreute ihre Verlegenheit keineswegs; er stand betroffen da und sagte nichts; sein größtes Interesse (aber auch dies nur unsicher und schüchtern) galt dem Arbeitstischchen: Es war ein eigenartiges Möbelstück, das einer Schulbank glich; die Schreibplatte (schräg und aufklappbar, darunter war Platz für Hefte und Bücher) bildete mit der Sitzfläche ein Ganzes.
»Na, was sagst du dazu, freust du dich denn nicht?«, konnte die Mutter sich nicht mehr zurückhalten.
»Doch, ich freue mich«, antwortete das Kind.
»Und was gefällt dir am meisten, erzähl!«, sagte der Großvater, der zusammen mit der Großmutter dem langerwarteten Auftritt zuschaute.
»Die Bank«, sagte das Kind, setzte sich hin und begann, den Deckel auf- und zuzuklappen.
»Und was sagst du zu den Bildchen?« Der Vater deutete auf die Zeichnungen in den Passepartouts.
Das Kind hob den Kopf und lächelte: »Die kenn’ ich schon.«
»Und wie gefallen sie dir, wenn sie so an der Wand hängen?«
Das Kind saß immer noch hinter seinem Tischchen und nickte, die Zeichnungen an der Wand gefielen ihm.
Das Herz der Mutter krampfte sich zusammen, sie wäre am liebsten aus dem Raum verschwunden. Doch sie war hier und konnte die Sprüche, die an der Wand hingen, nicht mit Schweigen übergehen, denn dieses Schweigen hätte wie eine Verurteilung geklungen; darum sagte sie: »Und schau dir diese Sprüche an!«
Das Kind hielt den Kopf gesenkt und schaute ins Innere des Tischchens.
»Weißt du, ich wollte«, fuhr die Mutter ganz verwirrt fort, »ich wollte, dass du eine Erinnerung an deine Entwicklung hast, von der Wiege bis zur Schulbank, du warst ja ein kluges Kind und hast uns allen Freude gemacht …« Sie sagte es, als wollte sie sich entschuldigen, und vor lauter Lampenfieber wiederholte sie es mehrere Male, bis sie nicht mehr wusste, was sie sagen sollte, und verstummte.
Sie hatte sich jedoch geirrt, als sie meinte, Jaromil habe ihr Geschenk nicht gebührend gewürdigt. Er wusste zwar nicht, was er sagen sollte, war aber nicht unzufrieden; schließlich war er immer stolz gewesen auf seine Worte und wollte sie nicht einfach so in den Wind sprechen; als er sie nun sorgfältig mit Tusche abgeschrieben und in Bilder verwandelt sah, empfand er ein Gefühl des Erfolgs, und zwar eines derart großen und unerwarteten Erfolgs, dass er nicht darauf reagieren konnte und Lampenfieber hatte; er begriff, dass er ein Kind war, das bedeutungsvolle Wörter von sich gab, und er wusste, dass ein solches Kind auch in diesem Moment etwas Bedeutungsvolles hätte vorbringen müssen, doch fiel ihm nichts ein, also senkte er den Kopf. Wenn er aber aus den Augenwinkeln seine eigenen Worte auf den Wänden sah, versteinert, erstarrt, dauerhafter und bedeutender als er selbst, war er berauscht; es schien ihm, als sei er von sich selbst umgeben, als sei er viel, ein ganzes Zimmer, ein ganzes Haus voll.
4
Noch bevor Jaromil in die Schule kam, konnte er lesen und schreiben, sodass die Mutter beschloss, ihn gleich in die zweite Klasse einzuschulen; nach langen Laufereien erhielt sie vom Ministerium eine Sondergenehmigung, und nachdem Jaromil von einer Kommission geprüft worden war, durfte er sich in die Bank zwischen Schüler setzen, die ein Jahr älter waren als er selbst. Er wurde von allen bewundert, sodass das Klassenzimmer ihm wie ein Spiegelbild seines Zuhauses vorkam. Am Muttertag, als die Schüler die Feier mit eigenen Produktionen bestritten, stieg er als Letzter aufs Podium und trug ein rührendes Gedicht über die Mütter vor, wofür er vom Elternpublikum mit großem Applaus belohnt wurde.
Eines Tages jedoch stellte er fest, dass hinter dem applaudierenden Publikum heimtückisch ein anderes, ihm feindlich gesinntes Publikum lauerte. Er stand im überfüllten Warteraum des Zahnarztes und entdeckte unter den wartenden Patienten einen Mitschüler. Sie lehnten sich nebeneinander ans Fenster, und da beobachtete Jaromil, dass ein älterer Herr mit freundlichem Lächeln zuhörte, was sie sich erzählten. Das ermunterte ihn, und er fragte den Mitschüler (er hob seine Stimme, damit die Frage niemandem entging), was er tun würde, wenn er Erziehungsminister wäre. Da der Mitschüler nicht wusste, was er sagen sollte, begann Jaromil selbst seine Betrachtungen zu entwickeln, was ihm keineswegs schwerfiel, genügte es doch, die Reden zu wiederholen, mit denen der Großvater Jaromil regelmäßig amüsierte. Also, wenn Jaromil Erziehungsminister wäre, würde die Schule nur zwei und die Ferien zehn Monate dauern, der Lehrer müsste den Kindern gehorchen und ihnen das Pausenbrot aus der Konditorei bringen, und es würden noch weitere wunderbare Dinge geschehen, die Jaromil sehr ausführlich und lautstark erörterte.
Da öffnete sich die Tür zum Behandlungszimmer, und die Sprechstundenhilfe führte einen Patienten hinaus. Eine Frau, die ein halb geschlossenes Buch im Schoß liegen hatte und mit dem Finger die Seite markierte, auf der sie zu lesen aufgehört hatte, wandte sich mit fast weinerlicher Stimme an die Sprechstundenhilfe: »Ich bitte Sie, machen Sie etwas mit diesem Kind. Das ist ja entsetzlich, wie der Bub sich aufführt.«
Nach Weihnachten zitierte der Lehrer die Kinder vor die Wandtafel, um sie nacheinander erzählen zu lassen, was sie unter den Christbaum bekommen hatten. Jaromil begann aufzuzählen, einen Baukasten, Skier, Schlittschuhe, Bücher, merkte aber bald, dass die Kinder ihn nicht so anstrahlten wie er sie, dass ihre Blicke gleichgültig oder sogar feindselig waren; er stockte und verschwieg die restlichen Geschenke.
Nein, nein, seien Sie ohne Sorge, wir wollen keineswegs die tausendmal erzählte Geschichte vom reichen Söhnchen wiederholen, das seinen armen Mitschülern zuwider ist; es gab in der Klasse durchaus Jungen aus vermögenderen Familien, die mit den anderen freundschaftlich verkehrten und denen niemand ihren Reichtum verübelte. Was also war es, das den Mitschülern an Jaromil missfiel, was reizte sie bloß an ihm, was unterschied Jaromil von ihnen?
Wir schämen uns fast, es zu sagen: Es war nicht der Reichtum, es war die Liebe der Mutter. Diese Liebe hinterließ ihre Spuren auf allem und jedem; sie haftete an seinem Hemd, an seiner Frisur, an den Wörtern, die er gebrauchte, am Schulranzen, in den er seine Hefte packte, und selbst an den Büchern, die er daheim zu seinem Vergnügen las. Alles war speziell für ihn ausgewählt und hergerichtet. Die Hemden, die seine sparsame Großmutter für ihn nähte, sahen Gott weiß warum Mädchenblüschen ähnlicher als Knabenhemden. Seine langen Haare mussten über der Stirn von einer mütterlichen Haarspange zusammengehalten werden, damit sie ihm nicht in die Augen fielen. Wenn es regnete, erwartete ihn Mama vor der Schule mit einem großen Regenschirm, während die Mitschüler ihre Schuhe auszogen und in den Pfützen herumwateten.
Mutterliebe sengt ein Brandmal auf die Stirn eines kleinen Jungen, ein Brandmal, das die Sympathie der Kameraden zurückstößt. Jaromil lernte im Laufe der Zeit zwar, dieses Mal gekonnt zu verbergen, durchlebte aber dennoch nach seinem glorreichen Schuleintritt eine bittere Zeit (sie dauerte ungefähr zwei Jahre), da seine Mitschüler ihn leidenschaftlich gern verspotteten und einige Male zum Spaß auch verdroschen. In dieser schlimmsten Zeit hatte er aber trotz allem einige Kameraden, und er vergaß ihnen das nie im Leben; zu erwähnen sind:
Kamerad Nummer eins war der Vater: Manchmal nahm er einen Ball (als Student hatte er Fußball gespielt) und stellte Jaromil im Garten zwischen zwei Bäume; er kickte den Ball gegen Jaromil, und dieser stellte sich vor, im Tor zu stehen und die Bälle für die tschechoslowakische Nationalmannschaft aufzufangen.
Kamerad Nummer zwei war der Großvater: Er nahm Jaromil jeweils in seine beiden Geschäfte mit; das eine war die große Drogerie, die nun vom Schwiegersohn selbstständig geführt wurde, das andere eine Spezial-Parfümerie, in der eine anmutige Dame verkaufte, die dem kleinen Jungen höflich zulächelte und ihn an allen Parfums riechen ließ, sodass Jaromil bald lernte, die verschiedenen Marken nach ihrem Duft zu unterscheiden; er schloss jeweils die Augen, und der Großvater musste ihm die Flakons unter die Nase halten und ihn prüfen. »Du bist ein Geruchsgenie«, lobte er ihn, und Jaromil träumte davon, Erfinder neuer Parfumsorten zu werden.
Kamerad Nummer drei war Alik; Alik war ein närrisches Hündchen, das seit geraumer Zeit die Villa bewohnte; obwohl es ungezogen und ungehorsam war, verdankte Jaromil ihm viele schöne Träumereien; er stellte sich ihn als ergebenen Freund vor, der im Korridor vor dem Klassenzimmer auf ihn wartete und ihn nach dem Unterrichtsende treu von der Schule nach Hause begleitete, sodass ihn alle Mitschüler beneideten und mit ihm gehen wollten.
Hundeträume wurden zur großen Leidenschaft seiner Einsamkeit und verleiteten ihn zu einem kuriosen Manichäismus: Die Hunde verkörperten für ihn das animalisch Gute, die Gesamtheit aller Tugenden der Natur; er stellte sich im Geist gewaltige Kriege von Hunden gegen Katzen vor (Kriege mit Generälen, Offizieren und allen Kriegslisten, die er zuvor im Spiel mit den Zinnsoldaten erprobt hatte), und er stand stets aufseiten der Hunde, wie der Mensch stets aufseiten der Gerechtigkeit stehen sollte.
Und da er viel Zeit im Zimmer seines Vaters mit Bleistift und Papier verbrachte, wurden Hunde auch zum wichtigsten Motiv seiner Zeichenkünste: Er zeichnete Unmengen von epischen Szenen, in denen Hunde Generäle, Soldaten, Fußballer und Ritter darstellten. Da sie jedoch in diesen menschlichen Rollen mit ihrer vierbeinigen Gestalt nicht gut zurechtkamen, zeichnete Jaromil sie mit Menschenkörpern. Eine große Erfindung! Wollte er einen Menschen zeichnen, stieß er nämlich auf eine beachtliche Schwierigkeit: Er konnte kein menschliches Gesicht zeichnen; dafür gelang ihm die längliche Form eines Hundekopfs mit dem Klecks der Schnauze an der Spitze vortrefflich, sodass aus Träumerei und Unvermögen eine merkwürdige Welt von Menschen mit Hundeköpfen entstanden war, eine Welt von Gestalten, die einfach und schnell zu zeichnen und in Fußballspielen, Kriegszügen und Räubergeschichten miteinander zu verbinden waren; Jaromil zeichnete diese Geschichten in Fortsetzungen und bemalte damit eine Menge Papier.
Erst Kamerad Nummer vier war ein Junge; es war ein Mitschüler Jaromils, dessen Vater der Hausmeister der Schule war; ein galliges Männchen, das sich beim Direktor oft über die Schüler beschwerte; diese rächten sich dann an seinem Sohn und machten ihn zum Geächteten der Klasse. Als Jaromils Mitschüler sich einer nach dem anderen von ihm abwandten, blieb der Hausmeisterssohn sein einziger treuer Bewunderer; und so kam es, dass er eines Tages in die Vorstadtvilla eingeladen wurde. Er bekam ein Mittagessen, er bekam ein Abendbrot, baute mit Jaromil etwas aus Bauklötzchen und machte dann zusammen mit ihm die Hausaufgaben. Am darauffolgenden Sonntag nahm der Vater die beiden mit zu einem Fußballspiel; die Partie war großartig, und großartig war auch der Vater, der sämtliche Spieler beim Namen kannte, das Spiel fachkundig kommentierte, sodass der Hausmeisterssohn ihn nicht aus den Augen ließ und Jaromil stolz sein durfte.
Es war eine fürs Auge komische Freundschaft. Jaromil stets adrett gekleidet, der Hausmeisterssohn mit durchgescheuerten Ellbogen; Jaromil mit sorgfältig gearbeiteten Aufgaben, der Hausmeisterssohn im Lernen schwerfällig. Und dennoch fühlte sich Jaromil neben seinem ergebenen Kameraden wohl, denn der Hausmeisterssohn war außergewöhnlich stark; als die Mitschüler die beiden im Winter einmal angriffen, kamen sie nicht auf ihre Rechnung; Jaromil war stolz darauf, dass sie beide einer Übermacht getrotzt hatten, doch der Ruhm einer erfolgreichen Verteidigung reicht nicht an den Ruhm des Angriffs heran.
Als sie einmal durch die öden Parzellen der Vorstadt gingen, begegneten sie einem Jungen, der so blitzsauber gewaschen und so schön herausgeputzt war, als ginge er zu einem Kinderfest. »Muttersöhnchen«, sagte der Hausmeisterssohn und trat dem Jungen in den Weg. Sie stellten ihm spöttische Fragen und freuten sich über seine Angst. Schließlich fasste der Junge Mut und versuchte, die beiden zur Seite zu stoßen. »Was erlaubst du dir! Das wird dich teuer zu stehen kommen!«, schrie Jaromil, gekränkt durch diese verwegene Berührung, aus der Tiefe seiner Seele; der Hausmeisterssohn hielt das für ein Signal und schlug dem Jungen ins Gesicht.
Intellekt und Körperkraft können sich hervorragend ergänzen. Hat Byron nicht eine ergebene Liebe für den Boxer Jackson empfunden, der den kränklichen Lord in allen möglichen Sportarten aufopfernd trainierte? »Schlag ihn nicht, halt ihn nur fest!«, sagte Jaromil zu seinem Kameraden und ging Brennnesseln pflücken; dann zwangen sie den Jungen, sich auszuziehen, und peitschten ihn am ganzen Körper mit den Brennnesseln. »Weißt du überhaupt, wie sehr sich die Mutti über ihr herrlich rotes Söhnchen freuen wird?«, sagte Jaromil dabei und empfand ein großes Gefühl inniger Freundschaft für den Mitschüler und ein großes Gefühl innigen Hasses für alle Muttersöhnchen.
5
Warum aber war Jaromil eigentlich ein Einzelkind geblieben? Hatte die Mutter kein zweites Kind gewollt?
Im Gegenteil: Sie wünschte sich innig, die beseligende Zeit der ersten Mutterjahre zu wiederholen, doch ihr Mann führte stets Gründe ins Feld, um die Geburt eines weiteren Kindes zurückzustellen. Der Wunsch nach einem zweiten Kind erlosch zwar nicht in ihr, doch wagte sie es nicht, weiter zu drängen, weil sie fürchtete, ihr Mann könnte es abermals ablehnen, und sie wusste, dass eine solche Ablehnung sie gedemütigt hätte.
Je mehr sie es sich aber versagte, über ihren Mutterwunsch zu sprechen, desto mehr dachte sie daran; sie dachte daran wie an etwas Unerlaubtes, Geheimes, also Verbotenes; der Gedanke, dass ihr Mann ihr ein Kind machen könnte, reizte sie schließlich nicht mehr wegen des Kindes selbst, er nahm vielmehr in ihren Vorstellungen einen aufreizend unanständigen Charakter an; Komm, mach mir eine Tochter, sagte sie im Geiste zu ihrem Mann, und es klang für sie ungeheuer lasziv.
Eines Abends kam das Ehepaar spät und gut gelaunt von Freunden zurück, und als Jaromils Vater sich zu seiner Frau legte und das Licht löschte (wir wollen anmerken, dass er sich ihrer seit der Hochzeit nur im Dunkeln bemächtigte, indem er sich vom Tastsinn und nicht von den Augen leiten ließ), warf er die Bettdecke zurück und schlief mit ihr. Die Seltenheit ihrer Liebesbezeugungen sowie der vorangegangene Weinrausch bewirkten, dass sie sich ihm in einer Verzückung hingab, die sie schon lange nicht mehr erlebt hatte. Die Vorstellung, dass sie zusammen ein Kind machten, erfüllte wiederum ihre Sinne, und in dem Augenblick, da ihr Mann sich dem Höhepunkt der Lust näherte, konnte sie sich nicht mehr beherrschen und begann, in Ekstase zu schreien, er solle die gewohnte Vorsicht ablegen und nicht unterbrechen, er solle ihr ein Kind, er solle ihr ein schönes Töchterchen machen, und sie klammerte sich so fest und krampfhaft an ihn, dass er sich gewaltsam von ihr befreien musste, um sicherzugehen, dass ihr Wunsch nicht in Erfüllung ging.
Als sie dann ermattet nebeneinanderlagen, kuschelte sich die Mutter wieder an ihn und flüsterte ihm ins Ohr, sie wünsche sich sehnlichst noch ein Kind von ihm; nein, sie wolle ihn nicht drängen, sie wolle ihm auf diese Weise vielmehr entschuldigend erklären, weshalb sie ihren Wunsch nach einem Kind gerade so gewaltsam und unerwartet (und vielleicht auch unpassend, das wolle sie gern zugeben) geäußert habe; sie plapperte, dass diesmal ganz gewiss ein Töchterchen zur Welt komme und er sich in diesem Töchterchen genauso sehen könne wie sie sich in Jaromil.
Und da sagte der Ingenieur zu ihr (es war das erste Mal seit der Hochzeit, dass er ihr das in Erinnerung rief), dass er selbst nie ein Kind mit ihr gewollt habe; wenn er beim ersten Kind habe nachgeben müssen, so sei jetzt sie an der Reihe nachzugeben; und wenn sie wünsche, dass er sich im zweiten Kind sehen könne, so versichere er ihr, dass er sich am wenigsten verfälscht in einem Kind sehe, das nie geboren werde.
Dann lagen sie nebeneinander, die Mutter sagte nichts und begann nach Kurzem zu schluchzen, und sie schluchzte die ganze Nacht, ihr Mann berührte sie nicht, sagte ihr nur ein paar besänftigende Sätze, die nicht einmal in die oberste Welle ihres Weinens einzudringen vermochten; sie hatte das Gefühl, endlich alles zu verstehen: Der, neben dem sie lebte, hatte sie nie geliebt.
Die Traurigkeit, in die sie verfiel, war die tiefste Traurigkeit, die sie bisher gekannt hatte. Da ihr Mann es nicht tat, kam zum Glück jemand anders, um ihr Trost zu spenden: die Geschichte. Ungefähr drei Wochen nach jener Nacht, die wir geschildert haben, bekam ihr Mann die Einberufung, er packte seinen Koffer und fuhr an die Grenze. Der Krieg stand unmittelbar bevor, die Leute kauften sich Gasmasken und bauten in den Kellern Luftschutzräume. Wie nach einer rettenden Hand streckte sich die Mutter nach dem Unglück ihres Landes aus; pathetisch durchlebte sie es, und sie verbrachte lange Stunden mit ihrem Sohn, indem sie ihm in bunten Farben schilderte, was geschah.
Dann einigten sich die Großmächte in München, und Jaromils Vater kehrte von der kleinen Festung zurück, die von der deutschen Armee besetzt worden war. Seit jener Zeit saß die ganze Familie unten in Großvaters Zimmer und debattierte Abend für Abend die einzelnen Etappen der Geschichte, die, wie es ihnen allen schien, bis vor Kurzem geschlafen hatte (oder gelauert, indem sie Schlaf nur vortäuschte) und nun plötzlich aus ihrem Versteck gesprungen war, um alles Übrige im Schatten ihrer großen Gestalt unsichtbar werden zu lassen. Oh, wie wohl fühlte sich die Mutter in diesem Schatten! Scharen von Tschechen flüchteten aus dem Grenzgebiet, Böhmen blieb mitten in Europa liegen wie eine geschälte, durch nichts geschützte Orange, und ein halbes Jahr später tauchten eines Morgens in der Früh deutsche Panzer in den Straßen von Prag auf, und die Mutter saß währenddessen ständig neben einem Soldaten, der sein Land nicht verteidigen durfte, und sie hatte ganz vergessen, dass es derjenige war, der sie nie geliebt hatte.
Doch selbst in Zeiten, in denen sich die Geschichte stürmisch voranwälzt, tritt früher oder später der Alltag aus dem Schatten, und das Ehebett erscheint wieder in seiner monumentalen Trivialität und bestürzenden Dauerhaftigkeit. Als Jaromils Vater eines Abends seine Hand wieder auf die Brust der Mutter legte, wurde ihr bewusst, dass der, der sie berührte, identisch war mit jenem, der sie gedemütigt hatte. Sie schob seine Hand weg und erinnerte ihn in einer zarten Anspielung an die groben Worte, die er ihr vor einiger Zeit gesagt hatte.
Sie wollte nicht böse sein; sie wollte mit dieser Zurückweisung sagen, dass die bescheidenen Geschichten des Herzens sich nicht vergessen lassen zugunsten der großen Geschichten der Völker; sie wollte ihrem Mann die Gelegenheit geben, jetzt seine Worte von damals zu widerrufen und das, was er erniedrigt hatte, wieder zu erhöhen. Sie glaubte, die Tragödie seines Volkes habe ihn empfindsamer gemacht, und sie war gewillt, auch eine zaghafte Liebkosung dankbar als Buße und Beginn eines neuen Kapitels ihrer Liebe anzunehmen. Aber oh weh: Der Mann, dessen Hand von der Brust seiner Frau geschoben worden war, drehte sich auf die andere Seite und schlief relativ rasch ein.
Nach der großen Studentendemonstration in Prag wurden die tschechischen Hochschulen von den Deutschen geschlossen, und die Mutter wartete vergeblich darauf, dass ihr Mann unter der Bettdecke wieder die Hand auf ihre Brust legen würde. Der Großvater stellte fest, dass die anmutige Verkäuferin in seiner Parfümerie ihn schon seit zehn Jahren bestahl, regte sich schrecklich auf und starb an einem Schlaganfall. Die tschechischen Studenten wurden in Viehwaggons in Konzentrationslager transportiert, und die Mutter suchte ihren Arzt auf, der den schlechten Zustand ihrer Nerven beklagte und ihr empfahl, zur Erholung wegzufahren. Er erzählte ihr von einer Pension am Rande eines Badestädtchens, das von einem Fluss und Teichen umgeben war, wo im Sommer Scharen von Ausflüglern hinkämen, die Wasser, Fischerei und Schlauchbootfahrten liebten. Es war früh im Frühling, und die Mutter war bezaubert von der Vorstellung, an stillen Gewässern zu spazieren. Doch dann erschrak sie bei der Vorstellung fröhlicher Tanzmusik, die vergessen über den Gartenrestaurants in der Luft hängen geblieben war wie eine wehmütige Erinnerung an den Sommer; sie erschrak über ihre eigene Wehmut und entschied, nicht allein dorthin zu fahren.
Ach, natürlich wusste sie sofort, mit wem sie fahren würde! Über all den Qualen mit dem Ehemann und all der Sehnsucht nach einem zweiten Kind hatte sie ihn in letzter Zeit fast vergessen. Wie dumm sie gewesen war, wie sehr gegen sich selbst, als sie ihn vergessen hatte! Reumütig beugte sie sich zu ihm nieder: »Jaromil, du bist mein erstes und mein zweites Kind.« Sie presste ihr Gesicht an das seine und setzte den verrückten Satz fort: »Du bist mein erstes, mein zweites, mein drittes, mein viertes, mein fünftes, mein sechstes und mein zehntes Kind …«, und sie bedeckte sein Gesicht mit Küssen.
6
Auf dem Bahnhof wurden sie von einer hochgewachsenen, aufrecht gehenden Frau mit grauem Kopf empfangen; ein stattlicher Mann vom Land bückte sich nach den zwei Koffern und trug sie vor den Bahnhof, wo bereits ein Pritschenwagen mit Pferd stand; der Mann setzte sich auf den Kutschbock, während Jaromil und die Mutter zusammen mit der hochgewachsenen Frau auf den zwei einander gegenüberliegenden Sitzen Platz nahmen, sie ließen sich durch die Straßen des kleinen Städtchens bis zum Hauptplatz kutschieren, dessen eine Seite von Renaissance-Arkaden, die andere von einem grünen Zaun abgeschlossen wurde, hinter dem ein Garten und darin ein von alten Reben umranktes Schloss lagen; dann fuhren sie zum Fluss hinunter; vor Jaromil tauchten eine Reihe gelber Holzkabinen auf, ein Sprungbrett, weiße Tischchen mit Stühlen, im Hintergrund säumten Pappeln das Ufer, und dann fuhr sie der Pritschenwagen weiter zu verlassenen Villen, die verstreut am Wasser standen.
Vor einer dieser Villen verlangsamte das Pferd seine Schritte, der Mann stieg vom Kutschbock, nahm die beiden Koffer, und Jaromil folgte ihm mit der Mutter in den Garten, die Halle und das Treppenhaus, bis sie sich in einem Zimmer befanden, in dem zwei Betten so aneinandergerückt waren wie Ehebetten, eines der beiden Fenster ließ sich wie eine Tür öffnen und führte auf einen Balkon, von dem aus man den Garten und an dessen Ende den Fluss sehen konnte. Die Mutter trat an das Balkongeländer und atmete tief ein: »Ach, hier herrscht göttliche Ruhe«, sagte sie, atmete wieder tief und schaute zum Fluss, wo ein rotes, an einer Holzbrücke vertäutes Schiffchen schaukelte.
Beim Abendessen, das unten im Salon serviert wurde, freundete sich die Mutter noch am selben Tag mit einem älteren Ehepaar an, das ein weiteres Zimmer der Pension bewohnte, sodass nun allabendlich ein langes, ruhiges Gespräch durch den Raum rauschte; Jaromil war allen lieb, und die Mutter lauschte gern seinen Erzählungen, Einfällen und diskreten Prahlereien; ja, diskret: Jaromil wird die Frau im Wartezimmer nie mehr vergessen und immer einen Schild suchen, hinter dem er sich vor ihrem bösen Blick verstecken kann; allerdings hat er nicht aufgehört, sich nach Bewunderung zu sehnen, jedoch gelernt, sie durch knappe, naiv und bescheiden vorgetragene Sätze zu gewinnen.
Die Villa im stillen Garten, der dunkle Fluss mit dem vertäuten Schiffchen, das Träume von langen Reisen weckte, der schwarze Pritschenwagen, der ab und zu vor der Villa hielt und die hochgewachsene Frau fortführte, die den Fürstinnen aus Büchern über Burgen und Schlösser glich, die verlassene Badeanstalt, die man vom Pritschenwagen aus betreten und so gleichsam umsteigen konnte wie von einem Jahrhundert ins andere, von einem Traum in den anderen, von einem Buch ins andere, der Renaissanceplatz mit den schmalen Arkaden, hinter dessen Säulen einst Ritter gefochten hatten, das alles war die Welt, die Jaromil bezaubert betrat.
Zu dieser schönen Welt gehörte auch ein Mann mit einem Hund; das erste Mal hatten sie ihn gesehen, als er reglos am Ufer des Flusses stand und auf die Wellen schaute; er trug einen Ledermantel, und an seiner Seite saß ein schwarzer Schäferhund; beide sahen in ihrer Erstarrung aus wie Gestalten aus einer anderen Welt. Das zweite Mal begegneten sie ihm an derselben Stelle; der Mann (wiederum im Ledermantel) warf Holzstücke, und der Hund brachte sie zurück. Als sie ihm das dritte Mal begegneten (die Kulisse war immer dieselbe: Pappeln und Fluss), verneigte sich der Mann leicht vor der Mutter und sah ihnen dann, wie Jaromil neugierig bemerkte, noch lange nach. Als sie am folgenden Tag von ihrem Spaziergang zurückkehrten, sahen sie den schwarzen Schäferhund vor dem Villeneingang sitzen. Als sie die Halle betraten, hörten sie aus einiger Entfernung ein Gespräch und zweifelten nicht, dass die Männerstimme dem Hundebesitzer gehörte; sie waren so neugierig, dass sie eine Weile untätig in der Halle stehen blieben, sich umsahen und sich unterhielten, bis endlich die Frau des Hauses aus einem der Zimmer trat.
Die Mutter wies auf den Hund: »Wo ist denn sein Herr? Wir begegnen ihm immer auf unserem Spaziergang.« »Es ist der Kunstprofessor des hiesigen Gymnasiums.« Die Mutter sagte, sie würde sich sehr gern mit dem Zeichenlehrer unterhalten, da Jaromil gern zeichne und die Meinung eines Fachmanns sie interessiere. Die Frau des Hauses stellte der Mutter den Mann vor, und Jaromil musste aufs Zimmer laufen, um seinen Zeichenblock zu holen.
Sie saßen dann zu viert im Salon, die Frau des Hauses, Jaromil, der Hundebesitzer, der sich die Zeichnungen anschaute, und die Mutter, die die Begutachtung mit einem Kommentar begleitete: Sie erzählte, dass Jaromil immer behauptet habe, dass es ihn nicht amüsiere, Landschaften oder Stillleben zu zeichnen, sondern Geschehnisse; und in der Tat, scheine ihr, seien seine kleinen Zeichnungen von bemerkenswerter Lebendigkeit und hätten Bewegung, obwohl sie nicht begreife, weshalb die Figuren des Geschehens lauter Leute mit Hundeköpfen seien; wenn Jaromil wirkliche menschliche Figürchen zeichnete, hätten seine Werkchen vielleicht einen gewissen Wert, so aber sei sie sich leider nicht sicher, ob diese Beschäftigung ihres Sohnes überhaupt einen Sinn habe.
Der Hundebesitzer sah sich die Zeichnungen mit Vergnügen an; dann erklärte er, gerade die Verbindung von Tierkopf und Menschenkörper fasziniere ihn an den Zeichnungen. Diese phantastische Verbindung sei nämlich kein zufälliger Einfall, sondern, wie die Menge der von dem Jungen gezeichneten Szenen bezeuge, eine Zwangsvorstellung, etwas, das in den unergründlichen Tiefen seiner Kindheit wurzele. Die Mutter solle das Talent des Kindes nicht nach der bloßen Fertigkeit der Nachahmung der äußeren Welt beurteilen; eine solche Fertigkeit könne sich jedermann aneignen; was ihn als Maler (nun gab er zu verstehen, dass die Schulmeisterei für ihn nur das notwendige Übel zum Broterwerb war) an den Zeichnungen des Jungen fessele, sei die originelle innere Welt, die sich aus dem Jungen heraus aufs Papier dränge.
Die Mutter hörte sich das Lob des Mannes gerne an, die Frau des Hauses strich Jaromil übers Haar und behauptete, er habe eine große Zukunft vor sich, und Jaromil sah unter den Tisch und prägte sich dabei alles, was er hörte, gut ein. Der Maler sagte, dass er im kommenden Jahr an einem Prager Gymnasium unterrichten werde und es ihn freuen würde, wenn die Mutter ihm dann noch weitere Arbeiten ihres Sohnes zur Begutachtung bringen könne.